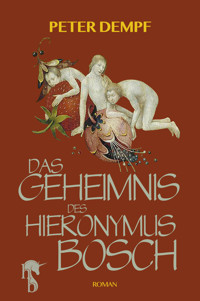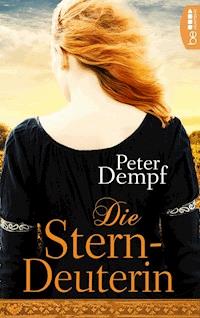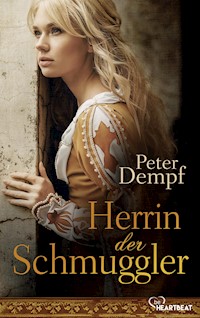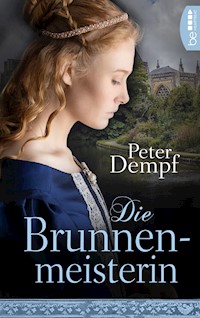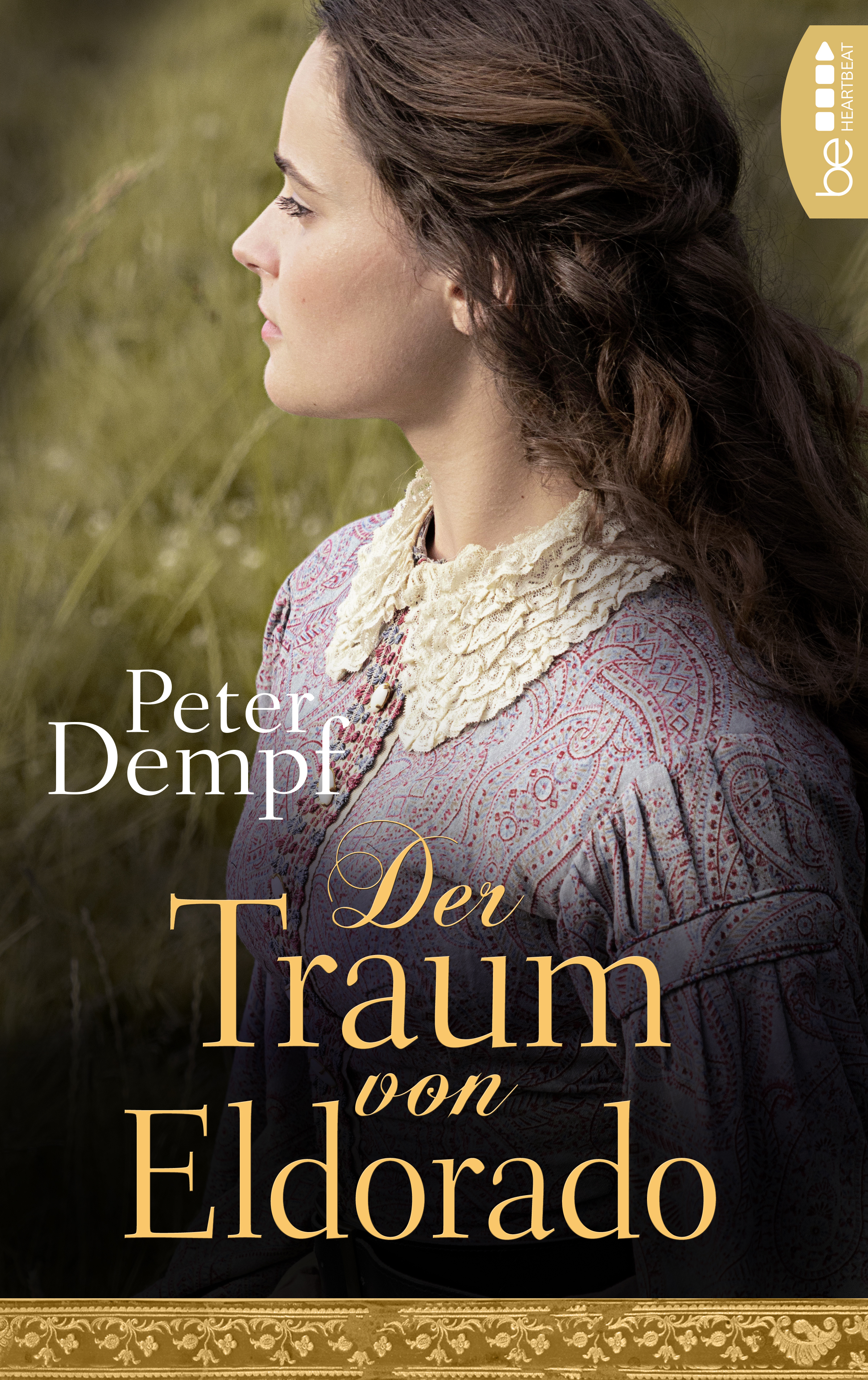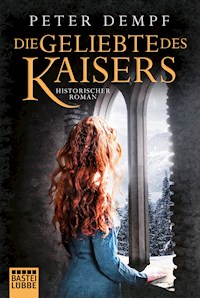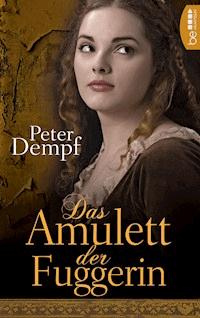6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Historischen Romane von Bestseller-Autor Peter Dempf
- Sprache: Deutsch
Eine verfolgte Frau, ein vermisstes Mädchen - und eine dunkle Verschwörung
Eine kalte Nacht im Jahr 1300. Als die Augsburger Apothekersfrau Hannah aus dem Schlaf aufschreckt, ahnt sie noch nicht, welche dramatische Wendung ihr Leben nehmen wird: Ihr Haus steht lichterloh in Flammen! Hannahs Mann ist dem Feuer zum Opfer gefallen, und ihre Tochter ist unauffindbar. Hannah kann dem Inferno entkommen, doch jemand trachtet ihr nach dem Leben. War der Brand etwa ein Anschlag? Als Bettlerin getarnt versucht sie, die Wahrheit aufzudecken - getrieben von der Hoffnung, ihre Tochter doch noch lebend wiederzusehen. Dabei kommt sie einem unfassbaren Skandal auf die Spur ...
Packend erzählter Mittelalterroman um eine Frau, die um ihr Recht kämpft - und dabei schockierende Machenschaften der Herrschenden aufdeckt.
In dieser Reihe haben wir die schönsten, spannendsten und fesselndsten Romane von Peter Dempf zusammengestellt. Die Romane erzählen vom Leben starker Frauen in vergangenen Zeiten: von ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft, von ihrem Kampf gegen Intrigen, Hass, Verrat und für die eigene Freiheit. Jeder Roman kann einzeln für sich gelesen werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zweiter Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dritter Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nachwort
Danksagung
Weitere Titel des Autors
Das Amulett der Fuggerin
Das Gold der Fugger
Das Haus der Fugger
Der Teufelsvogel des Salomon Idler
Der Traum von Eldorado
Die Botschaft der Novizin
Die Brunnenmeisterin
Die Geliebte des Kaisers
Die Sterndeuterin
Die Tochter des Klosterschmieds
Herrin der Schmuggler
Mir ist so federleicht ums Herz
Weitere Titel in Planung.
Über dieses Buch
Eine verfolgte Frau, ein vermisstes Mädchen – und eine dunkle Verschwörung
Eine kalte Nacht im Jahr 1300. Als die Augsburger Apothekersfrau Hannah aus dem Schlaf aufschreckt, ahnt sie noch nicht, welche dramatische Wendung ihr Leben nehmen wird: Ihr Haus steht lichterloh in Flammen! Hannahs Mann ist dem Feuer zum Opfer gefallen, und ihre Tochter ist unauffindbar. Hannah kann dem Inferno entkommen, doch jemand trachtet ihr nach dem Leben. War der Brand etwa ein Anschlag? Als Bettlerin getarnt versucht sie, die Wahrheit aufzudecken – getrieben von der Hoffnung, ihre Tochter doch noch lebend wiederzusehen. Dabei kommt sie einem unfassbaren Skandal auf die Spur ...
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über den Autor
Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik, Sozialkunde und Geschichte für das Lehramt am Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine Mittelalter-Romane „Die Brunnenmeisterin“, „Herrin der Schmuggler“ und „Das Amulett der Fuggerin“ angesiedelt sind.
Homepage des Autors: http://www.peter-dempf.de/.
Peter Dempf
Fürstin der Bettler
Historischer Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2013 by Peter Dempf und Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch AVA international GmbH, München
www.avainterntional.de
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Monika Hofko, Scripta Literaturagentur, München
Titelillustration: © Trevillion Images/Veronica Gradinariu; © FinePic®, München
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck, Büro für Gestaltung, Berlin
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7517-1027-5
be-ebooks.de
lesejury.de
Wir hören lieber eine gut vorgetragene Lüge,als uns der Wahrheit zu stellen.
ERSTER TEIL
Mai des Jahres 1300
Absturz
1
Frierend erwachte Hannah. Die Kälte griff hart unter ihr Hemd, und sie brauchte einen Augenblick, um sich zurechtzufinden. Jakob lag nicht mehr neben ihr!
Sie war eng an ihn geschmiegt eingeschlafen, so viel wusste sie noch. Er hatte den Arm um sie gelegt, als wollte er verhindern, dass sie aus dem Bett falle, und sie hatte den Unterarm festgehalten und ihn an sich gepresst. So schliefen sie am liebsten ein.
Dann überfiel sie dieser Reiz tief im Hals, und sie konnte einen langen Augenblick nichts anderes tun, als ihre Lungen freizuhusten.
Sie tastete mit der Hand zur Bettkante, doch Jakob saß nicht dort, wie er es oft tat, wenn eine Rezeptur ihn beschäftigte oder wenn er an einer Arznei arbeitete. Oft stand er dann mitten in der Nacht auf und murmelte in ihren Schlaf hinein, er müsse unbedingt wichtige Dinge notieren, bevor er sie vergesse. Dann fuhrwerkte der Apotheker mit Zunder und Stahl herum, um eine Flamme zu schlagen. Schließlich stand er am eigens dafür aufgestellten Pult in ihrer Schlafkammer und schrieb bei abgedeckter Lampe. An diese nächtliche Unruhe ihres Mannes hatte sie sich gewöhnt. Das beständige Reiben seiner kalten Füße an den Waden und das Kratzen der Feder ließen sie normalerweise wieder in den Schlaf zurückgleiten, während er oft bis in den Morgen hinein arbeitete.
Jetzt jedoch horchte Hannah beunruhigt in die mondlose Dunkelheit, die zu knistern schien wie dünnes Eis. Sie hörte keine Feder, kein Eintunken ins Tintenfass, sie hörte nur den Nachtwächter in die Gasse vor dem Haus hineinrufen. Er verkündete die dritte Stunde nach Mitternacht. Doch Jakob stand diesmal nicht am Pult.
Wieder musste sie husten wie der Webermeister aus ihrer Nachbarschaft, der nachts stundenlang aus hohler Lunge bellte.
Wo um alles in der Welt war Jakob? Hannah war jetzt hellwach und setzte sich auf. Eine dunkle Vorahnung, die sie sich nicht erklären konnte, aber die wie ein Druck unterhalb des Brustbeins saß, beschlich sie. Mit offenen Augen saß sie in der Schwärze der Nacht und lauschte.
Vermutlich war Jakob nur in den Hinterhof hinausgegangen, um sich zu erleichtern, und würde sich bald wieder an sie schmiegen, um sich zu wärmen.
Sie horchte, ob sie Geräusche aus dem angrenzenden Zimmer vernahm. Ihre Tochter Gera schlief in der Mädchenkammer, die nur vom Schlafzimmer der Eltern aus betreten werden konnte. Doch nicht einmal ihren Atem konnte Hannah hören.
Ihre Gedanken wanderten weiter durch das Haus und suchten die einzelnen Zimmer ab. Jedes der Zimmer hatte für die Hausfrau ein eigenes Geräusch. Über die Jahre hin waren sie ihr so vertraut geworden, dass sie allein am Klang der Worte oder an der Art des Gehens erkennen konnte, wo im Haus sich jemand aufhielt. Und endlich vernahm sie ein Geräusch: Jakob war offenbar im Verkaufsraum der Apotheke. Das leise Knarren der Dielen dort verriet ihr, dass er unruhig hin und her ging. Sicher suchte er nach irgendwelchen Inhaltsstoffen, die er zu einer neuen Arznei zusammenbrauen wollte.
Gleichzeitig sagte ihr ihr Gefühl jedoch, dass sie sich irrte. Der Schritt, den sie hörte, war nicht hektisch, war nicht getrieben von der Ungeduld und befeuert vom Strom der Gedanken. Er war ... Hannah musste schlucken, denn sie hatte beinahe das Gefühl, die Schritte seien von ... einem Fremden.
Hastig schlug sie das mit Heu gefüllte Laken zurück. Der Duft des frischen Heus im Inlett wurde mit einem Mal überlagert von einem Geruch, der ihr jetzt beinahe mit Gewalt in die Nase stieg: Rauch. Es roch brandig. Es war nicht die Nachtluft, die knisterte, sondern ...Sofort war sie aus dem Bett. Die Kälte der Holzdielen stach ihr eisig in die bloßen Fußsohlen.
Sie schnupperte – und dann packte sie das pure Grauen, und sie war wie gelähmt: Es brannte! Es brannte in ihrem Haus! Eine Gänsehaut lief ihr über den ganzen Körper – und plötzlich war ihre Lähmung verschwunden.
Aus Leibeskräften schrie sie nach ihrem Mann: »Jakob!« Ihre Stimme überschlug sich fast. Das Knistern wurde lauter, und der sargfinstere Schlafraum wurde durch ein Flackern leicht erhellt, das sich unter dem Türspalt hindurchzwängte. Wieder wurde Hannah von dem Hustenreiz gequält, er nahm ihr den Atem und den Mut zu handeln.
Wo war Jakob? War er wirklich in der Apotheke unten und versuchte vielleicht bereits, die Flammen zu ersticken? Doch sie konnte nun niemanden mehr unten hören. Wie eine Blinde tastete sich Hannah zur Tür.
Mit zitternden Händen und von heftigem Husten geschüttelt, gelang es ihr, die Klinke zu greifen. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr Qualm entgegen, der ein flackerndes Licht mit in den ersten Stock zu drücken schien. Er quoll die Treppe herauf, als schiebe jemand ihn von unten hoch. Wieder bellte sie hustend und rang nach Luft. Sie hatte das grauenvolle Gefühl, ersticken zu müssen.
»Gera!«, schoss es ihr durch den Kopf. Ihr Kind! Ihre Tochter! Sie tapste ins Schlafzimmer zurück, hastete röchelnd und fast blind durch die von Rauch und Dunkelheit schwarze Nacht zum Mädchenschlafzimmer.
»Gera!«, schrie Hannah. Ihr war, als müsste sie mit aller Macht ihren Verstand beisammenhalten; der Rauch, die Schwärze der Nacht, das Schweigen ihrer Tochter und die Furcht vor dem Feuer wollten ihn hinwegspülen wie ein Hochwasser. Wie von Sinnen tapste sie in Geras Zimmer umher und tastete auf dem Bett nach ihrem Kind. Doch Geras Bett war leer. Hannah schrie noch einmal aus Leibeskräften den Namen ihrer Tochter. Keine Antwort.
Ein Poltern im Erdgeschoss übertönte plötzlich alles – offenbar war eines der Regale mit den schweren Tiegeln umgestürzt. Jetzt packte Hannah die Angst wie eine riesige Faust und trieb sie vor sich her. Sie suchte den Weg zurück zur Tür der Schlafkammer. Sie spähte nach unten und sah, wie durch den Rauch bereits Flammen die schmale Stiege heraufleckten. Dann war sie auch schon auf dem Weg hinauf zum Söller. Das Dachgeschoss hatte eine Außentür, die auf den hinteren Garten wies. Dorthin jagte sie mit atemloser Furcht. Doch die Tür nach draußen war verschlossen. In ihrer Hast gelang es ihr nicht, den Bolzen zu ziehen, der den Riegel sperrte. Er klemmte. Verzweifelt warf sie sich gegen die Tür, bis ihr die Schulter schmerzte – und erst der Schmerz gab ihr etwas von ihrem Denken zurück. Sie zitterte, als sie es erneut versuchte. Langsam zog sie diesmal den Sperrbolzen heraus, hob den Riegel – und war, als die Tür aufflog, auch schon auf dem rückseitigen Dachbalkon. Doch aus dem Hof unten leckten bereits mannshohe Feuerzungen empor. Der ganze Lichthof unter ihr stand in Flammen. Das Heu für die Ziegen, der Hühnerstall, der Raum mit den Kräutern, alles brannte und prasselte in einem verzehrenden Knacken und Knistern. Der Fluchtweg hinab und durch die hintere Pforte hinaus war ihr versperrt. Wieder packte das Entsetzen sie und fror sie regelrecht ein. Ungläubig starrte sie auf die rot züngelnden Fackelhände unter ihr, die sich nach ihr streckten, und rief Jakobs Namen. Eine hochschießende Lohe, als der Hühnerstall in sich zusammenbrach, versengte ihr die Haare und zwang sie, den Kopf zu wenden – und wie zufällig fiel ihr Blick dabei auf das Nachbardach und die beiden Leitersprossen vom Dachbalkon dort hinauf. Sie führten aufs Dach und von dort aus ... Kaum hatte sie das Ende dieses Gedanken ergriffen, lenkte der Instinkt den Körper. Sie kletterte die beiden Stufen hoch, kroch auf das Hausdach und sprang laut schreiend vor Angst über den Abortspalt zwischen den Häusern. Dann rannte sie über das Dach des Nachbarn und musste ein weiteres Mal über einen Spalt hinwegsetzen.
Jakob war diesen Fluchtweg mit ihr schon zweimal gegangen. Sie kannte ihn auch des Nachts, erinnerte sich mit einem Mal an die Abstiege und plötzlich auch wieder an die Warnung, dass mindestens zwei Häuser zwischen ihr und dem Brandherd liegen sollten, damit sie unbeschadet davonkam. Diese wichtigen Hinweise hatte Jakob ihr einmal für solch eine Notlage gegeben, und nun schossen sie ihr wie Blitze durch ihren vor Angst wie leergefegten Verstand. Sie ließ sich an einem Seil hinab, das als Warenwinde gedacht war, und verbrannte sich dabei die Hände, weil sie es nicht fest genug hielt und wie rasend abwärtsglitt.
Unsanft schlug sie im Garten eines Gerbers auf, der vier Häuser weiter wohnte, und stolperte in der Finsternis gegen einen Gärbottich. Eine übel riechende Brühe schwappte über ihr Nachthemd und besudelte sie. Das Tor öffnete und schloss sich wie das bei ihnen zu Hause. Diesmal gelang es ihr schneller, es zu öffnen, und plötzlich stand sie auf der Gasse.
Niemand war mehr unterwegs. Der Nachwächter hatte alle Bürger längst in die Betten getrieben. Die Straßen waren leer. Hannah stolperte zurück in Richtung ihres Hauses.
Vom Ende der Gasse drohte ein feuriger Lichtschein. Jakob und Gera waren womöglich noch im Haus! Unvermittelt begann Hannah zu schreien, aus Leibeskräften zu schreien.
Fenster wurden aufgerissen. Schimpftiraden ergossen sich über sie – bis jemand den Lichtschein entdeckte.
»Feurio!« Der Ruf sprang von Fenster zu Fenster, von Haustür zu Haustür, von Mund zu Mund wie ein wildes Tier. Fensterläden wurden aufgerissen, Türen schlugen, Sicherungsbalken polterten zu Boden. Schreie füllten die schmale Gasse, ein Trappeln und Rufen hallte von den Wänden wider.
Eine Gestalt rempelte gegen sie, das rote, wie ein Busch vom Kopf abstehende Haar schien durch den Schein des lodernden Feuers von innen heraus zu leuchten. Sie trug einen Sack über der Schulter, der sich zu bewegen schien, doch der Widerschein des Feuers machte vieles lebendig. Die Gestalt umfasste die Öffnung des Sacks mit der Faust, und Hannah bemerkte, dass der Mittelfinger der linken Hand aussah, als hätte man ihn einmal gespalten und ihn dann mit groben Stichen wieder zusammengenäht. Die Gestalt hielt kurz inne – und einen Moment lang blickte Hannah ihr in die Augen. Sie waren schwarz wie Holzkohlestücke in dieser Brandnacht, und das Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Der Mann schien seine Freude an dem Feuer zu haben. Mit dem Schrei »Feurio!« riss er sich von ihrem Blick los und stürzte davon.
Schließlich holte die Feuerglocke vom Perlachturm die Menschen aus den Betten. Die Bewohner stürzten auf die Straße, Nachttöpfe oder Eimer in den Händen. Sie rannten an Hannah vorbei, die im Dreck der Gosse kniete, weil ihr die Beine versagten und sie am ganzen Leib zitterte. Die Menschen hasteten zum Haus am Ende der Gasse, zum Haus des Apothekers, zu ihrem Haus. Doch Hannah konnte sich nicht bewegen.
Sie sah zu, wie sich eine Kette vom Brunnen bis zu ihrem Haus bildete. Wie Menschen Eimer und Bottiche weiterreichten, hörte das Zischen von Wasser, das in die heißen Flammen geschüttet wurde und sich sofort in Dampf auflöste. Immer mehr Bewohner hasteten an ihr vorüber. Sie wurde getreten, mit Flüchen belegt, wie man sich an einem solchen Unglück nur weiden und nicht mit Hand anlegen könne. Schließlich wurde sie in eine Ecke gestoßen, wo sie wimmernd und zitternd auf den Knien kauerte.
Hannah schlug die Hände vors Gesicht. Was hatte sie nur verbrochen, um solch ein Schicksal zu erleiden?
Alles erschien ihr so weit entfernt, so unwirklich, als befände sie sich in einem Albtraum, als hätte sie eine Höllenvision, in der sich der Schlund zu Luzifers Reich öffnete.
Das Prasseln und Rufen steigerte sich zu einem Brausen, und endlich fand sie die Kraft, aufzustehen: Gera, Jakob!
Hannah stolperte aus dem Gassendunkel und drängte sich vor zum Haus. Mit den Ellenbogen musste sie sich den Weg freikämpfen.
»Gera!«, wollte sie schreien, doch sie brachte nur ein Krächzen zustande, »Jakob!«
Schließlich stand sie vor der Flammenwand, die einmal ihr gemeinsames Zuhause gewesen war. Wie durch einen roten Schleier hindurch sah sie die Menschen davorstehen, sah sie einen Eimer nach dem anderen in die roten und gelben Flammen schütten. Selbst vom Dach herab rieselte das Wasser. Hannah wusste, dass die Männer auf die Hausdächer gestiegen waren und die Balken und Wände der Nachbargrundstücke mit Wasser tränkten, damit die Flammen keine weitere Nahrung fanden.
»Schützt die gegenüberliegenden Häuser und lasst die Apotheke niederbrennen!«, hörte sie jemanden rufen.
»Gera und Jakob sind noch im Haus!«, schrie sie mit aller Kraft, doch ihr Schreien wurde vom Brüllen der Flammen geschluckt. Als sie auf das brennende Gebäude zustürzen wollte, wurde Hannah zurückgehalten. Sie schlug um sich, wehrte sich, biss und kratzte. »Jakob liegt unten, dort unten!«, heulte sie.
Plötzlich wurde sie losgelassen, und sie stolperte vorwärts. Im Gebälk ihres brennenden Heims krachte und jaulte es. Die Fassade wankte, dann stürzten Teile davon auf die Gasse.
Hannah sah noch, wie ein junger Patrizier auf sie zukam, als wollte er nach ihr greifen, sie retten. Im flackernden Licht der Flammen erkannte sie seine wegen der Hitze verzerrten Gesichtszüge. Sie spürte, wie er sie am Ärmel packte, sie beiseitezog. Aber da senkte sich unter dem Aufstöhnen des Gebälks ein Teil der Hausfront auf sie herab, und sie stolperte unfreiwillig weiter, als hätte sie einen Stoß erhalten. Ein glühender Lehmbrocken streifte sie an der Wange. Um sie herum tat sich die Hölle nun wirklich auf. Die Fackeln der Unterwelt schossen aus dem Boden und entzündeten den Platz, an dem sie stand, und verschluckten sie. Alles um sie her stand in Flammen. Wie glühendes Blei floss die Atemluft in ihre Lungen. Sie fühlte kurz, wie ihre Haut, wie ihre Haare Feuer fingen. Dann ergoss sich aus dem ersten Stock ein Schwall Wasser über sie und schwemmte sie aus der Unterwelt an den Rand der Gasse. Dann krachte der Bottich, in dem sie noch am Abend gebadet hatten, vor ihre Füße.
Wieder drang der Ruf verzerrt an ihre Ohren: »Lasst den Apotheker niederbrennen. Schützt die gegenüberliegenden Häuser!«
Ihr Bewusstsein begann zu schwinden, ähnlich der Sonne, die langsam hinter den Horizont sinkt. Sie spürte noch, wie jemand sie an ihrem Nachtgewand packte und sie aus den Trümmern riss, wie sie hingelegt wurde, wie die Helfer über sie hinwegstiegen und das Wasser aus den Eimern auf sie niederschwappte. Dann fühlte, sah und hörte sie nichts mehr.
2
Hannah schrak aus einem Dämmerzustand auf, der sie umfasste wie eine klamme Decke. Alles an ihr war nass. Ihr Gesicht brannte, und ihre Hände fühlten sich an, als lägen sie trotz der eisigen Feuchtigkeit um sie her in glühenden Kohlen. In ihren Ohren hatte sich das Fauchen der Flammen eingenistet und wollte nicht weichen. Nur langsam erwachte die Erinnerung an das, was geschehen war: der Rauch, das Feuer, das brennende Haus, der Wasserguss.
Als sie die Augen zu öffnen versuchte, waren ihre Lider verklebt, als wären sie in der Hitze des Brandes miteinander verschmolzen. Mit den Fingern zog sie die Hautfalten auseinander, und ein stechender Schmerz durchfuhr sie.
Der Anblick, der sich kurz darauf ihren entzündeten Augen bot, ließ sie aufstöhnen. Vor ihr lag eine rot schwelende, qualmende, schwarz verkohlte Fläche, aus der sich graue Dampfwolken kräuselten. Davor standen Gestalten, schwarz wie Höllenteufel, und mühten sich mit Wassereimern ab. Dort hatte einmal ihr Zuhause gestanden. Doch jetzt ragten nur noch einige rauchende Balken in die Luft.
Sie selbst lag gegenüber ihrem Wohnhaus in einer zurückgesetzten Toreinfahrt wie ein abgelegter Sack Lumpen. Die Wände der Häuser links und rechts waren verkohlt, aber heil geblieben.
Mühsam rappelte Hannah sich auf und schleppte sich zu den Trümmern hinüber. Der Lehm des Fachwerks war zu hartem Ziegel verbrannt. Die Balken glühten noch.
Hannah stolperte über die Gasse, wo noch immer erschöpfte und über und über verrußte Menschen herumliefen.
Sie zwängte sich zwischen den erschöpften Helfern hindurch. »Gera? Jakob?«, wollte sie ihnen zurufen. Doch ihre Stimme schien ebenso versengt worden zu sein wie das Haus vor ihr. Sie brachte kein Wort heraus. Sie achtete nicht auf die Hitze, die noch immer von dem Brandherd aufstieg. Hannah erkannte die Überreste des Eingangs zur Apotheke. Links davon musste sich ihr Mann aufgehalten haben. Von dort hatte sie das Geräusch von Schritten gehört. Ihr Blick glitt suchend über die verkohlten Balken und die Reste der Einrichtung. Die Decke war herabgebrochen und hatte die Regale mit sich gerissen. An einer Stelle wölbte sich der Brandschutt. Inmitten der dort aufgetürmten, schwarz verfärbten Tiegel, Porzellanscherben und Balken entdeckte sie tatsächlich die verkohlten Umrisse von Beinen und einen zusammengekrümmt am Boden liegenden Körper. Jakob lag dort, als kauerte er sich angstvoll zusammen.
»Jakob!«, formten ihre Lippen einen stummen Schrei. »Jakob!«
Sie wollte zu ihm hinstürzen, doch sie trat auf einen noch glühenden Balken, der sich zischend in die Hornhaut ihrer Füße brannte und sie vor Schmerzen aufheulen ließ. Sie wich zurück und bemerkte, wie Tränen ihr über die Wangen liefen.
»Jakob!«, hauchte sie noch einmal.
Doch da wurde sie am Arm gepackt und zurückgerissen.
»Seid Ihr wahnsinnig, Weib!«, herrschte eine Stimme sie an. Und als Hannah hochsah, blickte sie in das rußige Gesicht ihres Nachbarn. Mit Gewalt zerrte der alte Feingerber Wagner sie von ihrer verkohlten Heimstatt weg.
Hannah wollte etwas sagen, wollte ihn um Hilfe bitten, doch sie brachte noch immer keinen Ton heraus. Nur ein heiseres Zischen drang aus ihrem Mund.
Der Alte führte sie zur gegenüberliegenden Hauswand. »Ihr steht nur im Weg, Weib!«, herrschte er sie an. »Dort ist eine ganze Familie verbrannt. Der Apotheker war ein herzensguter Mensch, genau wie seine Frau. Bestimmt hat er Euch auch einmal geholfen, wie so vielen. Tot. Alle tot. Das Weib, der Mann das Kind. Der Herr erbarme sich ihrer.«
Der Feingerber verstummte. Man konnte spüren, wie sehr ihn der Tod der Apothekerfamilie berührte. Dann wandte er sich ab und griff nach einem Eimer mit Wasser, den eine der Stadtwachen anschleppte. Zu zweit schütteten sie den Inhalt in hohem Bogen in die rauchenden Trümmer.
Hannah stand da, an die Hauswand gelehnt. Nur langsam verstand sie, was eben geschehen war. Wagner, der Feingerber von nebenan, ihr Nachbar, ein Freund der Familie, mit dem sie gern geredet und mit dem sie und Jakob viel gelacht hatten, hatte sie nicht erkannt. Mehr noch, er hatte sie für eine Fremde gehalten.
Langsam sank Hannah in sich zusammen. Die Beine wollten das Gewicht des Körpers nicht mehr tragen. Sie glitt mit dem Rücken an der Hauswand hinunter zu Boden, bis sie im vom Wasser aufgeweichten Seim der Gasse hockte.
Sie betrachtete ihre Handrücken und sah, dass sie stark gerötet und an mehreren Stellen mit hellrosa Blasen übersät waren. Sie drehte die Hände um. Auch die Handflächen waren wund, aufgerissen und mit Blasen übersät. Als sie sich mit der Hand über den Kopf fuhr, erschrak sie. Ihr Haar, ihr langes blondes Haar, mit dem Jakob so gern gespielt hatte, war verschwunden. Das Feuer hatte es völlig versengt.
Erst langsam begann sie zu verstehen, dass sie am ganzen Körper Brandwunden hatte, die ihr nicht nur unerträgliche Schmerzen bereiteten. Vermutlich wurde sie von ihnen auch derart entstellt, dass sie kaum noch wiederzuerkennen war. Sie hob den Blick zum Himmel und schickte eine Frage hinauf. Eine Frage, die ihr bis in die Seele hinein brannte: »Warum ich?« Warum war sie verschont geblieben, während Jakob und Gera verbrannt waren?
Durch den Schleier ihrer Tränen nahm sie eine Gestalt wahr, die das Geschehen ein wenig abseits verfolgte, ohne sich an den Hilfsarbeiten zu beteiligen. Sie stand da mit dem Gestus eines Kaufmanns, der den Warenballen einer Rottfuhr abschätzte, um möglichst günstig einzukaufen.
Hannah fuhr sich mit der Hand über die Augen, damit sie besser sehen konnte. Sie kannte den Mann. Jeder kannte den Mann, der ein Vermögen damit gemacht hatte, verzweifelten Kaufleuten überfällige Warenladungen für billiges Geld abzukaufen, und Männern, die unter ärgster Geldnot litten, auf ihre Häuser Kredite zu gewähren und sich an gewagten Geschäften zu beteiligen. Was er als Wohltat an Verschuldeten ausgab, war in Wahrheit nichts anderes als das Ausnutzen notleidender Menschen.
Es war der Patrizier Hartmut Aigen. Er musste schon eine ganze Weile dort gestanden haben, mit vor der Brust verschränkten Armen, die Hände unter die Achseln gesteckt, offenbar damit er nicht fror. Nur kurz schweifte sein Blick über Hannah hinweg, dann blickte er wieder zum Grundstück. Sie konnte beobachten, wie er grimmig die Lippen aufeinanderpresste, sodass sie nur noch aussahen wie ein dünner Strich, blutleer und hart. Schießlich drehte er sich um und stapfte ein Stück die Gasse hinunter.
Hannah beobachtete die Männer weiter, die sich wie schwarze Kobolde um eine rauchende Esse versammelt hatten und beständig Wasser nachgossen, damit die Flammen nicht wieder aufloderten. Für die Apotheke war es zu spät. Die Helfer konnten nur noch die umliegenden Gebäude retten.
Da riss ein Stoß in die Seite sie aus ihrer Erstarrung.
»Weib, hau ab. Hier gibt’s nichts zu klauen!«
Hannah sah hoch. Einer der städtischen Büttel stand neben ihr und hatte ihr offenbar mit dem Schaft seiner Pike einen Schlag versetzt.
»Los, weg! Du stehst nur im Weg.«
»Aber ich ...«, wollte Hannah sich verteidigen, doch ihre Stimme versagte erneut.
Mühsam erhob sie sich und versuchte dem Kerl mit Gesten zu verstehen zu geben, dass sie sehr wohl hierher gehörte, dass sie die Besitzerin dieses Hauses war, die einzige Überlebende. Doch der Büttel blieb unerbittlich. Er schien sie nicht zu verstehen.
»Wenn du dich nicht sofort schleichst, Weib, bekommst du die spitze Seite zu spüren!«
Hannah gab nach. Sie schleppte sich aus der Gasse, und mit jedem Schritt, den sie machte, trieb es ihr mehr Tränen in die Augen. Was für eine schreiende Ungerechtigkeit. Wenn sie doch nur sprechen könnte! Wenn sie sich doch nur zu erkennen geben könnte! Wenn sie doch nur sagen könnte, wer sie war!
Der Büttel kam ihr noch einige Schritte hinterher, doch dann ließ er von ihr ab.
Hannah glaubte wie in einem Nebel zu laufen. Als sie wahrnahm, dass der Büttel abdrehte, bog sie sofort in die Toreinfahrt ein, die zu ihrem Grundstück führte. Ihr Haus war das einzige in der Gasse, das nur auf einer Seite mit dem Nachbarhaus zusammengebaut war. Die andere Seite war offen gewesen, und dort hatte sie einen kleinen Garten gehabt. Sie stieg über das verkohlte Tor hinweg und schleppte sich auf das Grundstück. Ihren armen Jakob hatte sie entdeckt, aber wo war Gera? Und woher wollte der Feingerber wissen, dass auch die Frau des Hauses verbrannt war? Sie stand schließlich hier, unter den Lebenden.
Die Beine taten ihr weh, die Fußsohle, mit der sie auf den glühenden Balken getreten war, brannte wie Feuer, und ihr Gesicht schmerzte, als würde sie mit tausend Nadeln gestochen, und doch trieb ein Gedanke sie vorwärts: Wo war Gera? War Gera verbrannt, so wie Jakob, so wie ihr Mann? Dann musste irgendwo ihre Leiche zu finden sein. Oder hatte Gera rechtzeitig aus dem Haus fliehen können? Dann würde sie womöglich nach ihrer Mutter suchen. Sie musste sich Gewissheit verschaffen.
Die Mädchenkammer hatte wie die Kammer der Eltern im hinteren Teil des Hauses gelegen. Von der Rückseite des Hauses war nichts mehr übrig nach dem Brand.
Trotz der noch über den Trümmern wabernden Hitze betrat sie den Hinterhof und suchte zwischen den Balken und den Lehmplatten des Fachwerks nach einem Körper. Doch sie fand nichts. Kein verkohlter Körper, keine Kleidungsreste, nichts. Gera war verschwunden, als wäre sie zu Staub zerfallen. Allein der Gedanke schnürte ihr die Luft ab.
Sie stolperte über den verkohlten Schutt – und plötzlich schlug ihr etwas in die Kniekehlen, sodass sie niedersank. Mit den Händen musste sie sich in der heißen Asche abstützen, und sie schrie lautlos auf.
»Verfluchtes Bettelpack, du kannst wohl nicht hören!«, wurde sie angefaucht. Es war wieder der Büttel. Diesmal packte er sie unter der Achsel und zerrte sie über die rauchenden Trümmer hinweg auf die Gasse hinaus. »Ich mag es nicht, wenn ich etwas zweimal sagen muss. Wer nicht hören will, muss fühlen!«
Der Büttel schleifte sie weiter. Hannah begann sich zu wehren. Was fiel diesem Kerl ein, sie von ihrem Zuhause wegzuzerren? Sie wollte schreien, doch ihr Krächzen und ihr Widerstand fachten den Zorn des Ordnungshüters nur umso heftiger an.
»Warte! Dir werd ich’s zeigen!«, fauchte er und klemmte sie wie ein Bündel Holz einfach unter die Achsel.
Hannah schlug mit den Beinen aus, trat und biss, sie wand sich wie eine Schlange, doch der rohen Gewalt des Büttels hatte sie nichts entgegenzusetzen.
»So ist’s recht!«, hörte sie jemanden in ihren Zorn hineinrufen, und sie erkannte die Stimme ihres Nachbarn Wagner. »Sonst nimmt das Gesindel überhand!«
Aber sie war kein Gesindel! Sie war Hannah Meisterin, die Frau des Apothekers und Wundarztes Jakob Meister. All das wollte sie sagen, aber ihre Stimme versagte ihr immer noch den Dienst.
»Was habt Ihr denn da für eine interessante Fracht?«, hörte sie, als der Büttel mit ihr auf einen Karren zuging, den sie nur allzu gut kannte. Es war der Karren, der die Delinquenten fürs Rädern und Vierteilen zum Gögginger Tor hinaus und auf den Richtanger brachte.
Auch diese Stimme erkannte sie wieder. Aigen stand am Straßenrand und ließ seinen Blick über die Szene schweifen. Alles würde sich aufklären, davon war sie überzeugt. Alles würde wieder gut werden, wenn sie dessen Aufmerksamkeit gewinnen könnte. Verzweifelt versuchte Hannah, den Blick des Patriziers auf sich zu lenken, doch der sah nur kurz zu ihr hin. In seinen Augen konnte sie kein Erkennen oder eine andere milde Regung wahrnehmen. Ein kurzes Kopfnicken folgte, dann fühlte sie einen harten Schlag auf den Hinterkopf, und sie stürzte in ein schwarzes Nichts.
3
Hannah wurde abrupt wach, als ein Albtraum Wirklichkeit wurde. Sie verlor den Halt, kippte vornüber, fiel endlos, sie konnte sich nirgendwo festhalten und platschte schließlich hart in eine stinkende Lache. Dann schlug über ihr eine Klappe zu, und es war finster.
Benommen und mit schmerzender Schulter lag sie eine Weile in der feuchten Brühe. Alles tat ihr weh, und sie hatte das Gefühl, als hätte es ihr Arme und Beine zerschlagen. Auch ihre Knie brannten höllisch.
Wo um alles in der Welt war sie, und was war mit ihr geschehen?
Hannah versuchte sich zu bewegen und stellte erleichtert fest, dass sie das, wenn auch mühsam und unter Schmerzen, noch schaffte. Zuerst tastete sie ihre Gliedmaßen ab, um festzustellen, ob sie sich etwas gebrochen hatte. Ihre Glieder waren trotz des Sturzes offenbar heil geblieben. Jedenfalls konnte sie Arme und Beine bewegen. Langsam rappelte sie sich hoch und stand auf.
Sie stand da, und die stinkende Brühe tropfte von ihr, sodass es ihr beinahe den Atem nahm. Durch den Holzdeckel über ihr drang ein feiner Schimmer Licht. Langsam gewöhnten ihre Augen sich an die Finsternis. Der Raum war beinahe viereckig, gerade so hoch, dass sie noch darin stehen konnte. Er wurde oben von einer Luke aus nicht ganz bündig anliegenden Holzbrettern verschlossen. Durch die Ritzen hindurch sickerte das spärliche Licht. Auch die Wände waren aus Holz, doch so feucht und glitschig, als befände sie sich unter Wasser. Sofort keimte ein Verdacht in ihr. Es gab nur einen einzigen Ort in Augsburg, von dem jeder wusste, dass es dort so aussah wie hier, auch wenn man selbst ihn noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte: die Wasserzelle im Stadtgefängnis, in den Hexenlöchern.
Ein Frösteln überlief sie, und ihre Zähne schlugen aufeinander. Der Büttel hatte sie niedergeschlagen und auf einen Karren geworfen. Und man hatte sie eingesperrt. Man hatte sie in das schlimmste Loch gesperrt, das es in der Stadt gab. Warum? Sie hatte doch nichts getan. Sie hatte nur ...
Über sich hörte sie die kehlige Stimme des Büttels, hörte Ketten rasseln, hörte die mit Eisen beschlagenen Stiefel des Mannes über die Holzbohlen laufen und das Schreien von mindestens drei Männern. Doch sie verstummten unvermittelt.
Sie trat einen Schritt von der Luke weg, weil sie befürchtete, ein weiteres Opfer könnte zu ihr herabgeworfen werden, doch sie blieb allein.
Man hatte sie zu Unrecht hier eingesperrt. Man hatte sie mit jemandem verwechselt. Man hatte sie ... Die Nässe kroch ihr die kalten Beine hoch – und plötzlich war der Schmerz wieder da. Der Schmerz über die Behandlung hier, der Schmerz ihrer Verbrennungen, der Schmerz über den Verlust ihrer Lieben.
Sie wollte schreien, doch nichts als ein jämmerliches Krächzen kam über ihre Lippen, sie hämmerte mit den Fäusten gegen die schwere Holzluke über ihr, hämmerte gegen die feuchten Bohlen an den Wänden. Doch selbst ihre Schläge waren nur ein mattes Wummern.
Sie würde allein bleiben, niemand würde sie suchen oder nach ihr sehen: kein Ehemann, kein Onkel, keine Tante, keine Kinder. Ihr Mann war verbrannt, die Tochter wohl ebenfalls – und nicht einmal mehr gute Freunde erkannten sie.
Erschöpft lehnte sich Hannah gegen die glitschige Wand des Kerkers und schloss die Augen. Doch mit einem Mal zog die Wucht der Erkenntnis ihr die Beine unter dem Leib weg, und sie sank erneut in den Dreck des Bodensatzes. Wenn sie nicht bald eine Salbe auf ihre wunden Hautstellen bekam, würden diese sich entzünden, und die Entzündung würde sie langsam auffressen. Sie wartete – auf den Tod.
Verzweifelt rappelte sie sich wieder auf und hockte sich so in eine Ecke des Raumes, dass sie möglichst nicht im Wasser saß. Ihr Kleid hatte sich bereits vollgesogen mit der Brühe und wurde mit jedem Augenblick schwerer. Hannah überlegte, was zu tun sei. Sie zermarterte sich den Kopf, wie sie ihre Lage verbessern, wie sie Hilfe herbeiholen könnte.
Zuerst musste sie ihre Stimme wieder zurückbekommen. Die Hitze und der Rauch hatten ihr zugesetzt, doch jetzt war es kühl, feucht, und kein stechender Rauch verätzte ihre Kehle. Hannah versuchte zu summen, dann einen Laut zu formen. Doch nur ein mattes Zischen kam aus ihrem Hals. Unzählige Male stemmte sie sich gegen ihre Stummheit, und ebenso oft versagte die Stimme. Es war hoffungslos.
In ihrem Kopf nistete sich Verzweiflung ein. Wenn Jakob und Gera, ihre beiden liebsten Menschen, tot waren, was sollte sie noch auf dieser Welt? Sie sollte ihnen besser ins Jenseits folgen.
Irgendwann hörte sie über sich die Bohlen ächzen, und die schwere Holzklappe öffnete sich. Eine Stimme brummte etwas von Essen, dann platschte etwas vor ihr ins Wasser. Sie konnte nicht genau sehen, was es war, denn der plötzliche Lichteinfall machte sie blind. Erst als die Klappe über ihr wieder zufiel, kroch sie vorwärts und tastete danach. Es war ein kleiner Flechtkorb, der Brot und eine Schweinsblase mit Flüssigkeit enthielt. Das Brot hatte sich bereits mit dem Brackwasser vollgesogen. Sie riss es heraus, drückte es aus, zögerte kurz, sie musste den Ekel vor dem matschigen Brei zwischen ihren Fingern erst überwinden. Doch sie hatte Hunger. Schließlich schlang sie das Brot hinunter. Sie öffnete die Schweinsblase, verschüttete beinahe die Hälfte der Flüssigkeit und trank dann in gierigen Schlucken.
Dann setzte sie sich wieder in ihre Ecke. Als hätte das Essen ihre Sinne geschärft, roch sie die schlammige Brühe um sie her nur umso stärker. Das Kotige und Brackige des Wassers stieg ihr in die Nase wie ein Brechmittel – und plötzlich wallte es in ihr auf. Sie spie Brot und Wasser in einem Schwall auf den nassen Boden. Gleichzeitig wurde sie von einem Weinkrampf geschüttelt, der nicht enden wollte. Es zog ihr die Gedärme zusammen. Ihr Magen krampfte, ihre Gliedmaßen wurden nach innen gezogen, als reiße jemand mit aller Macht daran, und wieder und wieder würgte sie den Inhalt ihres Magens heraus, bis nur noch bittere Galle kam und sich mit ihren Tränen vermischte. Sie würde elend verrecken in diesem Loch.
Hannah zog die Beine an und legte den Kopf auf die Knie. Sie wollte nur noch sterben.
Wozu leben? Alles, was sie sich in ihrem Leben erhofft, alles was sie sich erarbeitet und gewünscht hatte, war in einer einzigen Nacht zerstört worden. Es hatte sich buchstäblich in Rauch aufgelöst. Ihr Leben, ihre Sicherheit hatten sich verflüchtigt. Mann und Kind waren tot. Als Weib allein in einer Welt, in der sich Männer schon kaum behaupten konnten, war gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ebenso gut konnte sie sich auf der Straße anbieten – falls sie je wieder das Tageslicht zu sehen bekam.
Sie schaukelte mit dem Oberkörper vor und zurück, vor und zurück. Die Bewegung beruhigte sie. Sie träumte sich zurück in das Haus, das letzte Nacht niedergebrannt war, zurück in eine Zeit, als Jakob und sie sich entschieden hatten, es zu kaufen. Sie hatten das giebelständige Fachwerkhaus von den Nonnen des Klosters St. Stephan erworben. Vierhundert Gulden hatte Jakob dafür bezahlt und damit – und weil er den Frauen des Klosters seine Hilfe als Apotheker angetragen hatte – einen zweiten Bieter aus den Reihen des Augsburger Patriziats ausgestochen. Das war viel Geld gewesen für ihre junge Familie, doch Jakob hatte hart gearbeitet und sich als Apotheker rasch einen Namen gemacht. Selbst, dass die Apotheke ein Stück vom Stadtkern entfernt an der neuen Stadtmauer beim Steffinger-Tor lag, war kein Nachteil gewesen, wie sie zuerst vermutet hatten. Nein, er kam mit den Nonnen und den männlichen Geistlichen des Viertels ins Geschäft – und über diese mit den wirklich Reichen der Stadt. Und er belieferte nicht nur die wohlhabenden Familien. Seine Hustentinkturen, seine Wundsalben und Pasten gegen Grind und Hautausschlag verteilte er auch unter den Armen der Gemeinde. Er verlangte von den Begüterten etwas mehr für seine Arzneien und stellte dafür größere Mengen her, als verlangt waren. Was übrig blieb, verschenkte er an die Armen im Namen der Barmherzigkeit Jesu Christi. Dennoch blieb ausreichend Geld, um die Schulden zu begleichen und ein Leben in Wohlstand und Sicherheit zu führen. Jakob war beliebt gewesen. Sie als seine Frau stand in hohem Ansehen. Die Erfüllung ihres gemeinsamen Lebens war ihr Kind, ein fröhliches Ding – und in einer einzigen Nacht war das alles dahingegangen.
Wie ein Mühlstein wälzte sich dieser Gedanke in Hannahs Kopf herum. Der Gedanke an die Stunde zwischen Erwachen und Verhaftung, so als würde sie in dem sich ewig drehenden Rad der Zeit festhängen. Doch dazwischen streute die Erinnerung Fetzen ihres Lebens: die Vermählung mit Jakob, die Geburt Geras, der Kauf des Hauses, die Armensprechstunden ... Und immer wenn sie dachte, sie würde endlich aus dieser endlosen Schleife ausbrechen können, begannen die Erinnerungen wieder durcheinanderzuwirbeln und sie zu peinigen und zwangen sie zurück in die unselige Brandnacht.
Wie lange sie so in ihrer Ecke gehockt und über ihre Vergangenheit nachgegrübelt und ihren Oberkörper vor und zurück gewiegt hatte, wusste sie nicht zu sagen. Die Dunkelheit stahl ihr jegliches Zeitgefühl. Als sie wieder zu sich kam und sich dem sich drehenden Erinnerungsrad des Schicksals entwunden hatte, waren ihre Beine eingeschlafen, und sie konnte sich kaum mehr bewegen. Sie wollte aufstehen, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht. Sie fühlte eine glühende Hitze in sich pochen. Die ersten Anzeichen von Fieber. Wenn sich erst Wundbrand bildete, dann gab es keine Rettung mehr.
In ihr dumpfes Brüten hinein nahm sie Stimmen wahr. Die eine Stimme war die des Wächters, aber sie konnte nicht verstehen, was er sagte. Der Kerl sprach zu undeutlich. Die Stimme des zweiten Mannes konnte sie genau hören. Sie war melodisch und drang zumindest in Satzfetzen bis zu ihr hinab. »... Mörderin ... Mann und Kind ... beinahe ... Stadt niedergebrannt ...«, vernahm sie. Die Worte »... Schleusen ... ertrinken ...« und das Klirren einiger Geldstücke drangen bis zu ihr herunter, dann wurden die Geräusche schwächer, offenbar gingen die beiden Männer über ihr fort. Sie hörte nur noch ein verhaltenes Lachen, wie über ein gutes Geschäft. Dann war alles wieder still.
Kurze Zeit später begannen Ketten zu rasseln. Ein Gluckern setzte ein, so deutlich und so nah, dass sie glaubte, sie würde plötzlich mitten in einem der Lechkanäle sitzen. Schließlich spürte sie eine eisige Strömung an ihren Füßen. Das Rauschen wurde stärker. Aus den Ritzen zwischen den Bohlen schossen feine Strahlenfinger. Das Wasser in ihrer Zelle stieg! Es war so kalt, dass sie das Gefühl hatte, ihre Zehen würden abfrieren.
Hannah tastete nach den Holzbohlen und spürte, wie durch die Ritzen hindurch Wasser in ihr Gefängnis gepresst wurde. Der Wächter hatte eine Schleuse zu den Lechkanälen geöffnet!
Es stimmte also, was man sich in der Stadt über dieses Loch hier erzählte. Dass die Gefangenen dort gefoltert wurden. Dass man sie beinahe ertrinken ließ, damit man Geständnisse aus ihnen herauspressen konnte. Dass der eine oder andere Delinquent dabei tatsächlich ertrank, was weiter nicht tragisch war, denn schuldig waren sie alle, die in diese Wasserzelle gesperrt wurden. Aber sie war nicht schuldig. Sie war unschuldig. Und niemand hatte sie bislang zu irgendetwas befragt oder überhaupt angehört.
Hannah hämmerte erneut gegen die Holzluke über ihr, während das Wasser bereits ihre Knie umspülte und die Beine darunter gefühllos wurden.
Bald wurden ihr die Arme lahm vom Hämmern. Die Fäuste fühlten sich an wie Bleigewichte, sie waren blutig und zerschrammt, und die Beine drohten unter ihr wegzuknicken, weil sie sie nicht mehr spürte. Wie weit würde das Wasser noch steigen? Bis zum Hals, bis zum Kinn?
Als der Wasserspiegel ihr bis zur Brust reichte, hörte sie auf, gegen die Luke zu hämmern. Sie versuchte wieder zu schreien – und tatsächlich spürte sie, wie die feuchte Kühle ihrer Kehle wohltat. Sie konnte plötzlich wieder krächzen. Sie konnte einen einzelnen Ton hervorbringen. Doch das Wasser stieg unaufhaltsam. Hannah stellte sich auf die Zehenspitzen, damit sie nicht mit Mund und Nase unter Wasser geriet. Schließlich verlor sie den Boden unter den Füßen, doch sie konnte immer noch kurz Luft holen, wenn sie sich sinken ließ und sich vom Boden abstieß, um immer wieder aufzutauchen.
Doch dann stieß sie mit dem Kopf gegen die Bohlendecke und fand keinen Platz mehr, um zu atmen. Sie hatte immer gedacht, dass der Irrsinn sie in diesem Augenblick packen und mit sich reißen würde. Doch nichts dergleichen geschah. Sie wurde ruhig, hielt die Luft an und ließ sich einfach sinken. In völliger Gelassenheit beschloss sie, ein letztes, ein allerletztes Mal zu versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Wenn ihr dies nicht gelänge, dann würde sie einfach einatmen, das Wasser tief in die Lungen saugen und ertrinken. Kaum hatte sie den Boden berührt, schnellte sie nach oben in dem Wissen, dass sie mit dem Kopf gegen die Falltür schlagen würde. Doch sie durchbrach den Wasserspiegel, wurde an den Schultern gepackt, hochgerissen, auf den Boden geworfen und dort liegen gelassen.
4
Zieht Euch aus, rasch!«, hörte sie jemanden sagen, noch während sie nach Luft schnappte. Ihr ganzer Körper war ein einziges Zittern. Sie hätte nicht stehen, geschweige denn eine Bewegung machen oder sich gar ausziehen können.
Schwielige Hände packten sie, rissen ihr das Nachthemd vom Leib, das sie seit der Stunde trug, als sie aus der brennenden Apotheke geflohen war. Sie lag da, bloß und verstört, und sah, wie der Mann in dem dunklen Raum, in dem sie sich nun befand, sich an einer weiteren Frau zu schaffen machte. Auch ihr zog er das Hemd über den Kopf. Hannah schämte sich ihrer Nacktheit, doch jede Bewegung raubte ihr beinahe die Sinne, sodass sie sich nicht bedecken konnte. Der Mann kam zurück, sah auf sie hinab und holte tief Luft. »Mein Gott«, murmelte er und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als könne er nicht glauben, was er sah. »Hier«, sagte er schließlich und wandte sich ab, »zieht das über. Rasch.«
Hannah stöhnte, doch ihre Gliedmaßen waren derart steif und unbeweglich, dass sie nur reglos daliegen konnte. Selbst ihre Blöße war ihr plötzlich gleichgültig. Sollte der Kerl nur hinschauen; außer einem zerschlagenen und verbrannten Körper sah er ohnehin nichts.
»Jetzt nehmt schon. Die hier«, der Mann, den Hannah an der Stimme als den Wächter über ihr ausmachte, zeigte auf die zweite Frau, »braucht den Fetzen nicht mehr. Aber Euch könnte er helfen.«
Endlich versuchte sie nach den Lumpen zu greifen, ihre Finger um das Stück Stoff zu schließen, doch es gelang ihr nicht.
Währenddessen schleifte der Wächter die stumm Daliegende zum Wasserloch. Dann nahm er eine der Kerzen, entzündete damit eine Fackel und strich mit der Flamme über das Gesicht und die Arme der Frau, die dalag wie eine Wachspuppe. Er versengte ihr Haare und Haut. Danach löschte er die Fackel im Wasser und steckte sie zurück in die Halterung. Schließlich packte er die Frau bei den Schultern und ließ sie durch die Öffnung der Wasserzelle gleiten. Das Wasser stand bereits bis zur Lukendecke. Ganz langsam tauchte die Fremde in das schwarze Loch hinab. Dann warf der Wächter die Luke krachend zu und stieß die Frau so vollends in die Tiefe.
Hannah begann laut zu wehklagen.
»Jetzt habt Euch nicht so. Die Frau war schon tot. Pech für das Weib, aber Glück für Euch.« Der Wärter baute sich erneut über ihr auf. Im Halbdunkel des Verlieses konnte sie seine Augen nicht sehen. Es waren nur schwarze Höhlen in einem ansonsten gutmütigen Gesicht. Von irgendwoher kannte sie diese Miene, aber sie vermochte sich nicht zu erinnern, woher.
»Was habt Ihr getan?«, fragte der Wärter flüsternd. Er kniete sich neben sie hin, doch Hannah zuckte zurück. »Ich will Euch nichts tun«, sagte er. »Ihr müsst nur das Kleid überziehen, schnell.«
Er nahm sie am Arm, stützte sie ab und streifte ihr mit der anderen Hand umständlich den stinkenden Stofffetzen über. Dann hob er sie auf die Schulter, schleppte sie in einen anderen Raum und legte sie in der dunkelsten hinteren Ecke ab. »Bleibt ruhig. Kein Sterbenswort, sonst endet Ihr wie die Vettel da im Wasser«, zischte er ihr ins Ohr.
Hannah kauerte sich in die Ecke, starr vor Angst und vor Schmerzen. Alles an ihr fühlte sich wund und offen an, sodass sie unwillkürlich zu wimmern begann.
Kaum hatte der Wächter ihre Zelle verlassen und das Schloss abgesperrt, als auch schon gegen eine Tür geklopft wurde und die andere Stimme wieder zu hören war, so laut, dass Hannah alles verstehen konnte.
»Ist das Loch vollgelaufen?«
Eine Weile herrschte Schweigen, so als zögerte der Wächter mit der Antwort. »Ja, Herr«, hörte Hannah ihn dann sagen. »Aber das wird zusätzlich kosten. Ich muss jeden Eimer mit der Hand ...«
»Jetzt komm mir nicht damit. Hier, ein Silberstück. Zeig mir das Weib, los, Kerl.«
»Sie hat ... hat versucht zu schreien ...«, sagte der Wärter weiter.
»Schluss jetzt, Kerl. Ich will sie sehen und mich überzeugen, dass du sie ersäuft hast. Erst dann habe ich meine Ruhe.«
»Ihr werdet es sehen ...«
Hannah hörte, wie das Fallgatter angehoben wurde und ein paar weitere Geräusche – offensichtlich wurde die armselige Tote aus dem Wasser gezogen.
»Schaff sie weg. Hier ist ein ganzer Goldgulden. Mehr, als du im Monat verdienst.«
»Zwei«, hörte sie den Wärter sagen, leise, aber bestimmt.
»Willst du mich vielleicht erpressen?«, rief der Fremde aufgebracht. »Schließlich war nicht ich es, der das Weib ertränkt hat, sondern ...«
»Zwei«, sagte der Wärter erneut.
»Also gut. Hier, zwei rheinische Gulden. Aber kein Wort mehr.«
In Hannahs Schmerzgedanken schlich sich Bewunderung für den Wärter. Mit der Erhöhung seiner Forderung hatte er nicht nur sein Salär aufgebessert, sondern auch den Fremden von der Toten abgelenkt.
Wenn Hannah sich alles bisher Geschehene – ihre Rettung aus der Wasserzelle, den Tausch ihrer Kleidung mit der der Toten, die Worte des Wärters und dessen Verhandlungen mit dem Fremden – richtig zusammenreimte, dann wollte dieser Fremde offensichtlich sehen, ob sie, Hannah, wirklich ertrunken sei. Doch sein Ärger über die Bezahlung hatte ihn offensichtlich unaufmerksam werden lassen.
Warum tat der Wächter das für sie?
Vor ihrer Zelle hörte sie das Geräusch von Schritten – das unvermittelt abbrach.
»Wer liegt hier drin?«, fragte der Fremde misstrauisch.
»Ein Bettelweib«, sagte der Wärter und sperrte das Verlies unverzüglich auf. »Die Vettel hat vermutlich Lepra. Wir werden sie morgen vor die Stadt bringen. Nach Sankt Sebastian, ins Leprosenhaus. Wollt Ihr zu ihr und sie Euch ansehen?«
Wäre sie nicht beinahe besinnungslos gewesen vor Schmerzen, hätte Hannah laut herausgelacht. Der Fremde verneinte sofort, und seine Schritte entfernten sich hastig.
»Schafft sie weg!«, war der letzte Satz, den sie noch hörte, dann klang es so, als schlüge eine schwere hölzerne Tür zu. Sie hörte noch einen Schlüssel sperren, dann war Stille.
Doch Hannah hatte das Gefühl, als hätte der Wärter seinen Platz nicht verlassen. Er musste vor ihrer Zellentür stehen, oder in unmittelbarer Nähe, irgendwo da draußen im Dunkel des Durchgangs. Er hatte sie eben zum zweiten Mal gerettet. Obwohl Müdigkeit und Erschöpfung sie niederzwangen, lauschte sie dem Wärter.
»Ihr seid doch die Apothekerin, nicht?«, flüsterte der Wärter.
Hannah hätte ihm gern geantwortet, doch sie wusste, wie es um ihre Stimme stand. Also brummte sie nur.
»Euren Mann – ich kenne ihn.«
Wieder brummte Hannah mit einer gewissen Hoffnung in der Stimme.
»Es war vor mehr als einem Jahr. Sicher erinnert Ihr Euch nicht mehr daran. Ich war bei Euch in der Apotheke. Euer Mann hat nicht gezögert, als ich ihm von Stephanie erzählt habe. Sofort hat er seine Sachen gepackt, sie mir in die Hand gedrückt und nur gesagt, ich solle vorausgehen.«
Das Sprechen des Wärters war in ein ersticktes Schluchzen übergegangen. Hannah nahm an, dass er direkt vor dem in die Holztür der Zelle eingelassenen kleinen Gitter stand.
»Ich werde jetzt aufschließen«, flüsterte er. »Ich komme zu Euch in die Zelle. Niemand wird Euch etwas tun.« Sie hörte, wie der Schlüssel sich im Schloss drehte, hörte das Quietschen der Tür, hörte seine Schritte. Hannah wunderte sich, wie sehr sich das Gehör schärfte, wenn das Augenlicht nicht zu gebrauchen war.
»Euer Mann ... er hat damals meiner Stephanie geholfen. Eine gute Frau. Sie ist Wäscherin und hatte sich eine schwere Entzündung am Unterarm zugezogen. Die Wunde eiterte stark und Stephanie fieberte bald. Der Bader hatte ihr schon gesagt, er müsste den ganzen Arm ab dem Ellenbogen abnehmen, bevor das Fieber sie zerfräße. Wundbrand. Ein schreckliches Wort und ein Todesurteil. Stellt Euch nur vor, was das bedeutet hätte. Für mich, für unsere Kinder. Allein Euer Mann ... er hat sich meiner Stephanie angenommen. Sie durfte jeden Tag zu ihm kommen. Er hat ihr die Wunde zuerst mit dem Messer gesäubert, dann ausgebrannt und sie schließlich mit einem Mittel bestrichen und frisch verbunden. Eine Woche später war sie fieberfrei. Er war ein ... Engel, Euer Mann. Unser Engel.«
Hannah sah die schemenhafte Gestalt des Wärters und hörte, wie er sich zu ihr auf den Boden der Zelle setzte. Seine Stimme, die die Worte nur geflüstert hatte, kämpfte mit der inneren Bewegung, die die Erinnerung hochspülte.
Für eine Weile verstummte er, bis er sich wieder gefasst hatte. Dann erzählte er weiter. Langsam. Stockend. Er war das Sprechen nicht gewohnt, das hörte sie ihm an.
Er erzählte ihr, wie die Wunde seiner Frau ganz langsam verheilt sei, wie sich endlich Schorf gebildet habe, wie der Schorf schließlich abgefallen sei, wie er die Narbe auf dem Arm seiner Stephanie geküsst habe, die sich dort gebildet hatte. Weißlich sei sie gewesen, stotterte er, weißlich und ein wenig eingesunken, so als würde ihr ein Stück Fleisch im Unterarm fehlen. »Sie wartet auf mich«, sagte er zuletzt. »Jetzt. Zu Hause. Und kann mich mit beiden Armen umfangen.« Die letzten Worte sprach er mit bebenden Lippen. »Das hat sie Eurem Mann zu verdanken.«
Hannah seufzte. Einer Frau, die sie nicht einmal kannte, hatte sie also ihr Leben zu verdanken. Und dankbar war sie, wenn sie an die Tote dort im Wasserloch dachte. Sie hätte dem Mann so gern die Hand auf den Arm gelegt oder ihm sogar die Füße geküsst, doch sie war zu schwach. Und sie fror erbärmlich in den fadenscheinigen Fetzen der Toten, die inzwischen durch ihre nasse Haut feucht geworden waren.
»Ich werde Euch laufen lassen«, flüsterte der Mann. »Aber Ihr müsst mir etwas versprechen: Verschwindet aus der Stadt. Bitte. Wenn jemand erfährt, dass Ihr überlebt habt und ich Euch herausgelassen habe, dann muss ich es büßen. Sie schlagen mir die Hände ab, und – wenn sie gnädig sind – auch den Kopf. Aber sie sind nicht gnädig.«
Schweigen breitete sich aus, nur unterbrochen vom gelegentlichen Stöhnen aus den umliegenden Zellen.
Hannah wälzte sich raschelnd von einer Seite auf die andere.
Schließlich stand eine Frage in der Stille, von der sie erst allmählich begriff, dass der Wärter sie gestellt hatte.
»Was habt Ihr verbrochen?«
Hannah verstand den Sinn dieses Satzes zunächst nicht.
Was hätte sie ihm schon sagen sollen, selbst wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre? Nichts hatte sie verbrochen. Nichts. Sie saß zu Unrecht in den Hexenlöchern. Wieder versuchte sie, dem Wärter etwas zu sagen, doch die Stimme versagte ihr. Was, wenn ihre Stimme nie wieder zurückkam?
Ihr stöhnendes Brummen brachte dem Wärter offenbar in Erinnerung, dass das Sprechen ihr schwerfiel.
»Ich hatte vergessen. Ihr könnt ja nicht reden. Was immer dieser Teufel mit Euch gemacht hat, Ihr verdient es nicht.«
Hannah hörte, wie er in den Taschen seines Wamses suchte.
»Hier, das stammt von der Toten. Sie hieß Röttel. Merkt Euch den Namen. Röttel. Mit diesem Namen war sie in der Liste der Stadtarmen geführt. Das hier ist ihre Bettelmarke.«
Ein metallener Gegenstand klimperte neben ihr auf den steinernen Boden der Zelle. Unwillkürlich griff Hannah danach, obwohl sie solch eine Marke nie brauchen würde – schließlich war sie die Frau des Apothekers. Sie schloss die Finger um das Metall und spürte die Kälte, die es verströmte.
Hannah schwieg, und in ihrem Schweigen schien ihr ganzes Nichtverstehen mitzuschwingen. Sie schnaubte unwillig durch die Nase.
»Oh, natürlich«, sagte der Wärter. »Ihr seid es nicht gewohnt, dass die Menschen keine christlichen Namen tragen.« Er ließ so etwas wie ein Lachen hören. Der Wärter schien Hannah durch die Dunkelheit hindurch anzustarren. »Doch wer keine Zukunft hat, braucht keinen christlichen Namen mehr. So blieb ihr einfach nur der Name Röttel.«
Stille breitete sich aus, eine Stille, die schmerzte, dann räusperte der Wärter sich verlegen.
»Ihr sollt Euren Mann ... mitsamt der Tochter ... im eigenen Haus verbrannt haben. Aber ich glaube das nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen«, warf der Wärter hastig in den Raum. Er erhob sich, und sie hörte Zweifel in seiner Stimme. »Aber Euer Mann hat damals auch nicht gefragt, wer da zu ihm kommt und ihn um Hilfe bittet. Er hat einfach geholfen.« Wieder verstummte er, und Hannah begann sich zu fragen, warum er ihr das alles sagte. »Der Apotheker hat so freundlich von Euch gesprochen. Ich kann es mir nicht vorstellen.«
Langsam begann sich in Hannahs Kopf alles zu drehen. Sie sollte das Feuer gelegt und Mann und Kind ...? Glaubte er das wirklich? Sie stöhnte laut auf. Was war das für eine verkehrte Welt? Sie hatte niemandem irgendetwas getan. Wenn sie doch nur ihre Stimme wiederhätte, sie würde ihm erklären können, was wirklich geschehen war.
Langsam begann sich ein Bild zusammenzufügen. Ein Bild, das so grotesk war, dass sie es sofort wieder aus ihrem Kopf verscheuchte. Sie wurde als Brandstifterin angeklagt. Sie war angeblich die Mörderin ihrer Tochter und ihres Mannes. Doch wer verbreitete nur solche Schauermärchen? Und warum?
5
Bruder Adilbert blickte sich verstohlen um. Er war allein im Scriptorium seines Klosters Sankt Ulrich und Afra. Rasch zog er aus der Schublade seines Stehpults einen Bogen Papier und legte ihn auf das Pergament, auf das er gerade Zeilen der »Vita Simperti«, der »Lebensgeschichte des heiligen Simpert«, kopierte. Dann schweifte sein Blick erneut durch den kleinen Raum. Noch immer war er allein.
Rasch tauchte er die frisch gespitzte Feder in das Tintenfass und begann mit runden, weichen Buchstaben auf dem jungfräulichen Papier die ersten Zeilen des Brautlieds aus dem biblischen Hohelied in deutscher Sprache niederzuschreiben.
»Schön bist du, meine Freundin, ja schön; deine Augen blicken wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabsteigt von Gileads Bergen.«
Er liebte dieses Lied. Er liebte die Zeilen, die sich langsam, aber mit anschwellender Inbrunst steigerten und die Formen des Weiblichen in immer höheren Tönen zu preisen begannen.
»Wie ein Streifen von Scharlach sind deine Lippen ...«, schrieb er und musste seiner Hand dabei befehlen, ruhig zu bleiben und sich dem gleichmäßigen Strich der Feder unterzuordnen, statt sich dem Zittern der Erregung hinzugeben, das mit jedem Wort, mit jeder Zeile, mit jedem Vers heftiger wurde.
»Wie der Davidsturm ist dein Hals ...«, schrieb er aus dem Gedächtnis und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen, voller Vorfreude auf die beiden nächsten Verszeilen, die in seiner eigenen Sprache um so viel sinnlicher klangen als im spröden Latein.
»Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie Zwillinge einer Ricke, die unter den Lilien ...«
Ein kleines Geräusch ließ ihn hochfahren. Jemand betrat den Raum. Das letzte Wort wurde durch einen Klecks schwarzer Tinte verunstaltet, und ein Fluch presste sich über Bruder Adilberts Lippen. »Herrgott, was stört Ihr mich?«
Die Arbeit für Bruder Medardus war dahin. Solch ein Geschmier würde er nicht entgegennehmen wollen. Und das bedeutete für Adilbert wiederum: kein zusätzlicher Krug Wein, kein zusätzlicher Zipfel Wurst und kein zusätzlicher Apfel.
Der Bruder hinter ihm sagte nichts, sondern lachte nur leise.
Bruder Adilbert streute rasch Sand über das Blatt und faltete es zusammen. Er stellte sich dabei so, dass der andere Mönch keinen Blick auf das Papier werfen konnte. Dann legte er es in die Schublade zurück. Erst jetzt, da niemand mehr lesen konnte, was er da geschrieben hatte, drehte er sich um.
»Oh«, entfuhr es ihm. »Wer seid Ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen! Das ist das Scriptorium! Hier haben nur Mönche Zutritt.«
Die Gestalt vor ihm trug einen bodenlangen Umhang mit einer Kapuze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hatte, sodass nur der Mund und das Kinn zu sehen waren. Ein sauber gestutzter Vollbart, weiß wie Schnee, umrahmte das Gesicht. Der Mund verzog sich zu einem Lächeln. »Ich habe überall Zutritt.« Der Mann machte keinerlei Anstalten, sich aus dem Raum zu entfernen. Er ging um die vier Stehpulte herum, die dort im direkten Lichteinfall standen, und spähte in die aufgeschlagenen Werke, die kopiert wurden. Nun, diese enthielten keine Geheimnisse, und wenn Adilbert sich recht erinnerte, lagen gerade nur ein Altes Testament, ein Neues Testament und seine »Vita Simperti« auf den Pulten. Nichts, was verborgen werden musste.
Adilbert wusste nicht recht, was er tun sollte. Er warf einen schnellen Seitenblick zum Eingang des Scriptoriums, aber von dort erwartete er eigentlich keine Hilfe. Die meisten Brüder waren am späten Nachmittag im Garten oder mit eigenen Studien beschäftigt, weil die Lichtverhältnisse im Scriptorium für ihre Schreibarbeit nicht mehr ausreichten. Bruder Adilbert hatte diese ungestörte Zeit bewusst gewählt, um das Blatt für Bruder Medardus herzustellen. Der hatte ihn schon lange darum gebeten, und mit jedem Tag Warten war der Preis dafür gestiegen. Doch jetzt war nichts mehr aus dem Bruder Cellerar herauszukitzeln – und daher hatte er sich an die Arbeit machen wollen.
Bruder Adilbert räusperte sich und fasste wieder Mut. Der Mann vor ihm war ein Laie, so viel stand fest. Ihm war das Betreten des Konvents verboten. So viel stand ebenfalls fest. Dennoch strich er durch die Reihen der Stehpulte wie ein Hund und steckte seine Nase in alle Bücher. Das stand ganz offensichtlich fest. Und an diesem Umstand galt es ebenso offensichtlich etwas zu ändern.
»Raus hier!«, brüllte Bruder Adilbert in einem plötzlichen Anfall von Kühnheit. »Ihr dürft hier nicht sein!«
Der Fremde schaute auf, aus dem dunklen Loch der Kapuze starrte er ihn an, doch er wirkte keineswegs erschrocken.
»Ich darf das sehr wohl, Mönch«, sagte er seelenruhig und trat an das Schreibpult des Mönchs. Dann griff der Unbekannte rasch in die Schublade des Pults und zog das gefaltete Blatt Papier heraus, das Adilbert soeben dort hineingelegt hatte.
Der Fremde hielt es zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und schwenkte es hin und her.
»Ihr schreibt auf Papier? Nicht auf Pergament? Dann wird es wohl eine Skizze sein oder eine Anmerkung, die noch überprüft werden muss. Oder irre ich mich womöglich?«
Verblüfft schüttelte der Mönch den Kopf. »Nein. Natürlich nicht. Eine Skizze. Jawohl, nicht mehr als das. Unwichtig. Gebt schon her.« Mit ausgestreckter Hand stand er da und forderte das Papier. Doch der Mann entfaltete das Papier rasch und begann zu lesen: »Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie Zwillinge einer Ricke ...« Der Fremde hielt inne. Ein hohler Ton, der ebenso gut ein Lachen sein konnte wie eine Unmutsäußerung, drang aus der Kapuzenhöhle. »Höchst aufschlussreiche Skizzen«, murmelte er. »Ihr solltet noch ergänzen: Deine Gestalt ist der Palme gleich, deine Brüste sind wie Trauben. Oder den Vers, der mir der liebste ist aus dem Hohelied: Dein Schoß ist ein rundes Becken, es mangle ihm nie der gewürzte Wein. Wundervoll, nicht?«
Mit einer raschen Geste steckte der Unbekannte das Blatt in sein Wams, ging um das Pult herum und legte dann von der anderen Seite die verschränkten Arme auf das Stehpult.
Wieder sah Bruder Adilbert nur die untere Hälfte des Gesichts, während sich die obere Hälfte im Kapuzenschatten verbarg. Der Mönch hatte das Gefühl, als wäre alles Blut aus seinem Leib gewichen und hätte nur eine Hülle zurückgelassen. Wenn er sich bewegt hätte, wäre er vermutlich in sich zusammengesunken wie ein leerer Sack.
»Ich werde Abt Heinrich nicht verraten, Bruder Adilbert, dass Ihr erotische Verse aus der Bibel kopiert und an Eure Mitbrüder verteilt. Vermutlich nicht uneigennützig, sondern für kleine Vergünstigungen. Schließlich ist die menschliche Natur mit Fehlern behaftet, und solche kleinen Fehler muss man ihr nachsehen.«
Langsam ahnte Adilbert, worauf der Mann hinauswollte. Seine innere Stimme sagte ihm: Wie immer der seltsame Fremde ins Scriptorium gekommen war, er war nicht gekommen, um seine kleinen Schwächen aufzudecken, sondern um sie auszunutzen.
Die Augen des Fremden schienen ihn scharf zu mustern, und als der Unbekannte anhob zu sprechen, glaubte der Mönch, der andere könne Gedanken lesen.
»Ich will etwas Ähnliches von Euch, was Bruder Medardus von Euch wollte.«
Adilberts Augen weiteten sich. »Erotica? Ihr wollt von einem Mönch Erotica?«
Jetzt lachte der Fremde laut auf, doch es war ein unfrohes Lachen.
»Wenn ich Erotica wollte, würde ich mich unbedingt an einen Mönch wenden.« Die Stimme troff vor Spott. »Wer kennt die Schliche der menschlichen Natur besser als jemand, der sie beständig unterdrücken muss? Wer all seine Kraft dafür aufwenden muss, nicht nur die Natur, sondern auch seinen Geist zu überwinden, ist das geeignete Gefäß für Fantasien aller Art, Bruder Adilbert. Auch der schlimmsten.«