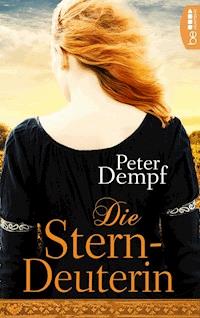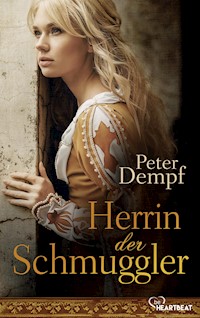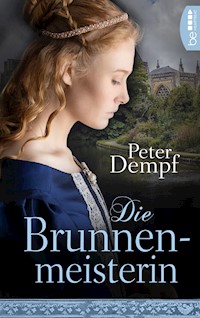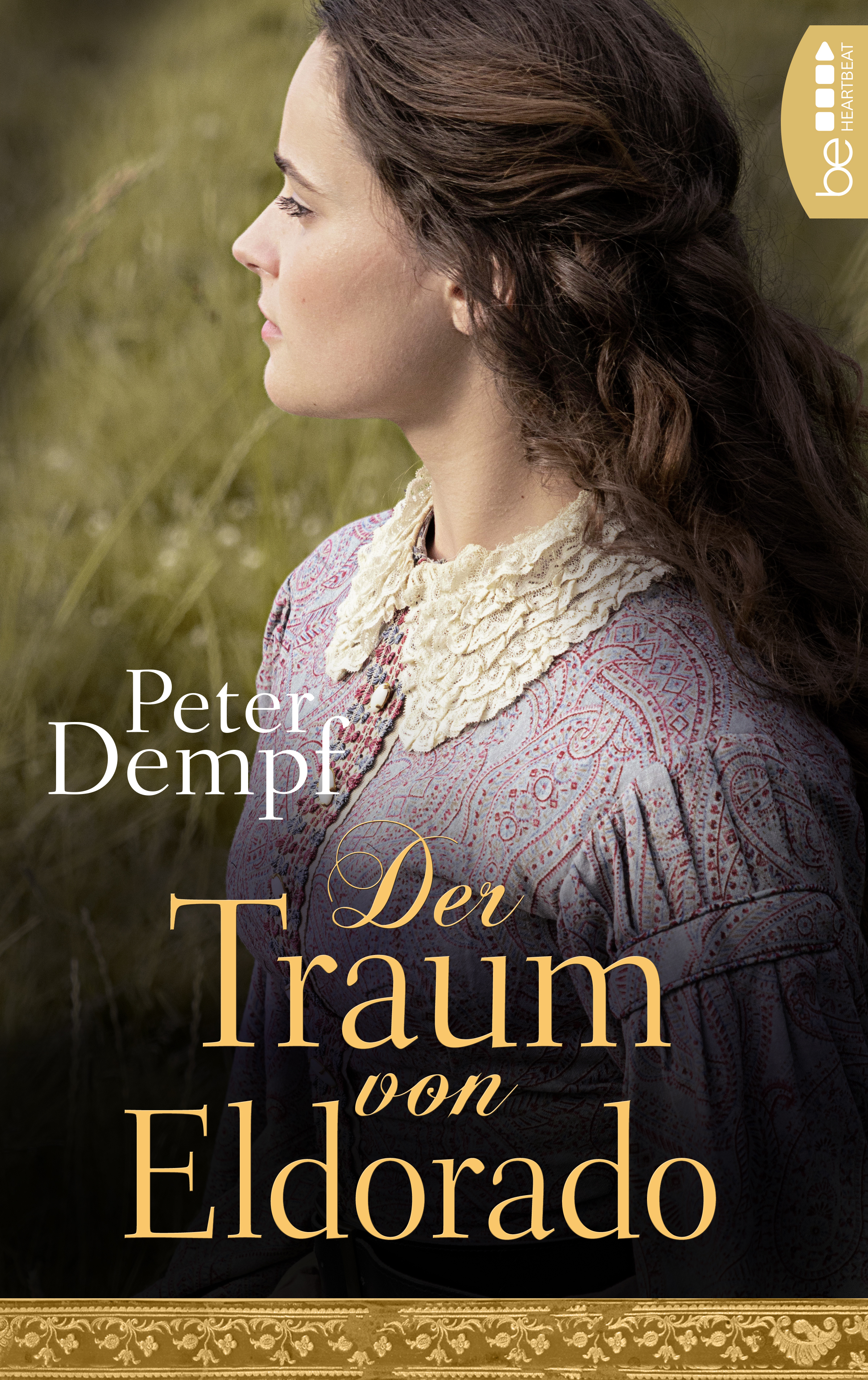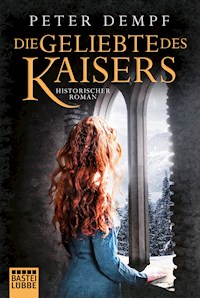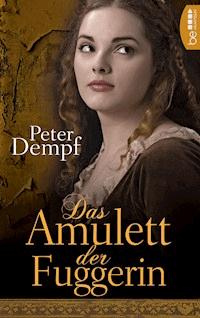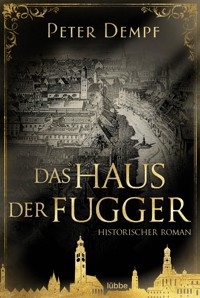
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Familie in Not, ein mächtiger Kaufmann auf der Suche nach seinem Seelenheil und ein fragwürdiges Heilmittel
Augsburg, im 16. Jahrhundert. Weil Eva und Joss den letzten Wunsch des Scharfrichters erfüllen und sich damit mehr Feinde als Freunde machen, gerät die ganze Familie in Not. Allein die Aufnahme in die neue Fugger-Siedlung rettet sie vor der Gosse. Um hier wohnen zu dürfen, müssen sie wie alle anderen Bewohner fortan täglich drei Gebete für das Seelenheil des Stifters Jakob Fugger sprechen. Zudem obliegt ihnen die Zubereitung und Ausgabe des berühmten Guajak-Tranks im Siechenhaus. Dann jedoch merkt Eva, dass das Medikament nicht wirkt - und bringt sich und ihre Familie in größte Gefahr ...
Spannender Historischer Roman um die älteste Sozialsiedlung der Welt: die Augsburger Fuggerei
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Die Figuren der Handlung
TEIL I: DAS GRAB AN DER MAUER
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
TEIL II: DIE HOLZELTERN
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
TEIL III: SCHMACH UND GERECHTIGKEIT
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Nachwort
Quellenangaben
Glossar
Dank
Über das Buch
Eine Familie in Not, ein mächtiger Kaufmann auf der Suche nach seinem Seelenheil und ein fragwürdiges Heilmittel
Augsburg, im 16. Jahrhundert. Weil Eva und Joss den letzten Wunsch des Scharfrichters erfüllen und sich damit mehr Feinde als Freunde machen, gerät die ganze Familie in Not. Allein die Aufnahme in die neue Fugger-Siedlung rettet sie vor der Gosse. Um hier wohnen zu dürfen, müssen sie wie alle anderen Bewohner fortan täglich drei Gebete für das Seelenheil des Stifters Jakob Fugger sprechen. Zudem obliegt ihnen die Zubereitung und Ausgabe des berühmten Guajak-Tranks im Siechenhaus. Dann jedoch merkt Eva, dass das Medikament nicht wirkt – und bringt sich und ihre Familie in größte Gefahr …
Spannender Historischer Roman um die älteste Sozialsiedlung der Welt: die Augsburger Fuggerei
Über den Autor
Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik und Geschichte und unterrichtet heute an einem Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine Mittelalter-Romane »Fürstin der Bettler«, »Herrin der Schmuggler« und »Das Gold der Fugger« angesiedelt sind.
Peter Dempf
Das Haus der Fugger
Historischer Roman
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren und Verlagsagentur, Münchenwww.ava-international.de
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnEinband-/Umschlagmotive: © clu/istockphoto; © shutterstock: Meder Lorant | brichuas | Lukasz SzwajUmschlaggestaltung: Birgit Gitschier, AugsburgeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9435-1
luebbe.delesejury.de
Die Figuren der Handlung
Die Kursivsetzungen verweisen auf historische Personen.
Jakob Fugger (1459–1525), Kaufmann und Bankier
Sibylla Fugger (um 1480–1546), seine Frau
Anton Fugger (1493–1560), sein Neffe und zusammen mit dessen Bruder Raymund (1489–1535) sein Nachfolger
Matthäus Schwarz (1497–um 1574), Hauptbuchhalter des Fugger’schen Handelshauses
Thomas Krebs, Baumeister Jakob Fuggers für die Fuggerei
Joss Neher, Zimmerer
Eva, seine Frau
Els, ihre Tochter
Barthlen, ihr Sohn
Jonathan Wolf, Bäckergeselle, Els’ Liebster
Aennlin, junge Krankenwärterin im Holzhaus
Michl Jordan, Zunftoberer der Zimmerer
Raymund Otto, Zweiter Vorsitzender der Zunft
Melchior Gross, junger Zimmermann
Urban Rieger (1489–1541), Domprediger, Theologe und Reformator
Pater Finn, Dekan bei St. Servatius
Adolph Occo (1476–1503), Arzt und Humanist
Marx Köllin, Scharwächter
Marie, seine Frau
Meister Hans, Scharfrichter, Freimann
Babette Hutter, blinde Hebamme
Achacius, ihr Mann
Franz Gelder, Schmied
Hänsel Fricks, Sackpfeifenspieler
Vroni, seine Frau
Mertin, »Doctor Lubricus«, Theriakhändler
Aaron, der Jude vom Judenberg
Esther, seine Frau
TEIL IDAS GRAB AN DER MAUER
Im Namen der heiligen unteilbaren Dreifaltigkeit, auch der Gebärerin des Allmächtigsten und Heiligsten, Jungfrau Maria, und aller Heiligen. Ich, Jakob Fugger, Bürger zu Augsburg bekenne mit diesem Brief und Siegel und verkünde [es] jedermann, der ihn ansieht, liest oder hört, nachdem einst meine Brüder Ulrich und Georg Fugger und ich, Gott zum Lob und aus Dankbarkeit für das Glück und den Erfolg, das er uns bislang in unserem Handel mit weltlichen Gütern erwiesen hat (…). Ich und meine Vettern haben uns vorgenommen, Gott zu Lob und Ehren, auch armen Tagelöhnern und Handwerkern zu Hilfe, etliche Häuser hier in Augsburg Kappenzipfel genannt zu bauen und am genannten Ort zu vollenden. Alles wird von meinem und meiner Brüder Söhne Eigentum (…) Gott dem Allmächtigen und seinen Heiligen zu Lob im Namen St. Ulrichs laut unseres Gesellschaftsbriefs vorgestreckt und bezahlt, außerdem von den 15.000 Gulden, die ich in meiner Gesellschaftsrechnung von Freitag, St. Valentins Tag (14. Feb.) 1511 vorgesehen habe und jetzt in meiner Verschreibung und Erklärung am 6. Tag des Monats August des gegenwärtigen 1521 Jahres auslobe, da ich mit sicherem Verstand, gutem Gewissen und Bewusstsein die nachher aufgeführte Ordnung und Stiftung vorgenommen und gemacht habe, und setze das jetzt wissentlich in Kraft mit diesem Siegel, dass (…) die genannten Armeleuthäuser in meinem Leben durch mich und nach meinem Tod durch meine Vettern und ihre Nachkommen ewig gebaut werden.1
1. Kapitel
AUGSBURG, AUGUST 1523
Die Welt im Fieber zu erleben musste höllisch sein. Eva las im Gesicht ihres Mannes nicht nur Qualen und Erschöpfung, sondern eine in Wellen wiederkehrende Furcht, die auch sie selbst in Angst versetzte. Wenn sie ihm einen kühlenden Lappen auf die Stirn presste, riss er die Augen auf und starrte panisch hinauf an die Decke, als blicke von dort der Leibhaftige aus dem Dunkel auf ihn herab. Sie vergewisserte sich jedes Mal, dass niemand auf den Dachbalken saß, und allein bei dem Gedanken daran lief ihr ein Schauder über den Rücken.
Joss’ rechter Arm war auf die doppelte Dicke angeschwollen und so rot, als wäre er eingefärbt. Sie wagte nicht, ihn zu berühren, weil ihr Mann dann vor Schmerzen schrie und sich so heftig hin und her warf, dass sie seiner nicht mehr Herr wurde. Sie dankte Gott für das spärliche Licht in ihrer Wohnstube, das so manche Ungeheuerlichkeit im Dämmer verbarg. So blieben ihr die schlimmsten Veränderungen an Joss’ Körper erspart.
Wieder stöhnte ihr Mann laut auf und verdrehte die Augen, als wolle er in sein Innerstes schauen. Sie griff nach dem Lappen, den sie in einer Schale bereithielt, und drückte ihm das kühlende Nass gegen die Stirn. Das Pochen an der Tür drang nur schwach an ihr Ohr.
»Endlich«, murmelte sie und blickte über die Schulter.
Der Bader stand auf der Schwelle, von hinten hell beleuchtet wie ein Engel mit dunklen, unheilvollen Konturen. Die tief stehende Abendsonne machte selbst aus dem blassen dürren Mann eine Erscheinung. Seine Hände waren groß wie Schüsseln und wirkten gegenüber seiner ganzen Gestalt so unförmig, als wären sie falsch angenäht worden.
»Ich dachte schon, Ihr kommt nicht mehr, Jörg.« Ihre Stimme sollte vorwurfsvoll klingen und hörte sich doch nur erschöpft an.
»Hat die Salbe geholfen?«, fragte er, trat über die Schwelle und schloss leise die Tür hinter sich. Dann ging er zu dem Kranken hinüber, kniete sich neben Joss nieder und betrachtete dessen Arm.
Eva hatte ihrem Mann schon am Tag zuvor kein Hemd mehr überziehen können, weil der Arm nicht mehr in den Ärmel gepasst hatte.
»Die Entzündung hat die Schulter erreicht. Vorgestern hätte ich den Arm noch abnehmen können. Heute ist es zu spät«, murmelte der Bader.
In seiner Stimme lag kein Bedauern, sie klang kühl und sachlich. Er machte Eva keinen Vorwurf, er stellte nur Tatsachen fest.
Ein Ausdruck des Entsetzens huschte über das verschwitzte Gesicht des Kranken, als hätte er verstanden, was Jörg gesagt und damit gemeint hatte. Joss riss die Augen auf und blickte erst dem Bader, dann Eva ins Gesicht. Sein Ausdruck verzerrte sich zu einer Grimasse der Panik, die in einem heftigen Zucken und einem Krampf gipfelte, der den gesamten Körper befiel. Er bäumte sich auf wie ein bockendes Pferd. Eva warf sich mit ihrem ganzen Gewicht auf ihren Mann, der aus der Bettstatt zu fallen drohte. Joss schrie vor Schmerzen. Der Bader hielt die zappelnden Beine gepackt, weil er sonst um sich getreten hätte.
Erst als Joss sich etwas beruhigt hatte, tunkte Eva erneut ihren Lappen in das Wasser und wischte ihm mit sanften Bewegungen über das rote Gesicht. Der Kranke verfiel wieder in eine Art willenloses Dämmern.
»Ich kann das Fieber nicht senken«, flüsterte Jörg, dem jetzt selbst der Schweiß auf der Stirn stand, betreten. »Ich fürchte, er wird den morgigen Tag nicht überleben.«
Plötzlich stand Els in der Tür, zitternd und mit rot geweinten Augen. Sie hielt den jüngeren Bruder an der Hand. Barthlen klammerte sich an ihren Fingern fest.
»Mutter, was ist mit Vater?«, fragte Els, und in ihrem Blick lag schon mit ihren vierzehn Jahren das Wissen darum, dass sie ihr nicht die Wahrheit sagen würde. Sie hatte offenbar mitgehört.
»Was ist mit Vater?«, plapperte Barthlen der Schwester nach.
Eva fühlte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Es ging nicht nur um Joss und sie, sondern auch um ihre beiden Kinder, die sich jetzt auf sie zubewegten und an sie drängten. Els umklammerte sie, als spüre sie, wie die knochige Hand des Todes an die Pforte des Lebens klopfte.
Warum nur hatte Joss vor vier Tagen den Balken zurechtschlagen müssen? Es hatte nicht geeilt. Der Jude hätte auch warten können. Joss war nicht recht wohl gewesen. Die Axt wollte ihm nicht gehorchen. Und dann war ein Splitter abgesprungen und hatte sich in seinen Unterarm gebohrt. Eine harmlose Verletzung, die kaum der Rede wert gewesen wäre, wenn sie sich nicht am selben Tag entzündet hätte. Zuerst hatte Joss noch abgewunken, aber mitten in der Nacht hatte er sie geweckt und gefragt, ob von dem Theriak des Quacksalbers noch etwas übrig sei, weil die Wunde so poche. Da war es bereits zu spät gewesen. Keine Stunde später hatten die ersten Krämpfe eingesetzt.
»Ihr könnt nichts mehr für ihn tun?«, fragte Eva, ohne den Bader anzusehen. Sie drückte die beiden Kinder an sich.
Er schüttelte den Kopf und presste die Lippen aufeinander. »Ihm können nur noch der Herr und Gebete helfen.« Damit erhob er sich und streckte die Hand aus. »Vier Kreuzer.«
Zuerst musste Eva schlucken, weil er so unverfroren seine Pranke aufhielt, aber dann nickte sie. Man nahm von den Lebenden – die Toten gaben nichts mehr. Sie kramte mit der freien Hand in ihrer Kittelschürze und holte die vereinbarten vier Kreuzer hervor. Das letzte Geld, das Joss verdient hatte. Judengeld. Einen Kreuzer hatte er im Bierausschank ausgegeben. Die restlichen vier hatte er bei ihr abgeliefert.
»Warum bekommt er Geld, wenn Vater noch immer krank ist?«, fragte Els.
So ganz unrecht hatte sie damit nicht. Doch weder Eva noch der Bader wollten darauf eine Antwort geben. Sie ließ die Münzen in seine ausgestreckte Hand fallen.
»Behüte ihn Gott!«, sagte er und nickte ihr zu. »Und Euch auch. Ich schaue morgen wieder vorbei.«
Eva blickte ihm nach, als trüge er alle Hoffnung mit sich und aus ihrem Leben hinaus. Zurück blieb diese düstere Höhle, die sich mit dem Geruch des Todes zu füllen begann.
»Eva!«, flüsterte es hinter ihr.
Sie drehte sich um. »Joss?«
»Ich werde sterben, nicht wahr?«
Sie wusste nicht, was sie erwidern sollte. Wenn sie jetzt »ja« sagte, dann würde er aufgeben. Aber sie wollte nicht, dass er aufgab. Sie wollte, dass er kämpfte, dass sich sein Körper auflehnte, sein Geist gegen diese Entzündung wehrte.
Er suchte mit der Linken nach ihrer Hand und drückte sie ganz sanft. »Warst mir eine gute Frau, Eva. Danke!«, hauchte er mit geschlossenen Augen.
»Du darfst nicht … nicht …«, schluchzte Els. »Geh nicht …«
Eva konnte nicht entscheiden, ob Els mitbekam, was sie sagte, oder ob es nur eine Reaktion in ihrem Halbschlaf war, in dem sie einerseits träumte und andererseits ihre Gespräche belauschte.
Sie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, um nicht einfach loszuheulen. Wenn sie sah, wie stark Joss war angesichts der Schwelle, die er bald zu überschreiten hatte, dann durfte sie sich nicht gehen lassen. Am liebsten hätte sie ihm die Schweißtropfen auf dem Gesicht weggeküsst, aber sie fürchtete, ihn am Arm zu berühren und ihm dadurch Schmerzen zu bereiten.
»Wunder … gibt es … in dieser … dieser Welt … keine!«, hauchte Joss.
Allein dieser Satz ließ die Kraft aus seinem Körper sickern wie Wasser durch ein Sieb.
Aber damit hatte er sie bei ihrer Ehre gepackt. An Wunder zu glauben hieß, an nichts zu glauben. Bevor sie an nichts glaubte, musste sie alles versuchen, was in ihrer irdischen Macht stand. Das war herzlich wenig als Gattin eines Zimmerers und Seemanns. Aber hatte sie alles versucht? Für sich und ihre Kinder?
Sie drückte Joss’ Hand, bis dieser vor Schmerzen das Gesicht verzog. Sie hatte es mit dem Mittel des Quacksalbers versucht, sie hatte gebetet, und dann hatte sie den Bader Jörg gefragt. Mehr war ihr nicht möglich gewesen. Für einen richtigen Arzt hatte sie das Geld nicht – und zugleich Zweifel daran, ob er tatsächlich hätte helfen können. Doktor Spring im Pfaffenviertel oben hinter dem Dom würde allenfalls in seine Bücher schauen und ihr vorschlagen, beim Apotheker ein Kräutermittel zu besorgen, das mehr kostete, als sie im Jahr verdienten. Nein, Doktor Spring konnte ihr auch nicht helfen.
Sie sah auf Joss hinunter, der wieder matt und ohne Bewusstsein auf der Bettstatt lag und schwer atmete. Alles Blut war aus seinem Gesicht gewichen, und er sah so blass aus wie einer der Toten, die der Scharfrichter vom Galgen nahm. Unwillkürlich drückte sie ihre Kinder fest an sich, bis Barthlen vor Schmerz zu wimmern begann und sie wieder nachließ.
Kurz musste Eva schlucken. Hatte sie wirklich alles versucht? Nein. Es gab noch eine Möglichkeit, eine einzige. Ihr Blick huschte hinüber in den Herrgottswinkel und zum Kreuz mit dem hölzernen Gott, dessen ausgebreitete Arme die Welt zu umfangen schienen. Es war eine Möglichkeit, die einem Pakt mit dem Teufel glich. Nur wer verzweifelt war, wagte, auch nur daran zu denken. Und sie war verzweifelt.
Aber wenn es zu spät wäre, wenn Joss in der Zeit, in der sie ihre Seele verkaufte, die Seite wechselte und ihr zusähe, wie sie den Weg des Glaubens und der Liebe verließ?
»Joss. Ich muss weg«, flüsterte sie, damit Barthlen sie nicht hören konnte. »Bitte, bitte, stirb mir nicht. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht … vielleicht weiß er ja noch einen Rat.« Sie wagte nicht, den Namen auszusprechen. Schon um die Schuld, die sich in ihr aufbäumte wie eine Welle, nicht übermächtig werden zu lassen.
Doch zuerst musste sie die Kinder ins Bett bringen. Sie hoffte, dass der Kleine trotz der Helligkeit einschlafen konnte. Sie trug Barthlen zu seiner Bettstatt, obwohl er ihr mit seinen neun Jahren bereits zu schwer war. Els stolperte ihr hinterher. Sie legte sich neben ihren Bruder und schlang ihren Arm um ihn. Barthlen schloss sofort die Augen.
Eva flüsterte Els ins Ohr, dass sie wiederkäme, bald wiederkäme, küsste beide Kinder auf ihre blonden Schöpfe und deckte sie zu.
»Du musst dich um Barthlen kümmern, Els. Er muss im Bett bleiben, solange ich weg bin.«
Dann raffte sie ihren Rock, schlüpfte in die Holzschuhe und eilte aus dem Haus. Viel Zeit blieb ihr nicht, das wusste sie. Also würde sie auch nicht zögern, das zu tun, was nötig war.
Sie rannte, so schnell es ihre Holzpantoffeln zuließen. Das Klappern, das von den Wänden der Gassen widerhallte, drängte sie vorwärts und schien ihr noch immer nicht rasch genug. Sie trieb sich selbst an wie einen Gaul, der zu müde war, und hätte sie eine Peitsche in der Hand gehabt, sie hätte nicht gezögert, sie sich über den Rücken pfeifen zu lassen.
Die Ziegel des Klinkertors leuchteten im letzten Licht rot zwischen den Gassen hervor wie eine Landmarke.
Dann bog sie nach Süden zum Kloster Heilig-Kreuz ab. Völlig außer Atem und mit weichen Knien langte sie vor dem Kirchhof unter dem steil in den Himmel ragenden Turm an. Sie blickte nach oben. Für einen kurzen Augenblick verschwamm ihr die Welt und löste sich in Flecken auf, bis sie sich wieder gefangen hatte und Luft bekam. Es gruselte sie vor dem Kirchhof, dessen Kreuze sie im schwindenden Licht durch das Gitter sehen konnte.
Langsamen Schritts suchte sie den Eingang und fand ihn unverschlossen, was sie verwunderte. Dahinter führte ein Pfad an der Kirchenmauer entlang zu einem Haus. Die Tür stand einen Spalt offen und zeugte wohl davon, dass der Bewohner anwesend war. Bevor sie eintrat, sandte sie ein kurzes Stoßgebet gen Himmel und spähte umher. Wenn sie diese Schwelle übertrat, gab sie sich in die Hand des Gottseibeiuns. Unwiderruflich. Endgültig … Sofern sie jemand beobachtete.
Noch einmal sah sie sich um, aber die Fenster der umliegenden Häuser waren geschlossen, die Mönche lagen schon in den Betten, die Bürger der Stadt waren nicht mehr unterwegs. Kurz entschlossen schlüpfte sie durch die Tür in einen kleinen Vorraum. Links führte eine Treppe nach oben.
Noch konnte sie umkehren, ihren Besuch dadurch rechtfertigen, dass sie nur eine Kleinigkeit für Frauenangelegenheiten kaufen wollte. Einen Trank für die Monatsblutung, eine Salbe gegen das Reißen, ein Amulett aus Haaren gegen den bösen Blick und Verwünschungen. Man würde ihr glauben, sie einige Tage schneiden und dann vergessen, weil alle ihn besuchten und solche Dinge von ihm kauften.
Sie atmete kurz durch, presste die Lippen aufeinander und stieg langsam die Treppe hinauf. Die hölzernen Stufen knarrten unter ihrem Gewicht und kündigten sie an, doch niemand rührte sich.
Sie hörte nur ein unbestimmtes Stöhnen – und dann sah sie, dass oben über der letzten Treppenstufe ein Paar Beine hervorragten, die in roten Stiefeln steckten. Der Mann, zu dem sie gehörten, keuchte und roch, als wäre eben der Herr der Unterwelt durch das Haus gegangen.
2. Kapitel
AUGSBURG, AUGUST 1523
Am liebsten hätte sie kehrtgemacht und wäre die Treppe wieder hinabgestolpert. Aber der Gedanke an Joss hielt sie zurück. Eva erklomm die letzten Stufen, stieg über die Beine und betrachtete den Mann. Letzte Strahlen einer tief stehenden Sonne fielen durch ein Seitenfenster im Westen ins Zimmer und erhellten den Raum notdürftig.
Was sie sah, war weniger beängstigend, als sie erwartet hatte. Er war wohl betrunken gestolpert und der Länge nach hingeschlagen. Dabei war der Krug über die Dielenbohlen gerollt und hatte den Schnaps darüber verteilt. Außerdem hatte sich der Mann erbrochen.
Eva konnte es sich jedoch nicht leisten, zimperlich zu sein, wenn sie Joss retten wollte. Also stieß sie den Betrunkenen mit dem Fuß an.
»Meister Hans, wacht auf! Es ist wichtig. Ich brauche Eure Hilfe.«
Der Angesprochene stöhnte wieder, doch als sie ihre Tritte verstärkte, schien er hochzudämmern. Er tastete mit einer Hand nach dem Krug, den Eva mit einem zusätzlichen Tritt in die Ecke beförderte. Langsam versuchte er, sich aufzustützen. Er griff sich an die Seite, als habe er Schmerzen, verzog das Gesicht und drehte sich auf den Rücken. So blieb er liegen, bis Eva ihn mit einem weiteren Fußtritt wieder in die Welt der Lebenden holte. Er öffnete ein Auge und blickte mit rot unterlaufenem Augenweiß zu ihr hoch.
»Wer … seid Ihr?«, keuchte er.
»Eva, des Zimmerers Frau – und wenn Ihr mir nicht helfen könnt, dann bald seine Witwe.«
Meister Hans lachte. »Ich … helfe nur den Lebenden hinüber ins Reich der Toten.«
Er sagte das in einem Ton, der sie schaudern ließ. Sie musste schlucken.
»Joss, ich meine, mein Mann, fiebert. Er hat eine Entzündung im Arm. Helft mir. Bitte.«
Wieder sackte Meister Hans in sich zusammen, dann griff er sich an die Seite, verzog das Gesicht und riss die Augen auf. »Ich brauche Hilfe, nicht Ihr.«
»Ich werde alles tun, was Ihr verlangt«, flüsterte Eva und glaubte selbst kaum, was sie sagte.
Der Mann, der da unter ihr in seinem Dreck lag, lachte verhalten. »Vor zwanzig Jahren hätte ich Euer Angebot sofort angenommen, Mädchen. Aber ich bin zu betrunken und zu alt … ahhh!« Er stöhnte laut auf. Seine Hände fuhren an die Seite. Offenbar hatte er stärkere Schmerzen, als er zugeben wollte.
»Helft meinem Mann, egal, um welchen Preis«, flehte Eva und schluckte. Sie machte sich damit zum Freiwild, bot sich an wie eine Dirne auf der Straße.
»Der Scharfrichter macht nichts umsonst, aber ich brauche Euren Körper nicht, Kind«, keuchte Meister Hans, als er sich aufrichtete. Er wischte sich das Gesicht ab und verschmierte sich dabei nur mehr.
Eva sah sich um, entdeckte in der Ecke einen Trog mit Wasser, griff ihn sich und schleppte ihn herbei. Sie benetzte den Saum ihres Rockes und begann, den Mann zu säubern. Sie erwartete, dass er die Gelegenheit nutzen und ihr unter den Rock greifen würde, doch nichts dergleichen geschah.
Bei jeder Berührung mit dem Wasser und dessen Kälte schien Meister Hans nüchterner zu werden. Sein Blick wurde klarer, obwohl seine Augen noch immer feuerrot glänzten. »Was fehlt Eurem Joss?«, fragte er endlich.
Eva erhob sich und schaute auf den Scharfrichter der Stadt Augsburg hinunter.
»Er hat einen entzündeten Arm und ringt mit dem Tod.«
»Und da kommt Ihr zu mir? Dem Roten Freimann?«
»Bei allen anderen war ich bereits. Niemand konnte helfen.«
»Was, wenn es auch mir nicht gelingt, Euren Mann zu retten?«
Eva schluckte. Mit dem Gedanken trug sie sich seit Tagen. Sie würde entweder einen anderen heiraten müssen oder mit den Kindern auf der Straße landen.
»Wenn man mich mit Euch sieht, seid Ihr wie eine Aussätzige in der Stadt. Das ist Euch bewusst?«
Eva nickte nur. Ein Wort brachte sie nicht heraus.
»Ich will es versuchen«, keuchte der Scharfrichter, griff sich wieder in die Seite und krümmte sich.
»Was müsst Ihr mitnehmen?«, fragte Eva. »Viel Zeit bleibt uns nicht mehr.«
Meister Hans zog sich am Geländer hoch und versuchte zu stehen, was ihm leidlich gelang. »Mir auch nicht«, sagte er. »Die Ledertasche dort hinten«, befahl er und deutete in die Ecke, aus der sie den Eimer geholt hatte. Dort stand auf einem Schemel eine Tasche, die so groß war, dass Eva bequem selbst hineingepasst hätte. Sie konnte sie kaum anheben.
Meister Hans schulterte sie mit einem Schwung, als wäre sie aus Stoff und leer.
»Ich gehe voraus«, sagte Eva und wollte schon die Treppe hinuntereilen, als er sie an der Hand festhielt. Eva zuckte zusammen. Sie musste also doch noch bezahlen. Sie würde es über sich ergehen lassen. Für ihren Mann. Für seine Rettung.
»Ich sagte eben, der Scharfrichter macht nichts umsonst. Erinnert Ihr Euch?«
Eva nickte schwach und schloss die Augen. Sie überlegte, wie viele Vaterunser sie wohl beten musste, bis er fertig war.
»Ich stehe an der Schwelle des Todes, Frau. Mein Weib ist längst verstorben, mein Sohn lebt in Nördlingen. Wenn ich sterbe, werden sie meinen wertlosen Körper auf den Schindanger werfen, zu den faulenden Innereien der Gäule und Rinder. Versprecht mir, dass Ihr mich in der Nähe des Friedhofs beerdigt und mir ein sauberes Grab verschafft. Versprecht es. Dann will ich Euren Mann zu retten versuchen.«
Eva war starr vor Schreck. Was er von ihr verlangte, war mehr als nur ein kurzer Beischlaf, über das Geländer des Aufgangs gebeugt. Was er verlangte, war das Ende ihrer Zukunft, falls irgendjemand dahinterkäme.
Er sah ihr Entsetzen, und dann sagte er etwas, das sie zutiefst beschämte. »Ihr seid auch nicht anders als alle anderen. Ihr fordert Hilfe ein, wollt aber keine Hilfe geben. Christin seid Ihr durch und durch!«
Er schob sie beiseite und ging an ihr vorbei die Treppe hinunter. Von der eben noch erkennbaren Unsicherheit des Schritts war nichts mehr zu sehen. Eva zögerte, ihm zu folgen.
»Ihr müsst mir schon zeigen, wo es hingeht. Riechen kann ich es nicht«, rief Meister Hans von unten hoch.
Eva traten die Tränen in die Augen. Er wollte Joss helfen, obwohl sie ihm noch nichts zugesagt hatte. Sie wäre beinahe die Treppe hinabgestolpert, als sie durch ihren Tränenschleier hindurch die erste Stufe suchte. Kurz musste sie innehalten, dann klapperten ihre Holzschuhe hinter dem Scharfrichter her.
Er wartete unten auf sie. Seine Miene war versteinert.
Eva sah ihn an. »Ich verspreche es«, flüsterte sie.
»Was?«
Eva schluckte ihren Stolz hinunter. »Ich verspreche, dass Ihr ein würdiges Begräbnis bekommt, wenn Ihr meinen Mann rettet.«
Meister Hans sah sie an, als wäre sie ihm anverlobt worden. Der eiskalte Blick verschwand von einem Augenblick auf den anderen. Doch sogleich verzog er zweifelnd den Mund. Die Offenheit in seinen Augen machte wieder der Härte Platz, die sie eben schon gesehen hatte.
»Verflucht sollt Ihr und Eure Familie sein bis in die dritte Generation und an Eurem Leben scheitern, wenn Ihr Euer Versprechen brecht!«, stieß er hervor und machte eine Handbewegung, die Eva wie ein magisches Zeichen erschien.
Unwillkürlich zuckte sie zusammen. Natürlich hatte sie insgeheim darüber nachgedacht, ob sie womöglich um diese Aufgabe herumkommen würde. Schließlich konnte ihr ein Toter nichts mehr anhaben. Und niemand wusste von ihrem Eid.
»Ich … ich schwöre es … ich werde Euch … begraben. Ihr bekommt … ein christliches Begräbnis.«
Meister Hans musterte sie stumm, und ein spöttisches Lächeln kräuselte seine Lippen. »Gut, dann kommt. Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte er nur.
Mit einer Kopfbewegung schickte er sie nach draußen. Sie schlüpfte aus der Tür und eilte über den Kirchhof auf die Straße. Mittlerweile hatte sich der Tag verabschiedet und war einer aufkeimenden Dunkelheit gewichen. Sie lief den Weg entlang, den sie gekommen war. Hinter sich hörte sie immer wieder das Stöhnen des Scharfrichters, der ihr in einem gewissen Abstand folgte, und hatte das Gefühl, der Gottseibeiuns wäre ihr auf den Fersen. Sie liefen in die Nacht hinein – und Eva hoffte, niemandem zu begegnen.
*
Drei Tage hatte Meister Hans neben Joss verbracht, hatte ihn gewaschen, ihm einen Trank nach dem anderen verabreicht, hatte die Wunde aufgeschnitten und gesäubert, den Arm mit einer Paste aus Blättern und Fett eingerieben, ihm bittere Blätter zu kauen gegeben, und schließlich war die Entzündung zurückgegangen. Die Krämpfe hatten nachgelassen, der Atem des Kranken war nicht mehr stoßweise gegangen, sondern hatte sich beruhigt und war flacher und gleichmäßiger geworden. Am Ende des dritten Tages war ihr Mann in einen tiefen Schlaf gefallen. Eva hatte sich eine kurze Pause gegönnt und war zu den Kindern in die Bettstatt gekrochen.
Als sie wachgerüttelt wurde, fuhr sie auf und erschrak zuerst bis ins Mark. Es war stockfinster. Offenbar war es mitten in der Nacht. In der Finsternis ragte eine Gestalt vor ihr auf, die die Dunkelheit noch regelrecht in sich aufzusaugen schien.
»Was?«, flüsterte Eva.
»Erschreckt nicht. Ich bin es!«, hörte sie die schwarze Silhouette sagen. »Euer Mann hat es überstanden. Ich gehe.«
Langsam gelang es Eva, ihre Furcht hinunterzuwürgen.
»Ihr wisst, was Ihr mir schuldig seid?«, fragte der Scharfrichter in einem Tonfall, der keinen Zweifel daran ließ, was geschehen würde, falls sie es verneinte.
»Ich habe Euch mein Wort gegeben, Meister Hans, und ich werde es halten.«
Wortlos drehte er sich um. Obwohl sie nur seinen Schatten wahrnehmen konnte, wusste sie, dass er sich an die Seite fasste und ein Stöhnen unterdrückte. Er keuchte kurz, dann humpelte er zur Tür, drückte diese auf und trat auf die Straße hinaus. »Ich verlasse mich auf Euch!«, sagte er noch, bevor die Tür hinter ihm zufiel.
Eva kehrte zurück ins Bett, drückte ihre Kinder an sich und starrte an die Decke. Sie horchte nach draußen, ob sie den Nachtwächter hören konnte, damit sie wusste, wie spät es war. Aber der ließ sich nicht vernehmen.
Noch immer schlug ihr Herz wie rasend. Doch als sie die gleichmäßigen Atemzüge ihres Mannes hörte, beruhigte sie sich langsam wieder.
Der Scharfrichter hatte ihren Mann gerettet. Sie wollte nicht wissen, wie ihm das gelungen war. Die Tage über hatte sie versucht, die Kinder, soweit es ging, von ihm fernzuhalten, aber die beiden hatten sich mit Meister Hans angefreundet – und das Ungeheuer hatte sich als ein im Grunde liebenswerter Mann entpuppt, der offenbar schwer krank war.
Während der Zeit in ihrem Haus hatte er keinen Schluck Schnaps getrunken. Aber je weniger Alkohol er zu sich nahm, desto stärker schienen seine Schmerzen zu werden, und die Pausen, in denen er mit sich selbst zu tun hatte, waren immer länger geworden.
Eva dämmerte nicht lange im Halbschlaf vor sich hin, immer wieder geweckt von den Bewegungen der beiden Kinder und dem gelegentlichen Stöhnen ihres Mannes, das jedoch keine Qualen mehr bedeutete, sondern mit der unbequemen Lage auf der Küchenpritsche zu tun hatte. Auf diese hatte der Scharfrichter ihn gelegt, damit er besser an den entzündeten Arm herankam.
Als das erste Licht sich durch die Spalten der Holzläden stahl, stand sie auf, völlig gerädert von dieser Nacht und den Nächten zuvor. Sie ging zu Joss hinüber und legte ihm die Hand auf die Stirn. Sie war kühl. Das Fieber war gegangen.
In diesem Augenblick klopfte es an der Tür. Eva zuckte zusammen, da sie niemanden erwartete.
»Seid Ihr das?«, fragte Eva, der das Herz bis in den Hals schlug. Warum war Meister Hans zurückgekommen? Um diese Zeit, wo jeder ihn sehen konnte, wenn er ihr Haus betrat?
»Ich bin es, der Bader Jörg. Ich wollte mich um Euren Mann …«
Der Morgenspeichel schmeckte bitter. Eva trat an die Tür und öffnete sie einen Spalt weit, vertrat dem Bader aber den Weg. Mit einem spöttischen Zug auf den Lippen sah er ihr suchend über die Schulter.
»Joss hat es überstanden«, sagte sie. »Es ist ein Wunder.«
»Dann hat meine Salbe …«, setzte der Bader erfreut an.
»Nein!«, unterbrach Eva ihn. »Ich habe jemanden … die Hebamme, die Babette, geholt … sie hat ihm geholfen.«
»Oh«, erwiderte der Bader. »Die blinde Hutter Babette also. Na dann. Ich dachte schon …«
»Was dachtet Ihr?«, fragte Eva vorsichtig.
»Ich dachte, sie wäre weggezogen, an den Kappenzipfel. Von da habt Ihr sie wohl hergeholt.«
Verunsichert wandte Eva den Kopf ab und nickte. Der Bader hob ungläubig die Augenbrauen und schlug eine weitere Kerbe in ihr Selbstbewusstsein. »Vor zwei Tagen war ich schon mal hier. Die Tür war verschlossen, aber ich habe gemeint … einen Mann … reden zu hören … womöglich …«
Eva erschrak, doch die Tür zu verrammeln war wohl ihre beste Idee gewesen.
»Joss hat im Fieber fantasiert. Das werdet Ihr gehört haben. Und die Tür mussten wir verriegeln, weil er zweimal aufgestanden ist und hinauswollte. Es war besser so.«
»Das war es vermutlich«, bemerkte Jörg und versuchte wieder, in den Raum zu spähen.
»Ich danke Euch für Eure Bemühungen, aber ich hätte ohnehin kein Geld mehr gehabt, um Euch zu bezahlen. Gehabt Euch wohl«, sagte Eva und hoffte, der Bader, der unschlüssig vor der Tür stand, würde sich endlich verabschieden. Seine dunkle Silhouette machte ihr Angst. Langsam wandte er sich um und ging davon.
Als sie die Tür schloss, atmete sie tief durch. Das war knapp gewesen. Wenige Glockenschläge früher und er wäre mit Meister Hans zusammengestoßen.
Warum hatte sie auch von der Hutter Babette reden müssen? Und wohin war diese mit ihrem Mann gezogen? An den Kappenzipfel, hatte der Bader Jörg gesagt. Natürlich, in die neue Fuggersiedlung. Niemand hatte ihr davon erzählt. Allerdings war sie in den letzten beiden Wochen auch kaum am Brunnen gewesen, wo solche Nachrichten ausgetauscht wurden.
Eva hockte sich vor den Herd, weil ihr die Knie weich wurden, und stocherte in der Asche, um noch etwas Glut zu finden. Sie entzündete das Feuer, um eine kleine Mahlzeit zuzubereiten und danach die verschwitzten Laken und Wäschestücke auszukochen. Sie hantierte mit der Pfanne, röstete etwas Grieben an, kochte in einem Topf Hirse auf. Rasch breitete sich ein köstlicher Duft im Raum aus, der die Kinder weckte. Das erwachende Leben vertrieb ihre Gedanken an Meister Hans und den Bader Jörg.
Barthlen kroch als Erster aus dem Bett, tapste vor die Tür und erleichterte sich auf der Gasse vor dem Haus. Els folgte ihm kurz darauf, ging allerdings hinter das Haus, wie es sich für ein Mädchen gehörte.
»Vater ist wach«, rief er aufgeregt, als sie zurückkam. Die Kinder stürmten auf Joss zu, der versuchte, sie einerseits in die Arme zu schließen, andererseits abzuwehren.
»Els, Barthlen, weg von eurem Vater. Ihr tut ihm weh!«, herrschte Eva die beiden an. Dann trat sie zu Joss an die Küchenpritsche und setzte sich auf den Rand. Sie suchte seine gesunde Hand.
»Wie geht es dir?«, fragte sie und konnte nicht verhindern, dass ihr Tränen in die Augen traten.
Sie hatte alles richtig gemacht. Alles.
Joss’ Stimme klang matt. »Wie lange …?«, fragte er leise.
»Beinahe eine Woche«, antwortete Eva. Sie konnte ihren Mann durch den Tränenschleier hindurch nicht richtig erkennen.
»Was?«, flüsterte er ungläubig. »Das erklärt den Hunger!«
Eva musste lachen, und in das Lachen mischte sich ein Schluchzen, das sie nicht unterdrücken konnte.
»Mutter«, fragte Els, die sich an sie drückte und unbeholfen versuchte, sie in den Arm zu nehmen. »Bist du traurig, dass Vater wieder gesund ist?«
»Nein. Das sind Tränen der Freude.«
»Aber wenn man sich freut, weint man doch nicht«, erklärte Barthlen, der sich an seine Schwester drückte.
Eva gab keine Antwort. Sie stand auf, weil die Grieben in der Pfanne bereits etwas streng rochen. Außerdem musste der Brei umgerührt werden, damit er nicht anbrannte. Sie beugte sich über Topf und Pfanne und wischte sich über die Augen.
Sie hatte alles richtig gemacht.
Eva drehte sich zu den Kindern um und befahl ihnen noch einmal, ihren Vater in Ruhe zu lassen. Er brauche noch Schonung. Und sie bräuchten wohl etwas Warmes zum Frühstücken.
Barthlen und Els gehorchten. Sie holten sich ihre Holzlöffel und setzten sich an den Tisch. Eva gab die etwas dunkel geratenen Grieben in den Brei, rührte ihn um und nahm aus dem Bord an der Wand einen hölzernen Teller, auf den sie etwas von dem Brei gab. Den Topf stellte sie auf den Tisch. Die Kinder fielen darüber her, als hätten sie seit Wochen nicht Warmes mehr zu essen bekommen.
Sie setzte sich mit dem Teller neben Joss und fing an, ihren Mann zu füttern, weil sie ahnte, dass er nicht kräftig genug war, um den Löffel selbst zu halten.
In ihrem Kopf tanzten Freude und Sorge miteinander einen Schäfflertanz und schlangen ihrer beider Lebensbänder umeinander.
Sie hatte alles richtig gemacht – dennoch wusste sie, dass sie für dieses Glück würde bezahlen müssen. In dieser Welt gab es nichts umsonst.
3. Kapitel
AUGSBURG, SEPTEMBER 1523
Marx starrte hinaus in den Tag vor der Mauer. Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, warum er diesen Anblick irgendwann einmal für den schönsten der Welt gehalten hatte. Oder zumindest für den zweitschönsten, wenn er den seiner Frau einmal dazurechnete. Damals. Aber sein Weib hatte die Schönheit mindestens ebenso rasch verloren wie der Blick von der Mauer seinen Reiz, und beides war einer Gleichgültigkeit und Langeweile gewichen, die sich nur mit Bier ertragen ließ.
Marx horchte unter seinem Metallhelm auf das Schlagen der Uhr. Zwölf. Es schlug zwölf. Wo um alles in der Welt blieb Marie?
Er spähte nach links und rechts den Wehrgang entlang, aber weder ließ sich ihr Schritt auf den hölzernen Bohlen hören noch ihr Rock sehen. Sie sollte ihm Bier und Essen bringen, pünktlich mit dem Glockenschlag, seit fünfzehn Jahren. Und seit fünfzehn Jahren verspätete sie sich. Immer.
Marx seufzte. Wenn sie nicht andere Qualitäten gehabt hätte, über die er in den Minuten, die er auf sie warten musste, vergnügt nachdenken konnte, wäre er verärgert gewesen. So fügte er sich in die Dinge, dachte an ihre warmen Schenkel und wünschte sich Bier und Brotzeit herbei.
Eine Bewegung forderte seine Aufmerksamkeit. Unten vor dem Graben huschte etwas geduckt durch das Gras. Es hätte längst wieder gemäht werden müssen, damit sich dort kein Gesindel herumtreiben konnte. Die derzeitige Höhe war unverantwortlich. Allerdings konnte er sich auch geirrt haben. Der Wind, der durch die hohen Gräser strich, gaukelte Bewegungen vor, die nicht existierten. Dennoch war er sich fast sicher, dass sich jemand in dem bereits herbstlich dürren Bewuchs verbarg.
Und jetzt verfluchte er die Unpünktlichkeit seiner Frau doch. Wäre sie zeitig hier gewesen, dann hätte er die Bewegung übersehen und wäre nicht gezwungen gewesen, sich genauer damit zu beschäftigen. So aber trat er näher an die Scharte heran und spähte hinaus, blieb jedoch weit genug zurück, um zu verhindern, dass man ihn von unten sehen konnte.
Im Grunde war es eine langweilige Aufgabe auf den Mauern. Die Zeiten, in denen Raubritter wie der gefürchtete Kunz von Villenbach oder Onsorg von Wellenburg das Umland unsicher gemacht und die Stadt bedroht hatten, waren längst vorbei. Sie mussten nicht mehr nach den Fahnen des Raubgesindels Ausschau halten und die Glocke schlagen lassen, was nicht hieß, dass er deswegen weniger Hunger hatte. Sein Magen knurrte vernehmlich. Das Weibsstück würde etwas zu hören bekommen, wenn es endlich erschien. Ihm hing der Magen in der Kniekehle, und sie schwatzte vermutlich mit Else, ihrer Nachbarin, über Schwangerschaften, Geburten und andere völlig belanglose Dinge und ließ ihn hier oben im Dienst der Stadt verhungern. Er würde ihr zeigen müssen, was es hieß, den Stadtwächter Marx warten zu lassen.
Er stieß den Schaft seines Spießes in die Bohlen, dass es krachte.
Dennoch ließ er das Gras vor dem Graben nicht aus den Augen. Tatsächlich bewegte sich wieder etwas und huschte durch die Binsen, jetzt rechts von ihm. Er war sich diesmal sicher, dass es kein Wind war, denn der bewegte die Grasspitzen gleichmäßig, während die Gestalt unter ihm die Gräser wie Wasser um ein Boot nach links und rechts teilte.
Wieder läutete die Glocke und zeigte die halbe Stunde an. Er getraute sich nicht, eine neue Runde zu beginnen, denn wenn er sich von der Stelle wegbewegte, würde seine Frau sicherlich auftauchen, ihn nicht sehen und das Bier und sein Essen wieder mitnehmen. Wenn er etwas mehr hasste als Unpünktlichkeit, dann war es abgestandenes Bier.
Außerdem durfte er diese merkwürdigen Wellen im hohen Gras nicht aus dem Blick lassen. Jetzt bewegten sich die Halme links von ihm, und er musste das Holzauge in der Scharte etwas drehen. Kurz überlegte er, wie hoch das Kraut dort unten stand, und kam auf gut drei Fuß. Ihm würde es bis zum Bauchnabel reichen.
Seine Aufgabe war es, die Stadt vor Unheil zu bewahren, das durfte er keinem noch so starken Hunger unterordnen. Wenn jetzt seine Frau käme, dann würde er den Blick nicht von der Graslandschaft zu seinen Füßen wenden und sie mit hartem Herzen zurückschicken. Vielleicht würde er ihr sogar nachrufen, dass das alles nicht hätte sein müssen, wäre sie pünktlich gewesen.
Er streckte den Kopf etwas weiter aus der Scharte, um genauer sehen zu können. Irgendjemand war dort unten und hielt ihn zum Narren, er konnte es fühlen. Plötzlich schlug etwas gegen das Holzauge. Splitter stoben durch das Loch und trafen seine Nase und das rechte Augenlid. Marx zuckte zurück und schlug mit dem Helm gegen die steinerne Umfassung.
»Verflucht!«, schimpfte er. »Ich bin beschossen worden.«
Rasch drehte er das Holzauge blind und lief eine Scharte weiter. Ihm war, als würde er einen Jubelschrei vernehmen.
Sofort spähte er durch die Klappe in der Scharte. Sie war breiter, und man konnte größere Musketen oder kleine Feldschlangen hindurchschieben. Kaum hatte er die Fallklappe gehoben und seinen Kopf in Position gebracht, hörte er auch schon ein Klingeln und spürte einen Schlag. Sein Helm war getroffen worden.
Er wurde tatsächlich angegriffen. Die Stadt wurde angegriffen. Was kam als Nächstes? Pfeile, Kanonenkugeln? Feuerbrände? Marx wandte sich hinunter zur Straße, wo die Wachstube lag.
»Wir werden angegriffen«, brüllte er. »Alle Mann auf den Wehrgang!«
Er sah, wie sich in der Wachstube etwas rührte. Dann geschah eine ganze Zeit lang nichts. Schließlich trat Bernd aus der Stube, kratzte sich am Hintern, gähnte und schaute zu ihm hoch. Der ältere Hauptmann der Wache hatte offenbar geschlafen.
»Was faselst du da? Wer greift uns an?«
»Weiß ich noch nicht. Aber wenn ich den Kopf durch die Schießscharten stecke, werde ich beschossen!«
Zuerst war es still unter ihm, und Marx hoffte, dass sich die Mannschaft unten endlich in Bewegung setzen würde.
Aber dann kam die nächste Frage.
»Womit wird denn geschossen? Ich höre es nicht knallen.«
Marx wusste es selbst nicht, aber wenn er jetzt sagte, er habe keine Ahnung, dann würde sich der alte Bernd wieder in die windschiefe Kate zurückziehen und seinen Mittagsschlaf fortsetzen.
»Bolzen!«, log er, weil das Geräusch, das an seinem Helm geklingelt hatte, diesen Schluss durchaus zuließ.
»Na dann. Sag ihnen, sie sollen die Tore schließen. Mehr ist nicht nötig. Bolzen. Lächerlich. Weck mich, wenn’s ernst wird.«
Marx fluchte. Nichts hatte er in der Hand, nichts, was diesen sturmerprobten Haudegen hätte aus der Ruhe bringen können. Und er selbst wusste nur zu gut, dass ihn ein größerer Fehlalarm unweigerlich von der Mauer verbannen konnte. Er verspürte keine Lust, irgendwann die Latrinenlöcher der Stadt zu leeren. Allerdings hätte er fragen sollen, was den Alten geweckt hatte, dass er so schnell auf den Beinen gewesen war. Aber so ging es ihm immer. Man nahm ihn nicht ernst. Er hieb vor Wut den Schaft seiner Pike in die Holzdielen.
Und jetzt tauchte auch noch seine Frau auf. Sie war den Zugang vom Schwibbogentor hochgeklettert und kam mit Bier und Essen auf ihn zu.
Marx verdrehte die Augen. Er konnte nicht glauben, dass sie gerade jetzt erschien.
»Ich hab keine Zeit!«, herrschte er sie an.
Verblüfft hielt Marie inne und sah sich um. »Aber … du tust doch nichts. Warum solltest du keine Zeit zum Essen haben?«
Marx verdrehte die Augen. »Die Stadt wird angegriffen! Weg von der Schießscharte!«
Doch es war zu spät. Marie trat an das Holzauge heran, drehte es so, dass sie hindurchblicken konnte, und spähte nach draußen. Man hörte etwas undeutlich gegen die Mauer schlagen – und dann herunterfallen und im Graben verschwinden.
»Siehst du?«, rief er, als Marie erschrocken zurückfuhr und sich beinahe die Haube vom Kopf riss, weil sie an der Überdachung der Scharte hängen blieb.
»Verfluchtes Pack!«, schimpfte sie.
Jetzt war ihr Mann neugierig geworden. »Hast du gesehen, wer es war?«, fragte er und trat hastig näher. Mit einer Hand langte er zum Brot und stopfte sich eine mit Butter bestrichene Scheibe in den Mund.
»Natürlich«, sagte sie und setzte gleich hinzu. »Iss langsam. Sonst bekommst du nur wieder Magendrücken. Kau gründlich!«
Er hasste diese Bemutterung. »Raus mit der Sprache, oder muss ich dich erst einer peinlichen Befragung unterziehen?«
Marie gluckste, dann begann sie zu lachen. »Für dich ist das hier alles wirklich ernst«, sagte sie und versuchte, den Korb so abzustellen, dass der Krug darin nicht umfiel.
»Das ist kein Spaß, weil der Krieg niemals ein Spaß ist!«, bellte er sie an. »Und jetzt verschwinde von hier oben.«
Er war nahe an sie herangetreten und packte sie an der Schulter. Er drehte sie um und gab ihr einen Stoß in Richtung Treppe. Kaum stolperte Marie von ihm weg, hörte er ein dumpfes Pochen, als hätte jemand wieder gegen die Holzverschalung der Schießscharte geklopft.
Tatsächlich war wohl das Innere des Auges getroffen worden. Ein Stein kullerte daraus hervor und ihm direkt vor die Füße. Er drehte sich noch ein paarmal um seine Achse. Marx starrte verblüfft auf den Kiesel. Ein simpler Lechkiesel, wie es sie zu Abertausenden im Flussbett gab.
Wer um alles in der Welt beschoss eine Stadt mit Kieseln?
Ein ungeheurer Verdacht stieg in ihm auf.
4. Kapitel
AUGSBURG, SEPTEMBER 1523
Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, sprang von Ohr zu Ohr, durchquerte die Gassen, zwängte sich durch Türspalten, schlüpfte in offene Fensterlöcher und war vermutlich bereits durch die ganze Stadt gehüpft, bevor der Körper des Scharfrichters den Boden berührt hatte: Meister Hans habe sich den Schädel gespalten und liege tot vor dem Kirchhof bei Heilig-Kreuz. Keine zehn Schritt entfernt von seinem Heim. Betrunken sei er gewesen, sagte die Fama, sei gestolpert und habe sich an einem der Prellsteine des Kirchhofs den Schädel eingeschlagen.
Eva betrat die Werkstatt ihres Mannes, der sich gut erholt hatte. Der Arm war gesundet, die Kraft zurückgekommen, wenn auch noch nicht so wie vor seinem Unfall. Joss arbeitete wieder mit dem Zimmererbeil. Vorsichtig, langsam, aber er arbeitete.
Als sie die Tür öffnete, drehte er sich nach ihr um, und Barthlen kam auf sie zu. Er hatte am anderen Ende des Balkens gesessen und Joss beobachtet. Er erzählte ihr in einem ununterbrochenen Wörterstrom, was sein Vater da tat, wie er schlug, wie er das Beil hielt, wie vorsichtig er werkte, wie das Beil klang, wenn es in das Holz schnitt, bis sich alles in einem unverständlichen Geplapper überschlug und dabei noch wirrer wirkte. Was sie allerdings aus dem Wasserfall an Worten heraushörte, war, wie überglücklich und stolz er darauf war, Joss beim Arbeiten zusehen zu dürfen.
»Was ist los?«, fragte Joss stirnrunzelnd.
Eva wunderte sich immer wieder darüber, wie genau ihr Mann sie beobachtete. Kein Gefühl konnte sie vor ihm und seinen suchenden Augen verbergen.
»Der Scharfrichter ist tot«, antwortete sie.
Joss ließ das Beil sinken. Dann hob er es entschlossen noch einmal hoch, und mit einer knappen Bewegung fuhr es in den Stamm.
»Was geht es uns an?«, fragte er leise. »Der Abdecker wird sich darum kümmern. Das weißt du.«
Eva nickte. Sie nahm Barthlen und schob ihn aus der Werkstatt hinaus. »Such Els. Sag ihr, ich brauche sie.«
Dann trat sie einen Schritt vor und senkte den Blick. Ihre Hände spielten mit dem Band, das sie sich um die Taille geschlungen hatte.
»Da ist doch noch was«, sagte Joss.
Er ging auf sie zu und nahm sie in den Arm. Er drückte sie – und an diesem Druck konnte sie bemerken, wie lange er noch brauchen würde, um den Arm wieder so bewegen zu können wie zuvor. Aber selbst das war nicht sicher.
Sie nickte, ohne ihn anzusehen.
»Was könnten wir mit dem Scharfrichter zu tun haben?«, fragte er vorsichtig und schob sie etwas von sich weg, ohne sie loszulassen. Er musterte ihr Gesicht genau.
»Ich … wir … du …«, stotterte sie.
Joss lachte. »Es hat dir die Sprache verschlagen, Eva? Du wirst doch keinen Apfel vom Baum der …«
Sie schlug nach ihm, so plötzlich und heftig, dass er zurückwich. Sie traf seinen kranken Arm, und Joss verzog vor Schmerz kurz das Gesicht.
»Willst du mich bestrafen?«, fragte er und hielt sich den Arm gegen den Körper gedrückt.
Sie brach in ein hemmungsloses Schluchzen aus, drehte sich von ihm weg, verbarg das Gesicht in den Händen und ließ sich von ihm wieder in die Arme nehmen.
»Jetzt sag schon«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Eva schüttelte den Kopf, konnte sich nicht beruhigen, aber ihr Gewissen brodelte, bis die Wahrheit an die Oberfläche schäumte und aus ihr herausbrach.
»Der Scharfrichter hat dir das Leben gerettet, Joss, nicht der Bader. Der hatte keine Ahnung, wie er dir helfen sollte. Er hatte dich aufgegeben. Aber Meister Hans wusste Hilfe. Er hat drei Tage an deinem Krankenlager gesessen und dich mit einer Salbe und …«
»Meister Hans?«, keuchte ihr Mann.
»… und mit Kräutern eingerieben, den Eiter mit einem Schnitt abgelassen, dir immer wieder den Arm verbunden und ihn so gerettet.«
»Das ist schwere Kost, Frau. Hoffentlich hat ihn niemand gesehen.« Sein Griff, mit dem er sie von hinten umfasst hielt, lockerte sich.
Plötzlich zuckten sie beide zusammen.
»Was ist mit Meister Hans?«, fragte eine hohe Stimme.
Els war durch die Tür getreten.
Eva und Joss sahen sich kurz an.
»Nichts, Kind«, entgegnete Eva. »Geh mit Barthlen in die Küche. Setz den Brei auf. Gib etwas Milch dazu.« Eva lächelte tapfer. »Und erzähl um Himmels willen nicht herum, dass der Scharfrichter bei uns war. Sonst bringst du deinen Vater noch in den Turm. Los jetzt.« Sie scheuchte das Mädchen aus dem Raum.
»Er hat uns verflucht …«, sagte sie leise, als das Mädchen verschwunden war.
»Er hat was?«, entfuhr es dem Zimmerer. »Wie kommt er dazu, uns zu verfluchen? Ich werde mit der Stadtverwaltung …«
»Lass mich ausreden. Ich musste ihm etwas versprechen – und für dieses Versprechen hat er dich gesund gepflegt.«
»Das wird ja immer schöner!«
Mittlerweile hatte Joss sie losgelassen und lief in der Werkstatt auf und ab. Mit der gesunden flachen Hand hieb er auf Holzblöcke, Werkzeugstiele und Balken ein.
»Was hast du ihm versprochen?« Joss’ Ton verschärfte sich. Seine Augen sprühten Funken. »Dass du heimlich zu ihm gehst? Dass du deine Kinder an ihn vergibst? Dass du …«
Plötzlich drehte sich Eva um. Ihr Ausdruck hatte sich völlig gewandelt. Der Wutausbruch ihres Mannes hatte sie aufgebracht. Schließlich hatte sie ihm das Leben gerettet, indem sie den Scharfrichter aufgesucht und um Hilfe gebeten hatte.
»Ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen. Aber jetzt muss ich das wohl. Ich musste Meister Hans versprechen, ihn zu begraben, wenn er stirbt. Und du wirst mir dabei helfen, denn es war dein Leben, das er gerettet hat. Da ist es nur recht und billig, ihm ein Grab auszuheben und ihn anständig zu beerdigen.«
»Aber … aber er war der Scharfrichter!«
»Und es war dein Leben, Mann!«
»Er war ein Unehrlicher!«, versuchte Joss, sich zu verteidigen. »Niemand wird ihn auch nur anrühren. Nur der Abdecker …«
»Auch du wirst mich nicht mehr anrühren, wenn du dich dieser Pflicht entziehst, Joss Neher!«, fuhr Eva ihn an. »Ich habe meine Ehre aufs Spiel gesetzt, um dich zu retten. Jetzt ist es an der Zeit zurückzuzahlen.«
»Und wenn nicht?«
Sie spürte seinen Widerwillen, seinen Widerstand.
»Dann wird uns der Fluch in die Gosse werfen.« Sie bekreuzigte sich, und Joss tat es ihr nach.
Dennoch schien er nicht überzeugt. »Aberglaube«, stieß er hervor. »Er ist tot und schreckt niemanden mehr.«
Eva sagte nichts, sondern stand nur da und sah ihn an.
»Er hat … wirklich … mich … und dich verflucht?«
Eva musterte ihren Mann, den ihr der Scharfrichter zurückgegeben hatte. Alle Verlegenheit war von ihr gewichen. »Ohne ihn wärst du jetzt tot, und ich würde die Zunft anbetteln, mir einen Gesellen ins Haus und ins Bett zu schicken, damit ich nicht meinen Körper verkaufen muss, um zu überleben.«
Joss schluckte bei dieser Vorstellung sichtbar, aber er lenkte nicht ein. »Er geht uns nichts an. Er hätte mir nicht helfen müssen. Vermutlich wäre ich auch ohne ihn genesen. Er hat nur meine Kraft gesehen und es so aussehen lassen, als würde er …«
Eva spuckte auf den Boden. »Du bist ein Feigling, Joss Neher. Meister Hans hat nicht gezögert – und er hätte nicht den Finger krumm machen müssen für dich. Noch nicht mal eine Bezahlung hat er genommen.«
Joss keuchte und stützte sich mit beiden Armen auf seinen Oberschenkeln ab, als hätte sich ein Huckauf auf ihn gesetzt und drücke ihn nieder. Und plötzlich griff er sich an den Arm. Eva sah, wie sich sein Gesicht vor Schmerz verzerrte.
»Was ist?«
Als er sich aufrichtete, war er so bleich, als hätte er einen Toten gesehen.
»Der Arm hat gefeuert. Kurz nur«, flüsterte er. »Als ich daran gedacht habe, ins Wirtshaus zu gehen und Meister Hans Meister Hans sein zu lassen.« Er schluckte wieder lautstark. »Er hat mir gegen den Arm geschlagen, damit ich nicht vergesse, wer ihn versorgt hat.«
Eva legte den Kopf schief. Wer war jetzt abergläubisch?
»Du weißt, was das bedeuten kann?«, fragte Joss und fasste sie am Arm.
Eva war erleichtert, weil sie spürte, dass sie gewonnen hatte. Joss’ Widerstand schwand. Er fügte sich.
»Er wollte dich daran erinnern, dass er noch immer offen daliegt. Eines Christenmenschen unwürdig – denn selbst der Scharfrichter war ein Christ.«
Joss presste die Lippen aufeinander, schließlich nickte er. »Dann sollten wir uns beeilen. Der Abdecker wird …«
»… er wird erst morgen kommen. Es ist so abgemacht. Man lässt ihn über Nacht liegen. Dem Erbarmen preisgegeben. Erst wenn der Leichnam am Morgen nicht verschwunden ist …«
Joss räusperte sich. »Wo willst du ihn begraben?«
Eva setzte sich auf den Balken, den Joss gerade bearbeitet hatte.
»Oben, bei St. Salvator, an der Armenmauer. Da fällt es nicht auf, wenn wir ein zusätzliches Grab ausheben. Der Friedhof wird von mehreren Pfarreien benutzt.« Sie strich ihren Rock glatt. »Lass uns anfangen, dann sind wir fertig, bis es dunkel wird.«
»Er darf nicht in geweihte Erde«, widersprach Joss erneut, auch wenn seine Gegenrede bereits kraftlos wirkte und mehr ein Rückzugsgefecht war als ein offener Angriff. »Du machst ihn sonst zum Wiedergänger.«
Eva sah ihren Mann an. Er hatte plötzlich Schweißperlen auf der Stirn, als würde das Fieber zurückkommen. Aber es war nicht das Fieber. Es war die Furcht.
»Im Süden liegt Buschwerk. Er wusste, dass er uns das nicht zumuten kann. Er wollte nur nicht auf den Schindanger, sondern außerhalb des Friedhofs in der Nähe geweihter Erde bestattet werden.«
»Und die Kinder? Was machen wir mit den Kindern?«
»Ich schicke sie zur Nachbarin. Sie wird ein Auge auf sie haben.«
»Was wirst du ihr als Grund nennen?«
»Ich werde ihr sagen, dass es Zeit wird für Nachwuchs – und wir nicht gestört sein wollen.«
Joss schüttelte den Kopf. »Das wird sie nicht glauben«, sagte er matt.
Offenbar hatte er seinen letzten Widerspruch verbraucht. Er ging hinter ihr her, blieb aber vor der Werkstattwand stehen und griff nach der Hacke, die dort hing. Auch eine Schaufel nahm er, und legte beides in die Handkarre. Zuletzt bedeckte er alles mit drei Säcken, um später die Leiche darunter verbergen zu können.
5. Kapitel
AUGSBURG, SEPTEMBER 1523
Marx hatte sich auf den Sims der Schießscharte gesetzt und starrte hinunter in die Stadt. Man hatte ihn genarrt. Er hatte sich von Jugendlichen an der Nase herumführen lassen. Eine Handvoll Halbwüchsiger hatte sich einen Spaß erlaubt. Sie hatten sich seiner Ängste bedient und ihn zum Gespött der Scharwache gemacht. Die Männer hatten gewiehert, und seine Frau war vor Scham nach Hause gegangen, ohne ihn zu beschimpfen. Das war in fünfzehn Jahren noch nicht vorgekommen. Sogar das schale Bier, das er in der Hand hielt, schien ihn zu verlachen. Es schmeckte, als würde er an vom Regen durchnässten Fußlappen lutschen.
Was hatte er der Welt getan, dass sie ihn auf diese Art behandelte?
Am liebsten hätte er seinen Ekel an der Welt hinausgebrüllt, aber er durfte sich nicht noch mehr zuschulden kommen lassen, sonst würden sie ihn noch aus der Scharwache entfernen. Außerdem hätte er längst nach Hause gehen sollen. Seine Wache war vorbei, die Nachtwache der anderen Scharwächter hatte längst begonnen. Lange hatte er sich nicht überwinden können, bis die Dämmerung sich langsam über die Stadt gelegt hatte. Jetzt erhob er sich schwerfällig und wankte zum Abgang. Er war betrunken, aber nicht betrunken genug, um nach Hause zu gehen und seine Frau ertragen zu wollen. Doch Marie wartete mit dem Nachtmahl und einer Predigt auf ihn, und was er gerade nicht gebrauchen konnte, war ihr Zorn, weil er sich verspätete. Er würde noch einkehren und ein oder zwei Humpen trinken.
Marx hangelte sich an dem Geländer entlang, als ein Geräusch ihn zusammenfahren und innehalten ließ. Es war das Flüstern von Stimmen zusammen mit dem Mahlen einer eisenbereiften Karre, die unter ihm vorbeigeschoben wurde. Sie schien eine regelrechte Melodie zu quietschen – und wenn er besser gelaunt gewesen wäre, dann hätte er diese mitgepfiffen.
Marx zog sich in den Schatten der Wehrmauer zurück. Wer war hier nachts mit einer Handkarre unterwegs? Die Bleicher, die vor dem Bleichertörlein ihre Stoffbahnen ausgerollt hatten, waren längst wieder hinter den Mauern. Das Bad in der Nähe des Nebentors hatte geschlossen. Die Handwerker hatten ihre Hämmer und Schäleisen beiseitegelegt und waren zu ihren Frauen unter die Decke geschlüpft.
Er versuchte, vom Wehrgang hinunter in die Gasse zu spähen, ohne selbst gesehen zu werden, um festzustellen, wer sich hier zu so später Stunde noch herumtrieb. Aber es war zu dunkel, als dass er jemanden zweifelsfrei hätte erkennen können. Nur das Quietschen war deutlich zu vernehmen.
Die Karre bog zum Friedhof hin ab und hielt auf dessen Rückseite zu. Abrupt endete das Quietschgeräusch.
Marx beschloss, seinen Platz nicht zu verlassen und von der Warte aus zu beobachten, was passieren würde. Sollte Marie zu Hause warten! Jetzt war er wieder fast nüchtern. Wer wollte sich um diese Zeit auf einem Friedhof tummeln? Nur Spiritisten und Geisterbeschwörer suchten nächtens diese Orte auf – und vor denen hatte man sich in Acht zu nehmen und sie um der Totenruhe willen vor allem der Obrigkeit zu melden. Auch hatten Leichenräuber in den letzten Jahren auf verschiedenen Friedhöfen mehrere Gräber heimgesucht. Er sollte also ein Auge auf das Treiben dort unten haben. Gleichzeitig wollte er aber nicht schon wieder die Scharwache aufrütteln. Diesmal würde er allein handeln, diese Verbrecher allein stellen. Marie würde stolz auf ihn sein.
Die Gruppe verwendete keine Laterne. Marx konnte nur seinem Gehör vertrauen. Und das sagte ihm, dass hinter der Friedhofsmauer Werkzeug abgeladen und anschließend gegraben wurde. Ihm kamen Zweifel, und zugleich war er erleichtert, dass er nicht sofort Alarm geschlagen hatte. Waren das wirklich Leichenräuber?
Was um alles in der Welt wollten sie dann hinter der Mauer? Wenn sie für ihre dunklen Messen eine Leiche oder für die Leichenschauen der Ärzte Körper ausgraben wollten, machten sie sich an der falschen Stelle zu schaffen.
Er musste näher heran, um herauszufinden, was hier genau geschah. In letzter Zeit gab es alle möglichen Umtriebe in der Stadt, die den Magistrat beunruhigten. Für ein Anschleichen war er allerdings schon zu betrunken. Dennoch war es einen Versuch wert, schon um sein Ansehen wiederherzustellen.
Er beschloss, hinunterzugehen und nachzusehen.
Mittlerweile hatte die Nacht ihr schwarzes Tuch gänzlich über die Stadt gebreitet, und nur die Spreu der Sterne hatte sich über den Himmel verteilt. Man sah die Hand nicht mehr vor Augen. Marx wusste nicht, wie die Unbekannten hinter der Friedhofsmauer ohne Laterne zurechtkamen.
Er tastete sich langsam vorwärts, verfehlte den Handlauf aber immer wieder. Die Dunkelheit war sein Feind, und er fluchte, weil er auch noch dagegen ankämpfen musste. Unter großen Mühen gelangte er bis zur Treppe. Dort suchte er mit einem Fuß nach der ersten Stufe und wagte sich dann weiter vor. Ein Triumphgefühl überkam ihn. Er gehörte noch nicht zum alten Eisen! Ihm würde das Verdienst zufallen, diese Verbrecher gestellt zu haben. Es würde an ihm sein, die Scharwache wegen ihrer Schlafmützigkeit auszulachen.
Doch die Treppe war steil. Er trat auf die zweite Stufe, wurde sicherer und stieg schneller hinunter, verfehlte die übernächste Stufe, griff ins Leere – und dann rauschte er mit einem Schrei abwärts. Er nahm noch wahr, wie er mehrmals auf Holz aufschlug, dann lag er unten.
Er konnte sich nicht entscheiden, was ihm wehtat, denn der Schmerz war überall. Er wusste nur, dass er mit seinem Schrei vermutlich die Ausgräber vertrieben und die Möglichkeit, sich vor seinen Kollegen der Scharwache wieder in ein besseres Licht zu rücken, vertan hatte. Er war ein Versager, zu nichts nütze, zu nichts zu gebrauchen. In dieser Gewissheit dämmerte er in eine andere Welt hinüber.
Als er wieder zu sich kam, war es noch immer dunkel. Der Mond war entweder noch nicht aufgegangen oder schon wieder hinter dem Horizont versunken.
Er lag kopfüber da, die Beine auf den Treppenstufen des Wehrabgangs. Marx horchte in sich hinein, spürte den Schmerzen nach, die sich jetzt auf zwei Punkte konzentrierten: den rechten Arm und das linke Bein. Das Bein war gebrochen, so viel spürte er. Und den Arm konnte er nicht bewegen.
Er blieb liegen, weil er sich nicht rühren konnte. Erst gegen Morgen würde die Scharwache abgelöst, und zumindest Mattheis würde kommen und ihn finden. So lange musste er ausharren.
Marx seufzte, weil ihn dieser Tag genarrt hatte wie kein anderer zuvor. Statt seine Schmach auszuradieren, hatte er sich nur umso tiefer hineingeritten. Jeder würde wissen, dass dieser Unfall seiner Sauferei geschuldet war. Sie würden sich das Maul zerreißen und ihn über Monate auslachen.
Ein sich ständig wiederholendes Quietschen riss ihn aus seinem Selbstmitleid.
»Die Karre«, flüsterte er vor sich hin.
Das rhythmische Quietschen näherte sich so langsam von der Stadtseite her, als würde etwas Schweres bewegt. Dann verstummte es plötzlich, und Marx vernahm die Stimme einer Frau, auf die ein Mann antwortete.
»Ist das nicht Marx Köllin? Ist er tot?«
»Jedenfalls bewegt er sich nicht«, entgegnete der Mann.
Marx hatte das Gefühl, als kenne er die Stimmen.
»Was sollen wir machen?«, fragte die Frau.