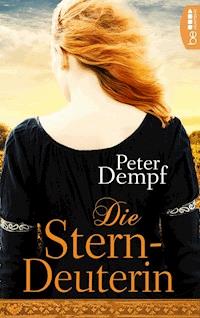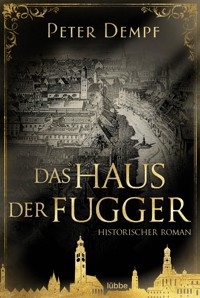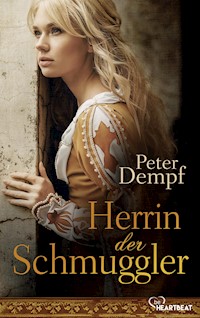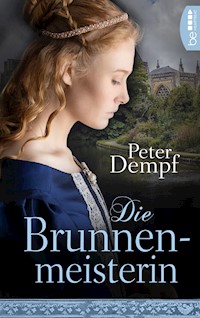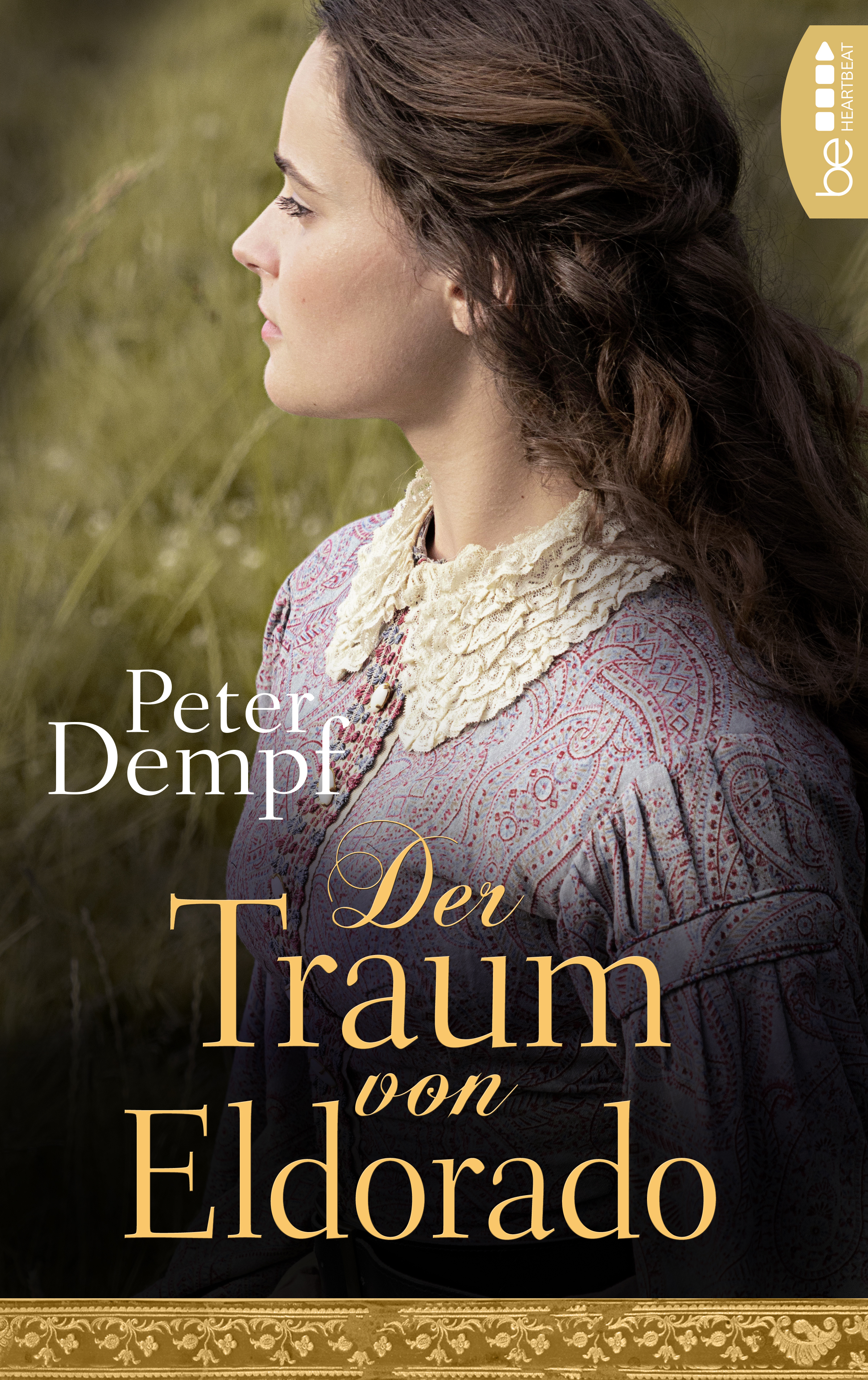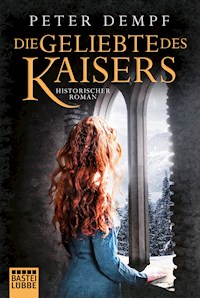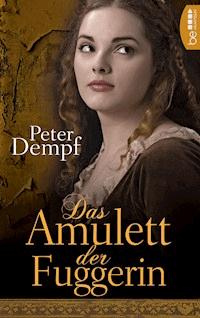9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein stimmungsvoller Roman um eine historisch verbürgte starke Frau des 18. Jahrhunderts
Augsburg, im 18. Jahrhundert. Die Welt der Farben hat es der jungen Anna Barbara Koppmair angetan. Gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Nachbarn Johann Friedrich Gignoux beginnt sie, Farben zu mischen. Aus Freundschaft wird Liebe, und gegen die heftigen Widerstände der Weber gründen sie einen Betrieb, in dem sie Textilien auf besondere Art und Weise färben und bedrucken: eine der ersten Kattundruckereien der Stadt. Als Johann viel zu früh stirbt, ist die junge Witwe Gignoux auf sich allein gestellt. Ihr Unternehmen weckt Begehrlichkeiten. Eine überstürzte Heirat erweist sich als fataler Fehler. Kann sie ihr Reich der Farben für sich und die Kinder retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
Die wichtigsten Figuren der Handlung
Prolog
BUCH I – Die Faszination der Farben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
BUCH II – Weiß und Schwarz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BUCH III – Der Kampf um die Fabrique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BUCH IV – Das Blau des Himmels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nachwort und Dank
Glossar
ÜBER DAS BUCH
Ein stimmungsvoller Roman um eine historisch verbürgte starke Frau des 18. Jahrhunderts
Augsburg, im 18. Jahrhundert. Die Welt der Farben hat es der jungen Anna Barbara Koppmair angetan. Gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Nachbarn Johann Friedrich Gignoux beginnt sie, Farben zu mischen. Aus Freundschaft wird Liebe, und gegen die heftigen Widerstände der Weber gründen sie einen Betrieb, in dem sie Textilien auf besondere Art und Weise färben und bedrucken: eine der ersten Kattundruckereien der Stadt. Als Johann viel zu früh stirbt, ist die junge Witwe Gignoux auf sich allein gestellt. Ihr Unternehmen weckt Begehrlichkeiten. Eine überstürzte Heirat erweist sich als fataler Fehler. Kann sie ihr Reich der Farben für sich und die Kinder retten?
ÜBER DEN AUTOR
Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik und Geschichte und unterrichtet heute an einem Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine Mittelalter-Romane »Fürstin der Bettler«, »Herrin der Schmuggler« und »Das Gold der Fugger« angesiedelt sind.
Peter Dempf
Die Herrin der Farben
Historischer Roman
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren und Verlagsagentur, Münchenwww.ava-international.de
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnEinband-/Umschlagmotive: © akg-images; © Richard Jenkins Photography; © shutterstock: enterphoto | brichuas | Lukasz SzwajUmschlaggestaltung: Birgit Gitschier, AugsburgeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2830-0
luebbe.delesejury.de
»Diese Welt hat schon immer den Männern gehört, alle Gründe aber, die man dafür angeführt hat, erscheinen uns unzureichend.«
SIMONE DE BEAUVOIR
Die wichtigsten Figuren der Handlung
Die Kursivsetzungen verweisen auf historische Personen.
Anna Barbara Koppmair
Johann Gignoux, ihr Mann
Felicitas, ihre Tochter
Johann Friedrich, ihr Sohn
DIE FAMILIE KOPPMAIR
Anna Barbara »Anba« Koppmair
Andreas Koppmair, Goldschlager, ihr Vater
Maria Barbara, ihre Mutter
Rosina Catharina, die jüngere Schwester
Susanna Regina, eine weitere jüngere Schwester
Sabina Barbara, Annas jüngste Schwester
Elsbeth, Annas Magd
Georg Gottlieb Deisch, Susannas Ehemann, Chirurg und Bader
DIE FAMILIE JEAN FRANÇOIS GIGNOUX
Jean François Gignoux, Formschneider und Kattundrucker
Felicitas Gignoux, geb. Steberin, seine Ehefrau
Anton Christoph, sein älterer Sohn
Johann Friedrich, sein jüngerer Sohn
Rosina Kurtz, Antons Frau
Meister Hallbacher, Vorarbeiter in der Fabrique
Johann Heinrich Schüle, Textilhändler, später Erfinder und Manufakturbesitzer
Catharina, seine Frau
Melchior Gräz, Drucker bei Gignoux, später bei Schüle
Georg Christoph Gleich, Kaufmann
Benedikt Adam Liebert Edler von Liebenhofen, Bankier
Johann Conrad Schwarz, Bankier
Carl Heinrich Bayersdorf, Kaufmann
Ulrich Schwenck, Obermeister der Weber
Hans Kenlin, Mitglied der Weberdeputation
Prolog
AUGSBURG, FRÜHJAHR 1733
Wieder lag ein Blatt auf dem Tisch, wieder waren da diese beiden geheimnisvollen Zeichen, blau, auf rotem Grund. Anna Barbara sah sich kurz um. Ihr Vater drehte ihr gerade den Rücken zu. Rasch beugte sie sich über das Papier und überlegte sich, wie das Zeichen auszurichten war. Lag es, stand es aufrecht oder auf dem Kopf?
»Papa?«, begann sie und räusperte sich, als sie bemerkte, dass ihr Vater sie nicht beachtete. »Herr Papa, was sind das für Zeichen auf diesem Blatt?«
Andreas Koppmair wirbelte herum, runzelte die Stirn und nahm es an sich.
»Das ist nur etwas für Erwachsene. Nichts für Kinder und schon gar nichts für kleine Mädchen.«
»Aber …«, wollte Anna widersprechen, doch ihr Vater hob nur den Zeigefinger. Damit war jegliches Gespräch unterbunden.
Sie ärgerte sich und lief ihm nach. Er war in den Nebenraum gegangen. Dort hämmerten drei Quetschen gleichzeitig und machten einen unvorstellbaren Lärm. Die Schläge der Hämmer gingen durch den Körper hindurch, und selbst ihr Herz versuchte, sich an den Takt anzupassen.
»Heimer!«, machte Vater Koppmair den Gesellen auf sich aufmerksam. »Nimm das, und leg es beiseite. Meine Tochter darf nicht wissen, dass es sich um ein großes E und ein kleines e handelt. Das ist nichts für Mädchen.«
Ihr Vater musste fast brüllen, um verstanden zu werden. Heimer nickte nur und verdrehte die Augen.
Doch Anna hatte genau gehört, was ihr Vater geschrien hatte. Sie drückte sich an die Türzarge und lugte um die Ecke, damit sie mitbekam, wo der Geselle das Blatt versteckte. Heimer packte den Zettel unter die Lederbücher, in denen die Goldblätter verwahrt wurden, die später noch unter die Quetschen kommen würden.
Anna wusste, er würde noch bis Mittag an den Hämmern stehen und dann mit ihrem Vater und Meister Gignoux zum Mittagessen in die nächste Wirtschaft gehen. Wenn sie es geschickt anstellte, hätte sie ausreichend Zeit, das Blatt abzuschreiben. Bereits in Gedanken überlegte sie sich, wie die Zeichen ausgesehen hatten, und suchte in der ganzen Wohnung nach ihnen. Sie fand sie auf einer Flasche in der Küche im Gewürzregal: »E« war das erste Zeichen darauf.
Sie holte die Flasche vom Regal, öffnete sie und roch daran: Essig. Hatte der Vater nicht gesagt, sie solle nicht wissen, dass das ein großes »E« sei?
»E, e, e, e wie Essig«, wiederholte sie immer wieder. Sie stellte sich das Bild des Zeichens im Kopf vor und verglich es mit dem auf dem Steinkrug. Jetzt wusste sie, wie es gestellt wurde: die Bögen nach links, die Öffnungen nach rechts. Sie presste die Lippen aufeinander. Weder waren diese Zeichen nichts für Mädchen noch war sie zu klein dafür. Sie war immerhin acht Jahre alt.
Sie suchte weiter und fand in der Stube die Bibel, die der Vater jeden Morgen aufschlug, um daraus einen Satz laut vorzulesen, der ihm und der Familie als Motto für den Tag diente.
Was hatte er heute früh vorgetragen? Aus dem Evangelium des Matthäus? Matthäus 13, Vers 3. »Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen«, murmelte sie vor sich hin. Die Seite lag noch ebenso offen da wie heute Vormittag. Ein Einmerker zeigte, wo das Evangelium begann. Dort musste ein »E« zu finden sein. Und im Text selbst auch jede Menge.
Anna zog einen Stuhl heran, kniete sich auf die Sitzfläche und beugte sich über den Text.
Das Wummern der Hämmer war zwar in der Küche weniger zu hören, zu spüren war es jedoch überall bis unter das Dach. Es begleitete sie, seit sie denken konnte.
Die Seite war voller »E« und »e«, aber nur an einer Stelle tauchte das kleine »e« dreimal hintereinander auf, nur unterbrochen von jeweils einem anderen Zeichen: »er redet«. Sie merkte sich die Aussprache: »r«, »d«, »t«.
Pah! Nichts für kleine Mädchen. Dass sie nicht lachte. Sie musste nur genau aufpassen, dann würde sie bald alles verstehen, was dort stand.
Schließlich blätterte sie zurück und suchte das Anfangskapitel. Das große »E« stach ihr sofort in die Augen. »Evangelium nach Matthäus«, murmelte sie vor sich hin. Sie versuchte, sich das Wort »Evangelium« einzuprägen.
Sorgfältig legte Anna den Einmerker ein und blätterte zum Spruch des Tages zurück. Langsam kletterte sie vom Stuhl.
Als sie sich zur Tür wandte, stand dort ihr Vater, groß und mit auf dem Rücken verschränkten Händen. Im Lärm der Quetschen hatte sie ihn nicht kommen hören. Er sah sie mit gerunzelter Stirn an, sagte aber kein Wort.
Anna schluckte.
»Was machst du da, Anba?«, fragte ihr Vater, aber seine Stimme klang nicht verärgert, sondern lediglich neugierig, auch weil er sie zärtlich mit ihrem Kosenamen Anba für Anna Barbara ansprach.
»Ich …«, versuchte Anna sich eine Geschichte zurechtzulegen. »Ich wollte nur sehen … ob das Buch auch zu mir …« Sie verhaspelte sich, und ihr Vater unterband alles weitere Gestotter mit dem Heben des Zeigefingers.
Anna war ihm unendlich dankbar dafür, denn so verhinderte er, dass sie ihn anschwindeln musste. Wenn sie etwas nicht wollte, dann war es lügen.
»Komm her!«, sagte der Vater und breitete seine Arme aus.
Erleichtert lief sie auf ihn zu, und Andreas Koppmair tat etwas, was Anna noch bei keinem anderen Vater gegenüber seinen Kindern gesehen hatte, auch nicht bei François Gignoux, mit dem die Familie befreundet war und der zwei Söhne hatte und gleich gegenüber wohnte. Er nahm sie in die Arme, hob sie hoch und drückte sie an sich.
»Mein Mädchen«, sagte er und küsste sie auf die Stirn. »Was wird nur aus dir werden?«
Anna streckte sich und drückte sich etwas ab. Ernst sah sie ihm ins Gesicht. »Eine Mutter natürlich.«
Zuerst musste der Goldschlagermeister lachen, doch dann wurde er ernst. »Vermutlich, Anba, nein, sicher sogar. Aber das, lass dir gesagt sein, ist nicht alles auf der Welt. Wenn es auch mehr ist, als wir Mannsbilder zustande bringen.«
Er ließ sie ab und strubbelte ihr durchs Haar, was sie zu einem schrillen Kreischen veranlasste.
»Meine Frisur!«, beschwerte sie sich.
Sie genoss diese kleinen Liebkosungen des Vaters und wusste, wie selten sie bei anderen waren, zum Beispiel bei Johann und Anton. Auch wenn Vater Gignoux nicht streng war und seine Jungen kaum schlug.
Sie winkte ihrem Vater, als sie den Raum verließ und zurückblickte. Dabei wunderte sie sich, wie verträumt er im Türrahmen stand und ihr nachblickte. Aber sie hatte jetzt anderes zu tun, als darüber nachzudenken. Sie musste ihren Schwestern erzählen, was sie entdeckt hatte, und sie musste üben.
Im hinteren Garten hatte sie ein Beet angelegt, das vor allem eines enthielt: Sand. Dorthin war sie unterwegs. Sie lief so schnell, dass ihre blonden Locken flogen.
Dass keine ihrer Schwestern zu sehen war, störte sie nicht. Spätestens wenn sie im gemeinsamen Bett lägen, hätten sie Zeit genug, sich flüsternd den Tag zu erzählen, bis ihre Eltern kämen und Nachtruhe verlangten.
Sie kniete sich vor dem Beet nieder, glättete das Sandbett mit einem Holzspatel und begann zu üben. Sie schrieb die Buchstaben, die sie gesehen hatte, in den Sand, korrigierte, begann erneut und übte so lange, bis sie das Gefühl hatte, die Buchstaben zu beherrschen. Dann dachte sie an die Wörter, die sie gesehen hatte, und schrieb Evangileun,er und redete, wischte sie wieder aus und malte sie von Neuem in den feuchten Sand.
»Oh, da übt schon wieder jemand.«
Anna erschrak derart, dass der Holzstab, den sie verwendete, quer über das Beet fuhr und alle ihre Übungen beschädigte.
Anton sah auf sie hinunter. Er war der älteste Spross des Formschneiders und Kattundruckers Gignoux, schon beinahe erwachsen. Er ging bei seinem Vater in die Lehre, war groß und schlaksig und hatte tiefblaue Augen.
Annas Herz schlug wie wild.
Anton hockte auf der kleinen Mauer, die beide Grundstücke voneinander trennte. Er betrachtete ihre ungelenken Versuche und schüttelte den Kopf.
»Du wirst nie schreiben lernen. Mädchen können das nicht!«, sagte er und grinste bis über beide Ohren. Er tippte an seinen Kopf. »Sie haben ein zu kleines Gehirn. Und auch sonst sind sie nicht dafür geschaffen.« Er musterte sie unverschämt von oben bis unten.
»Woher willst du das wissen? Du kannst doch selber nicht schreiben«, zischte sie. »Außerdem … außerdem …« Sie wusste nicht weiter.
Anton sprang zu ihr herunter und forderte mit einer herrischen Geste den Holzstab. Dann korrigierte er das Wort »Evangelium«, weil sie »e« und »i« vertauscht und bei »m« einen Bogen weggelassen hatte.
»Das zum Thema, ich kann nicht schreiben«, sagte er und drehte sich weg. Hocherhobenen Hauptes stolzierte er davon, setzte seinen Schuh in eine Lücke der Mauer und war auf der anderen Seite, bevor sie auch nur eine Antwort parat hatte.
Annas Augen schwammen in Tränen. Warum musste er sie immer so behandeln? Was hatte sie ihm getan?
»Er meint es sicher nicht so«, sagte eine andere Stimme über ihr.
Anna musste ihre Tränen hinunterschlucken und sich kurz übers Gesicht wischen, bevor sie hochschauen konnte. Auf der Mauer hockte Johann, Antons jüngerer Bruder.
»Wo kommst du her?«, fragte sie.
Johann begutachtete die Schreibübungen und nickte. Ohne sich zu Anna umzudrehen, deutete er mit dem Daumen hinter sich in den Garten seines Elternhauses. »Von da.«
Sie verdrehte die Augen. »Das denk ich mir«, sagte sie schnippisch.
»Warum fragst du dann?«
Johann war der jüngste Gignoux-Spross und nur ein Jahr älter als sie.
»Warum sagt Anton immer so blöde Sachen?«, fragte Anna.
»Du schreibst schon ziemlich gut«, antwortete Johann. »Aber du musst auf Papier üben, nicht im Sand.«
Er kramte in seinem Hemd und zog daraus zwei gefaltete Papierstreifen hervor.
»Versuch es damit. Die Tinte machst du aus Spucke und Ruß. Federkiele findest du überall. Zum Üben genügen Hühnerfedern.«
Anna wusste genau, woher das feine Seidenpapier stammte. Man legte es unter frisch bestrichene Druckmodeln, damit sie keine fremde Farbe annahmen, wenn man sie ablegte.
»Du hast das Papier geklaut«, sagte sie forsch.
»Iwo. Es lag am Boden. Es ist außerdem verdreckt, und man kann es nicht mehr benutzen. Mein Vater hätte es zerknüllt und verbrannt. Das kann er ja immer noch, wenn du es beschrieben hast. Aber zum Üben ist es vortrefflich.«
Er reichte ihr die beiden Bögen, und Anna griff zu.
Ihre Blicke trafen sich, und Johanns dunkle Augen saugten sich an denen von Anna fest. Er lächelte sie von oben an. Schließlich kramte er in seiner Hosentasche und zog eine Hühnerfeder hervor, etwas zerzaust und oben geknickt, aber sonst funktionstüchtig.
»Zeig mir, was du geschrieben hast, wenn du fertig bist«, sagte er.
Anna knickste, nahm auch die Feder an sich, drehte sich um und rannte davon.
Sie mochte Johann, und sie mochte auch, wie er sie ansah. Es war ein Blick wie ein Sommertag, voller Sanftheit und Wärme – und doch kribbelte etwas in ihr, wenn er sie so betrachtete, was sie noch nicht einzuordnen wusste. Aber sie ahnte, dass sie sich damit noch nicht intensiver beschäftigen konnte und wollte.
Sein Blick verfolgte sie und berührte ihren Rücken, und bevor sie sich dessen bewusstwurde, drehte sie sich um und warf Johann, der noch immer auf der Mauer hockte wie ein Eichhörnchen, einen Handkuss zu. Er löste ein Grinsen im Gesicht des Jungen aus, das auch Anna glücklich machte.
Sie stürmte in die Küche und setzte sich an den Tisch.
Ihre Mutter war damit beschäftigt, das Mittagessen zuzubereiten. Annas nur etwas über ein Jahr jüngere Schwester Susanna stand an der Anrichte, schnitt Zwiebeln und beachtete sie nicht.
»Du bist ja ganz außer Atem, Kind«, tadelte die Mutter sie. »Komm erst einmal zur Ruhe. Was ist denn los?«
Immer wenn sie ihrer Mutter gegenübersaß, hatte Anna das Gefühl, als würde diese in sie hineinschauen können. Sie wusste, wann Anna schwindelte, wann sie traurig oder wütend war, wann sie Kummer hatte. Als würde es auf ihrer Stirn geschrieben stehen.
»Hat Anton dich wieder geärgert?«
Jetzt auch wieder. Woher wusste sie das nur?
»Ich will schreiben und lesen lernen!«, entfuhr es ihr.
Anna hatte erwartet, ihre Mutter aufspringen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen zu sehen, stattdessen flog nur ein kurzer Schatten über ihr Gesicht.
»Warum willst du so was können?«
Die Frage kam von Susanna, die sie aus den Augenwinkeln beobachtete.
»Weil ich es lernen kann!«, erwiderte Anna. »Ich habe ein mindestens so großes Gehirn wie Anton oder Johann!«, setzte sie mürrisch hinzu. »Vielleicht sogar größer!«
»Was?«, fragte ihre Mutter nach, und jetzt klang sie etwas belustigt.
Auch Susanna prustete los und musste das Zwiebelschneiden unterbrechen, was Anna dazu veranlasste die Arme vor der Brust zu verschränken.
»Anton sagt, mein Gehirn wäre zu klein und auch sonst wäre ich als Mädchen nicht geeignet …«
»Unsinn«, unterbrach ihre Mutter sie schroff. »Wir Frauen können alles. Wir müssen es nur wollen. Sogar mehr. Oder hast du schon einen Mann gesehen, der ein Kind austrägt?«
Anna schüttelte den Kopf.
»Und das mit dem Gehirn prüfen wir nach. Zum Wochenende werde ich Hirn kaufen. Einmal vom Schaf, einmal vom Bock, dann schauen wir uns an, wie groß die Unterschiede sind. Das von Anton könnten wir auch nehmen, aber dann müsste ich deines danebenlegen – du könntest dann aber nicht mehr sehen, welches Gehirn größer ist. Also nehmen wir nur Schaf und Bock.«
Alle drei brachen in Gelächter aus.
Schließlich legte Anna das Papier auf den Tisch.
»Darf ich etwas Ruß aus dem Herd nehmen?«, fragte sie und legte die Feder daneben.
Ihre Mutter runzelte kurz die Stirn. »Wenn du danach Rüben putzt!«
Anna nickte eifrig. Sie holte sich eine kleine Schale und einen Löffel, mit dem sie etwas Ruß von den Schamottesteinen des Herdes schabte und in die Schale gab. Sie spuckte mehrmals auf den Ruß, rührte ihn zu einem Brei und begann zu schreiben. Es war nicht perfekt, aber die »E«s gelangen – und zuletzt schrieb sie Evangelium, wobei sie die Fehler korrigierte, die sie im Sandbett noch gemacht hatte.
Als sie fertig war, glühten ihre Wangen, ihre rechte Hand krampfte, und sie hatte das Gefühl, ihre Zungenspitze völlig zerkaut zu haben. Aber auf dem Blatt stand deutlich Evangelium.
Ihre Mutter drehte sich zu ihr um, als sie das Blatt stolz in die Höhe hob.
»Was soll nur aus dir werden, Kind?«, fragte sie, und in ihrer Stimme schwangen Stolz und Sorge mit.
1
SOMMER 1740
»Du musst aufpassen, dass dir der Kopf nicht platzt!«, rief ihr Jonas über die Straße hinweg zu.
»Lesen macht hässlich!«, schrie ihr Michl, der Färbersprössling, hinterher und drehte ihr dabei eine Nase.
Die beiden Jungs saßen auf einer der Urintonnen, die vor der Werkstatt ihres Vaters aufgestellt waren. Sie hatten den Deckel aufgesetzt. Durch ihre löchrige Kleidung spitzten weiße Hautstellen.
»Jedenfalls stinke ich nicht so wie ihr!«, murmelte sie.
Anna hob den Kopf und stolzierte an den Jungen vorbei, ohne sie zu beachten. Sollten sie nur spotten.
»Du wirst noch als alte Jungfer enden!«, rief ihr Jonas nach. »Und deine Brüste werden flach sein wie die Seiten von Büchern!«
Er zischelte wie eine Schlange, weil ihm vorn bereits zwei Zähne fehlten. Die Jungs johlten über ihren Witz.
Anna schüttelte die Haare, die ihr wie mattes Gold über den Rücken fielen. Über dieses dumme Geschwätz und die Anzüglichkeiten konnte sie nur lachen. Sie bemerkte sehr wohl, wie ihr die jungen Männer neuerdings hinterhersahen. Sie bemerkte auch, wie sie absichtlich die Straßenseite wechselten, um an ihr vorüberzukommen und sie zu grüßen. Sie bemerkte, wie sie sich aufplusterten wie die Hähne, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken.
Sie presste die beiden Bücher an ihre Brust. Das eine war eine Geschichte über einen unmöglichen Menschen, genannt Till Ulenspiegel, illustriert mit Holzschnitten. Sie hatte es aus der Bibliothek von Pfarrer Michlberger entleihen dürfen. Das andere war eine kurze Schrift über Farben. Sie würde es Johann zeigen.
Beide Bände trug sie wie Schätze vor sich her. Sie konnte es kaum erwarten, die Seiten aufzuschlagen und darin zu blättern, zu lesen, sich die Wörter zu eigen zu machen.
Sie ertappte sich selbst manchmal dabei, wie sie überlegte, ob all das Wissen, das in diesen vielen Büchern steckte, das Gehirn verstopfen und ihr so schaden könnte. Dann wieder hielt sie das alles für Unsinn. Männerköpfe wurden auch nicht verstopft. Warum sollte es bei Frauen anders sein?
Sie vernahm das Hämmern der Quetschen, die so regelmäßig schlugen wie ihr Puls, sobald sie in den Hinteren Lech einbog. Das Haus atmete diese Schläge, die nur des Nachts aussetzten und den Ohren wie dem Körper Ruhe gönnten.
Sie schlüpfte ins Haus, lief hinaus in den Garten und setzte sich an den kleinen Tisch, der jetzt dort stand, wo noch vor ein paar Jahren ihre Sandtafel gewesen war, schlug das Buch über Ulenspiegel auf und begann, sich darin zu vertiefen.
»Anba!«, rief ihr Vater, kaum dass sie die ersten Zeilen entziffert hatte, was schwer genug war, denn der Druck war alt und die Sprache, in der die Geschichte geschrieben war, eher ungewöhnlich. Sie musste sich konzentrieren und wollte nicht gestört werden.
»Bist du schon wieder am Lesen? Ich hätte es dir doch nicht erlauben sollen«, sagte er mit gespielter Entrüstung.
»Papa?«, fragte Anna. Sie wusste, dass sie etwas ungeduldig klang. Sie wusste aber auch, was es bedeutete, nicht nur sticken und häkeln zu müssen.
»Lauf zu den Gignoux’ hinüber, und sag ihnen, dass wir heute gegen Abend gern kommen würden.« Er sah Anna an und seufzte. »Sag ihnen auch, ich werde meine älteste Tochter mitbringen. Sie soll endlich einmal aus dem Haus kommen.«
Anna schluckte. Wie oft hatte sie hinter der Mauer gestanden und den Gesprächen gelauscht, die aus dem Garten dahinter zu ihr herüberdrangen. Ihr Nachbar, der Kattundrucker Jean Gignoux, war ein bekannter Mann in der Stadt. Er versammelte Menschen um sich, die offen redeten und ebenso offen Kritik übten. Er war ein Erneuerer, der auch nicht davor zurückschreckte, sich mit den mächtigen Zünften anzulegen und bei der Weberdeputation für seine Ideen zu kämpfen.
Sie schlug das Buch zu, klemmte sich das Farbenbuch unter den Arm und rannte los.
»Anba!«, rief ihr der Vater nach. »Denk dran, du bist kein Wildfang, sondern langsam eine Dame, die sich zu benehmen wissen muss! Wenn ich anderes höre, musst du zu Hause bleiben. Ich will mich nicht blamieren.«
Im Vorbeihuschen am Vater nickte sie. Zuerst brachte sie ihren Ulenspiegel ins Zimmer. Dafür musste sie das Schlafzimmer der Eltern durchqueren.
Sie öffnete kurz das Fenster und gab einen Pfiff von sich, wartete, bis sich drüben ein Fenster öffnete, und deutete einfach nach unten. Der Junge von gegenüber nickte. Sie sprang die Treppen hinunter und fuhr sich mit der Hand durchs Haar.
Sie musste über eine kleine Brücke gehen. Links neben ihr schaufelte ein Wasserrad und trieb die drei Hämmer der Quetschen im Haus an. Selbst auf der Treppe spürte man das Zittern ihrer Schläge.
Erst als sie auf die Gasse hinaustrat, verlangsamte sie ihren Schritt. Sie ging nach Norden, den Hinteren Lech entlang, bog um die Ecke und lief nach Süden zurück.
Vor dem Haus der Familie Gignoux blieb sie stehen. Der pastellfarbene Anstrich gefiel ihr außerordentlich. Er war schöner als das graue Mauerwerk ihres eigenen Hauses, von dem immer wieder der Putz abfiel. Das läge an den Hämmern, erklärte ihr Vater immer. Die Quetschen würden den Putz lockern, egal, was er anstellen würde. Er ließ in regelmäßigen Abständen den abgebröckelten Lehmputz erneuern, das war dann alles. Angestrichen oder gar bunt bemalt wurde das Haus nicht mehr.
Anna seufzte. Sie ging mit für eine junge Dame angemessen langsamen Schritten auf das Gignoux-Haus zu. Bevor sie den Klopfer betätigen konnte, wurde die Tür aufgerissen, und Johann stand vor ihr.
»Was gibt es?«
Anna spürte, wie sie rot wurde, wie der Hals und die Wangen zu feuern begannen, als sie Johann sah. »Ich … soll … ich muss zu deinem Herrn Vater. Mein Herr Papa schickt mich.«
»Oh«, machte Johann und versuchte eine Verbeugung, bei der er den rechten Fuß so weit nach hinten zog, dass er beinahe das Gleichgewicht verlor. »Dann ist das der offizielle Besuch einer jungen Dame. Solltet Ihr aber in Heiratsabsichten zu meinem Herrn Papa wollen, muss ich Euch leider kundtun, er ist schon verheiratet. Es wäre nur noch die Stelle einer Mätre…«
Weiter kam er nicht, denn Anna gab ihm einen Stoß in die Seite, dass er gegen die Tür stolperte, weil seine Beine völlig verdreht waren.
»Filou!«, sagte Anna schnippisch und segelte mit erhobenem Haupt an ihm vorbei ins Innere.
»Lasst mich Euch wenigstens ankündigen, Mademoiselle!«, bat Johann gestelzt und wollte an ihr vorbeiwischen. Doch er hatte nicht mit Anna gerechnet. Als er sich an ihr vorbeidrückte, stellte sie ihm ein Bein. Er stolperte in die Stube hinein und konnte seinen Sturz nur dadurch verhindern, dass er sich an einer Stuhllehne festklammerte. Damit hätte er beinahe den Stuhl umgestoßen.
»Das Frauenzimmer Koppmair!«, verkündete er lachend.
Anna war in der Türöffnung stehen geblieben, knickste artig und schaute jedem der dort am Mittagstisch Sitzenden in die Augen, wie es sich gehörte. Dass sie Johann gerade noch das Bein gestellt hatte, sah man ihr nicht an. Allerdings runzelte Jean François Gignoux, der am hinteren Kopfende saß, die Stirn ob des Verhaltens seines Sohnes.
»Johann«, zischte er.
Doch der Bursche konnte nicht an sich halten und prustete vor Lachen.
»Ich hoffe, ich störe das Mittagsmahl nicht«, begann Anna und ignorierte Johann völlig. »Und wenn es so sein sollte, tut es mir außerordentlich leid, und ich erbitte Eure Verzeihung.« Sie knickste ein weiteres Mal vor dem Hausherrn. »Mein Herr Vater schickt mich, Meister Gignoux.«
»Aber … aber … Mir tut es leid, dass dieser Tölpel von Sohn Euch so angekündigt hat, Mademoiselle Koppmair!« Er sprach mit einem französischen Singsang, den er wohl nie würde ablegen können. Anna gefielen die besonderen Betonungen und das Weiche des Klangs.
Er stand auf. Der Tuchdrucker war ein kleiner, drahtiger Mann, dessen Energie aber für zwei reichte und der mit seiner Präsenz den Raum ausfüllte, als stünden fünf Männer darin. Mit einer galanten Handbewegung lud er Anna in die Stube und wischte seinem Jüngsten nebenbei eins über den Hinterkopf.
»Tretet ein. Wollt Ihr eine Limonade? Meine Frau hat eben eine Zitrone …«
Er winkte seiner Gattin zu. Madame Gignoux huschte in die Küche hinaus und holte einen weiteren Becher, in den sie umgehend etwas von dem Zitronenwasser füllte. Der Duft hing im ganzen Raum wie ein Parfumtuch.
»Mein Herr Vater lässt ausrichten …«, begann Anna und trat wie zufällig Johann, der sich auf den Stuhl gesetzt hatte, auf die Zehen. Unter ihrem Rock war das nicht zu sehen. Johann schnappte nach Luft. Sie lächelte verbindlich und schaute Meister Gignoux an. »Er lässt ausrichten, er käme gern zu Eurer Soiree. Er würde nebst seiner Gattin auch gern die Tochter mitbringen, wenn es Euch recht ist.«
Gignoux strahlte. Seine Frau stellte Anna den Becher Zitronenwasser hin.
Vielleicht hatte er gesehen, wie Johann die Qual seiner Zehen dadurch zu mildern versuchte, indem er ihr in den Rücken boxte.
»Setzt Euch, Mademoiselle Koppmair.« Und dann siegte die Neugier. »Darf ich fragen, was Ihr da unter Eurer Achsel für ein Buch verbergt?«
Jetzt erst wurde Anna wieder bewusst, dass sie das Buch mitgenommen hatte.
»Eine Lehre, wie man Farben mischt, auf dem Tuch aufbringt und dort fixiert.«
Die Brauen des Tuchdruckers hoben sich. »Ihr interessiert Euch für das Tuchdruckgewerbe?«, fragte er erstaunt.
»Ich liebe Farben«, antwortete sie. Während sie antwortete, nahm sie Platz und nippte an dem Zitronenwasser. Es war herrlich bitter und zugleich erfrischend süß. »Mich interessiert, wie Ihr diese auf den Tüchern festhalten könnt.«
Noch bevor Meister Gignoux antworten konnte, war Johann aufgesprungen.
»Darf ich es ihr zeigen?«, fragte er unaufgefordert. Weil der Vater gleich neben ihm stand, empfing er erneut einen Schlag gegen den Hinterkopf.
»Ich habe doch gar nichts gemacht«, maulte er und grinste Anna schelmisch an.
Diese bemerkte, wie Johanns Mutter aus der Küche hereinkam und zwischen ihr und Johann hin und her blickte, als fühle sie nicht nur diese Verbindung, sondern auch etwas anderes.
»Darf ich es mir ansehen?«, fragte der Textildrucker mit seinem weichen Akzent und streckte die Hand nach dem Buch aus.
»Natürlich.« Anna reichte ihm das Buch, und er begann darin zu blättern.
»Eine Niederschrift des Kattundrucks nach englisch-holländischer Manier und die Technik des Krapprot-Färbens von Georg Neuhofer«, flüsterte er ehrfürchtig. »Der Goldschlager und Kattundrucker mit seinen Fabriken hier unten im Lechviertel. Vor fünf Jahren ist er verstorben. Sein Sohn führt jetzt die Geschäfte weiter.« Dann musterte er Anna, als müsse er erst verstehen, was sie damit bezweckte. Schließlich waren die Neuhofers seine stärksten Konkurrenten.
Unbefangen strahlte sie ihn an.
»Woher hast du das Buch?«
Er verfiel in den persönlichen Ton des Nachbarn, was Anna lieber war als das Gestelzte, dieses Höfisch-Höfliche.
»Geliehen«, sagte sie nur. »Von Pfarrer Michlberger. Ich muss es ihm wiedergeben. Bald.«
»Wenn ich es den Nachmittag über behalten darf, geb ich es dir am Abend zurück.« Er hob fragend die Augenbrauen, und Anna nickte. »Ich freue mich darauf«, fuhr er fort, »dich und deine Eltern begrüßen zu dürfen.«
2
SOMMER 1740
Johann versuchte immer wieder, nach ihrer Hand zu greifen, aber Anna entzog sie ihm. Nicht schnell und entschieden, als wolle sie das nicht, aber doch deutlich. Wer sie zufällig sah, sollte nicht den Eindruck gewinnen, sie wären ein Paar. Diesen Anschein musste sie vermeiden. Schließlich hatte sie als Tochter eines bekannten Goldschlagers einen Ruf zu verlieren.
Sie hielten ihre Gesichter in die Sonne und schlossen die Augen. Per Zuruf leiteten sie sich gegenseitig blind durch die Straßen. Dabei schlenderten sie die Schlossermauer entlang, durchquerten das Barfüßer Tor und gingen in die Jakober Vorstadt hinein nach Osten, um an der Kirche St. Jakob scharf nach Norden abzubiegen und am Theater vorbei zum Pulvergässchen zu gelangen.
Je näher sie der Färberei und Druckerei kamen, desto stechender wurde der Geruch.
»Puh, langsam brauche ich deine Führung nicht mehr«, beschwerte sich Anna und hielt sich die Nase zu. »Ich kann meiner Nase folgen.«
»Es mag stinken, dafür kann ich dir ein Wunder zeigen«, sagte Johann ernst. »Ein wirkliches Wunder.«
Anna wusste zwar, dass die Familie Gignoux eigene Fabrikräume hinzugekauft hatte, aber sie hatte sie noch nie gesehen. Sie hätte nicht einmal gewusst, wo sie hätte suchen sollen.
»Sag mal, stimmt es, dass dein Herr Vater sich mit der Färberzunft angelegt hat?«
Johann wurde ernst. Wieder suchten seine Finger nach den ihren. Diesmal zog Anna sie nicht sofort zurück, sondern drückte Johanns Hand zuerst leicht.
»Angeblich haben sie zehn Jahre lang darüber gestritten, ob wir einen eigenen Färber beschäftigen dürfen. Ich war noch zu jung, als es damit angefangen hat, aber ich habe die Beschimpfungen und Drohungen erlebt, wenn die Tucherer vor unserem Haus aufmarschiert sind. Da wird einem ganz schön mulmig.«
Es waren zwei weitläufige Gebäude mit kleinen Fenstern unter der Traufe, auf die sie zugingen.
Johann lief voraus, als könne er es nicht erwarten, ihr das Wunder zu zeigen.
»Komm«, trieb er sie an. »Nicht so langsam!«
Doch Anna rümpfte die Nase. Es stank schlimmer als die beiden Färberjungen Michl und Jonas zusammen. Ihr wurde übel.
Zwei mächtige Wasserräder forderten ihre Aufmerksamkeit. Sie ließen das Wasser des Stadtbachs schäumen. Ihre gewaltigen Antriebswellen führten ins Innere der Gebäude. Es rumpelte und rauschte, und für einen Moment nahm das den Geruch aus der Luft.
Der kehrte allerdings zurück, als Johann die Tür zum ersten Gebäude öffnete. Es war ein Holzbau, der sich den Stadtbach entlang erstreckte und auf einem Steinfundament aufsaß. Nur Oberlichter ließen Helligkeit herein.
Johann deutete auf die Öffnungen.
»Damit die Sonne die Farben nicht sofort wieder ausbleicht«, erklärte er.
Offenbar kannte man den jungen Gignoux. Die Arbeiterinnen nickten ihm zu, andere lächelten ihn nur an, konzentriert auf das, was sie taten.
»Wir mussten eine Bleiche dazukaufen«, sagte Johann fachmännisch, als wäre er bereits der Inhaber der Färberei. »Man braucht Stoff, der gleichmäßig weiß ist, damit die Farben durchkommen. Sonst wird das Tuch fleckig.«
Anna hielt sich die Nase zu. Der Geruch war so scharf, dass es ihr beinahe die Luft nahm. Jeder Atemzug stach in die Lungen.
»Wolltest du mir zeigen, wie man hier überlebt?«, fragte sie bissig.
Johann grinste schief. Er packte ihr Handgelenk und zog sie tiefer in die Baracke hinein. »Du musst darauf achten, nirgends anzuecken, sonst bringst du die Farbe nie wieder aus dem Kleid heraus.«
Das sagte er ihr ja früh. Sie raffte den Rock etwas und ließ sich mitziehen. Irgendwann blieb er vor einem Bottich stehen. Er starrte auf die grünliche Brühe, als gäbe es dort etwas Besonderes zu sehen.
»Schwimmen hier Frösche drin, weil du diese Brühe so anstarrst? Kommen sie und bringen dir einen goldenen Ball?« Anna gluckste vor Vergnügen, obwohl von dem Bottich ein fauliger Geruch nach vergorenen Pflanzen und Schimmel ausging.
Ohne aufzusehen, sagte Johann: »Viel besser«, sagte er, ohne aufzusehen. Er winkte einen der Gesellen heran. »Wie lange müssen die Tücher noch einfärben?«, fragte er ihn.
Der Junge, der sicher noch nicht zwanzig war, legte den Kopf in den Nacken, als suche er unter der Decke der Holzbaracke etwas. »Wir sind gleich so weit!«
Anna kam das komisch vor, bis sie bemerkte, dass der Bursche durch die obere Fensteröffnung nach draußen auf die Uhr von St. Max geschaut hatte. Als die Glocke die zweite Nachmittagsstunde einläutete, holte der Geselle eine Kelle und einen Galgen. Er bedeutete den beiden Neugierigen, sie sollten zurücktreten, da es jetzt spritzen würde.
Er tauchte das Paddel in die Suppe und angelte sich ein Tuchende. Das holte er aus dem Brei und legte es über den hölzernen Galgen. Zweimal wiederholte er die Prozedur, bis drei Tücher über der Querstange hingen. Schließlich nahm er eine Kette, zog daran – und die Tücher wurden aus dem Brei geholt und schwebten zum Abtropfen über dem Bottich.
»Ach. Und das ist jetzt das Wunder? Schwebende schmutzig grüne Tücher?«
Johann wiegte den Kopf. »Das müsste eigentlich ausreichen, um ein Mädchen zu beeindrucken. Findest du nicht?«, fragte er und trat einen Schritt beiseite.
Anna folgte ihm und wandte den Tüchern den Rücken zu. »Johann Friedrich Gignoux! Verdirb es dir nicht mit mir. Ich kann schneller lesen und schneller rennen als du. Und im Kopfrechnen schlage ich dich, ohne mich auch nur anstrengen zu müssen.«
Johann tat, als würde er die Vorwürfe erst durchdenken müssen. Er wiegte den Kopf. »Also, wenn du in all den Dingen so blind bist wie beim Erkennen der Farbe, dann …«
»Willst du damit sagen, ich könne keine Farben erkennen?«
»Ja. Will ich. Welche Farbe hatte das Tuch eben?«, fragte er und tat unschuldig.
»Grünschlammgelb!«, zischte Anna. »Glaubst du, ich bin blind?«
Sie hatte nicht erwartet, dass Johann sie plötzlich so anfuhr. »Na, ich weiß nicht. Sag du’s mir.«
Er deutete hinter sie auf die Tücher, denen sie den Rücken zugekehrt hatte. Sie drehte sich um und schimpfte: »Sie sind grünschlammgelb, so wahr ich Anna …«
Sie stockte. Zwar hingen die Tücher noch immer an der Galgenstange und tropften ab. Aber sie waren nicht mehr grünlich. Ein leichtes Blau hatte sich gebildet, das mit jedem Moment dunkler und kräftiger wurde. Es war ein Blau, das einem den Atem nahm.
»Hab ich zu viel versprochen? Ist das ein blaues Wunder?«
Johann war nahe an sie herangetreten. Anna konnte seinen Atem in ihrem Nacken spüren. Es kitzelte nicht nur. Sie fühlte, wie ein Schauder sie überlief. Am liebsten hätte sie sich an ihn gedrückt, aber das ziemte sich nicht.
Auch der Geselle schaute dem Wunder der Blaufärbung zu.
»Wie geht das?«, fragte sie. »Hat der Kerl die Tücher ausgetauscht?« Sie drehte sich auf dem Absatz zu Johann um, und ihr Gesicht war jetzt dem seinen sehr nahe. Näher als es schicklich war. »Vielleicht trittst du einen Schritt zurück«, sagte sie leise. »Es wirkt sonst etwas … kompromittierend.«
Johann zuckte zusammen und stolperte dann ein kleines Stück rückwärts. Er lächelte verträumt.
»Du hast so schöne Härchen auf der Oberlippe«, sagte er mit einer Stimme, die von einem anderen Stern zu kommen schien.
Anna sah ihn entsetzt an. All ihre Begeisterung, all ihre Neugier, all ihre Zuneigung war mit einem Mal wie weggeblasen. Sie runzelte die Stirn. Ihre Augenbrauen schlossen sich zu einer geraden Linie über den Augen.
»Johann Friedrich Gignoux«, platzte es aus ihr heraus. »Man sagt einer Frau nicht, dass sie Härchen auf der Oberlippe hat! Egal, wie viele Wunder man ihr zuvor gezeigt hat!«
3
SOMMER 1740
Die Mutter musste Anna ein neues Kleid geben. Natürlich hatte sie sich in der Druckerei den Rock beschmutzt. Tropfen der gelblichgrünen Flüssigkeit waren auf den Stoff geraten – und jetzt sah man darauf lauter blaue Flecken.
Maria Koppmair hatte nur den Kopf geschüttelt, aber merkwürdigerweise nichts gesagt. Als wäre das alles unwichtig.
Anna war für den Abend ausstaffiert worden. Sie fühlte sich wie für eine Verkaufsschau hergerichtet, mit dem Unterschied, dass das Vieh, das man anbot, ihren Namen trug.
»Hört mal«, fuhr sie die Mutter entschieden an. »Ich komme mir bald vor wie eine ausgestopfte Gans.«
Maria Koppmair musterte sie. Sie musste sich drehen. Und die Mutter lächelte verträumt. »Keine Gans, Kind. Ein junger Schwan.«
So ganz unrecht hatte sie damit nicht. Die Mutter hatte ihr die Brust mit kleinen Kissen ausstaffieren müssen. Ihr gefiel auch nicht, dass das wenige, was sie besaß, beinahe gewaltsam nach oben gedrückt wurde. Es tat weh und war unbequem. Hinzu kam, dass sie kaum Luft bekam. Ihre Mutter hatte darauf bestanden, das Kleid eng zu schnüren. Zwar brauchte sie noch kein Mieder, aber die Taille war wie mit einem Harnisch zusammengepresst. So hätte sie jedem Schwertangriff sorglos standhalten können.
In ihre Haare waren echte Blumen eingesteckt, und aus dem Schmuckkästchen der Mutter wurde ein Haarreif herausgekramt, von dem Anna gar nicht gewusst hatte, dass er existierte. Sogar ein goldenes Kettchen mit einer roten Koralle als Stein legte sie ihr um den Hals.
»Soll ich wirklich verkauft werden?«, keuchte Anna. Sie atmete schnappend mit kurzen Stößen und hatte ständig das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen. Ihre Schwester Susanna hatte eine Bemerkung in dieser Richtung gemacht und dabei gekichert, was sie völlig verunsichert hatte.
»Kindchen. Du bist fünfzehn Jahre alt. In dem Alter tragen andere Frauen bereits ihr zweites Kind unter dem Herzen«, sagte ihre Mutter im Plauderton, als gelte es zu klären, dass es dieses Mal ernst war.
»Es wird doch nur eine Einladung mit Gesprächen. Mehr nicht – oder etwa doch?«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf.
Als der Vater anklopfte und das Zimmer betrat, blieb er stehen.
»Meine beste Arbeit in der Auslage!«, murmelte er bewundernd und erntete sogleich den Protest seiner Tochter.
»Ich bin keine Ware!«, schimpfte Anna.
Im Hintergrund schlug die Domglocke.
»Wir sind schon spät«, drängte der Vater und zog beide Frauen an sich. »Na. Zwei Juwelen an meiner Seite.« Sie stiegen die Treppe hinab. Ihr Vater rief noch in den Raum, in dem die Quetschen-Hämmer gerade entkoppelt wurden: »Macht Schluss für heute. Für jeden ein Bier auf meine Rechnung.«
Die Gesellen beeilten sich, den Anordnungen des Meisters nachzukommen.
Ihr Vater nahm die Lederbücher entgegen, in denen das Gold zu hauchfeinen Plättchen gehämmert wurde, und sperrte sie in eine Truhe, die fest am Boden verankert war. Massive Eisenbänder umschlossen sie, und ein unüberwindbares Schloss sicherte den Inhalt vor begehrlichen Händen.
Seit Anna denken konnte, war das der Abschluss des Tagwerks: Der Vater steckte den Schlüssel ins Schloss, entriegelte einen geheimen Stift und öffnete den Deckel. Die drei Bücher mit den etwa fünfzig Goldfolien kamen zu den übrigen Wertsachen. Schließlich klappte er die Truhe zu, hängte den Schlüssel wieder an den Gürtel und gab den Frauen das Zeichen mitzukommen.
Drei Laternen zeigten ihnen den Weg, obwohl es noch taghell war.
Anna spürte, wie ihr die Röte den Hals hinaufkroch.
Ob Johann auch da sein würde? Anton war noch auf der Walz. Erst in einem halben Jahr wurde er zurückerwartet.
»Wen hat Monsieur Gignoux noch eingeladen?«, wagte sie ihre Mutter zu fragen, die sich am Arm ihres Mannes eingehängt hatte.
Maria Koppmair schritt die wenigen Meter von ihrem Zuhause bis zum Gignoux-Haus wie eine Adlige, fand Anna. Schlank und feingliedrig, wie sie war, machte sie eine beeindruckende Figur. Allerdings kämpfte auch sie mit der Luft und bat ihren Gatten, etwas langsamer zu gehen.
»Wenn ich noch langsamer gehe, bleibe ich stehen«, maulte der. Doch dann wandte er sich an seine Tochter. »Ein junger Kaufmann aus Straßburg soll kommen. Johann Heinrich Schüle. Zwanzig erst, aber ganz schön forsch. Er kauft hier in Augsburg Tuche ein, und …« Koppmair senkte die Stimme. »… er hat Verbindungen, um an indisches Zitz zu gelangen. Das ist feiner gewebt als das Augsburger Tuch – und doch billiger.«
Langsam begriff Anna, woher der Wind wehte.
»Auch Caspar Walter«, flüsterte der Vater weiter. »Der Brunnenmeister, der demnächst zum Augsburger Stadtbrunnenmeister erhoben werden soll. Vorgeschlagen dafür ist er. Allerdings ist er schon verheiratet. Auch der Händler Elias Hayum hat zugesagt. Und der Landkartenstecher Tobias Conrad Lotter und seine junge Gattin wollen ebenfalls kommen.«
Von Walter hatte sie gehört. Von seinen Bemühungen um die Wasserversorgung der Stadt. Anna hoffte nur, dass sie alle ihre Frauen mitbrächten, damit die Gespräche wenigstens einigermaßen anregend wären. Und sie hoffte, Johann zu sehen.
Sie brauchten nicht zu klopfen. Die Tür stand offen, und Gignoux’ Frau Felicitas winkte sie herein.
»Walter ist schon da«, flüsterte sie, während sie an ihr vorbei nach hinten gingen. »Und Schüle auch. Ein fescher Mann. Und Lotter auch.« Ihre Augen glänzten.
Sie mussten drei Stufen nach unten gehen, unter das Niveau der Straße. Im Raum links standen die Webstühle, die Johanns Vater noch immer betreiben ließ. Rechts ging es in den ersten Stock hinauf und in den Salon. Es war eine schmale, steile Treppe, die sie nacheinander betraten. Von Johann war nichts zu sehen. Selbst die wenigen Stufen in den ersten Stock ließen Anna außer Atem kommen, und sie taumelte leicht. Doch da war hinter ihr jemand, der ihr ans Gesäß griff und sie stützte. Hätte sie scharf einatmen können, hätte sie es getan.
»Fallt mir nicht, Jungfer Anna«, säuselte Johanns Stimme hinter ihr und drückte sie weiter hoch.
Der Rock und die Unterröcke sowie ihre Schnürung machten es ihr unmöglich, sich umzudrehen. »Finger weg!«, zischte sie.
Sofort war ihre Mutter hellhörig.
»Anna Barbara, was gibt es da?«, fragte sie scharf.
»Nichts«, schwindelte Anna, obwohl Johann noch immer seine flache Hand an ihrem Gesäß hatte und sie nach oben schob. »Ich wäre nur beinahe gestürzt.«
»Um Gottes willen, Kind«, seufzte Maria Koppmair. Doch der Bass des Hausherrn Gignoux, der sie oben überschwänglich begrüßte, ließ sie den Vorfall offenbar schnell vergessen.
»Lieber Koppmair, meine liebe Maria!«, rief Jean François Gignoux mit seiner singenden Betonung und den im Hals kratzenden Endungen. »Ich freue mich so. Kommt mit in den Salon.« Er wollte sich schon umwenden und vorausgehen, als er Anna entdeckte. »Oh – und wer ist diese Orchidee in unserem Haus? Ihr seht bezaubernd aus, Mademoiselle Koppmair.«
Anna sah sich gezwungen zu lächeln, obwohl sie sich am liebsten ihre Kleidung vom Leib gerissen hätte und davongelaufen wäre. Sie konnte kein Wort sagen, so sehr musste sie um Luft ringen. Vor ihren Augen flimmerte es leicht – nur eines spürte sie deutlich. Die Hand war ebenso verschwunden wie Johann.
Ihr Vater und ihre Mutter ließen sich in den Salon führen, der das ganze obere Stockwerk umfasste. Für einen Model-Formschneider wie Gignoux war es ein stattlicher Raum.
»Dahinten, dieser kleine Mann, mit den nahe zusammenstehenden Augen, das ist Tobias Lotter«, flüsterte ihr die Mutter zu. »Seine Frau ist eine Augenweide. An ihr könntest du dir ein Beispiel nehmen.«
Den Raum und das Gespräch beherrschte allerdings ein großer, schmaler Mann. Er hatte eine hohe Stirn, aber eine ebenso hohe Stimme, die nicht so recht zu ihm passen wollte. Die Perücke war ihm leicht in den Nacken gerutscht, was die Denkerstirn betonte. Seine Nase war energisch steil und spitz.
Ein junger Geck in bunter Kleidung stand neben ihm und schien seinen Ausführungen zu lauschen.
»Und stellen Sie sich vor, Monsieur Schüle. Wenn in diesem Becken ein Problem entsteht und man rasch hinaufmuss, dann muss der Aufsteigende warten, bis der Absteigende unten angekommen ist. Das verzögert alles. Ich werde eine zweite Treppe bauen müssen.«
Annas Blick wurde langsam wieder klar, und sie konnte dem Gespräch folgen, ohne das Gefühl zu haben, im Nebel zu stochern.
Natürlich unterhielten sich die Männer und Frauen über das, was sie antrieb, was sie tagsüber beschäftigte. Caspar Walter über das Wasser und die Wasserversorgung, ihr Vater über das Goldschlagen und Gignoux über die Stoffveredelung. Aber wer war dieser Schüle?
»Was treibt Euch in unsere Gefilde, Monsieur Schüle? Sollte ein junger Mann wie Ihr nicht nach London unterwegs sein, oder nach Rom?«, fragte sie ihn unumwunden, als der Brunnenmeister einmal Luft holen musste.
Mit einem galanten Kopfnicken wandte sich der Geck ihr zu. In seinen Augen blitzte für einen kurzen Moment Dankbarkeit auf, wohl weil sie den Redefluss des Brunnenmeisters unterbrochen hatte.
»Tuche«, sagte der junge Mann. »Augsburg ist eine Textilstadt und produziert Baumwolltücher. Ich bin Kaufmann und handle mit Tuchen. Ein Hundsfott, der Böses dabei denkt. Ich will mich hier umschauen, ob es sich lohnt, mit den Zünftlern ins Geschäft zu kommen.«
»Da muss ich Euch leider enttäuschen, Schüle«, lachte Walter. »Die Zünfte mögen es nicht, wenn jemand von außen hereinschneit und sich an den Stoffen einheimischer Zünfte versucht.«
Jetzt lachte Schüle offen – und Anna fand dieses Lachen durchaus ansprechend.
»Ihr klingt nicht danach, als wäret Ihr in unseren Gefilden aufgewachsen, Monsieur Schüle«, hauchte Anna. Das Kleid verwehrte es ihr sogar, der Stimme Druck zu verleihen.
»Ihr habt ein feines Ohr, Mademoiselle. Ich komme aus Künzelsau, habe aber in der Textilstadt Straßburg und in Kaufbeuren südlich von Augsburg gelernt. Was dort möglich ist, sollte in Augsburg nicht unmöglich sein.«
Er strahlte sie regelrecht an. Und für einen Moment verdrängte Anna den Gedanken an Johann.
»Wenn die Zünfte nicht verkaufen wollen, werdet Ihr Euch die Zähne ausbeißen«, tönte der Hausherr, bevor er sich wieder unter die Gäste mischte.
»Oh, dann eröffne ich eben meine eigene Stoffdruckerei!«, verkündete Schüle.
Plötzlich war es still im Raum. Man hörte nur noch das Rascheln der Kleider und das schwere Atmen der Frauen. Anna bemerkte es sofort. Nur dieser Schüle schien für den Umschwung der Stimmung kein Gespür zu haben. Er lachte, als hätte er einen besonders guten Witz gemacht.
»Ihr solltet eine Wendeltreppe bauen lassen, bei der man gleichzeitig hinauf- und hinunterkommt, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten, Herr Walter. Eine doppelte Wendeltreppe sozusagen«, warf Anna ein, um das peinliche Schweigen zu beenden.
Alle schauten sie an. Caspar Walter schlug sich zuerst auf die Schenkel, dann gegen die Stirn.
»Warum fällt mir so etwas nicht ein?«, rief er.
Die Gespräche begannen wieder, als hätte es die Bemerkung Schüles nie gegeben.
Anna lächelte nur und wandte sich an den Kattunhändler. »Woher kommt Ihr, sagtet Ihr?«
»Aus Künzelsau«, sagte er. »Im Württembergischen«, setzte er sofort hinzu, als er Annas gerunzelte Brauen bemerkte. »Aber Mademoiselle Koppmair. Ihr bekommt ja Falten, wenn Ihr Eure Brauen so zusammenschiebt.«
»Und dort sind die Zünfte nicht so rigoros wie in Augsburg?«
Jetzt war es an Schüle, die Stirn zu runzeln. Er drehte sich ihr ganz zu, was das Gespräch mit Caspar Walter beendete. Dieser ging hinüber zum Hausherrn.
Anna wusste, dass es jetzt Gesprächsstoff genug geben würde.
»Wie meint Ihr das?«, fragte der junge Geck.
Sie fand seinen Mund ein wenig zu breit, als dass er ansprechend gewirkt hätte. Das gab dem ganzen Aussehen etwas Überhebliches. Sein Rüschenhemd bauschte sich und stellte die Brust heraus.
»Hier in Augsburg kämpfen die Formschneider gegen die Zünfte an, wenn sie einen Färbermeister einstellen wollen.« Anna senkte die Stimme. »Der Hausherr musste sich erst einmal mit den Zünften auseinandersetzen, bevor sie ihm einen solchen genehmigten. Es hat elf Jahre gedauert, bis er eine Bleiche, eine Färberei und eine Druckerei für Textilien unter einen Hut gebracht hat. Dass ihm die Weber nicht nachts aufgelauert und ihn erschlagen haben, ist wohl der reine Zufall.« Sie lächelte ihn an, als hätte sie ihm gerade kein Lehrstück über die Augsburger Wirtschaftsverhältnisse geliefert.
Schüle aber war bleich geworden. Rasch sah er sich um. Die Gäste im Hause Gignoux steckten die Köpfe zusammen – und langsam schien er zu begreifen, was er mit seiner Bemerkung ausgelöst hatte.
»Da habe ich wohl in ein Wespennest gestochen!«, murmelte er.
Anna legte nur den Kopf schief, sagte aber nichts, während er sich langsam wieder fing.
»Ihr scheint – verzeiht mir die Bemerkung – als Mademoiselle ziemlich gut informiert zu sein«, setzte er hinzu. »Obwohl Ihr noch … sehr jung seid.«
Die letzte Bemerkung gab ihr einen Stich. Sie stimmte zwar, aber es aus dem Mund dieses Gecken zu hören, der nur wenig älter war als sie, schmerzte.
»Seid Ihr für eine Textildruckerei nicht auch noch – zu unerfahren?«, konterte sie. Ihr Lächeln wurde eine Spur eisiger. »Immerhin seid Ihr ein …«, sie stockte, um das, was sie sagen wollte, zu unterstreichen, »… ein Nichts, während Gignoux die bedeutendste Textildruckerei der Reichsstadt führt. Ach, was sag ich: im süddeutschen Raum. Keiner kann ihm das Wasser reichen.«
Schüle stutzte kurz, dann strich er sich verlegen über die Rüschen seines Hemdes. »Jetzt bin ich wohl in den nächsten Fettnapf getreten«, sagte er ehrlich verlegen. »Obwohl Ihr mir geholfen habt.«
Mit einem maliziösen Lächeln und gespitztem Mund wandte sich Anna um und ging davon.
Für eine kurze Zeit stand er allein da, bis der Hausherr darauf aufmerksam wurde und den Gast wieder zurück in die Gruppe führte.
Annas Mutter warf ihr einen Blick zu, der alles bedeuten konnte, aber durch die hochgezogenen Augenbrauen eine klare Botschaft enthielt: »Warum hast du den jungen Mann stehen lassen?«
Sie zuckte nur mit den Schultern und deutete auf ihren Bauch. Die Schnürung, malte sie lautlos mit ihrem Mund und verdrehte die Augen. Sie bekam keine Luft – und wer keine Luft bekam, konnte keine Konversation betreiben.
4
SOMMER 1740
Johann stand über ihr auf der Mauer und blickte wütend auf sie herab. Er stemmte die Hände in die Hüften. »Du hast ihn angehimmelt, als wäre er ein Gott! Musste das sein?«, herrschte er sie an.
Anna genoss seine Anschuldigungen. Seine Augen glühten vor Zorn, und seine Kiefer mahlten, als müsse er jedes Wort erst hervorkauen. Sie harkte das kleine Stück Erde weiter, das ihnen als Garten diente, ohne sich viel um ihn zu kümmern.
Sie hatte ein helles Kleid angezogen, das luftig und frisch war und nach Lavendelseife roch. Es passte zwar nicht zu ihrer Arbeit, aber der ging sie nur nach, weil sie gehört hatte, wie Johann auf die Mauer geklettert war. In ihrer Schürze steckte ein Buch, das sie gern gelesen hätte.
Mit einem Satz sprang Johann neben sie, und Anna tat so, als würde sie erschrecken. Dabei hatte sie gehofft, dass er zu ihr herunterkäme.
»Er wollte doch nur wissen, wie es um die Textilgeschäfte in der Stadt steht«, sagte sie unschuldig und lächelte innerlich. »Außerdem: Du warst es, der sich den ganzen Abend nicht hat blicken lassen. Mit wem hätte ich denn sonst reden sollen? Mit Caspar Walter? Über seine Wendeltreppe, die er jetzt bauen will, nachdem ich ihm die Idee dafür geliefert habe? Ich bitte dich!«
Johanns Zorn schmolz mit jedem Satz, den sie sagte. Schließlich stimmte es ja.
»Du hast mir nur in den ersten Stock geholfen – und dich dabei ziemlich ungebührlich benommen, Gignoux, wenn ich dich daran erinnern darf!« Sie sprach ihn mit seinem Nachnamen an, um ihn zu ärgern.
Johann verzog das Gesicht zu einem Grinsen, offenbar bei dem Gedanken daran, wie er ihr ans Gesäß gegriffen hatte. Er verschränkte die Arme hinter dem Rücken wie ein Alter und lief um sie herum. »Jemand musste ja nach den Bottichen schauen. Nach den Farben. Sie dürfen nämlich keinen Moment aus den Augen gelassen werden.«
»Lüg mich nicht an«, herrschte sie ihn an. »Dazu bist du ein zu schlechter Schwindler. Ich weiß nicht, was dich abgehalten hat, aber …«
Weiter kam sie nicht. Johann baute sich vor ihr auf. »Also gut. Es war mir verboten«, sagte er geradeheraus. »Ich durfte nicht. Es war mir verboten.«
Jetzt erst schaute Anna auf. Sie stellte die Harke auf und stützte sich darauf. »Warum das? Oder willst du mich wieder veralbern?« Sie sah ihm prüfend in die Augen. Doch diesmal schien es die Wahrheit zu sein.
»Du solltest dich … Ich sollte nicht …«
Anna schnaubte. Warum mussten Jungs nur immer herumstottern, wenn es um Gefühle ging? Zwar ahnte sie bereits, was der Grund gewesen sein könnte, doch sie wollte es aus seinem Mund hören.
»So!«, sagte sie und legte ihm eine Hand auf die Brust. »Du atmest jetzt ganz langsam. Dann schaust du mir in die Augen, denkst an das, was du mir sagen willst, und dann lässt du es Wort für Wort heraus. Langsam und überlegt.«
Zuerst runzelte Johann die Stirn. »Was soll das?«, fauchte er sie an. »Ich bin kein kleines Kind mehr!«
»Ach ja? Und warum stotterst du nur herum, statt mir ins Gesicht zu sagen, was du denkst?«
Verlegen blickte Johann auf seine Schuhe. »Weil du ein Mädchen bist … Und weil ich dir nicht wehtun möchte«, sagte er schnell und leise.
Kurz sah sich Anna um, ob sie auch niemand beobachtete. Dann trat sie einen Schritt vor und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Das war schön gesagt«, flüsterte sie.
Johann lief über und über rot an. »Sie wollten dich mit dem Kerl aus … aus … mit dem Tuchhändler verkuppeln. Ich hätte dabei nur gestört und dabei vielleicht Unsinn gemacht. Womöglich hätten sie sich auch nur über Antons Walz unterhalten. Deshalb hat Vater es mir verboten, beim Empfang und beim Essen dabei zu sein.«
Jetzt war es heraus, und Johanns Kopf hatte eine noch rötere Farbe angenommen.
Anna, deren Hand immer noch auf seiner Brust lag, hob diese und strich ihm zärtlich übers Kinn. »Danke, Johann«, sagte sie. »Ich wusste es. Aber ich freue mich, dass du es mir noch einmal bestätigt hast. Geh jetzt. Ich muss mit meinem Vater reden.«
Johanns Augen weiteten sich. »Aber … aber das kannst du nicht. Wenn er Widerworte hört, wird er dich aus Augsburg wegschicken und … und wir … ich … vielleicht sehen wir uns nie wieder.«
Jetzt lächelte Anna. »Unsinn«, sagte sie. »Wenn ich jemals einen Ehemann haben will, dann so einen wie meinen Vater. Er ist weitsichtig und voller Verständnis.«
Sie raffte den Rock und stapfte in Richtung Haus. In Gedanken malte sie sich aus, wie Johann dastand, mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf. Wie er ihr nachlauschte, ihrem raschelnden Kleid hinterherhorchte und sich schließlich aus dem Staub machte. Sie wollte sich nicht umdrehen und konnte aber nicht umhin, als sie die Tür aufdrückte, einen kurzen Blick zurückzuwerfen.
Johann stand da, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick ihr zugewandt und den Kopf schüttelnd. Offenbar konnte er nicht verstehen, was sie da tat – und doch hatte er sie nicht zurückgehalten. Ein Lächeln huschte ihr über die Lippen.
Mit dem Ruf »Papa!« betrat sie das Haus. »Papa!«
Sie musste ihn nicht lange suchen. Er stand in seinem Kontor und prüfte die Lederbücher. In ein Auge hatte er eine Lupe geklemmt, mit der er die Feinheit der Goldfolien kontrollierte. Offenbar war er zufrieden mit dem, was er sah.
Während in einem Auge noch die Lupe klemmte, musterte er mit dem anderen seine Tochter. Anna wusste, wie vernarrt er in sie war.
»Papa!«, stieß sie dennoch hervor und ließ das höfliche »Herr« dabei weg. Eigentlich eine Unziemlichkeit, die ihr die erhobene Augenbraue des Vaters bescherte.
»Du störst!«, sagte er nur knapp.
»Herr Papa. Ich muss mit Euch reden.«
»Ach ja«, antwortete er nur und widmete sich wieder seiner Prüfung. »Dann musst du warten. Ich muss dieses Buch examinieren, bevor die Folien in Papier gelegt werden können.«
»Es muss jetzt sein. Sofort!«
Sie wusste, er konnte ihr solche Dringlichkeiten nicht abschlagen. Dazu war sein Wesen zu weich, die Liebe zu Frau und Tochter zu groß. Aber er musste den Hausherrn spielen. Demonstrativ verärgert klappte er das Lederbuch zu, legte es weg und nahm die Lupe aus dem Auge. Dann stützte er sich mit beiden Händen auf dem Pult ab. Mit einer Stirn, die sich in unzählige Falten warf, wandte er sich ihr zu.
»Also. Ich habe nicht ewig Zeit, Tochter. Die Eskapaden meiner Frauen, die sich in ihren hübschen Köpfen bilden, muss ich mit mehr Arbeit ausgleichen. Also, was bedrückt dich, Kind?«
Anna spitzte die Lippen. Wenn er sie Kind nannte, wollte er klarstellen, welches Verhältnis zwischen ihnen herrschte. Sie konnte ihn bitten, aber nichts fordern.
»Ich komme nicht mit einem unsinnigen Wunsch meines hübschen Köpfchens«, gab sie spöttisch zurück. »Mein Wunsch ist … mein Leben.«
Ihr Vater sah sie verständnislos an. Er blieb stumm, was Anna ihm hoch anrechnete. Er ließ die Mitglieder seiner Familie immer ausreden, bevor er antwortete und eine Entscheidung traf.
»Ich möchte selbst entscheiden dürfen, welchen Mann ich heirate. Etwas wie gestern, dass ich einem Mann vorgeführt werde wie ein Rassepferd, will ich nicht mehr über mich ergehen lassen. Dann gehe ich lieber in ein … ein …« Sie hätte gern Kloster gesagt, aber das war für eine Protestantin nicht möglich. Also ließ sie die Folgerung einfach offen. Sollte er denken, was er wollte.
Ihr Vater sah sie einfach nur an. In seinen Gesichtszügen war keine Verärgerung zu lesen, auch keine Ablehnung, sondern nur ein Staunen. Und die Mimik veränderte sich, wie sich das Aprilwetter wandelte. »Was habe ich da nur für eine Tochter großgezogen?«, murmelte er.
Anna atmete durch. Sie wusste sehr wohl, was ihre Forderung bedeutete. Keine junge Frau in der Nachbarschaft, ja, in der gesamten Stadt suchte sich ihren Bräutigam selbst aus. Das war Aufgabe der Eltern, und als Tochter hatte man sich zu fügen. Vater und Mutter wussten, welche Voraussetzungen nötig waren, klärten die Umstände, die Mitgift, die Versorgung. Eine Tochter musste gehorchen. Je angesehener die Familie war, desto umsichtiger wurde dabei vorgegangen. Schließlich war es eine Entscheidung auf Lebenszeit. Da hatten solche unsinnigen Gefühle wie Liebe oder Zuneigung hintanzustehen. Heirat war eine Geschäftsbeziehung.
All das spiegelte sich im Gesicht ihres Vaters.
Je länger seine Antwort auf sich warten ließ, desto mulmiger wurde es Anna. Schließlich musste er sich ja auch mit der Mutter absprechen. Sie hatte in Sachen Heirat und Versorgung der Tochter ein gewichtiges Wort mitzureden.
Sie sah, wie ihr Vater den Mund öffnete, um etwas zu sagen, ihn aber sofort wieder schloss. Offenbar wollte er nichts Unsinniges von sich geben, also schwieg er lieber. Zwei Falten bildeten sich über der Nasenwurzel senkrecht zu den Stirnfalten.
In Annas Augen traten Tränen. Stumm und entscheidungslos hatte sie den Vater nur selten erlebt. Er war ein Mann, der wusste, was er wollte, und sich für seine Verfügungen auch vor der Familie weder rechtfertigen musste noch schämte. Diese fiel ihm schwer, so schwer, dass er die Tränen seiner Tochter zwar bemerkte, doch ob sie seine Entscheidung beeinflussen würden, konnte Anna nicht mit Sicherheit sagen.
»Raus jetzt!«, herrschte er sie an. »Ich sagte schon, du störst. Wir sprechen beim Abendbrot darüber. Und glaube nicht, dass du das Recht hast, irgendwelche Forderungen zu stellen!«
Energisch klemmte er sich die Lupe wieder ins Auge und konzentrierte sich auf seine Arbeit. »Mach die Tür sanft zu. Du weißt, der Luftzug kann die Goldfolien beschädigen!«
Annas Unterlippe zitterte vor Unwillen und Enttäuschung. Dennoch schlich sie aus dem Raum und ließ die Tür leise ins Schloss fallen, obwohl sie diese am liebsten mit all der Kraft ihrer Enttäuschung zugeschlagen hätte, was ihr Vater sicher befürchtet hatte.
5
SEPTEMBER 1740
Johann drehte sich ein letztes Mal um. Er suchte das Dunkel des Tordurchgangs ab, ob sich nicht doch das Blitzen eines weißen Kleides zeigte. Aber die wenigen hellen Stellen waren die blanken Waffen der Stadtwache.
Es war einfach zu früh. Er hätte später loslaufen sollen. Nicht schon um sechs Uhr, sondern um zehn oder elf Uhr. Das hätte sie vielleicht geschafft.
Die Luft um diese Zeit war noch kühl, und ihn fröstelte. Er zog seinen Mantel enger, drehte sich nach Westen und stapfte los.