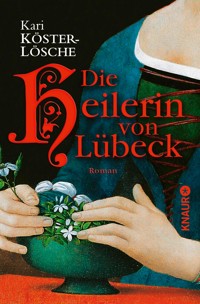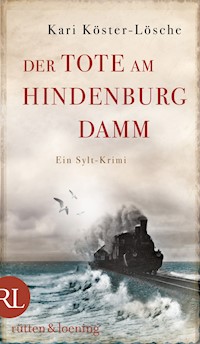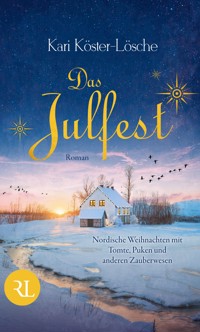6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein geldgieriger Erzbischof, der sich auf Kosten der friesischen Bauern bereichern will. Eine mutige junge Frau, die alles daransetzt, den Familienbesitz zu retten. Und eine gefährliche Pilgerreise nach Santiago de Compostela, bei der alles auf dem Spiel steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Kari Köster-Lösche
Die Strafpilgerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1234. Im Stedingerland setzen sich die friesischen Bauern vergeblich gegen das Kreuzzugsheer des geldgierigen Erzbischofs Gerhard II. zur Wehr. Unter dem Vorwand, das Nichtbezahlen der Steuern zu ächten, werden die Bauern getötet und etliche der reichen Höfe in kirchlichen Besitz übernommen. Nachdem der begüterte Gutsherr Tjard tom Dieke von den Soldaten erschlagen wurde, steht auch sein Hof vor der Übernahme. Doch seine Frau Taalke und Tochter Okka sind entschlossen, den Hof für die Familie zu retten.
Unterdessen werden alle überlebenden Stedinger durch eine päpstliche Bulle zu Ketzern erklärt; ihnen wird eine Bußwallfahrt nach Santiago de Compostela auferlegt. Da auch ihr Bruder ums Leben gekommen ist, entschließt sich Tjards Tochter Okka, die gefährliche Reise auf sich zu nehmen. Und viel steht auf dem Spiel, denn wenn die Büßer innerhalb der festgesetzten Zeit nicht zurückkehren, verlieren sie mindestens einen Teil ihres Besitzes an die Kirche, Unverheiratete wie Okka den gesamten Besitz. Und tatsächlich stößt Okka auf ihrer weiten Pilgerreise immer wieder auf Gefahren und unerwartete Hindernisse, die nahelegen, dass irgendjemand ein großes Interesse daran hat, dass Okka nicht wieder ins Stedingerland zurückkehrt …
Inhaltsübersicht
Karte
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil II
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil III
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Worterklärungen
Nachwort
Prolog
»Hoch mit ihm an die Rah!«, brüllte der Herzog zornbebend.
»Edler Heinrich, Herzog von Brabant«, flüsterte sein Sekretär mit weinerlicher Stimme, »den Kreuzfahrern ist vom Heiligen Vater vollkommener Ablass zugesichert worden. Es würde sich herumsprechen, wenn Ihr einen von ihnen mit dem Tode bestraft.«
»Das Pack hat rechtzeitig Gehorsam zu lernen«, schnauzte der Herzog. »Einer, der jetzt stirbt, erspart zehn anderen, gehängt zu werden.«
Dreißig Schiffe des Herzogs waren im Konvoi unterwegs nach Bremen, beladen mit Kreuzfahrern, die zur Unterstützung des Erzbischofs von Bremen, Bernhardt II., mit schweren Waffen und Pferden ins Stedingerland gebracht wurden.
Im Geiste rieb sich der Herzog schon jetzt die Hände. Er war bereits im Besitz von Brüssel, mitsamt Stadthafen und Seehafen, sowie weiterer Ländereien, die an die Nordsee grenzten. Ein Bein in die Weser und ihre Häfen zu setzen würde ihm nicht übel gefallen. Mit dem Grafen und Erzbischof Bernhardt würde er schon fertig werden. Übrigens auch im Hinblick auf diesen einen reichen Hof, den es da geben sollte und den er, Heinrich, als Stützpunkt für zukünftige Unternehmungen haben wollte. Wie hieß der noch gleich?
Grübelnd verfolgte er, wie der dummdreiste Kerl, der ihm widersprochen hatte, kopfüber vom Deck an die Rah hochgezogen wurde. Noch strampelte er mit dem freien Bein. Am anderen würde er hängen, bis er verdorrte, seinesgleichen zur Warnung. Jetzt fiel es dem Herzog wieder ein. Tom Dyk war wohl der ursprüngliche Familienname der Hofbesitzer, jetzt nannten sie sich tom Dieke.
Der Herzog wandte sich ab und wanderte zum achteren Aufbau der Kogge, wo neben dem Steuermann der Schiffsbesitzer stand, Wellen, Windrichtung und Kurs abschätzend. »Wie schnell werden wir in Bremen sein?«
»Das weiß nur unser Herr«, antwortete der Besitzer des Schiffes, ein Kaufmann.
»Habe ich Euch nach dem Willen des Herrn gefragt?« Der Herzog bölkte, wie es seine Art war, wenn jemand nicht sofort parierte. »Ihr sollt mir Auskunft geben!«
Der Steuermann verzog keine Miene. Der Kaufmann prustete abweisend, entschloss sich dann jedoch nachzugeben. »Herzog«, sagte er, »niemand außer unserem Herrn weiß, wie der Wind in den nächsten Tagen wehen wird. Bläst er aus einer Richtung zwischen achtern und halbem Wind, werden wir gut vorwärtskommen. Tut er das nicht, müssen wir voraussichtlich Schutz suchen in einem der kleineren Häfen oder hinter einer der Inseln, an denen wir vorbeimüssen. Ebenso, wenn die See ganz rauh werden sollte. Zwischen fünf und sechzig Tagen ist alles denkbar, um Bremen zu erreichen. Ist damit Eure Frage beantwortet?«
»Nein!«, schrie der Herzog außer sich und drosch dem Kaufmann mit seinem lose in der Hand gehaltenen Kettenhandschuh rechts und links über beide Wangen.
Der Schiffsbesitzer taumelte und hielt sich an seinem Steuermann fest. Aus seiner Nase strömte Blut, und zwischen den Lippen sickerten rote Rinnsale hervor, die ihm über das Kinn liefen.
»Habt Ihr immer noch nicht verstanden«, brüllte der Herzog, »dass ich Auskünfte brauche, mit denen ich etwas anfangen kann?«
»Auf See ist keine andere Auskunft möglich«, nuschelte der Kaufmann und sackte wie leblos aufs Deck.
Heinrich von Brabant spähte zum Vorschiff, wo sich eine Gruppe seiner bewaffneten Pilger aufhielt und den Streit neugierig verfolgte. Herrisch winkte er zu ihnen hinüber. Drei Männer lösten sich von den anderen und kamen beflissen zum Herzog getrabt.
»In die See mit ihm!«, befahl Heinrich.
»Aber, Herr«, stammelte einer der Kreuzfahrer, »der Kapitän lebt doch noch! Er atmet, seht nur.«
»Möchtest du neben ihm im Wasser landen?«
Mehr Worte waren nicht nötig. Die drei Pilger packten den Bewusstlosen und wälzten ihn über die niedrige Reling. Seine langen braunen Haare breiteten sich für einen Augenblick im Schaum einer weißen Welle aus, dann war er verschwunden.
Teil I
Bremen im Jahr des Herrn 1234
Kapitel 1
Teufelsanbeter und Ketzer! So stellt sich der Papst unser Land vor!«
Okka nickte. Sie kannte den Text, jeder in der Familie tom Dieke kannte ihn. Das päpstliche Schreiben Vox in Roma über die vermeintlichen Ungeheuerlichkeiten in Deutschland war ihrem Vater zur Leidenschaft geworden. Zuweilen sprach er über nichts anderes.
Tjard tom Dieke wischte gedankenlos Krumen vom Tisch. »Es wurde zwar schon im Jahr des Herrn 1233 geschrieben, aber auch jetzt, ein ganzes Jahr später, hat es seine Gültigkeit nicht verloren. Der Heilige Vater bezweckt damit etwas. Ich möchte wissen, was.«
Okka winkte mit der gebotenen Ehrerbietung ab. »Von einer Säule würde daraufhin rückwärts ein schwarzer Kater steigen. Auch dieser wird von allen Anwesenden auf das Hinterteil geküsst«, zitierte sie mit Spott in der Stimme. »Wer wird denn solchen Unsinn glauben, Vater? Welcher Bauer würde den Hintern von Tieren küssen? Wer auch nur einmal bei seinem Vieh stinkende Kotreste aus dem Fell bürsten musste …«
Vater Tjard, über die vielen Kämpfe, die er als Bauer gegen adelige Herren hatte führen müssen, frühzeitig grauhaarig geworden, seufzte tief. »Kind, du weißt nicht, was du redest! Im Papstpalast kennen sie die Tiere, die du meinst, nicht. Auf die Festtafeln kommen Kraniche, die nach dem Kochen mit einem Federkleid geschmückt werden, egal, von welchem Vogel, nur prachtvoll muss es sein. Und Wolle sehen sie ausschließlich brennend in den vergoldeten Schnäbeln der Pfauen, wenn die beim Bankett vermeintlich feuerspeiend hereingetragen werden.«
Okka, die hier im Haus kein Kopftuch trug, lachte derart, dass sich ihre hellblonden Flechten lösten und ihr über die Schultern herabfielen. Auch Reuke, ihr Bruder, grinste über beide Ohren. »Vater, wollt Ihr damit sagen, dass nach Ansicht der Geistlichen in Rom die Wolle auf den Zungen von Pfauen wächst?«
Der Vater nickte. Das Licht von der Feuerstelle beleuchtete sein Gesicht nur schwach, aber Okka konnte doch sehen, dass er nun selbst schmunzelte. »Man sollte es fast meinen, so wenig, wie sie vom kargen Leben der Menschen wissen, die ihre Nahrung selber beschaffen müssen.«
»Ich werde allen Geistlichen aus dem Wege gehen, Vater«, versprach Okka listig blinzelnd und kam wieder auf den Beginn der Diskussion mit dem Vater zurück. »Ich möchte endlich einmal wieder auf den Markt. Es ist schon so lange her, dass ich in Bremen war.«
»Zieh es bitte nicht ins Lächerliche«, versetzte Tjard. »Du weißt so gut wie wir alle, dass die Priester seit der Fastensynode vor zwei Jahren unser Stedingerland verlassen haben. Die stellen natürlich nicht die Gefahr dar, die auf den Straßen lauert! Auf unseren Wegen treibt sich vielmehr fremdes Kriegsvolk herum, und das fackelt nicht lange.«
»Wir wissen es, Vater«, bemerkte Reuke gelangweilt und strich sich seine kinnlangen, hellblonden Haare hinter die Ohren. »Ihr predigt nicht schlechter als ein Priester.«
»Im Übrigen sind die Priester noch gefährlicher als einfache Krieger«, setzte Tjard seine Ermahnungen fort. »Also außerhalb der Familie weiterhin kein abfälliger Ton über Rom oder die Kirche! Ganz gleich, mit wem ihr sprecht. Auch bei uns gibt es Spitzel, wie ich vermute. Es ist eine sehr menschliche Eigenschaft, sich auf diese Weise Vorteile zu verschaffen.«
»Erzbischof Bernhardt soll neulich im Land gesichtet worden sein«, erinnerte sich Okka. »In bewaffneter Begleitung, wie immer. Dann gehe ich eben …«
»Was sagst du? Woher hast du dieses Gerücht?«, unterbrach ihr Vater sie mit angespanntem Gesichtsausdruck.
Okka zuckte verblüfft die Schultern. Dass ein Erzbischof, der gleichzeitig Graf war, sich gelegentlich auf seinen Besitzungen aufhielt, hatte sie für normal gehalten. Ihr Vater anscheinend nicht. Er war beunruhigt. »Ich hörte zwei alte Mägde darüber sprechen, Luecke heißt die eine, die gehörte mal zu Hiskes Gesinde. Sie ist von dieser frömmelnden Art …«
Wieder unterbrach er sie. »Das spielt jetzt keine Rolle. Was genau haben sie gesagt?«
»Dass es eine Sünde sei, wie verlassen unsere Kirchen sich jetzt ausnähmen. Sie vermissten die Gewänder der Priester und ihren getragenen Gesang. Aber Seine Heiligkeit, unser Erzbischof Bernhardt, sei jetzt wieder da, und alles würde besser. Mehr weiß ich nicht. Ich hielt es für dummes Zeug von geschwätzigen Weibern. Seine Heiligkeit!«
»Wenn es stimmt, ist es kein dummes Zeug, sondern sollte uns argwöhnisch machen«, murmelte Tjard nachdenklich. »Dann liegt wieder etwas in der Luft. Ich werde mich selbst umhören.«
Reuke zog eine Grimasse, und Okka konnte sich denken, warum. Der Vater witterte in letzter Zeit überall Gefahren. »Was erwartet Ihr denn nach zwei Kriegen, die wir Stedinger gewonnen haben, Vater? Der Erzbischof und alle, die auf seiner Seite waren, haben sich blutige Nasen geholt und sollten daraus gelernt haben, sich hier nicht mehr blicken zu lassen.«
»Und wir haben vierhundert Mann verloren …« Tjard knirschte mit düsterer Miene mit den Zähnen. »Die Gegenseite könnte daraus leicht folgern, dass auch wir gelernt haben und nicht noch mehr Männer opfern können. Wir Stedinger sind ein kleines Volk.«
Dass er jetzt abgelenkt war, passte Okka hervorragend. »Der Friede währt nun schon ein halbes Jahr, Vater. Wir können uns doch nicht zeitlebens darauf einrichten, dass ein neuer Krieg droht, und uns im eigenen Weideland zu Gefangenen machen!«
»Nun, du bist jung, ich kann dich verstehen.«
Der Vater, ein stämmiger Mann mit von der Arbeit breiten Schultern, versank anscheinend in Nachdenken über seine eigene Jugend, was Okka einige Augenblicke Luft verschaffte, um zu überlegen, welche Taktik ihr jetzt am besten zum Erfolg verhelfen konnte. Sie wollte gar nicht auf den Markt, sondern war fest entschlossen, die städtischen Großkaufleute aufzusuchen. Es musste unter ihnen einen geben, der ihre unvergleichliche Feinwolle zu schätzen wusste. Die würde sie doch nicht einem der gräflichen Aufkäufer in den Rachen werfen! Die strotzten von Primitivität und hatten keine Ahnung von Wolle. Aber sie dachte gar nicht daran, dem Vater den Grund für ihren dringenden Wunsch zu erklären. Die Schafe waren ihre Verantwortung, abgesehen vom Wollverkauf, aber auch darauf war sie sehr stolz. »Wenn Ihr so gut wärt, Vater, mir als Begleitung Galt für einen Tag zu borgen, kann mir überhaupt nichts passieren.«
»Galt! Ausgerechnet«, schimpfte Vater Tjard, schon im Nachgeben. »Eigentlich brauche ich meinen Großknecht selber dringend. Du erhältst die Erlaubnis nur, weil du tollkühn genug bist, sonst ohne Begleitung zu gehen. Von wem du das wohl hast?«
»Ja, von wem wohl?«, neckte Okka ihren Vater und umarmte ihn stürmisch, statt sich mit einem Knicks zu bedanken. »Alle Männer dieser Familie sind so.«
»Eben. Die Männer!«, warf Mutter Taalke ein, die am anderen Ende des Hallenhauses den Hühnern Eischalen vorgeworfen hatte und jetzt leise zum Flett, dem Wohnbereich, zurückgekehrt war. Die Hände in die Hüften gestützt, betrachtete sie kopfschüttelnd ihre Tochter. »Wir Frauen sind meistens etwas klüger. Bei dir habe ich meine Zweifel.«
Okka schnitt eine Grimasse ins Wams ihres Vaters hinein. Die Mutter sollte ihr die Widerspenstigkeit nicht vom Gesicht ablesen können.
Am nächsten Morgen wanderte Okka los, begleitet von Galt, einem maulfaulen Riesen aus der sächsischen Urbevölkerung des Stedingerlandes, der mit unverbrüchlicher Treue zu den friesischen tom Diekes stand. Deren Familie war unter dem Hollerrecht vor rund hundert Jahren eingewandert, um bis dahin unbewohnbares Land urbar zu machen. Galt würde es zu schätzen wissen, wenn Okka ihn trotz ihres für gewöhnlich übersprudelnden Mundwerks in Ruhe ließ. Also hing sie ihren Gedanken nach, während sie auf dem niedrigen Deich entlang der Ochtum Richtung Bremen wanderten.
Im Augenblick dachte sie an die Schafe ihrer Herde, deren Wolle von der der gewöhnlichen Heidschnucken abwich. Seitdem sie sich als mannbare Frau betrachten durfte, kümmerte sie sich um die Herde, anfangs noch von ihrem Vater beraten, welchen Bock sie mit welchem Schaf paaren sollte, dann zunehmend in eigener Verantwortung. Tjard war darüber nicht unglücklich gewesen, hatte er doch zusammen mit seinem Sohn Reuke – Okkas zwei Jahre älterem Bruder, der schon einundzwanzig war – mit den Feldern und den Kühen genug zu tun. Hinzu kamen die kriegerischen Handlungen, denen sich alle Männer von Ehre seit Jahren immer wieder widmen mussten.
Es ging um die vielen Zwingburgen, die Edelherren und Grafen im Stedingerland errichten ließen, um die rechtmäßigen Eigentümer, die Bauern, unter ihre Knute zu zwingen. Immer wieder wurde aufs Neue gebaut, und immer wieder griffen die erzürnten Landleute Burgen und angeschlossene Klöster an und schleiften sie.
Zum Teil waren die hohen Herren dem Erzbischof hörig, zum Teil lagen sie mit ihm in Fehde. Und diese trugen sie auf dem Land der Stedinger aus, die sich gegen alle wehren mussten.
Die Stedinger waren, seit sie ihr Land urbar gemacht hatten, fast abgabenfrei, beabsichtigten dies auch zu bleiben und mussten sich daher in regelmäßigen Abständen gegen den Adel der Umgebung wehren, der sich diesen neu geschaffenen Reichtum einverleiben wollte. Die tom Diekes gehörten zu den wichtigsten und vornehmsten Verteidigern der bäuerlichen Rechte, und darauf war Okka stolz. Da es schon längere Zeit keine Auseinandersetzungen mehr mit den Burgbesatzungen gegeben hatte, schien im Augenblick die Gefahr nicht groß und also die Gelegenheit günstig, sich in Bremen nach einer neuen Handelsverbindung umzusehen.
In der Nähe hoben zwei Störche ab.
»Da kommt ein Trupp Burgmänner, Okka«, unterbrach Galt ihre Gedanken.
»In den Graben!«, zischte Okka erschrocken, »vielleicht haben sie uns noch nicht gesehen.« Sie rannte den Deichabhang hinunter.
Galt stolperte hinter ihr her. »Sie haben. Sie traben schon an.« Er schulterte seine Forke auf der rechten Seite und legte den Packsack auf die Linke.
»Wir können es nicht mit vier gerüsteten Kerlen aufnehmen!«
»Wir müssen.« Galt stellte sich breitbeinig vor Okka, die Forke bereit zum Zustechen, und erwartete die Reiter, die vor ihm zum Halt durchparierten.
Okka musterte sie. Drei waren Knechte, der vierte ein Ritter. Die Knechte blieben manierlich, wahrscheinlich warteten sie ab, wie ihr Herr sich verhalten würde.
Dieser betrachtete Okka wie eine willkommene Beute, ohne Galt zu beachten.
Okka wurde unruhig. Was plante er? »Wer seid Ihr?«, entfuhr es ihr herrisch. Es war heraus, bevor sie merkte, dass sie sich im Ton vergriffen hatte.
»Welch niedliche Kratzbürste läuft uns denn heute über den Weg!«, rief der Ritter mit falschem Grinsen. »Gewohnt, die Wolle eines stinkreichen Bauern zu kratzen, so wie du gekleidet bist? Immer hochnäsig, diese verfluchten Stedinger, ihre Mägde sind besser ausstaffiert als bei unsereinem die Töchter!«
Er hielt sie für eine Magd, weil die Bauern Frau und Töchter für gewöhnlich nicht ohne bewaffnete Begleitung gehen ließen. Dabei würde Okka es fürs Erste belassen. Fieberhaft überlegte sie, wie sie sich aus der Klemme winden könnte.
Der Kerl erhob sich in den Steigbügeln und schaute sich im fast baumlosen, flachen Land um, in dem nur die Gräben manchmal von Büschen gesäumt wurden. Seiner zufriedenen Miene konnte Okka entnehmen, dass sie auf weiter Flur allein waren. Ihre Hände krampften sich zusammen, als er seinen gierigen Blick wieder auf sie richtete.
»Ein so bildschönes Gesicht wie deins verdient eine Antwort. Wärst du keine Magd, wärst du wohl auch für einen Ritter begehrenswert.« Er machte eine Pause und lächelte falsch.
Aber Okka gab sich keiner Illusion hin. Die Situation war brandgefährlich.
»Also: Wir sind Mannen des Grafen von Bruchhausen, und du gehörst jetzt mir. Wenn ich mit dir erst fertig bin, wird dein Gesicht aussehen, als hätte ein Blechschmied es bearbeitet, und reden wirst du dann nicht mehr wollen. Du machst einen wehrhaften Eindruck, das liebe ich.«
Sie musste den Mann in ein Gespräch verwickeln! »Zum Erzbischof gehört Ihr also. Die Stedinger liegen derzeit mit ihm nicht im Streit.«
»Meinst du das? Ein Weib mit dem Gehirn einer Heuschrecke? Das Denken überlass Männern wie mir und Seiner Eminenz Bernhardt II.!«, rief der Ritter überrascht und zog die Zügel an, so dass sich sein schweres Pferd am Gebiss abkaute. »Trotzdem, wenn du frech eine eigene Meinung dazu äußerst, bist du wohl gar keine Magd. Noch besser!«
»Natürlich nicht«, antwortete Okka bestimmt und schob Galt beiseite, in der Hoffnung, dass der nun nicht ihren Namen ausplaudern würde. In dem Fall würde der Ritter sie wahrscheinlich als Geisel mitnehmen, und das konnte für die Familie schlimmer ausgehen als alles andere. Galt schien gottlob zu spüren, dass er besser den Mund hielt. »Würdet Ihr mich jetzt durchlassen? Ich bin in Geschäften auf dem Weg nach Bremen.«
»Bei dem Frieden, der plötzlich zwischen euch Bauern und dem Erzbischof zu herrschen scheint, willst du bestimmt ihn zu einem Geschäft überreden!« Der Ritter brach wieder in Gelächter aus, und seine Knechte stimmten mit ein.
Bernhardt hielt sich also tatsächlich gerade in Bremen auf! Dann hatte der Ritter ihr den Ausweg geboten, den sie suchte, und diese Idee beabsichtigte Okka flugs umzusetzen. »Gib mir mal den Sack, Galt«, forderte sie und fuhr, an den Ritter gewandt, in aller Ruhe fort: »Richtig geraten. Zu seiner Eminenz will ich.«
Der Ritter sperrte den Mund auf und schnaufte laut. Der Hellste war er nicht. Im Gegensatz zu Galt, der den Sack vor Okka abgesetzt hatte und ihn in Windeseile aufzuschnüren begann. Dann holte er eine Handvoll gewaschene und gekardete Wolle heraus, um sie wortlos dem Ritter zu präsentieren.
»Dies ist«, begann Okka mit erhobener Stimme, »eine ganz besondere Wolle, fein wie Spinnweben und schlohweiß. Keine kratzige Heidschnuckenwolle. Sie steht der Wolle, die sich der Heilige Vater aus dem byzantinischen Reich liefern lässt, in nichts nach.« Sie ließ ihre Worte wirken.
»Byzantinische Wolle«, wiederholte der Ritter beeindruckt. Die kannte er.
»Genau! Feinwolle! Keine Mischwolle, keine Grannenhaare und schon gar kein Vlies. Eine solche Ware hat es bisher in unseren Landen noch nicht gegeben, aber meine Familie versteht Schafe mit dieser Wolle zu züchten. Es ist ein Familiengeheimnis …«
»Familiengeheimnis. Bei einem Bauern im Stedingerland …« Unzusammenhängende Brocken tröpfelten dem Ritter wie einem Irren aus dem Mund.
»Genau! Versteht Ihr nun? Erzbischof Bernhardt lässt Euch vierteilen, wenn das Familiengeheimnis, das im Grunde meines ist, durch eine Unachtsamkeit verlorengeht. Oder gar durch einen unüberlegten Übergriff seiner Mannen auf mich und meinen Knecht. Ich bin unterwegs zum Erzbischof, um ihm den Vorschlag zu unterbreiten, in Zukunft sein Erzbistum mit feinsten Wollstoffen zu beliefern. Das könnte das Geschäft seines Lebens werden.«
»Tatsächlich. Ihr scheint unsere Eminenz zu kennen«, murmelte der Ritter. »Er vergisst über der geistigen Nahrung nie die leibliche.«
»Eben. Das ist es, womit er sich ein gewisses Vertrauen schafft«, schwindelte Okka. »Sogar bei uns. Dafür haben wir Verständnis.«
»Darf ich einmal anfassen?«
»Aber nehmt Euch in Acht. Die Wolle wurde mit Hilfe von warmem Öl gekämmt, um die Fasern nicht zu beschädigen, und ich möchte nicht, dass Ihr sie mit Euren groben Händen zerspleißt.«
»Ich bin ganz vorsichtig!« Um seinen guten Willen zu zeigen, ließ sich der Ritter vom Pferd gleiten und beugte sich über den Sack, nachdem er einen seiner Kettenhandschuhe ausgezogen hatte.
Okka gelang es mit einem drohenden Blick, Galt davon abzuhalten, ihm das Rückgrat mit dem Stiel seiner Forke zu brechen.
Der Ritter ließ die Fasern mit einem sehnsüchtigen Seufzer wieder in Okkas Sack rieseln. »Wenn wir Mannen doch auch Zugang zu solch wunderbaren Stoffen hätten! Die Wolle, die ich tragen muss, lässt mich schier aus der Haut fahren! Es juckt wie die Hölle, und ich kratze, aber davon verschwindet kein einziger Pickel.«
»Heidschnuckenwolle natürlich. Ich kenne deren Unverträglichkeit. Aber glaubt mir: Wenn die feine Wolle erschwinglicher wird, weil die Schafe unseres eigenen Landes sie liefern, kommt bald jeder Burgmann in den Genuss weicher Gewänder.« Okka lockte mit feinem Sinn dafür, wo es den Mann zwickte, dann fuhr sie betrübt fort: »Sofern es uns gelingt, unbeschadet nach Bremen zu gelangen. Ich hätte den Gang gar nicht gewagt, wenn ich gewusst hätte, dass der Erzbischof seine Mannen wieder durchs Land schickt.«
»Es wird mir eine Ehre sein, Euch sicher nach Bremen zu geleiten«, versprach der Ritter feierlich.
»Oh, würdet Ihr das tun?«, fragte Okka in überraschtem Ton. »Ich bin sicher, Erzbischof Bernhardt wird sich Euch gegenüber erkenntlich zeigen. Vielleicht sogar mit dem Hemd, nach dem Eure empfindliche Haut verlangt. Soll ich ihm einen kleinen Hinweis geben?«
Vor dem Ritter auf dem Rist seines Pferdes sitzend, erreichte Okka Bremen schneller als gedacht. Galt musste hinterherlaufen, aber er schaffte es, weil die Reiter mit Rücksicht auf Okkas nunmehr kostbar gewordenes Hinterteil langsam trabten und ihre Pferde in regelmäßigen Abständen Schritt gehen ließen.
Ein wenig Angst vor ihrem eigenen Mut bekam Okka erst, als sie die mit einer Mauer und Wehrtürmen geschützte Stadt vor sich sah und mitten darin die steinernen Kirchen, die selbst wie Befestigungen wirkten. Zwar war sie schon hier gewesen – doch nie ohne den Vater.
Aber was konnte ihr schon passieren? Allenfalls würde sie auf Ablehnung stoßen. Weitaus gefährlicher war die Begegnung mit den Bewaffneten auf einsamem Feld gewesen, und die Situation hatte sie gemeistert.
Das Holz der Weserbrücke dröhnte unter den Hufen der Pferde, und die Fußgänger beeilten sich, den gräflichen Mannen Platz zu machen. Okka wurde an der Liebfrauenkirche, der Kirche des Rats, außerhalb des Dombezirks vom Pferd gehoben.
Die einst hohe Mauer des Bezirks war längst abgerissen worden, weil Bedarf für die Steine bestand, aber die Grenze zwischen dem geistlichen und dem bürgerlichen Bremen blieb erkennbar. Mit einem entschuldigenden Lächeln meinte der Ritter: »Ich lasse mich nicht gern mit einer Dame im Sattel von den Domgeistlichen erblicken. Wer weiß, welche Gerüchte dann wieder von Neidhammeln in die Welt gesetzt werden. Unser oberster Lehnsherr sieht es nicht gerne, wenn unsereiner eine Liebschaft anfängt.«
Gewalt ist hingegen wohl kein Anlass für Tadel, dachte Okka erbost und beeilte sich, ihm zuzustimmen, umso mehr, als auch sie nicht direkt vor dem erzbischöflichen Eingang abgeladen werden wollte. »Ich danke Euch für das Geleit, Ritter. Gehabt Euch wohl.«
»Ich wünsche Euch viel Glück und den Segen unseres Herrn. Wenn Ihr das Geschäft mit dem Erzbischof macht, denkt an mich. Ich habe Euch beschützt …« Der Ritter schien sich förmlich vor ihr verneigen zu wollen, dann beugte er sich jedoch grinsend herab und flüsterte ihr ins Ohr: »Wundert Euch nicht, wenn die Wachen Euch ohne Zögern zum Erzbischof führen. Er ist auch nur ein Mann. Auf seinen Burgen sind Frauen allerdings häufiger als hier im erzbischöflichen Palast.«
Dann richtete er sich abrupt auf und gab seinen Männern ein harsches Zeichen zum Umkehren, worauf sie im Pulk zur Balgebrücke trabten, ungeachtet der dichten Menschenmenge, die zum Markt strebte. Als die Warnrufe der beiseitespringenden Fußgänger abgeebbt waren und die auf- und abwippenden Lederkappen der Krieger nicht mehr zu sehen waren, stieß Okka einen erleichterten Seufzer aus.
»Wir sind mit knapper Not entkommen, Okka. Wenn dein Vater das wüsste, würde er mich rösten.« Galt war unter seiner sonnengebräunten Haut ganz blass geworden.
»Na, es ist doch gut gegangen. Am besten, wir reden zu Hause gar nicht über den kleinen Zwischenfall.«
Okka kehrte dem Dombezirk, den sie mit allen Fasern ihres Herzens hasste, den Rücken und wandte sich zur Obernstraße, gefolgt von Galt.
Kapitel 2
In der Obernstraße hatten die meisten vornehmen Kaufleute ihre Handelshäuser, so viel wusste Okka. Die Schwierigkeit bestand darin, dass sie über ihren gewagten Plan, die besondere Wolle nach Bremen zu verkaufen, mit niemandem hatte sprechen können. Ihr Vater hätte ihr das Ansinnen kurzerhand abgeschlagen und sie unter Aufsicht auf dem Hof festgehalten. Nur er verhandelte über Wollpreise, und Okka war nicht ein einziges Mal dabei gewesen, wenn die gräflichen Aufkäufer kamen, denn es war allemal besser, mannbare Töchter vor ihnen zu verstecken.
Das verstand sie zwar, aber sie fand es trotzdem ärgerlich, dass sie dadurch nicht die geringste Ahnung hatte, an welchen Handelsherrn sie sich wenden konnte. Außer ehrbaren Kaufleuten gab es schließlich auch Betrüger.
So wanderte sie mit dem hinter ihr herzockelnden Galt die Gasse entlang und versuchte an den Hausfassaden zu erkennen, welcher Kaufmann ehrlich war und wer eher nicht. Die reichsten Kaufleute hatten sich in den letzten Jahren Handelshäuser aus Ziegelsteinen erbaut.
Das Gedränge war groß, sie mussten sich ihren Weg entgegen dem Strom von Bürgern, Mägden, Handwerkergesellen und zweifelhaften Gestalten bahnen, die zum Markt am Liebfrauenkirchhof unterwegs waren. Während Okka zu einem Giebel hochspähte, merkte sie, wie sich jemand an ihrem Gürtel zu schaffen machte.
Galt griff bereits zu. »So haben wir nicht gewettet, du kleiner Lump«, raunzte er einem halbwüchsigen Buben zu und entwand ihm das winzige Messer, mit dem er gerade Okkas Geldbeutel hatte vom Gürtel schneiden wollen.
Der Junge nahm Reißaus, duckte sich unter den Ellenbogen der Passanten weg, und fort war er. Galt war durch den Wollsack behindert und hatte keine Hand frei, um ihn beim Schlafittchen zu packen.
Okka zuckte die Schultern. »Lass ihn laufen. Ich bin selbst schuld, an so etwas habe ich nicht gedacht.« Sie hatte lediglich Galt beschworen, den Sack unter keinen Umständen loszulassen. An diesem Tag war er das Wichtigste, was sie mit sich führten, wie sich in der Frühe erwiesen hatte.
»Wohl wahr«, knurrte Galt. »Wenigstens bedeuten die vielen Diebe und Bettler, dass diese Stadt reich ist. Gut für Verkäufer von hervorragender Ware.«
Okka lachte. »Wir müssen nur den richtigen Käufer finden.«
Nach vier vergeblichen Versuchen bei den reichsten Kaufleuten machten sie schließlich Rast an der Balge neben der Stintbrücke. Galt ließ sich ein Riesenstück Kalbfleischpastete vom Garbäcker auf dem Markt schmecken, und Okka hielt einen in Schmalz ausgebackenen, mit Käse gefüllten Kringel in der Hand.
Während sie gedankenlos die neben der Zugbrücke festgemachten kleinen Boote und Kähne betrachtete, tropfte ihr das Fett von den Fingern und auf ihr gutes Kleid. Sie hatte keinen Appetit. So schwierig hatte sie sich die Suche nach einem Kaufmann, der exzellente Wolle zu schätzen wusste, nicht vorgestellt. Hoffentlich schlug nicht der ganze Plan fehl.
»Soll ich dich von deinem Kringel befreien?«, fragte Galt, immer noch hungrig.
»Ja, gerne. Was machen wir denn jetzt?«
»Weitersuchen.«
»Aber wo? Diese Pfeffersäcke sind sich alle irgendwie ähnlich.« Missmutig dachte Okka an die vier Kaufleute, bei denen sie vorgesprochen hatte und die Vettern hätten sein können: bunt gekleidet wie Mutters gesprenkelte Hühner, pausbäckig und kurzatmig. Und alle abweisend, obwohl sie behauptet hatte, ein größeres Geschäft anbieten zu können. Sie verdächtigten sie, eine Betrügerin zu sein, das hatte sie von ihren feisten Gesichtern abgelesen.
Einer hatte sie außerdem als Stedinger Ketzerin gescholten, aber den Schimpf hatte sie zurückgegeben, denn schließlich hatte der Papst alle Deutschen als Ketzer bezeichnet. Während der Mann den Mund gar nicht mehr zubekam vor lauter Staunen über ihre unbotmäßigen Widerworte, war sie die Treppe hinuntergerauscht. Immer noch erbost, hatte sie in der Diele eine ebenso eilige Magd angehalten. »Wie heißt denn dein Fettsack da oben?«
»Das ist doch Kaufmann Budenbusch«, hatte die Magd geantwortet und war mit klapperndem Eimer und gesenktem Kopf weitergerannt, als ob der Leibhaftige hinter ihr her wäre.
Ein anderer Kaufmann hatte Okka herzlich ausgelacht, und das war die tiefste Kränkung gewesen. Über die spöttische Frage des vierten, ob die Stedinger jetzt ihre kleinen Mädchen zum Spionieren in die Stadt schickten, hatte wiederum sie gelacht.
Jedenfalls schien ein Geschäft mit den Bremern, die für ihre Teilnahme am Krieg gegen die Stedinger Bauern reichlich mit neuen Privilegien bezahlt worden waren, gegenwärtig aussichtslos.
Okka putzte sich noch die fettigen Finger im Sand ab, als ein Mann, der über die Balgebrücke eilte, ihre Aufmerksamkeit erregte. Sein Barett zeigte, dass er zur besseren Gesellschaft gehörte. Auch sonst war er gut angezogen. Seltsam war nur, dass er einen Schweif von Jungen hinter sich herzog, die ihn zu bedrängen schienen und dabei so durcheinanderschrien, dass kaum etwas zu verstehen war. Er schien sie nicht abzuwehren, sondern nur schmunzelnd zu flüchten.
Erst am diesseitigen Ufer der Balge konnte Okka einzelne Worte heraushören.
»Bitte, Herr Platensleger, einen Schwaren für jeden von uns! Der Herrgott wird’s Euch vergelten.«
Der Kaufmann, oder was auch immer er sein mochte, stoppte jäh seinen Lauf und drehte sich um. »Ihr hartnäckigen Bengel«, brummte er, indem er seinen Geldbeutel öffnete, »ihr macht mich noch arm.«
»Euch doch nicht«, jubelte die Schar und ordnete sich zu Okkas Überraschung rasch zu einer diszipliniert aufgereihten Warteschlange. Einer nach dem anderen trat vor den mildtätigen Mann und nahm seine Münze in Empfang. Schließlich bedankten sie sich mit erneutem Geschrei und stoben davon.
»Na, so was«, bemerkte Galt. »Der hat sich die kleinen Bettler aber gut erzogen. Habe ich noch nie gesehen.«
»Ja.« Mehr wusste Okka nicht zu sagen. Sie war aufs Höchste verblüfft.
Am Nachmittag erhielt Okka von zwei weiteren Kaufleuten abschlägige Bescheide. Der letzte hatte gar nicht einmal Zweifel an der Wolle, die sie ihn prüfen ließ – die befand er für gut –, sondern an der Ernsthaftigkeit eines jungen Mädchens, das behauptete, genügend Wolle dieser Art zur Verfügung stellen zu können.
»Versteht mich recht, Okka tom Dieke, die Wolle eines einzigen Schafes reicht für einen Handelsherrn nicht aus«, beteuerte er, »das werdet Ihr einsehen.«
»Gewiss, aber ich habe etwa zwanzig Schafe, deren Wolle von dieser ausgezeichneten Beschaffenheit ist …«
Der Kaufmann winkte ab. »Es geht nicht gegen Euch. Ich zweifle nicht an dem, was Ihr sagt, eher an Euren Schafen. Auf einmal haben achtzehn von den zwanzig plötzlich Vliese, mit denen man bestenfalls im Winter Fensteröffnungen zustopfen kann. Ich werde das Risiko nicht eingehen. Aber ich könnte Euch einen Rat geben, wenn er willkommen wäre.«
»Ja, gern«, sagte Okka niedergeschlagen. Immerhin gab der Mann sich Mühe, ihr seine Gründe für die Ablehnung zu erklären, im Gegensatz zu den anderen Kaufleuten.
»Folkmar Platensleger, ein junger kaufmännischer Kollege, über den allerdings manche lieber hinwegsehen, ist bekannt dafür, zuweilen seltsame Wege einzuschlagen. Bei dem solltet Ihr Euer Glück versuchen.«
Okka starrte ihn überrascht an. »Gibt es in der Stadt mehrere Kaufleute mit diesem Namen?«, fragte sie.
»Nein, warum?«
»Ein Platensleger verteilte an der Balgebrücke Almosen an eine Schar von jungen Bettlern«, berichtete sie. »Die kleinen Rabauken waren ihm gegenüber handzahm wie Gänse, die auf Futter warten. Kein Fingern an seinem Gürtel oder Abtasten, wie ich es heute selbst schon erlebt habe.«
Der Kaufmann nickte, ohne Überraschung zu zeigen. »Das ist er. Etwas sonderbar, wie ich schon sagte. Aber als Kaufmann erfolgreich, das muss man ihm lassen.«
»Ich werde es bei ihm versuchen. Wo wohnt er?«
Okka erhielt die Beschreibung und trennte sich ohne jeden Groll von diesem Kaufmann, der immerhin den Willen gezeigt hatte, ihr zu helfen. Mit neu erwachtem Mut eilte sie, Galt auf den Fersen, zur Sögestraße, wo Folkmar Platensleger Haus und Speicher besaß.
Okka musste nicht lange im Erdgeschoss des Handelshauses warten, bis der Kaufmann kam, um sie zu begrüßen. Sie fand gar nicht genug Zeit, sich zu orientieren, welche Waren er in Fässern und Ballen in seinem Lager führte, abgesehen davon, dass sie zu ihrer Beunruhigung keine Wolle entdecken konnte. Als Platensleger vom Hinterhof hereinstürmte, höflich sein Barett lupfte und sie höchstpersönlich eine Treppe nach oben führte, war ihr Mut schon wieder bis in die Kniekehlen gesunken. Immerhin trottete der zuverlässige Galt zur Unterstützung hinter ihr her.
Der Raum, den sie gleich darauf betrat, enthielt eine große Truhe, einen Tisch mit zwei Stühlen und ein Wandbord, auf dem acht Bücher standen. Sie konnte kaum die Augen von ihnen lassen, wie von selbst kehrten sie immer wieder dorthin zurück. Welch ein unerwarteter Schatz!
»Mögt Ihr Bücher? Könnt Ihr lesen?«, erkundigte sich Platensleger sanft.
Okka nickte, beeindruckt von allem, was ihr hier begegnete, zuallererst vom Kaufmann selbst. Er war groß gewachsen, größer als sie selbst, und im Gegensatz zu den anderen Geschäftsleuten nicht schreiend bunt, sondern in zurückhaltendem Grau und Braun gekleidet, die Stoffe von feinstem Gewebe. Offensichtlich hatte er es nicht nötig zu prunken. Er schien noch nicht einmal dreißig Jahre zu sein, jedenfalls viel jünger als die anderen Pfeffersäcke. Außerdem hatte er die lockigen blonden Haare, die Männer aus dem Dänischen häufig aufwiesen.
»Habt Ihr Euch nun ausreichend umgesehen? Dann müsst Ihr mir jetzt Euren Namen sagen«, bat der Kaufmann. »Man teilt viel zu selten das Vergnügen mit einem anderen Menschen an Büchern.«
»Oh«, sagte sie und erkannte, dass sie unhöflich gewesen war. »Ich bin Okka tom Dieke aus dem Stedingerland.«
»Tom Dieke.« Platensleger nickte angenehm berührt. »Ist Tjard der Herr Eures Anwesens, oder gibt es noch mehr Höfe dieser Familie?«
»Ihr kennt uns? Ja, Tjard ist mein Vater.«
»Tjard tom Dieke«, wiederholte er nachdenklich. »Es ist ein angenehmes Gefühl, auf die Leistungen seiner Ahnen und die eigenen zurückblicken zu können und zu bemerken, wie sich der Wohlstand mehrt. Ihr seid im Besitz von mehreren ordentlich gehaltenen Gebäuden und einem recht großen Viehbestand.«
»Ja«, murmelte Okka zustimmend und wusste nicht, auf was er hinauswollte.
»Wohlstand weckt Neid. Zuweilen ist er gefährlich, weil er Begehrlichkeiten auf sich zieht.«
Okka erschrak und wich zurück. »Was meint Ihr?«
»Es spricht sich herum, dass Erzbischof und Graf Bernhardt ein wohlwollendes Auge auf den Hof der tom Diekes geworfen hat. Seinem Wohlwollen würde mancher gerne entgehen.«
»Was redet Ihr da? Dass der Erzbischof unseren Hof als Kirchengut haben möchte?«
»Ich fürchte, eher noch will der Graf ihn als persönliches Eigentum beanspruchen.«
Okka starrte den Kaufmann an und schüttelte ungläubig den Kopf. Woher wusste er das, und warum erzählte er es ihr?
Platensleger tat ein paar ziellose Schritte durch seinen Raum. »Und Euer Anliegen?«, erkundigte er sich.
Es klang wie eine Ermunterung, und Okka vergaß für den Moment, was er vorher gesagt hatte. »Ich habe Wolle zu verkaufen, die ihresgleichen sucht«, stammelte sie eingeschüchtert, aber unter des Kaufmanns interessierten Blicken löste sich ihre Unsicherheit wie Nebel in der Sonne auf. »Es handelt sich nicht um die gewöhnlichen harten Vliese unserer heimischen Heidschnucken … Eher ist sie wie die feine Wolle, aus der Eure Kleidung gewebt wurde. Möchtet Ihr sie prüfen?«
Galt grub die weiße Wolle aus dem Sack und legte sie dem Kaufmann in die ausgestreckten Hände.
Dieser drehte den Wollbatzen, zupfte Haare heraus, beroch und befingerte sie. »In der Tat«, sagte er schließlich. »Außergewöhnlich. Woher habt Ihr sie?«
»Von meinen Schafen, wie ich Euch gerade sagte«, fauchte Okka. Plötzlich wusste sie, dass ihre Mühe wieder vergebens sein würde.
»Darf ich Euch darauf aufmerksam machen, dass Ihr lediglich sagtet, Ihr hättet sie zu verkaufen, nicht, dass sie von Euren Schafen stammt.«
»Stimmt. Entschuldigung.«
Er nickte nur. »Ich kenne solche Wolle aus dem Land der Engländer und der Spanier. Aber häufig ist sie auch dort nicht.«
»Mir hat man erzählt, dass die Byzantiner Schafe mit dieser Wolle haben. Die scheren sie, um die Wolle zu verkaufen, angeblich verkaufen sie aber die Tiere nie, damit kein anderer mit ihnen züchten kann.«
»Das ist wahr«, bemerkte Platensleger. »Und Ihr? Woher habt Ihr die Tiere?«
Okka wand sich innerlich. »Ich hoffe, Ihr haltet mich nicht für eine Lügnerin. In unserer Familie gibt es die Überlieferung, dass eines Tages ein fremdes Schiff aus einem fernen Land bei einem Sturm vor der Küste in Not geriet und zerschellte. Nur wenige Lebewesen konnten sich ans Ufer retten, darunter drei Schafe, ein Bock und zwei weibliche Tiere. Die sollen dieses feine Haar gehabt haben, waren aber vermutlich nicht zum Verkauf bestimmt, sondern als lebender Proviant an Bord. Das Schiff war wohl nach England unterwegs.«
»Das wäre glaubhaft«, sagte Folkmar Platensleger zustimmend. »Und dann?«
»Die Schafe wurden in unsere Heidschnuckenherde gesteckt, alles gehörnte Tiere mit grauem Haar. Damals lebte die Familie noch in Friesland, aber als die Friesen als Kolonisatoren hierher eingeladen wurden, nahmen sie die ganze Herde mit. Bei den Nachkommen tauchte immer wieder einmal das feine Haar auf. Seit einigen Jahren sind die Schafe meine Angelegenheit, und ich entschloss mich, die Feinhaarigen abzusondern und miteinander zu paaren. Nun bekomme ich nur noch selten Ausreißer mit gewöhnlichem Haar, die meisten haben die feine weiße Wolle und sind hornlos, und es werden immer mehr.«
»Tatsächlich!«, rief der Kaufmann aus. »Eine ausgezeichnete Idee von Euch. Man nennt sie Merinoschafe, und sie stammen aus Spanien. Dort ist es bei Todesstrafe verboten, sie in andere Länder zu verkaufen.«
»Ihr kennt sie«, wunderte sich Okka und verstummte beeindruckt.
Platensleger nickte. »Ich handele auch mit Wolle.«
»Umso besser. Und ich stelle mir nun vor«, fuhr Okka beschwingt fort, »dass man die Erzeugung dieser Wolle zu einem einträglichen Geschäft machen könnte. Der höhere Klerus begnügt sich, soviel ich weiß, nicht mit den groben Gewändern aus gewöhnlicher Wolle, sondern bevorzugt die feinere, die aufgrund des weiten und unsicheren Weges teuer sein dürfte. Bei den vielen Fehden, die die geistlichen Herren miteinander haben, könnte die Kirche daran interessiert sein, Geld zu sparen, und wenn es durch preiswertere Wolle ist. So dachte ich es mir.«
Platensleger betrachtete Okka beifällig, während er sich ihren Vorschlag durch den Kopf gehen ließ. »Nicht nur das«, sagte er schließlich. »Bernhardt II. zur Lippe ist Erzbischof und Kriegsherr, über seine Vögte und die von ihm kontrollierten Handwerker aber auch Kaufmann mit weit gefächerten Handelsinteressen. Der würde sofort an den Export dieser kostbaren Wolle ins Erzbistum von Lund denken, das Dänemark vorsteht und obendrein die Suprematie über alle nordischen Prälaten innehat.«
»Ich verstehe nicht, was das bedeutet«, erklärte Okka unumwunden.
»Der Erzbischof würde sich die Alleinrechte für den Verkauf dieser Ausnahmewolle zusichern lassen. Damit würde er den nordischen Markt beherrschen.«
Okka staunte. Dies ging weit über ihre Überlegungen hinaus.
»Aber wir bräuchten natürlich große Herden für ein solches Geschäft«, ergänzte der Kaufmann. »Zwanzig Wollschafe reichen nur als Probe für wenige Ballen. Bei dem feinen Haar gewinnt man von einem Schaf wahrscheinlich höchstens zwei Bremer Ellen Gewandstoff.«
Okka blieb der Mund offen stehen.
»Wir haben durchaus frühe Fliegen, auch hier in der Stadt.« Platensleger grinste.
Okka klappte die Kiefer hörbar zu und schämte sich für ihr bäuerliches Benehmen. Dann fragte sie, ob sie sich setzen dürfe.
Nachdem sie geklärt hatten, wann Okka die Wolle in welcher Menge zu welchem Preis liefern konnte, schlossen sie einen leicht verständlichen Vertrag. Folkmar Platensleger nahm mit wohlwollendem Lächeln zur Kenntnis, dass Okka ihre Unterschrift mit geübter Routine leistete. Ein Petschaft besaß sie natürlich nicht, im Gegensatz zu ihm.
»Sollten wir nicht einen Zeugen holen?«, erkundigte sich Okka zaghaft, da sie von ihrem Vater wusste, dass er es gegenüber den gräflichen Aufkäufern so handhabte. »Eure Gattin vielleicht?«
Platensleger grinste wieder. »War das jetzt eine schlaue Art zu erfahren, ob ich verheiratet bin? Oder nur, ob sie auch schreiben kann?«
Okka errötete tief. Wenn sie geahnt hätte, dass ihre Neugier so leicht zu durchschauen war, hätte sie sich die Frage verkniffen.
Platensleger legte eine federleichte Hand auf ihre Schulter. »Okka tom Dieke, ich habe keine Ehefrau. Aber ich schwöre Euch, sollte ich jemals heiraten, dann nur eine Frau, die schreiben kann. Falls das Eure Sorge ist.«
Okka kochte vor Zorn.
Galt löste sich von der Wand, an der er die ganze Zeit gestanden hatte, und trat einen Schritt nach vorn. »Ich kann als Zeuge mein Kreuz machen, Kaufherr. Das habe ich schon öfter gemacht.«
»Und bei den Stedingern gilt ein ehrlich gemachtes Kreuz wie anderswo ein Siegel!«, schnaubte Okka.
Folkmar Platensleger hörte ihr aufmerksam zu, betrachtete den Knecht von Kopf bis Fuß und nickte schließlich. »Wie heißt du?«
»Galt Naber.«
»Gut, Galt Naber. Ich schreibe deinen Namen auf, und du bezeugst ihn mit deinem Kreuz.«
So machten sie es, während Okka versuchte, ihren Ärger zu bekämpfen, was ihr nur schlecht gelang. Trotzdem schaffte sie es, sich einigermaßen gefasst zu verabschieden und in stolzer Haltung die Treppe hinunterzugehen.
Draußen auf der Straße konnte sie nicht mehr an sich halten. »So ein Spitzbube!« Als sie sah, dass nun auch Galt breit grinste, beschloss sie, gar nichts mehr zu sagen. Es war ein Tag, an dem sie sich in die Nesseln setzte, was immer sie tat.
Kapitel 3
In seiner Residenz innerhalb der Domburg schritt Erzbischof Bernhardt II. zur Lippe gedankenvoll auf und ab. Gelegentlich blieb er stehen, um auf das Stammwappen derer zur Lippe zu blicken, das gegenüber der Betbank an der Wand hing. Eine goldene Rose auf einem silbernen Helm.
Was oder wen die Rose verkörperte, hatte sich in der mündlichen Familiengeschichte nicht erhalten. Der Helm aber gehörte von Beginn an zu allen männlichen Vertretern der Ahnenreihe, die sich über die Familie von Werl bis zu den Karolingern zurückverfolgen ließ. Und wie Karl der Große, ihr Frankenkaiser, vorgegeben hatte, führten die Nachkommen die Familientradition getreulich fort, die mit der Unterjochung der unbotmäßigen Sachsenstämme begonnen hatte.
Viereinhalb Jahrhunderte Krieg gegen Sachsen und Friesen! Und immer noch hatten diese störrischen Bauern nicht gelernt, vor den jetzigen Machthabern zu kriechen und um Gnade zu winseln. Nicht vor weltlichen Kriegsgegnern und nicht vor der römischen Kirche, die von Anbeginn auf der Seite der Karolinger gekämpft hatte.
Bernhardt selbst gehörte zu beiden Seiten, zur Kriegsmacht und zur Kirche. Er schlug ein flüchtiges Kreuz, als er am entblößten, blutigen Leib des hölzernen Christus vorbeikam. Dieser war aus einem Balken des Golgathaholzes geschnitzt, und für gewöhnlich brachte Bernhardt dieser ihm persönlich gehörenden Reliquie mehr Ehrfurcht entgegen, aber heute war nicht der Tag dafür.
Die Zeit drängte, und viele Überlegungen waren anzustellen, denn riesige Heere waren ins Stedingerland unterwegs. Bernhardts Furcht war groß, dass sie ihn um einen Teil der Früchte seiner Arbeit bringen würden.
Und was hatte er nicht alles unternommen, um genau das zu verhindern, unter anderem einige Kriege geführt! Und obwohl der Heilige Vater, Gregor IX., sein Feld bestellt hatte, wie er, Bernhardt, es ihm vorgeschlagen hatte, war vieles schiefgegangen.
Ohne es zu wissen, hatte übrigens der fanatische Inquisitor Konrad von Marburg ihm mit der Schilderung der Teufelsanbeter in Deutschland geholfen. Jedenfalls hatte dieser die Grundsteine für die Verfolgung von Häretikern und Ketzern gelegt, worauf Papst Gregor IX. das Schreiben Vox in Roma verfasst hatte, in dem über Häresie berichtet wurde. Bernhardt war selbst nach Rom gereist, um dem Papst von Priestermorden, Abgötterei und Wahrsagerei in seiner Diözese zu berichten.
Es war ihm also gelungen, alle Vorbedingungen für einen Kreuzzug zu schaffen, doch dann hatte er zu seinem großen Ärger feststellen müssen, dass die gesamte Kriegsmacht seiner Gefolgsleute nicht ausreichte, um die Stedinger unter die Oberherrschaft der Kirche Roms zu zwingen. Obwohl der Herr seiner frommen Streitmacht beigestanden und sie mindestens vierhundert Bauern erschlagen hatten, war auf seiner Seite Graf Burchard von Oldenburg-Wildeshausen zusammen mit zweihundert seiner Pilger gefallen.
Es war ihm, dem Erzbischof, also nichts anderes übriggeblieben, als ein größeres Heer zusammenzurufen, mit allen Risiken, die damit verbunden waren, vor allem Macht- und Landgier. Der Erfahrenste unter den gegenwärtigen Heerführern war zweifellos Heinrich von Brabant, auch Heinrich der Mutige genannt, der sein Heer in zwei Kreuzzügen ins Heilige Land und nach Ägypten geführt hatte. Zwischen Staufern und Welfen hatte er mehrmals die Partei gewechselt, aber wen scherte das, das taten die meisten Heerführer. Viel beunruhigender war, dass der Brabanter nach einem Sieg hart um neue Besitzungen streiten und sie nicht kampflos dem Bremer Erzbischof überlassen würde.
Eine ganz anders geartete Gefahr stellte der Graf von Geldern dar. Er war bekannt für seine Auseinandersetzungen mit den Herren von Brabant und Holland sowie dem Kölner Erzbischof um Rheinzölle, weitere Flusszölle und Anteile am bischöflichen Zehnten – und er hatte sie alle gewonnen. Wer wusste schon, zu welchen Forderungen er sich hier versteigen würde, dachte Bernhardt düster.
Dietrich VI. von Kleve wiederum war in zahlreiche Fehden verwickelt und immer zur Stelle, wo es etwas einzusacken gab.
Florens, Graf von Holland, der ebenfalls mit seiner Streitmacht unterwegs nach Bremen war, hatte schon etliche Schlachten siegreich geschlagen.
Alle diese Herren mit Besitzungen rechts und links des Rheins lagen obendrein in ewigem Streit miteinander und gönnten einander weder die kleinste Burg noch das unbedeutendste Dorf.
Sämtliche Parteien zufriedenzustellen würde von Bernhardt höchstes Fingerspitzengefühl erfordern. Andernfalls könnten sie sich womöglich entschließen, die Domburg zu überrennen. Es erschien ihm ratsam, bereits jetzt einen Boten nach Rom zu schicken, um den Heiligen Vater auf die Gefahr aufmerksam zu machen, dass die Kriegsherren auf die Idee kommen könnten, den Gewinn der Kirche unter sich aufzuteilen. Die Dokumente über ihre Exkommunikation ließen sich gewiss schon vorbereiten und dem Boten übergeben. Wenn er als Erzbischof diese päpstlichen Urkunden erst in Händen hätte, könnte er die land- und geldlüsternen Herren in Schach halten. Mit dem erfolgreichen Kreuzzug gegen die Stedinger wäre schließlich erwiesen, dass Rom die Kraft hatte, seinen Anspruch auch außerhalb des Heiligen Landes durchzusetzen.
Gemessen an diesen diplomatischen Schwierigkeiten mit den adeligen Kriegsherren, würde er mit den Bremer Kaufleuten leichtes Spiel haben. Versprochen hatte er ihnen für die Teilnahme am Kampf gegen die Stedinger, den Anspruch des Hochstifts auf die Zölle und Wegegelder zwischen Elbe und Weser bis zur Nordsee fallenzulassen. In einem unkontrollierten Augenblick hatte er sie selber als ungerecht bezeichnet, was fälschlicherweise so im Vertrag mit den Kaufleuten stehengeblieben war. Seinen dämlichen Sekretär Reemt Grummer, der versäumt hatte, ihn darauf aufmerksam zu machen, hatte er sofort entlassen. Allerdings war kein Schaden entstanden. Es scherte Bernhardt nicht, was er einmal festgelegt hatte – wichtig war, was ihm in der Gegenwart nützte.
Im Grunde war Erzbischof Bernhardt trotz aller erwarteten Schwierigkeiten mit sich selbst im Reinen. Er drückte das Christuskreuz an die Lippen und sank auf seine Betbank.
In der Diele war es totenstill und dunkel, als Okka und Galt am späten Abend zurückkehrten. Selbst die zusammengekauerten Hühner plusterten ihr Gefieder und versteckten die Köpfe.
Nur auf der Feuerstelle im Flett glomm noch etwas Holzkohle unter der irdenen Abdeckung. Okka zündete zwei zusätzliche Tranlampen an, die sie leise auf den Tisch in der Kübbung, der Abseite unter dem schrägen Dach, stellte, um niemanden zu wecken. Aus dem elterlichen Anbau am Hausende drang das tiefe Schnarchen ihres Vaters, und im Alkoven ihres Bruders ertönte in Abständen ein Pfeifen.
Okka setzte sich und fragte sich ungeduldig, warum die Magd, die im Verschlag an den Kälberständen schlief, aber doch gewiss ihr Kommen gehört und außerdem ganz sicher den Auftrag hatte, ihnen das Abendessen vorzusetzen, nicht erschienen war. Irgendetwas schien in der Luft zu liegen.
Trotz allem war Okka mit dem Vertrag und sich selbst sehr zufrieden. Dass sie sich über diesen Platensleger geärgert hatte, weil er es darauf angelegt hatte, sie zu necken, war eine andere Sache.
Endlich schlurfte die Magd heran, verweint und mit derart zitternden Händen, dass sie das gute Bier beim Eingießen verschüttete.
»Was ist passiert?«, flüsterte Okka streng, damit sie sich zusammennahm und das dumme Schluchzen unterließ.
Die Magd wusste es nicht. Der Hausherr und der junge Herr Reuke seien am Nachmittag ganz plötzlich zu Nachbarn geritten. Vorher war ein Bote ins Haus gestürmt, mit dem sich Herr Tjard zur Beratung an den Tisch zurückzog, nachdem er alle anderen fortgeschickt hatte. Nicht einmal für ein Bier hätten die Männer Zeit gehabt.
Was das wohl wieder sein mochte? Ein neuer Burgenbau, der zu schleifen war? Okka murrte unzufrieden. Sie musste sich tatsächlich bis zum nächsten Morgen gedulden, um der Familie ihren Triumph zu erzählen.
Galt war alles gleich. Hungrig löffelte er vier Schüsseln Hafergrütze mit gebratenem Speck, erhielt seinen Becher Bier und verschwand zum Schlafen in seinem Verschlag bei den Gäulen.
Am nächsten Morgen war nichts wie sonst. Okka prallte vor Schreck zurück, als sie aus ihrem Alkoven schlüpfte. Vater, Mutter, Bruder, die beiden Knechte, dazu sogar die beiden Altenteiler, und die beiden Mägde standen zwischen Tisch und Herdstelle herum, als ob sie auf etwas warteten. Der Bogen ihres kühnen Bruders baumelte an dem Rahmen, an dem auch der Kesselhaken hing, offenbar, um langsam angewärmt und geschmeidig gemacht zu werden.
Okka begriff. Ein Kampf stand bevor.
»Gut, dass du gesund zurück bist, Tochter« war alles, was Tjard anfänglich bemerkte. »Heute hätte ich dich selbst mit einer Kriegsmacht nicht nach Bremen gehen lassen.«
Mutter Taalke legte unauffällig den Zeigefinger an die Lippen, so dass Okka wusste, dass es im Augenblick nicht angebracht war, den Vater zu unterbrechen.
»Diese Schurken!«, spuckte Tjard aus. »Da bereiten sie die ganze Zeit den nächsten Krieg gegen die Stedinger vor, und wir wissen von nichts.«
Okka sank schreckgeschlagen neben ihren Vater, der sich inzwischen auf die Bank gesetzt hatte. »Ein Krieg? Oder ein Kampf?«
»Ein Kreuzzug!«, brüllte der Vater.
Ein Kreuzzug war kein gewöhnlicher Krieg, das wusste Okka.
In den Kreuzzügen gegen die Ungläubigen im Heiligen Land war die ganze Welt im Namen des Heiligen Vaters aufgeboten, einen Krieg zu führen, um das Grab Christi in Jerusalem zu befreien. Da waren Tausende und Abertausende unterwegs, die sich als persönlichen Gewinn das Himmelreich erwerben wollten. Abgesehen von denen, die mehr auf Plünderungen aus waren. Und Adelige konnten sich sogar ganze Grafschaften im Heiligen Land erkämpfen. »Kann es sein, dass sie uns nur erschrecken wollen?«, murmelte Okka verzagt. »Es kann doch keiner einen Kreuzzug gegen das Stedingerland führen! Das müssen sie doch einsehen!«
»Im Gegenteil! Und das Drohen ist beendet. Jetzt geht unser hochverehrter Erzbischof aufs Ganze!«, wütete Tjard. »Endlich hat er geschafft, wonach er schon so lange strebt: Ein Kreuzzug ist die tückischste Methode überhaupt, die von Christen aufgeboten werden kann. Damit wird er uns kleines Völkchen endgültig unter seine Knute zwingen.«
»Aber wir haben doch schon zwei Mal gegen verschiedene Heere gewonnen.« Okka ließ ihren Blick fragend zu ihrem Bruder hinüberwandern, der mit einem knappen Nicken bestätigte.
»Der Unterschied zu bisher ist, dass den bewaffneten Pilgern ins Stedingerland jetzt der gleiche Ablass versprochen wurde wie den Kreuzzüglern ins Heilige Land, die mitunter mehrere Jahre unterwegs sind, häufig mit fremden Krankheiten zurückkommen, wenn überhaupt, und außer Gotteslohn nichts nach Hause zurückbringen. Verstehst du? Die Kriegsherren selbst haben natürlich Anspruch auf Land, Beute und Besitztümer.« Tjard schob den Bierkrug, den die Magd inzwischen vor ihn gestellt hatte, so heftig von sich, dass er überschwappte.
Okka atmete scharf ein.
»Genau«, sagte ihr Vater. »Billiger als beim Kampf gegen uns kann keiner seinen Ablass kaufen. Alle haben sie sich gegen uns verbündet, sorgfältig vorbereitet durch die Dominikaner von Bremen. Die Folge: Papst Gregor IX. ruft durch seine neue Bulle vom Januar zum Kreuzzug gegen uns Stedinger auf, Kaiser Friedrich II. hat die Reichsacht gegen uns verkündet. Dieser Schurke Bernhardt hat aufgeboten, über wen immer er das Sagen hat: seine eigenen Ministerialen, die Gefolgsleute des Edelherrn von Stotel und die der Oldenburger. Das allein sind Hunderte von Bewaffneten. Außerdem hat er den Bremer Kaufleuten für ihre Teilnahme am Kampf gegen uns weitere Privilegien versprochen. Die schicken ihre Knechte in den Kampf …«
»Weiter«, murmelte Okka tonlos.
»Die Gefährlichsten sind die erfahrenen Kriegsleute aus Holland, Brabant, Flandern und vom Niederrhein, die teilweise zu Schiff kommen werden. Die sind nichts als marodierende Söldner, die für Geld gegen jeden kämpfen. Hinzu kommen noch die Deutschordensherren aus Bremen, die im Kreuzzug Akko im Heiligen Land erobert haben.«
»Das … das …«, stammelte Okka.
»Ja, das ist das Endergebnis dessen, was mit der Vox in Roma vorbereitet wurde«, sagte der Großbauer mit verzerrter Miene. »Wusste ich doch, dass dieses Schreiben der Beginn von etwas ist, das wir als gläubige Christen uns niemals hätten vorstellen können. Kreuzzüge werden ab sofort nicht nur gegen Ungläubige und abgefallene Christen, sondern gegen Christen geführt, die sich das Fell nicht von Kirchenmännern über die Ohren ziehen lassen wollen. Erst haben sie uns die Sakramente und die Pfarrer weggenommen, dann das Betreten der Kirchen verboten, die wir mit eigenen Händen erbaut haben, und weil wir uns gewehrt haben, sind wir nun zu Ketzern erklärt worden.«
»Du bist jetzt eine Ketzerin der schlimmsten Art, verstehst du, Okka?« Reuke war bis ins Innerste aufgewühlt. »Genau wie Mutter, wie Vater und ich, wie unser Gesinde und die Rindviecher. Und Harmke.«
»Nein, Harmke nicht. Sie ist gottlob ein Gast, keine gebürtige Stedingerin«, versetzte der Vater.
Aber meine Schafe, dachte Okka in das verzweifelte Heulen der Mägde hinein, die auf den Wink der Mutter begonnen hatten, ihnen aufzuwarten. Hatte ihr Vertrag mit Folkmar Platensleger jetzt überhaupt noch Gültigkeit? Würde der Erzbischof Wolle von ketzerischen Schafen kaufen, mit deren Besitzern er im Krieg lag? Oder würde er sie einfach konfiszieren? »Wie geht es jetzt weiter?«, fragte sie verstört und registrierte aus dem Augenwinkel Harmkes Erschrecken und gleichzeitig ihren sehnsüchtigen Blick, der Reuke galt.
»Das gesamte Stedingerland beginnt unverzüglich mit den Kriegsvorbereitungen. Wer zwei Kriege gewonnen hat, könnte auch im dritten siegen.« Aber Tjard klang nicht sehr überzeugt.
Vorübergehend wurde es still am Tisch. Nur das Klappern des Schöpflöffels war zu hören, mit dem eine der Mägde ihre Schüsseln füllte. Dann setzte sie sich selbst auf die Bank.
Plötzlich reckte Reuke die geballten Fäuste in die Luft. »Wir werden das ganze Stedingerland unzugänglich für Reiter und Schwerbewaffnete machen, wir stauen Gräben zu Seen, wir werfen Schanzen auf, heben Fallgruben aus, schmieden Dreikante gegen Pferdehufe und machen alles, was eine Kriegsmacht zu Pferde behindern kann. Die werden staunen!«
»Und wir Frauen«, warf die meist schweigsame Taalke ein, »werden uns wie immer auf die Versorgung Verwundeter vorbereiten. Unsere Diele kann eine Menge Krankenlager aufnehmen, mehr als alle anderen Häuser hier im Land. Stroh haben wir noch genug. Wir werden aus unseren Heilkräutern Heilsude bereiten, unser Linnen zu Verbänden zerschneiden und entbehrliches Vieh schlachten und einpökeln, damit wir später zu essen haben, wenn wir die Kühe nicht mehr auf die Weiden schicken können. Es ist ungeheuer viel zu tun, aber auch wir Frauen haben Übung in derlei. Beim letzten Krieg, Okka, warst du noch zu jung, um Verantwortung zu tragen, das ist jetzt anders.«
»Dann ist mir auch klar, weshalb Erzbischof Bernhardt sich derzeit in Bremen aufhält«, platzte Okka heraus.
Alle Gesichter wandten sich ihr zu.
»Wahrscheinlich inspiziert er die Wehrhaftigkeit der Stadt und überlegt, wie er im Notfall den Dombezirk ohne Mauer gegen die Stadt verteidigen könnte. Auch wenn er die Bremer Kaufmannschaft wieder gekauft hat und sie auf seiner Seite steht, könnte es ja sein, dass sie irgendwann unzufrieden sind und sich gegen ihn wenden.«
»Deine Beobachtungen und Schlüsse sind nicht von der Hand zu weisen«, stimmte Tjard ihr anerkennend zu. »Als er die Weser mit einer Kette sperrte, bekam er ja bereits die Macht der Kaufleute zu spüren.«
Reuke fluchte leise. »Diese Kaufleute sind Schurken, genau wie die adeligen Geistlichen! Wendig wie Wetterfähnchen, glitschig wie Aale! Sie scheren sich einen Dreck um Recht oder Unrecht, ihnen geht es nur darum, ihre Geldsäcke zu füllen.«
Vielleicht gab es ja Ausnahmen. Ob die Pfeffersäcke in Bremen alle das neue Bündnis mit dem Erzbischof kannten? Wahrscheinlich. Das erklärte dann auch die ihr so unverständliche Bemerkung eines der Kaufleute, sie sei wohl zum Spionieren in die Stadt gekommen. Nur Folkmar Platensleger war offenbar nicht eingeweiht, oder er scherte sich nicht darum, und das machte ihn noch sympathischer. Okka fiel wieder ein, was er ihr erzählt hatte. »Vater, wisst Ihr, dass Bernhardt unseren Hof in seinen Besitz bringen möchte?«
»Der Erzbischof?« Die Hand, mit der Tjard gerade auf den Tisch hatte schlagen wollen, blieb in der Luft schweben. »Es ist kein Geheimnis, dass die Kirche besonders die großen Höfe in Kirchenbesitz bringen will. Um sie dann zu verpachten, versteht sich.«
»Nein, er will unseren Hof für sich selbst. Als Graf Bernhardt.« Okka wurde das Gefühl nicht los, dass Folkmar Platensleger sie hatte warnen wollen.
»Woher weißt du das?«
»Ich hörte es in Bremen.«
»Das kann dieser kirchliche Räuber gar nicht!«, blaffte Tjard verächtlich. »Da müsste er mich schon totschlagen. Und nach mir Reuke! Dann allerdings … Ihr Frauen würdet diesen großen Hof schwerlich allein betreiben können.«
Okka fing einen kurzen verständnisinnigen Blick zwischen ihrem Bruder und Harmke auf, über den sich zu wundern sie nur kurz Zeit hatte, weil ihre Mutter sich mit Nachdruck zu Wort meldete.
Vom über dem Herdfeuer hängenden Kochkessel, in dem sie gerührt hatte, kam Taalke eilig herbei und baute sich mit den Händen in den Hüften vor ihrem Ehemann auf. »Was glaubst du wohl, Tjard tom Dieke, was Frauen in der Not alles fertigbringen! Mehr, als du denkst! Ich würde diesen Hof nie aufgeben, unter keinen Umständen. Und deine Tochter Okka fühlt genauso. Glaubst du, wir wären Schafe, die sich kampflos scheren, melken und schließlich das Leben nehmen lassen? Wer das vermutet, hätte mich nicht zu heiraten brauchen!«
»Oh, Taalke, mein geliebtes Weib!«, rief Tjard und sprang auf. Trotz des anwesenden Gesindes drückte er ihr einen schmatzenden Kuss auf den Mund und schwenkte sie über das Flett. »Wir sollten heute Nacht weitere kleine tom Diekes machen, Jungen und Mädchen, gewissermaßen für alle Fälle!«
»Tjard, lass doch«, murmelte Taalke, der so viel Aufmerksamkeit unangenehm war, verlegen.
Okka, Reuke, Harmke und das Gesinde brachen in Lachen aus und klatschten begeistert in die Hände.
Es war nur ein kurzer unbeschwerter Augenblick, der ihnen vergönnt war.
»Wenn es stimmt, dass er unseren Hof für sich begehrt, macht es unsere Situation noch gefährlicher«, murmelte Tjard. »Aber wir können nicht so tun, als wüssten wir es nicht.«
Am Tisch trat bedrücktes Schweigen ein. Sie wussten, was Krieg bedeutete, es hatte keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Nicht alle, die hier versammelt waren, würden überleben, einer oder mehrere der Männer würden möglicherweise verstümmelt werden und nicht mehr arbeiten können, und die Frauen erwartete Gewalt oder Verschleppung.
»Was hast du in Bremen erlebt, Okka? Etwas Netteres als wir? Gar den Erzbischof im Prunkornat zu Gesicht bekommen?«, erkundigte sich Taalke nach einer Weile.
»Nein«, beteuerte Okka. »Ich habe auf dem Markt ein Strumpfband gekauft.«
Vater Tjard brach in sarkastisch klingendes Gelächter aus. »Wir werden zu Ketzern erklärt – und unsere Okka kauft ein Strumpfband. Frauen!«
Taalke furchte ungläubig die Stirn, und Okka senkte den Blick. Ihre Mutter kannte sie gut.
In den nächsten Stunden kümmerte sich Okka um ihre Schafherde. Noch war Frühjahr, und nicht alle Mutterschafe hatten schon gelammt. Eines von ihnen war nach der Geburt gestorben, während das Lamm lebte, und Okka verbrachte eine Weile damit, eine passende Amme zu suchen. Endlich war sie zufrieden, es hatte geklappt. Dann musste sie sich um die Klauen einiger Tiere kümmern, die wegen der Nässe im Moorboden zum Faulen neigten.
Ein Verband mit einer Teerpackung würde Abhilfe schaffen.
Ein paar der neuen Lämmchen hatten ein vielversprechendes seidiges Fell, aber Okkas und Platenslegers ganze Planung schwebte jetzt im Ungewissen. Zumal die Mutter recht hatte: Haltbare Nahrungsmittel waren in Zeiten, in denen ein Krieg bevorstand, zwingend notwendig. Die einjährigen Böcke und sogar einige ihrer Mutterschafe würden geopfert werden, um Nahrung für kämpfende Bauern zu liefern, anstatt Wolle. Nicht einmal den Verlust von Milch konnte Okka geltend machen, denn die seidenhaarigen Schafe gaben die wenigste Milch.
Es dunkelte bereits, als sie endlich meinte, für diesen Tag alles Notwendige getan zu haben, und tief in Gedanken nach Hause wanderte, neben sich Göke, den fröhlich hopsenden jüngsten Knecht des Hofes, der noch keine Sorgen kannte. Ganz im Gegensatz zu ihr.
Der Vater hatte bisher keine Kenntnis davon erhalten, wo sich das Kreuzfahrerheer gerade aufhielt. Gewiss würde es eine Weile dauern, bis die Männer sich aus allen Richtungen gesammelt und zu einem Heer vereinigt hätten. Noch konnte Okka die Schafherde auf der Weide lassen, aber in einigen Wochen sollte sie sie besser näher an den Hof herantreiben. Das war ohnehin die Zeit der Schafschur und passte ganz gut. Allerdings waren weder Hofnähe noch der Heidschnuckenstall für die Tiere ein sicherer Schutz vor marodierenden Räubern.
Für Okka und ihre Mutter sowie für die Ziehtochter der Eltern, Harmke, begann eine hitzige Zeit der Vorbereitungen, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass das vereinigte Heer längst auf dem Wege war.
In allen Höfen wurde geschlachtet und eingepökelt, und dabei waren die Frauen fast unter sich, denn jeder Mann, der noch Kraft in den Armen hatte, wurde an den Grenzen des Stedingerlandes gebraucht, um es kriegsfest zu machen. Tjard und Reuke kamen nur noch gelegentlich nach Hause, meistens in tiefer Nacht, wechselten nasse Kleidung gegen trockene, nahmen einige Happen zu sich und schliefen mit dem Bierkrug in der Faust am Tisch ein.