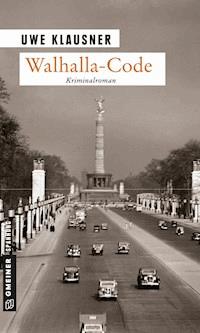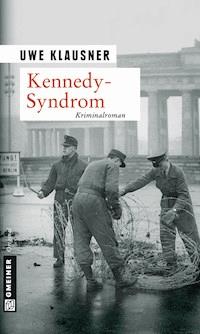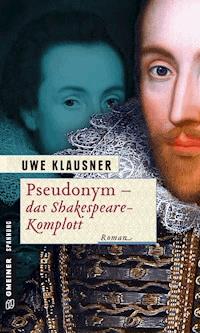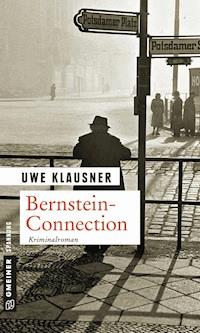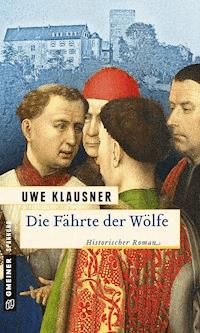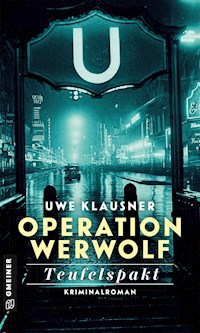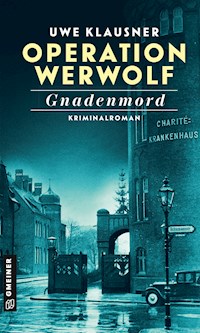Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aurelius Varro
- Sprache: Deutsch
Das spätantike Trier, 313 n. Chr. Ausgerechnet während der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Kaiser Konstantin wird der Gladiator Niger, Publikumsliebling im Amphitheater, tot aufgefunden. Die Mächtigen zeigen jedoch keinerlei Interesse an dem Fall, sehr zum Ärger von Gaius Aurelius Varro, Anwalt, Autor und vermögender Aristokrat. Erbost über die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des dunkelhäutigen Gladiators, beginnt Varro auf eigene Faust zu ermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Die Stunde der Gladiatoren
Historischer Kriminalroman
IMPRESSUM
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Umjb – Fotolia.com
und © Blickfang – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4240-7
REALE HAUPTFIGUREN
am kaiserlichen Hof
FLAVIUS VALERIUS CONSTANTINUS, 41 Jahre3, römischer Kaiser von 306 – 337 n. Chr.
FAUSTA, 19 Jahre4, seine zweite Frau
3Vergl.Demandt,S. 35:›Constantin war an einem 27. Februar, wahrscheinlich 272 in Naïssus, geboren worden.‹ Vergl. dagegenBrandt, der darlegt, die Geburt liege ›wohl zwischen 272 und 285‹.
4Das Geburtsjahr der Kaiserin steht nicht genau fest, die Meinungen in der Fachwelt reichen von 289 bis 298 n. Chr.
Fiktive HAUPTFIGUREN
am kaiserlichen Hof
CHRYSAPHIUS, ihr Kammerherr (praepositus sacri cubiculi) und Mitglied des Thronrates
TIRO, Oberhofmeister (magister officiorum)
VALERIUS MAXIMUS, Prätorianerpräfekt (praefectus praetorio)
BERENIKE, Kammerfrau der Kaiserin
FIKTIVE HAUPTFIGUREN
in der Villa Aurelia5
GAIUS AURELIUS VARRO, 42 Jahre, Anwalt und Mitglied des städtischen Magistrats
DROMAS, sein Hund
SYPHAX, sein Leibsklave
FORTUNATA, Varros Amme und Haushälterin
AURELIA, 35 Jahre, Varros Schwester
PUBLIUS, 13 Jahre, Varros Neffe, Aurelias Sohn
ANTIGONOS, Sekretär, Hauslehrer und Verwalter
AULUS, Türsteher, Faktotum und ›Mädchen für alles‹
5fiktiv
FIKTIVE HAUPTPERSONEN
in der Gladiatorenkaserne
NIGER (›Der Dunkelhäutige‹), einRetiarius
DANAOS, ehemaliger Gladiator und Nigers Ausbilder
PUGNAX (›Der Draufgänger‹), einSecutor
MAXIMINUS,Lanista, d.h. Gladiatorenunternehmer
INCITATUS (›Der Heißsporn‹), einMurmillo
MUCRO, einThraex
EUPHRATES, ein Mesopotamier
MYRON, einHoplomachos
URSUS, einSecutor
BATO, einProvocator
WEITERE FIKTIVE HAUPTPERSONEN
ASPASIA, Schankwirtin
PENELOPE, Aspasias Tochter
VALERIUS PROBUS, ehemaliger Militärarzt und Varros Freund
FLAVIUS SABINUS, genannt IMPUDICUS (›Der Lüstling‹), Befehlshaber der Stadtwache und für das ›Polizeiwesen‹6zuständiger Magistrat der Stadt Trier7
LUPICINUS (›Das Wolfsjunge‹), Geldwechsler und Pfandleiher
FLAVIUS MESSALA, genannt ›Scorpio‹, Präfekt der Palastwache
6›Ein äquivalenter lateinischer Terminus zu ›Polizei‹ existiert nicht.‹ (RominaSchiavone,Agens et laterculum – Strafverfolgung im Römischen Reich. In: MarcusReuterund RominaSchiavone(Hrsg.),Gefährliches Pflaster, Kriminalität im Römischen Reich, Mainz 2011, S. 228)
7s.Demandt, S. 374: ›Die städtische Polizei unterstand Friedenswächtern (lirenarcha), die Knüppelgarden kommandierten. Das Amt wurde als einjährige Liturgie (Volksdienst) von Curialen versehen, wir kennen es insbesondere aus dem Osten.‹
MORITURI8
Waffengattungen (armaturae)
und
Fechtpaarungen der Gladiatoren im Roman:
Murmillo(Großschildner, ausgerüstet mit Helm, Beinschienen, Bandagen und Schwert mit gerader Klinge)
gegen
Thraex(Kleinschildner, ausgerüstet mit Helm, Strumpfhosen und geknicktem Schwert)
oder
Hoplomachus(halbkugeliger Schild, Helm, Stoßlanze und gerades Schwert)
*
Retiarius(Bandage, Metallschirm, Netz, Dreizack und Dolch)
gegen
Secutor(Visierhelm, ansonsten Ausrüstung wie derMurmillo)
»Im 2., 3. und 4. Jahrhundert dürften diese beidenarmaturaemehr Kämpfe bestritten haben als alle anderen Waffengattungen zusammen.« (Marcus Junkelmann)
8dt.: Todgeweihte (»Ave Caesar, morituri te salutant.« – »Heil Dir, Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich.«)
TAGESABLAUF UND ZEITRECHNUNG IM MONAT JULI
Beginn der
hora prima (erste Stunde): 04:00 h
secunda: 05:20 h
tertia: 06:40 h
quarta: 08:00 h
quinta: 09:20 h
sexta: 10:40 h
septima: 12:00 h
octa: 13:20 h
nona: 14:40 h
decima: 16:00 h
undecima: 17:20 h
duodecima: 18:40 h
Beginn der ersten Nachtstunde: 20:00 h
Dauer einer Stunde im Juli: 80 Minuten
Sonnenaufgang am 25. Juli in Trier: kurz vor 05.00 Uhr
Sonnenuntergang: ca. 20.30 Uhr
RÖMISCHE LÄNGENMASSE9:
ein(e/n)
lat.:
Handbreit
Palma
07,40 cm
¼ Fuß
Fuß
Pes
29,63 cm
1 Fuß
Elle
Cubitum
44,45 cm
1 ½ Fuß
Schritt
Gradus
74,08 cm
2 ½ Fuß
Doppelschritt
Passus
01,48 m
5 Fuß
Stadium
Stadium
185,22 m
625 Fuß
Meile
mille passuum
01,48 km
5000 Fuß
9Quelle: Der Kleine Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch
KARTE: TRIER IN DER SPÄTANTIKE
GLADIATORENEID
›In verba Eumolpi [sacramentum] iuravimus: uri, vinciri, verberari, ferroque necari, et quidquid aliud Eumolpus iussisset.‹
[Petronius, Satyrica (117,5)]
›So leisteten wir … den von Eumolpus vorgesprochenen Schwur: Uns brennen, fesseln, peitschen sowie mit dem Schwerte richten zu lassen, und was Eumolpus sonst alles anordnen würde.‹
PROLOG
(Freitag, 24. Juli 313 n.Chr.)
I
Amphitheater, Beginn der zehnten Stunde
[16:00 h]
Er war der Schrecken seiner Gegner.Er war kräftig, zäh und ausdauernd. Und er war der Abgott des Publikums, vor allem der Frauen.
Eins war Niger, Sieger in drei Dutzend Kämpfen, freilich nicht: ein Betrüger.
»Du lässt ihn gewinnen, klar? Andernfalls kannst du dein Testament machen.« Das war deutlich gewesen. Unmissverständlich. Niger, Retiarius und gefeiertes Idol der Massen, ballte die Faust. Das war es also, was ein Römer unter Ehre verstand. Unter Anstand und dem Gebot, dass Pflichterfüllung an erster Stelle stand. Das also war es, worum es in seinem Gewerbe ging. Nämlich um Geld, um eine Menge Geld. Wie hatte der Kaiser, welcher das Flavium errichten ließ, doch gesagt: »Pecunia non olet.« Genau. Ein Aureus roch nicht. Auch dann nicht, wenn er in der Schatulle des Veranstalters verschwand.
Das also, dachte Niger zähneknirschend, hatte es mit dem Eid auf sich, den er geschworen hatte. ›Uri, vinciri, verberari, ferroque necari.‹ Ich werde es erdulden, ausgepeitscht, in Ketten gelegt und gebrandmarkt zu werden. Und wozu? Damit ein paar Wenige, deren Namen es nicht wert waren, ausgesprochen zu werden, Nutzen aus dem Gemetzel zogen, welches in Kürze beginnen würde. Perfider, um nicht zu sagen ehrloser, ging es wirklich nicht.
»Lass ihn nicht zu nah ran, hörst du? Sonst bist du geliefert!« Der gute alte Danaos, sein Ausbilder. Oder, anders ausgedrückt, sein Ersatzvater. Auch er ahnungslos, naiv wie ein kleines Kind. »Du weißt doch, wie er ist, Niger – Pugnax geht immer gleich aufs Ganze. Der hält sich nicht mit Vorgeplänkel auf. Wenn du schlau bist, wartest du erst mal ab. Auf Zeit spielen, verstanden? Alles andere regelt sich von selbst. Und noch was: Lass dich nicht provozieren. Wenn hier einer Katz und Maus mit einem Secutor spielt, dann du – haben wir uns verstanden? Du hältst dir den Tollpatsch vom Leib, tänzelst ihm vor der Nase rum – und zack! Dann ist der Angeber erledigt. Glaub mir, Niger: Der kann dir nicht das Wasser reichen. Viel Kraft, aber nichts dahinter.« Danaos stockte. »Sag mal, schwarzer Herkules, hörst du mir überhaupt zu?«
»Natürlich höre ich dir zu.« Noch etwas, das ihm nicht gefiel. Danaos machte das weder absichtlich, noch hatte er vor, ihn zu kränken. Aber er konnte es nun einmal nicht ausstehen, wenn man Anspielungen auf seine Hautfarbe machte. Er war ein Gladiator wie jeder andere, nicht schlechter, aber um einiges besser als die meisten, mit denen er in Leptis, Rom oder in Arelate die Klingen gekreuzt hatte. Und er war nicht immer der gewesen, zu dem ihn das Schicksal gemacht hatte. Vor sieben Jahren, während seines achtzehnten Sommers, war er, den man in der Heimat ›Großer Jäger‹ genannt hatte, in die Fänge von Sklavenhändlern geraten. Ausgerechnet er, Mahamadu, dessen Wurfnetz Dutzenden von Straußen, Gazellen und sogar Antilopen zum Verhängnis geworden war. Eingefangen, in einen Käfig gesperrt, verschleppt und durch die Große Wüste Richtung Norden gekarrt. Hungrig, der Rücken mit Striemen übersät, halb wahnsinnig vor Durst. Es war wie ein Albtraum gewesen, eine mörderische, nicht enden wollende Tortur.
Doch dann, in schier auswegloser Lage, hatte Fortuna ein Einsehen mit ihm gehabt. Auf dem Sklavenmarkt von Leptis war er einem Lanista aufgefallen. So nannte man die Besitzer von Gladiatorenschulen, die es überall im Imperium gab. Eugenius, gerissen, ohne Skrupel und mit allen Wassern des Styx gewaschen, hatte sofort zugegriffen und ihn für einen Spottpreis ersteigert.
Zunächst einmal war er froh gewesen, den Fängen der Sklavenhändler entronnen zu sein. Die Freude indes sollte nicht lang Bestand haben. Kaum in Sicherheit, gebadet und mit einer Wolltunika versehen, hatte er mit dem übelsten Gesindel in Tripolitanien Bekanntschaft gemacht. Unter den Gladiatoren, das merkte er recht bald, befanden sich eben nicht nur Leute wie er. In der Mehrzahl handelte es sich um Kriegsgefangene, Kriminelle und Sklaven, die, offenbar zu nichts anderem nütze, von ihren Herren für teures Geld an die Gladiatorenschulen verkauft worden waren. Mitunter meldeten sich sogar Freiwillige, etliche davon auf der Suche nach Ruhm und Ehre, andere wiederum, um mit dem Geld, das sie zu verdienen hofften, nach Ablauf ihres Kontrakts ein neues Leben anzufangen.
»Sag mal, träumst du oder hast du zu viel Mohnsaft getrunken?«, ereiferte sich Danaos, während er ihm half, den bronzenen Schulterschirm auf einem Polsterärmel aus gestepptem Leinen festzuschnallen. Beide, sowohl der Ärmel als auch die Bandage, waren sein einziger wirklicher Schutz, und dementsprechend sorgfältig ging sein Ausbilder zu Werke. »Spuck’s aus, vor mir brauchst du keine Geheimnisse zu haben!«
»Weiß ich, Danaos, weiß ich!«, beteuerte Niger und zurrte den ledernen Bauchgurt fest, den er über seinem knallroten Lendenschurz trug. »Trotzdem – wenn du nichts dagegen hast, möchte ich mich jetzt voll und ganz …«
»… auf den Kampf konzentrieren!«, vollendete sein Magister und band die Riemen seiner Lederstiefel zu. Von der Unrast, die Niger ergriffen hatte, war bei ihm nichts zu spüren. Danaos war durch nichts aus der Ruhe zu bringen, wie stets, wenn es aufs Ganze ging. »Recht so, aber wenn du schlau bist, lässt du den Hitzkopf erst mal ins Leere laufen.«
»Schon gut, alter Freund, ich hab’s kapiert.«
»Das will ich hoffen.« Danaos erhob sich. Dann musterte er Niger von Kopf bis Fuß. Die Zeiten, während denen sich der Zypriote als Steinmetz und nach seinem Hinauswurf als Gladiator verdingt hatte, waren schon lang vorbei. In seinem Gesicht, von Narben, Schrammen und tiefen Falten durchzogen, hatten sie unübersehbare Spuren hinterlassen. »Wenn wir gerade von Hoffnung reden – noch zwei, drei Kämpfe, und du bist ein freier Mann. Dann bekommst du vom Kaiser ein Holzschwert in die Hand gedrückt, und dann nichts wie weg, ab nach Hause! Mensch, Niger: Was ich konnte, kannst du ja wohl auch, oder?«
»Nach Hause. Du hast gut reden.« Niger wandte sich ab und trat an den Altar der Göttin Nemesis, um ein Opfer darzubringen. Aus Gewohnheit, nicht etwa, weil er glaubte, die geflügelte Statue in der Nische unweit der Hebebühne könne Wunder wirken. »Kannst du mir verraten, wie?«
»Kein Grund, aus der Haut zu fahren, alter Junge.« Der Ausbilder, mehr als einen Kopf kleiner als sein Lieblingsschüler, klopfte ihm begütigend auf die Schulter und prüfte die Klinge des Dolches, bevor er ihn Niger in die Hand drückte. Es folgte der Dreizack, Symbol des Gottes Neptun, was der Retiarius, der nicht einmal hinsah, als ihm die Waffen überreicht wurden, mit versteinerter Miene quittierte. »Schuld, dass du hier bist, sind ja wohl andere, oder?«
»Ja, das stimmt.«
»Na also, dann sind wir uns ja einig.«
»Sagst du!«
»Was soll das heißen?« Das Netz vor Augen, dessen Bleigewichte er einer letzten Überprüfung unterzog, blickte Danaos überrascht auf. »Raus damit, oder denkst du, ich kann Gedanken lesen?«
»Gut so!«, erwiderte Niger und starrte in die Flamme, die vor dem Standbild der Göttin emporzüngelte. Der Duft von Weihrauch und Räucherwerk hing in der Luft, vermischt mit dem Geruch nach Wein, den er auf der Altarmensa ausgegossen hatte. »Sonst würde dir das Lachen vergehen.«
»Beim Janus, was ist denn eigentlich los?« Das war zu viel für ihn. Entschieden zu viel. Danaos nahm das Netz und schleuderte es wutentbrannt in die Ecke. Dann winkelte er die Arme an und baute sich neben dem Retiarius auf. »In einer Viertelstunde beginnt dein Kampf, und was machst du? Du stehst hier rum und tust so, als ginge dich das Spektakel da droben nichts an. Also ehrlich, Niger: Manchmal werde ich nicht schlau aus dir.« Der gedrungene, mittelgroße und trotz seines Körperbaus überaus wendige Zypriote schnappte nach Luft. »Jetzt hör’ mir mal gut zu, mein Junge: Was immer dir durch den Schädel spukt, es hat Zeit bis nachher, klar? Mit Pugnax ist nicht zu spaßen, das weißt du so gut wie ich. Der geringste Fehler – und aus ist der Traum! Dann landest du auf dem Gladiatorenfriedhof. Meinst du, ich habe Tag und Nacht mit dir geübt, damit du dich wie ein Hammel zur Schlachtbank führen lässt? Nichts da, Herkules, so haben wir nicht gewettet!«
»Und was ist, wenn ich mich einfach aus dem Staub …«
»Gar nichts wirst du!«, stieß Danaos zornbebend hervor, hob das Netz auf und drückte es seinem Musterschüler in die Hand. »Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ich muss dir nicht sagen, was passiert, wenn du kneifst.«
»Nein.«
»Na also.« Der Zypriote atmete tief durch. »So, und jetzt tu dem alten Danaos den Gefallen und schlitze diesem Großmaul von einem Secutor den Wanst auf. Du weißt doch: Die Leute lieben dich. Noch ein, zwei Kämpfe, und die Sache ist ausgestanden. Dann ist Schluss mit dem Gladiatorendasein. Dann bist du ein freier Mann. Stell dir vor, Niger, wie herrlich es ist, wenn man tun und lassen kann, was man …«
Der Rest von Danaos’ Worten ging im Schmettern der Fanfaren unter, deren Echo bis in den hintersten Winkel der Katakomben drang.
Niger, Liebling der Massen, umklammerte seinen Dreizack, seufzte und senkte das Haupt.
Jetzt war er an der Reihe.
Die Stunde der Gladiatoren war gekommen.
*
Er hasste dieses Geschrei. Vor allem aber hasste er die Art, wie man ihn taxierte. Für viele hier war er doch nur ein Verfemter, kaum wert, dass man sich wegen ihm den Kopf zerbrach. Die Spiele, welche auf Geheiß des Kaisers stattfanden, dienten nun einmal der Zerstreuung. Und sie verfolgten den Zweck, den Imperator in ein günstiges Licht zu rücken. Morgen, am Tag des Saturn, jährte sich die Thronbesteigung Konstantins zum siebten Mal. Das musste gefeiert werden, zumal gemunkelt wurde, der Kaiser stehe den Christen näher, als es sich gezieme. Nichts wichtiger also als das Volk bei Laune zu halten. Nichts vordringlicher als die Bedenken, welche hinter vorgehaltener Hand geäußert wurden, zu zerstreuen. ›Panem et circenses‹– Brot und Spiele. Seit es Kaiser gab, hatte dieses Schlagwort Gültigkeit. Und nichts deutete darauf hin, dass sich das ändern würde.
Aber immerhin waren sie ein ordnungsliebendes Volk, diese Römer. Das musste ihnen der Neid lassen. Weniger mit seinem Gegner, der unweit von ihm auf das Zeichen des Oberschiedsrichters wartete, als mit den Gaffern ringsum beschäftigt, ließ Niger den Blick über die voll besetzten Ränge schweifen. Knapp 18 mal tausend Schaulustige, wenn nicht gar mehr. Fein säuberlich aufgeteilt, so war es schließlich Brauch. Zuunterst, auf den besten Plätzen, die Dekurionen, darüber, im zweiten Rang, die freien Bürger und Freigelassenen, und auf den oberen Rängen, hinter denen sich die Stadtmauer von Treveris erhob, Frauen und Sklaven. Die Angehörigen des Hofstaates, welche in der Loge links von ihm saßen, natürlich nicht zu vergessen. So hatte es der göttliche Augustus festgelegt. Und so würde es vermutlich auch in Zukunft bleiben.
Der Zufall wollte es, dass sein Blick die Ehrenplätze streifte, doch Niger wandte sich rasch wieder ab. Dort droben, umgeben von Lakaien, Hofdamen, den Mitgliedern des Thronrates und dem Statthalter, saß nämlichsie.
Und ansiewollte er nicht denken.
Denn jetzt ging es ums Ganze. Nigers Körper straffte sich, die Muskeln, welche sich auf über sechs Fuß Körpergröße verteilten, bis zum Zerreißen gespannt. Alle, auch die Höflinge oben in der Loge, warteten jetzt nur noch auf das verabredete Signal. AufihrSignal. Dann würde der Kampf, von dem so viel abhing, beginnen.
Eine Fanfare aus kreisförmig gebogenen Hörnern. Tuben, die schmetterten, dass es wie Donner von den Wänden widerhallte. Das Seidentuch, welchessie,deren Gegenwart ihm auf der Seele lastete, mit theatralischer Gebärde fallen ließ. Und dann, mitten in die atemlose Stille hinein, die erlösenden Worte des Schiedsrichters: »Accedete!«
Die Worte von Danaos im Ohr, schob Niger den linken Fuß nach vorn, umklammerte seinen Dreizack und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Lang zu warten brauchte er nicht. Pugnax, ein mit Kurzschwert, Visierhelm, Beinschienen und rechteckigem Schild ausgerüsteter Secutor, wurde dem Ruf, in dem er stand, einmal mehr gerecht. Kaum hatte der Schiedsrichter das Signal gegeben, hob er den Schild und bewegte sich mit gezücktem Schwert auf ihn zu. Es brauchte nicht viel, um diesen Brachialangriff zu parieren. Ein Stoß mit dem Tridens, eine Körpertäuschung – und die Attacke des Secutors ging ins Leere.
Applaus, Zoten, Hohn und Spott an die Adresse von Pugnax waren die Folge. Das Publikum gab sich gelangweilt. Aber das war nicht weiter verwunderlich. Am Morgen hatte es bereits ein paar Tierhetzen gegeben, mit Ebern, Wildkatzen, Auerochsen und jeder Menge Rotwild aus den Wäldern der Provinz Belgica. Doch das war natürlich erst der Anfang gewesen. Richtig aufregend war es dann um die Mittagszeit geworden. Ein Strauchdieb, dem Vernehmen nach Alamanne, war durch einen Bären zu Tode gehetzt und von dem völlig ausgehungerten Monstrum zerfleischt worden. Doch damit immer noch nicht genug. Auf fünf Sarmatenkrieger, Furcht einflößend wie wilde Tiere, hatte sich ein Rudel Wölfe gestürzt, direkt aus den Käfigen, welche den Rand der Arena säumten.
Ein Spektakel so recht nach dem Geschmack des Publikums, aber nicht das, worauf es wartete. Nun, da sich der Tag dem Ende zuneigte, waren die Gladiatoren an der Reihe.
Jetzt, so der allgemeine Tenor, gingen die Spiele erst richtig los.
»Iugula!« Ein Schrei, durchdringend, schrill und beinahe hysterisch, brachte Niger wieder in die Wirklichkeit zurück. Und siehe da, schon stimmten weitere Rufer mit ein, unter ihnen sogar Frauen. Die Meute hatte Blut geleckt, sie wollte ihren Appetit stillen. Eine Gier, die, wie Niger mit gemischten Gefühlen registrierte, schier unersättlich war.
»Ab in den Orkus mit ihm, schwarzer Panther!« Jetzt wurde es also ernst. Sprungbereit wie zwei Raubtiere, standen sich Niger und sein Gegner gegenüber, belauerten sich, warteten ab, wer die Initiative ergreifen würde.
Der Afrikaner rang nach Luft. Wahrhaftig, die Arena hatte ihre eigenen Gesetze. Es war der Tod, der hier das Sagen hatte. Er war allgegenwärtig, wies jedem seine Rolle zu, bestimmte, wer Publikumsliebling werden oder den Launen der Fortuna zum Opfer fallen würde. In der Arena, angetrieben vom johlenden und nach Blut lechzenden Pöbel, waren sie alle nur Statisten, Reisende auf dem Weg ins Schattenreich.
Das Netz bereit zum Wurf, taxierte der Afrikaner seinen Gegner, tänzelte bald hierhin, bald dorthin, umkreiste, belauerte und reizte ihn so lang, bis sein Temperament, Pugnax’ ärgster Feind, mit ihm durchzugehen drohte. »Was ist, schwarzer Auswurf, hast du etwa Angst vor mir? Komm her, Memme, damit ich dir eine Lektion erteilen kann!«
Niger tat so, als habe er die Schmähung nicht gehört. Im Kreis der Kameraden, so viel stand fest, wäre sein Widersacher nicht ungestraft davongekommen. Das wusste der lllyrer, mit dem er wiederholt aneinandergeraten war, genau. Zuletzt, vor etwa einem halben Jahr, war es Danaos gewesen, der die Streithähne getrennt hatte. Heute aber, am Tag der Entscheidung, würde es dazu nicht kommen. Einer würde den Kürzeren ziehen – nämlich er.
Und, so war ihm versichert worden, überleben.
Den Kampf verlieren, aber wie? Was tun, damit niemand etwas merkte? Auf der Hut vor dem Secutor, der es kaum abwarten konnte, ihn zu demütigen, nahm Niger Habtachtstellung ein. Für den Illyrer, der ihn durch die Augenlöcher seines Visierhelmes musterte, ein Grund mehr, seine Beleidigungen fortzusetzen: »Tja, schwarzer Deckhengst, so ist das nun mal!«, schnaubte er mit heiserer Stimme und bewegte sich bis auf wenige Schritte auf seinen Widersacher zu. »Der Bessere gewinnt eben nicht immer. Schreib dir das hinter die Ohren. Dein Problem, wenn du dich bei gewissen Leuten unbeliebt gemacht hast, nicht meins!« Die Freude über den bevorstehenden Triumph war dem Secutor deutlich anzumerken. »Jetzt komm schon, du Halbaffe – bringen wir’s hinter uns!«
»Und was, wenn ich nicht nach eurer Pfeife tanze?«
»Dann wirst du so enden, wie es ein Neger verdient!«, zischte Pugnax und vergewisserte sich, ob sich der Schiedsrichter außer Hörweite befand. »Und weißt du, was dann passiert? Nein? Dann werde ich mir deine gallische Lupa vorknöpfen und ihr zeigen, was ein Mann ist! Hast wohl geglaubt, du hättest sie für dich allein! Falsch gedacht, Africanus! Ich hab sie gehabt, der Murmillo hat sie gehabt, Mucro, der Thraex, auch – alle haben sie gehabt, du Narr! Und soll ich dir was sagen? Dein Wildfang konnte gar nicht genug kriegen. Beim Priapus, ich kann’s kaum erwarten, dass sie für mich wieder die Beine breitmacht!«
Nigers Antwort kam prompt. Und sie kam so schnell, dass ein Aufschrei durch die Arena ging. Außer sich vor Wut holte der Retiarius aus und stieß zu. Pugnax hatte Mühe, den Stoß mit dem Dreizack zu parieren, wäre sein Schild aus Platanenholz nicht gewesen, hätte dies sein Ende bedeutet.
Doch damit war die Gefahr nicht gebannt. Kaum hatte er den Stoß abgefangen, folgte bereits der nächste. Und danach wieder der nächste. Wie von Furien gehetzt, setzte der Afrikaner nach, trieb seinen Erzfeind, der Mühe hatte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, vor sich her. Dem Ungestüm, mit dem ihn der Retiarius attackierte, hatte der Secutor nichts entgegenzusetzen. Kaum fähig, sich seiner Haut zu erwehren, wich Pugnax, der Illyrer, zurück. Doch die Serie der Stöße riss nicht ab. Das Publikum, dessen Sympathien dem Retiarius galten, hielt es nicht mehr auf den Sitzen, es schrie, johlte, begleitete die Attacke mit frenetischem Applaus.
Dann jedoch, nachdem Pugnax durch die halbe Arena gehetzt worden war, geschah es. Blind vor Raserei, hatte Niger erneut zugestoßen, hatte seinem Zorn, der ihm beinahe den Verstand raubte, durch einen besonders heftigen Stoß Luft verschafft.
Und war vom Jäger zum Gejagten geworden.
Niger erstarrte. Das, was nie und nimmer hätte geschehen dürfen, war eingetroffen. Sein Dreizack war im Scutum seines Widersachers stecken geblieben, und bevor er reagieren konnte, wich Pugnax zurück und riss ihm die Waffe, auf der seine Gefährlichkeit beruhte, aus der Hand.
Der Illyrer reagierte blitzschnell. Ehe der Afrikaner wusste, wie ihm geschah, ließ Pugnax den Schild fallen, in dem immer noch der Dreizack steckte, und ging mit gezücktem Schwert zum Angriff über. All das dauerte nicht länger als einen Wimpernschlag, und es gab niemanden, der jetzt, im Angesicht der unerwarteten Wende, noch auf Niger gewettet hätte.
Doch das Publikum, all die Schreihälse, die ihn mit Schmähungen überhäuften, irrte. Niger fing sich wieder, gerade rechtzeitig, bevor Pugnax mit gezücktem Schwert auf ihn zustürzte. Immerhin hatte er ja noch sein Netz, nicht viel, aber besser als nichts.
Und er hatte seine Gewandtheit, die Fähigkeit, sich in den Gegner hineinzuversetzen. Pugnax hielt nicht viel von Finten, Täuschungsmanövern oder Taktik. Er bevorzugte den Frontalangriff, liebte das Risiko.
So wie jetzt, da er sich im Vorteil wähnte. Aber er hatte die Rechnung ohne den Afrikaner gemacht. Scheinbar mühelos wich ihm dieser aus, behände wie eine Gazelle, auf der Hut wie ein Luchs. Der Retiarius rang nach Luft. Außer Gefahr, das wusste er, war er noch lang nicht. Aber er gewann Zeit. Wenigstens so viel, um einen Plan zu schmieden.
Bebend vor Groll, wirbelte Pugnax herum. Der Afrikaner indes wich zurück, zückte seinen Dolch, drehte sich bald hierhin, bald dorthin, tänzelte wie ein Satyr durch die Arena, auf deren Rängen sich allmählich Unruhe breitmachte. Niger achtete nicht darauf. Taub gegenüber Zurufen, welche ihn der Feigheit bezichtigten, ließ sich der Afrikaner nicht beirren und zog seine Kreise, das Netz, welches er am Boden entlangschleifen ließ, in der rechten Hand. Bald schien es, als vollführe er ein uraltes Ritual, begleitet vom Klang der Trophäen, welche er an seinem Fußgelenk trug. Sie waren das Einzige, was ihm von zu Hause geblieben war, aus der Zeit, in der er, Mahamadu, noch wilde Tiere gejagt, deren Zähne, Hauer und Krallen er aufbewahrt und zu einer Kette, seinem Glücksbringer, zusammengefügt hatte.
Und siehe da – die Rechnung ging auf. Der Kampfeifer des Illyrers erlahmte. Je länger Niger um ihn herumtänzelte, ihn reizte und provozierte, desto schwerfälliger wurden seine Schritte, desto rascher der Atem, nach dem er rang. Am Ende seiner Kraft, schnappte der Secutor nach Luft, während ihm der Schweiß über den dicht behaarten Oberkörper rann. Niger sah es mit Genugtuung. Alles, was er jetzt tun musste, war abwarten. Abwarten, bis Pugnax einen Fehler beging.
Nicht lang, und es war so weit. Das Gesicht nach Osten gewandt, stand Niger seinem Gegner gegenüber. Der Afrikaner schien zu zögern, unsicher, was er als Nächstes tun solle.
Doch dem war nicht so. Ein Lächeln im Gesicht, das der Secutor nicht zu deuten wusste, verharrte Niger auf der Stelle. Wohl wissend, dass der Kampf auf Messers Schneide stand, umklammerte der Secutor seinen Schwertknauf, wischte sich den Schweiß von der Stirn, blinzelte in die tief stehende Sonne, wich zurück – und folgte dem Blick des Retiarius, der, so schien es, nach seinem Dreizack Ausschau hielt.
Es war nicht der erste Fehler, den Pugnax beging, aber ein Fehler, der sein Schicksal besiegeln sollte. Kaum hatte auch er die Waffe erspäht, spürte der Illyrer, dass dies nur ein Ablenkungsmanöver war. Eine List, auf die, wie ihm schmerzlich bewusst wurde, nicht einmal ein Anfänger hereingefallen wäre.
»Damnatus!« Entschlossen, dem Schicksal zu trotzen, wandte sich der Secutor wieder seinem Gegner zu, biss die Zähne zusammen und riss reflexartig den Arm in die Höhe.
Vergebens.
Der Kampf, auf den er wie ein Besessener hingefiebert, für den er monatelang geübt, dessentwegen er sogar auf den Besuch im Lupanar verzichtet hatte, war verloren. Endgültig verloren, ohne Wenn und Aber.
Kaum hatte er sich damit abgefunden, surrte das Netz auch schon durch die Luft und brachte den Illyrer zu Fall. Pugnax strampelte, drehte und wand sich, zerrte und hieb wie von Sinnen auf die Maschen ein, in denen er sich verstrickt hatte. Überschüttete den Gegner, der seelenruhig auf ihn zu schlenderte, mit Flüchen. Umklammerte sein Schwert, um seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen.
Eine Mühe, die er sich hätte sparen können.
Begleitet von frenetischem Jubel, näherte sich der Afrikaner dem verhassten Gegner, der wie ein Fisch in seinem Netz zappelte, ergriff seinen Dreizack und hielt Ausschau nach dem Schiedsrichter, der das Geschehen vom Rand der Arena aus verfolgt hatte. »Was zögerst du noch, Auswurf!«, hörte er Pugnax sagen, die Stimme, deren Klang etwas Tierisches anhaftete, überquellend vor Hohn. »Mach ein Ende, und grüße deine Lupa von mir!«
Der Retiarius schien es nicht zu hören, den Blick abwechselnd auf das Publikum und auf den Schiedsrichter gerichtet, der so tat, als ginge ihn das, was nun folgen würde nichts an. Ein fairer Kampf, schien der Blick des einstigen Gladiators zu sagen, du weißt, was du zu tun hast, Herkules!
Und ob der das wusste. Erneut, zum mittlerweile zehnten Mal, war es an ihm, das Gesetz der Arena zu befolgen. Ein Gesetz, dem zu gehorchen er verpflichtet war.
Verpflichtet?
»Iugula, Niger, iugula!«, hallte es durch die Arena, tausendfach, blutrünstig, gnadenlos. Ohne Erfolg. Der, dem die Aufforderung galt, reagierte nicht. Die Waffen gesenkt, starrte der Retiarius ins Leere, taub für die Zurufe, welche das Amphitheater in ein Tollhaus verwandelten.
Abstechen – und wozu?
Seiner selbst überdrüssig, fixierte Niger die Ehrenloge. Alle, bis aufsie, die ihn mit unbewegter Miene musterte, taten das Gleiche. Standen da und zeigten mit dem Daumen nach unten.
Alle, bis aufsie.
Niger hatte verstanden. Spät zwar, aber er hatte verstanden. »Iugula, Herkules!«, hörte er Danaos, seinen Ausbilder, noch rufen, der, berstend vor Stolz, mit seiner Handkante über die Kehle fuhr. »Mach ihn fertig, er verdient’s nicht anders!«
Dann umklammerte Niger seinen Dreizack, holte aus und stach zu.
AMOR MORTIS
›Es ist gerade dieses Paradox – ihr geringer sozialer Stand in der römischen Gesellschaft und ihre Aussicht auf ein spannendes Leben und die Chance auf großen Wohlstand –, das viele Männer von einstmals gutem Stand in diese Profession trieb. Zumeist holten sich die Gladiatorenschulen ihren Nachwuchs von den Sklavenmärkten, aber es gab auch einige Freiwillige unter den Neuankömmlingen.‹
(Stephen Wisdom / Nic Fields, Gladiatoren, Königswinter 2009)
LIBER PRIMUS
(Samstag, 25. Juli 313 n.Chr.)
II
Villa Aurelia, eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang
[07:00 h]
Das fing ja gut an.
Gaius Aurelius Varro, Anwalt und Ratsherr zu Treveris, senkte den Kopf und ließ sich mit schmerzverzerrter Miene auf der Bettkante nieder. Ausgerechnet heute, am ersten Mußetag seit Wochen, quälte ihn wieder sein Bein, ein Andenken an die Zeit, als er noch Tribun gewesen war. Damals, während der Kämpfe gegen den Usurpator Allectus, hatte ihn ein Wurfspeer am Oberschenkel getroffen und seinen Militärdienst in Britannien jäh beendet. Geraume Zeit war sein Leben an einem seidenen Faden gehangen und nach Meinung der Ärzte, unter ihnen sein Freund Probus, keinen Sesterz mehr wert. Doch er war dem Tod entronnen, wie so häufig in jenen Tagen. Der Preis, den er dafür hatte zahlen müssen, war allerdings hoch. Sein Bein war nie wieder richtig verheilt, der Grund, den Dienst beim Militär zu quittieren.
»Schon gut, Dromas – halb so wild.« Varro stieß einen halblauten Seufzer aus. So phlegmatisch sein Hund, der behäbigste Vierbeiner diesseits der Alpen, auch sein mochte, wenn es ihm schlecht ging, wich Dromas nicht von seiner Seite. Als Wachhund war das Monstrum, welches einen legendären Ruf als Vielfraß besaß, zwar nicht zu gebrauchen, aber da er sich als treuer Gefährte erwiesen hatte, sah er über seine Flausen hinweg. In Treveris, pflegte Varro zu scherzen, gab es wahrscheinlich niemanden, der die Warnung auf dem Mosaik im Vestibül seiner Stadtvilla ernst nahm, mochte das ›Cave canem!‹ samt dem abgebildeten Ungetüm noch so bedrohlich anmuten.
»Runter mit dir, aber schnell!« Bereit zu einem erneuten Anlauf, scheuchte Varro seinen Hund von dem Feldbett, auf dem er seit seiner Militärzeit nächtigte, legte die Handflächen auf die Oberschenkel und schraubte sich in die Höhe.
Kaum auf den Beinen, besserte sich auch schon seine Laune. »Na, du bist mir vielleicht einer!«, rief er lachend aus, im Zweifel, ob sein Bild von Dromas nicht vielleicht doch korrekturbedürftig sei. »Gib her, damit ich meine Ruhe habe!«
Die Antwort bestand aus einem freudigen Jaulen, und so blieb Varro nichts anderes übrig, als den Stock, der im Maul seines Hundes steckte, an sich zu nehmen, in seine Sandalen zu schlüpfen und nach Syphax, seinem Leibsklaven, zu rufen. Dieser war denn auch prompt zur Stelle, brachte ihm eine Waschschüssel samt dazugehörigem Leinentuch und half ihm beim Rasieren. Das hörte sich leichter an, als es war, denn das sichelförmige Messer war scharf, und Varro überaus penibel, wenn es um Fragen der Körperpflege ging. Von der Unsitte, sich die Körperhaare entfernen zu lassen, hielt er allerdings nicht viel, und so war die Morgentoilette, welche er verrichtete, in wenig mehr als einer Viertelstunde beendet.
»So, Herr, das hätten wir«, stellte Syphax fest, knapp 30 und von Geburt Berber, der Varro, der beinahe sechs Fuß maß, um Haupteslänge überragte, »hier – dein Spiegel.«
Das fehlte gerade noch. Es war spät geworden gestern Nacht, sehr spät sogar. Das Gastmahl beim Statthalter, auf das er nicht übermäßig erpicht gewesen war, hatte sich über Gebühr in die Länge gezogen, weshalb er es vorzog, die Begegnung mit seinem Konterfei zu meiden. Hätte er eingewilligt, wäre sein Blick auf einen hochgewachsenen Aristokraten gefallen, jenseits der 40, hager und mit einem Gesichtsausdruck, den viele, mit denen er zu tun hatte, als ernst und bisweilen sogar als einschüchternd empfanden. Dabei war Varro, zumindest aus seiner Sicht, alles andere als ein zurückhaltender Mensch. Er liebte es zu scherzen, wenngleich sein Humor, wie er bereitwillig einräumte, nicht jedermanns Sache war. Aber damit, das heißt mit dem Ruf, welcher ihm vorauseilte, hatte er sich längst abgefunden. Die Leute sahen nun einmal den ehemaligen Militärtribun in ihm, weniger den Advokaten, der am liebsten in seinem Studierzimmer saß und an seiner ›Kriminalgeschichte des Römischen Reiches‹ schrieb. Das war es, was ihm am meisten Spaß machte, allemal lohnender, als sich bei einem Bankett zu Tode zu langweilen.
»Nicht nötig, Syphax«, beschied der Advocatus seinen Sklaven, der, so mutmaßte er, sein Desinteresse an Festivitäten nicht teilte. Dann drückte er ihm seinen Stock in die Hand. »Ich weiß, wie ich aussehe.«
Das heißt, Varro glaubte, es zu wissen. Denn obwohl er es verschmähte, sich herauszuputzen, war er beileibe kein hässlicher Mann. Der Advocatus war kräftig, hatte dunkles und von silbergrauen Strähnen durchzogenes Haar sowie dank seiner Mutter, die aus Hispalis stammte, auch dunklere Haut, als sie die Bewohner der Provinz Belgica besaßen. Seine Nase, markant und leicht nach unten gebogen, war dagegen ein Erbteil seines Vaters, zu Lebzeiten Senator und einer der reichsten Männer Roms. Das Gleiche galt für die dunklen Augen, von denen es hieß, dass niemand, der etwas ausgefressen hatte, ihrem Blick auf Dauer standhalten könne.
»Aber Herr, wenn deine Klienten dich in diesem Aufzug …«
»Damit du es weißt, Syphax«, erstickte Varro den Einwand seines Leibsklaven im Keim, »ich habe nicht vor, mich heute mit ihnen herumzuschlagen.«
Syphax hütete seine Zunge und nickte.
»Im Klartext: Sobald einer der Herrschaften auftaucht, sagst du ihm, ich habe zu tun. Damit das klar ist, Syphax: Ich möchte heute Morgen nicht gestört werden, von niemandem, haben wir uns verstanden?«
»Wie du wünschst, Herr. Ich werde persönlich dafür Sorge tragen.«
»Das will ich dir auch geraten haben. So, und jetzt tu mir den Gefallen und sag Fortunata, ich möchte frühstücken.«
»Das Übliche, Herr?«
»Du hast es erfasst.« Varro war eben ein Gewohnheitsmensch, und das fing bereits beim Frühstück an. Ein Stück Brot, Ziegenmilch und Schafkäse mit gebratenen Zwiebelringen und Lauch reichten ihm völlig aus. Ganz besonders nach einem Gelage, welches sich stundenlang hingezogen hatte. Varro schüttelte unwirsch den Kopf. Selbst im Nachhinein drehte sich ihm noch der Magen um, kein Wunder angesichts der Kost, welcher er den Vorzug gab. Der Statthalter, ein würdiger Nachfolger von Trimalchio, war da schon aus anderem Holz geschnitzt, hatte aufgeboten, was Küche und Keller hergaben. Nichts für Varro, der Angeberei hasste, aber mehr als genug für die zahlreichen Gäste. Angefangen bei der Vorspeise, mit Seeigeln gefüllten Sauzitzen, hatte das Gastmahl aus sieben Gängen bestanden, eine Tortur für den Schöngeist, der sich weder etwas aus Siebenschläfern noch aus Reiherzungen noch aus Garum mit Zypressenrauch, Most oder Honig und schon gar nichts aus einem Wildschwein machte, das mit lebenden Drosseln gefüllt und mit Zitzen aus Hartkäse versehen worden war. Auch verabscheute er Honigwein, allein schon aufgrund des Katers, welchen einem dieser Trank bescherte. Wein diente dazu, den Durst zu stillen, nicht etwa, damit man ihn unvermischt und bis zum Umfallen trank. Genau das war nämlich am gestrigen Abend geschehen, und er, der den Spitznamen ›Der Spartaner‹ trug, einmal mehr belächelt worden.
»Schafkäse mit Zwiebeln?«
»Genau. Und jetzt sieh zu, dass du in die Küche kommst.«
Varro konnte eben nicht aus seiner Haut. Knapp zehn Jahre Militärdienst, die Hälfte davon in Britannien, hatten sich ihm unauslöschlich eingeprägt. Der beste Beweis dafür war sein Cubiculum, das bis auf zwei, drei Öllampen, das Feldbett, den Hocker und die Truhe, in der er Schwert und Rüstung aufbewahrte, nahezu völlig leer war. Die Wände waren kahl und unbemalt, ganz anders als bei seinen Ratskollegen, die bestrebt waren, einander in puncto Luxus zu überbieten.
»Wie du wünschst, Herr«, antwortete Syphax, verneigte und beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen. Varro ließ ihm den Vortritt, verließ sein Cubiculum und schlug den Weg zum Lararium ein, gefolgt von Dromas, der sich umgehend an seine Fersen heftete.
*
Der Tag war noch jung, die Stadtvilla, ein Erbstück seines Vaters, wie verlassen. Varro war es recht so, denn er genoss es, frühmorgens durch das Atrium zu spazieren, dem Plätschern des Springbrunnens im Peristyl zu lauschen und die Stille, welche ringsum herrschte, auf sich wirken zu lassen. Für Varro, bei dem Ruhe und Beschaulichkeit hoch im Kurs standen, war dies die schönste Zeit des Tages. Dann konnte er, was allzu selten der Fall war, seinen Gedanken nachhängen oder, wie in diesem Moment, das Morgenlicht genießen, welches sich im Impluvium, dem Auffangbecken für das Regenwasser, widerspiegelte. An Regen war derzeit freilich nicht zu denken, wie ein Blick des Hausherrn hinauf zum Compluvium bewies. Der Himmel über der Stadt war strahlend blau, was in Varro, von Natur aus Optimist, die Hoffnung nährte, dass der Tag des Saturn ein friedvoller werden würde.
Dass sie trog, konnte er jetzt, da er vor der Maske seines Vaters innehielt, freilich nicht ahnen. Varro, auch diesbezüglich ein Gewohnheitstier, zupfte die zerknitterte Tunika zurecht, seufzte und neigte das Haupt. Zeitlebens waren er und der Senator, Tatmensch und Verächter der schönen Künste, einander mit Distanz begegnet. Einer, wenn nicht gar der Grund hierfür, war die Distanz Varros gegenüber Rom, der Geburtsstadt seines Vaters, gewesen. Dies ging sogar so weit, dass er sich geweigert hatte, dorthin überzusiedeln. Der Vater, schwerreicher Adelsspross und überdies Statthalter der Provinz Belgica, wo er Ländereien und zahlreiche Villen erworben hatte, war darüber mehr als erbost gewesen. An Varros Weigerung, seiner Geburtsstadt den Rücken zu kehren, hatte dies jedoch nichts geändert, alles Bitten, Zureden und die Drohung, ihm sein Erbe abzuerkennen, waren erfolglos geblieben. Anstatt einzulenken, hatte sich der 15-Jährige in seinen Schmollwinkel zurückgezogen, hatte Horaz, Ovid und die Selbstbetrachtungen des Mark Aurel studiert und so getan, als ginge ihn Politik, die Passion seines zum kaiserlichen Rat aufgestiegenen Vaters, nichts an. Erst wesentlich später, als er und der aufstrebende Stern am politischen Firmament Roms längst getrennte Wege gegangen waren, hatten ihn schließlich Gewissensbisse geplagt. Aber da war es bereits zu spät gewesen. Vater und Sohn waren einander fremd geworden, hatten sich, wenn überhaupt, nur noch wenig zu sagen gehabt.
Vor einem Dreivierteljahr, kurz nach dem Sieg des Kaisers über Maxentius, war es dann geschehen. Vater, mittlerweile 70, Wortführer im Senat und im Bürgerkrieg auf der falschen Seite, hatte seinem Leben ein Ende gesetzt, einsam, verbittert und um die Früchte seines Wirkens betrogen.
So wollte er, Varro, ganz gewiss nicht enden, bei allem Schmerz über den Verlust, den er zu spät als solchen empfunden hatte. Politik war nun einmal ein schmutziges Geschäft, und wer sich darauf einließ, lief Gefahr, Kopf und Kragen zu riskieren. Das war ihm des Öfteren bewusst geworden, je älter er wurde, desto mehr.
»Ist ja gut, Dromas – ich komme gleich.« In Gedanken bei einem Thema, an das er heute, wo er auf Erholung bedacht war, lieber nicht erinnert werden wollte, fiel Varros Blick auf den Ring an seiner rechten Hand. Kaum war dies geschehen, wandte sich der Advocatus ab und heftete sich an die Fersen seines Hundes, der es nicht abwarten konnte, den Rundgang fortzusetzen. Varro war froh darüber, wohl wissend, dass er gut daran tat, die Vergangenheit ruhen zu lassen.
Ruhe, welch schönes Wort. »Gaius – Frühstück! Bei meiner Jungfernschaft: Wo steckt der Junge bloß?« Der Advocatus konnte sich eines Schmunzelns nicht erwehren. Nirgendwo, nicht einmal vor dem Lararium, hatte man anscheinend seine Ruhe, schon gar nicht vor dem Organ seiner Amme, welches ihn, den ehemaligen Tribun, an den allmorgendlichen Weckruf beim Militär erinnerte. Obschon älter als 70, bestand Fortunata darauf, den Haushalt zu führen, und das, wie Varro immer wieder erfreut feststellte, besser als manche halb so alte Frau. »Gaius, die Zwiebeln werden …«
»Moment, ich komme gleich!« Ein Lächeln im Gesicht, bückte sich der Hausherr nach dem hufeisenförmigen Feuerstein, welcher griffbereit neben dem Kultschrein lag, und schlug mit geübter Hand auf ein faustgroßes Stück Quarz. Funken sprühten, etliche davon auf den Zunderschwamm, den Varro, der es sich nicht nehmen ließ, dies selbst zu erledigen, mithilfe seines Atems zum Glühen brachte. Jetzt fehlte nur noch das mit Räucherwerk überzogene Stäbchen, und schon hatte das Ritual, für einen Mann seines Schlages eine Selbstverständlichkeit, seinen Anfang genommen.
»Gaius Aurelius Varro, wenn du dich jetzt nicht beeilst, kannst du dir eine andere Haushälterin …«
»… suchen, ich weiß!«, vollendete der Anwalt im Flüsterton, den Blick auf dem Bild, welches die Mitte des Kultschreins zierte. An sich, so fand er, war es gut gelungen, abgesehen vielleicht von dem Römer, welcher sich bei näherer Betrachtung als sein Vater entpuppte. Wie andernorts üblich, wurde Quintus Aurelius Varro, der Erbauer der Villa, von den in hochgegürtete Tuniken gehüllten Zwillingsgöttern flankiert. Besagte Laren trugen Trinkhörner in der Hand, eine, wie Varro nicht zu Unrecht vermutete, Anspielung auf den Lebenswandel seines Vaters, der ohne Falerner nicht hatte leben können. Am Fuß des Bildes wand sich eine Schlange durch das Gebüsch, im Begriff, die Opfergaben, unter anderem Wein, Feldfrüchte und frisches Brot, zu inspizieren. Sie stellte so etwas wie den guten Geist des Hauses dar, die passende Ergänzung zu Fortunata, deren Stimme wie ein Fanfarenstoß durch die Korridore der Villa Aurelia hallte. »Bin schon unterwegs!«
*
Vorbei am Peristylgarten, wo es nach Buchsbaum, Oleander und Schwertlilien duftete, humpelte der Advokat zur Küche. Dort wartete bereits sein Frühstück auf ihn. Und dort hatte sich auch Fortunata postiert, vor nunmehr vier Dezennien seine Amme und eine der Wenigen, auf deren Meinung er etwas gab. »Da hast du aber Glück gehabt, Dominus!«, redete ihn die beleibte Matrone mit seiner korrekten Bezeichnung an, nicht ohne einen Hauch von Spott, wie Varro insgeheim bemerkte. Der Herr im Haus, oder vielmehr die Herrscherin, war nämlich sie, und er tat gut daran, dies nicht infrage zu stellen. »Sonst hättest du dir dein Essen selbst zubereiten können!«
»Davor, wie vor allem Bösen, möge mich Vesta behüten!«, rief Varro mit gespielter Inbrunst aus und steuerte auf den gemauerten Herd zu, wo die Frau, die für ihn Mutterstelle eingenommen hatte, die Mahlzeiten für die Hausbewohner zubereitete. »Hm – sieht wirklich lecker aus!«
»Tu bitte nicht so, als täte dir dein Zuspätkommen leid!«, schnaubte die 71-jährige, energische und rotwangige Frau mit erhobenem Kochlöffel, von dem sie während seiner Jugend vor allem dann Gebrauch gemacht hatte, wenn der Sohn des Hauses über die Stränge schlug. »Oder denkst du, ich falle darauf herein?«
»Nie und nimmer – wenn hier jemand Gedanken lesen kann, dann du.«
»Du sollst mich nicht auf den Arm nehmen, klar?«, schnaubte die Alte, trat auf die Zehenspitzen und kniff ihn ins linke Ohr. »Sonst setze ich dich auf halbe Kost!«
»Aua, das tut …«
»Wenn wir gerade von Schmerzen reden, was macht dein Bein?«
»Recht gut, kann nicht klagen«, erwiderte Varro und trat beiseite, um Fortunata nicht ins Gehege zu kommen. In der Küche, höchstens vier Schritte im Quadrat groß, war dank der Leibesfülle seiner Amme kaum Platz, nichts Ungewöhnliches in den Patrizierhäusern der Stadt. Allein schon der Herd nahm die Hälfte der Fläche ein, was dazu führte, dass das Rupfen, Ausnehmen und Enthäuten der Hühner im Atrium ausgeführt und das Fleisch während eines Gastmahls auf tragbaren Kohlenbecken gebraten wurde. »Hm, riecht das aber …«
»Lenk nicht ab, Gaius. Wenn du gefrühstückt und deine Arbeit erledigt hast, wirst du dich schleunigst zu deinem Freund, diesem … diesem …«
»Probus. Valerius Probus. Du wirst doch nicht etwa alt, Fortunata?«
»Frühstück, ja oder nein?«
»Beim Andenken des Lukullus – ja!«