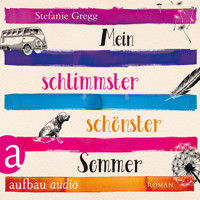9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schatten des Krieges
- Sprache: Deutsch
Ein erster, letzter Tanz mit dir.
München, 1947: Helene wächst zwischen den Trümmern auf, die ihr Zuhause und Spielplatz zugleich sind. Doch dann kehrt ihr Vater zurück, und sie fasst einen Beschluss: Von diesem Fremden wird sie sich nichts sagen lassen – und fortan rebelliert sie. Sie möchte ein unbefangenes, freies Leben führen und nicht wie ihre Schwester Ana immerzu Sicherheiten schaffen. Erst viele Jahre später, als ihre Mutter erkrankt und ihrer Tochter von ihrem Leben vor dem Krieg und ihrer ersten Ehe erzählt, erkennt Helene, wie sehr auch ihre eigene Existenz von der Vergangenheit gezeichnet ist ...
Authentisch und berührend – eine Mutter-Tochter-Geschichte in den Schatten des Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
München, 1947. Helene hat vor nichts und niemandem Angst: nicht vor der gemeinen Hausmeisterin, dem großen Schäferhund in den Trümmern und erst recht nicht vor dem fremden Mann, der ihr Vater sein soll. Seit sie mit ihrer Mutter und Schwester aus Breslau geflohen ist, bringt Helene das Feuerholz nach Hause. Um zu überleben, brauchen sie also keinen Mann – vor allem keinen, der ihr sagt, was sie zu tun und zu lassen habe. Auch Jahre später strebt Helene immer nach einem Leben in Unabhängigkeit und Freiheit, doch dass sie der Vergangenheit nicht entfliehen kann, erkennt sie erst, als ihre kranke Mutter erstmals von ihrem Leben vor dem Krieg erzählt: wie sie Ludwig einst kennenlernte – und sie noch mit einem anderen Mann verheiratet war.
Über Stefanie Gregg
Stefanie Gregg, geboren 1970 in Erlangen, studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Germanistik und Theaterwissenschaften, worin sie auch promovierte. Nach Stationen in Medienunternehmen und als Unternehmensberaterin widmet sich die Autorin dem Schreiben. Mit ihrer Familie wohnt sie in der Nähe von München.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Mein schlimmster schöner Sommer«, »Der Sommer der blauen Nächte« und »Nebelkinder« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefanie Gregg
Die Stunde der Nebelkinder
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog — Helene München 1947
Teil I
KAPITEL 1: Helene — München 1988
KAPITEL 2: Käthe — Breslau 1931
KAPITEL 3: Helene — München 1988
KAPITEL 4: Helene — München 1947
KAPITEL 5: Helene — München 1988
KAPITEL 6: Helene — München 1947
KAPITEL 7: Helene — München 1988
KAPITEL 8: Helene — München 1988
KAPITEL 9: Käthe — Breslau 1933
KAPITEL 10: Helene — München 1988
KAPITEL 11: Käthe — Breslau 1933
KAPITEL 12: Helene — Breslau 1944
KAPITEL 13: Helene — München 1988
KAPITEL 14: Paula Ollech — Breslau 1931
KAPITEL 15: Helene — München 1947
KAPITEL 16: Helene — München 1988
KAPITEL 17: Paula Ollech — Breslau 1931
KAPITEL 18: Helene — München 1988
KAPITEL 19: Helene — Breslau 1943
KAPITEL 20: Helene — München 1988
KAPITEL 21: Helene — München 1988
KAPITEL 22: Käthe — Breslau 1931
KAPITEL 23: Helene und Käthe — Schweiz 1988
Teil II
KAPITEL 24: Käthe — Breslau 1931
KAPITEL 25: Käthe — Breslau 1932
KAPITEL 26: Käthe — Breslau 1932
KAPITEL 27: Käthe — Breslau 1933
KAPITEL 28: Ludwig — Breslau 1933
KAPITEL 29: Käthe — Breslau 1933
KAPITEL 30: Käthe — Breslau 1936
Teil III
KAPITEL 31: Käthe und Helene — Schweiz 1988
KAPITEL 32: Käthe und Helene — Monte Verità 1988
KAPITEL 33: Helene — Monte Verità 1988
KAPITEL 34: Helene — Monte Verità 1988
KAPITEL 35: Helene — Lago Maggiore 1988
Teil IV
KAPITEL 36: Paula Ollech — Marseille und Jerusalem 1937
KAPITEL 37: Käthe — Breslau 1938
KAPITEL 38: Paula Ollech — Jerusalem 1938
KAPITEL 39: Käthe — Breslau 1938
KAPITEL 40: Käthe — Breslau 1943
Teil V
KAPITEL 41: Helene — München 1988
KAPITEL 42: Helene und Käthe — München 1988
KAPITEL 43: Helene — München 1989
KAPITEL 44: Helene — München 1990
KAPITEL 45: Helene — München 1990
KAPITEL 46: Helene — München 1990
KAPITEL 47: Helene — München 1991
KAPITEL 48: Helene — München 1991
KAPITEL 49: Helene — München 1991
KAPITEL 50: Helene — München 1991
KAPITEL 51: Helene — München 1992
KAPITEL 52: Helene — München 1992
KAPITEL 53: Helene — München 1992
KAPITEL 54: Helene — München 1992
KAPITEL 55: Helene — München 1992
KAPITEL 56: Helene — München 1992
KAPITEL 57: Helene — München 1992
KAPITEL 58: Helene — München 1992
KAPITEL 59: Helene — München 1992
KAPITEL 60: Helene — München 1992
KAPITEL 61: Käthe — München 1993
KAPITEL 62: Helene — München 1993
KAPITEL 63: Helene — München 1993
KAPITEL 64: Helene — München 1993
KAPITEL 65: Käthe — München 1993
Epilog — Helene Paris 2000
NACHWORT
DANKE
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine Mutter und meinen Vater, die ich sehr liebe
Prolog
Helene München 1947
Helene spielte mit ihren Freunden auf den Trümmern. Sie war eine Piratenprinzessin und die anderen ihre Mannschaft. Sie hielt ein Rohr an ihr Auge und blickte über das Trümmermeer. »Dort, Männer, sehe ich eine Insel.«
Endlich wieder eine Insel, nach all diesen Tagen auf See. Sie deutete auf ein verfallenes Haus. »An die Ruder, Männer!« Die Mannschaft gehorchte, setzte sich in zwei Reihen vor sie, nahm Hölzer, Rohre, oder was immer sich finden ließ, und begann zu rudern, was das Zeug hergab.
»Langsam, wir sind gleich da«, befahl Helene, und der Takt der Ruder beruhigte sich. »Ab in die Beiboote.« Die »Männer«, die natürlich ebenso kleine Jungs wie kleine Mädchen umfassten, standen auf und stiegen in die imaginären Beiboote. Ein Mädchen ließ ihre Hand ins vermeintliche Wasser gleiten. »Ist es nicht glasklar hier? Das blaue Meer!«, rief sie begeistert aus.
Dann winkte Helene die Mannschaft weiter. »Lasst uns nun das Festland betreten und Ausschau halten, was die Insel zu bieten hat. Aber haltet die Schwerter gezückt, man weiß nie, welchen Feinden wir begegnen können!«
Alle hielten das, was gerade noch Ruder gewesen waren, als Schwerter hoch in die Luft und schlichen auf die Insel. In drei Minuten waren sie am halb zerfallenen Haus angekommen. Helene betrat es als Erste. »Ihr«, sie deutete auf zwei Jungs, »sucht die rechte Hälfte ab. Und ihr«, nun zeigte sie auf zwei Mädchen, »die linke. Die anderen folgen mir nach oben.«
»Ich will auch mit dir nach oben«, protestierte einer der kleineren Jungen.
»Dann werde erst mal groß, Dreikäsehoch«, lachte sie ihn aus. Dass sie selbst mit ihren sieben Jahren nur ein Jahr älter war und jünger als die meisten anderen, würde keiner einwenden. Helene war die Piratenprinzessin, die Trümmerprinzessin, denn sie war die Prinzessin unendlicher Phantasiewelten.
»Es ist zu gefährlich, die oberen Stockwerke brechen eher ein«, gab sie versöhnlich hintendrein. »Auf, Männer«, verfiel sie dann wieder in ihr Spiel.
Zwei Stunden später hatte sie in ihrer Tasche eine Tischdecke und unter dem Arm drei dicke Hölzer zum Verfeuern. Die Beute hatte sie wie immer gerecht unter der Mannschaft verteilt. Darauf legte Helene großen Wert. Als einmal ein Junge etwas in der Hosentasche versteckt hatte und sie darauf gekommen war, durfte er zwei Wochen lang nicht mehr mitspielen. Allerdings achtete sie darauf, dass die Kinder, von denen sie wusste, dass es ihnen noch schlechter ging als den anderen, ein wenig mehr bekamen. Und keiner der Truppe hatte es je gewagt, ihre Entscheidung anzuzweifeln.
Stolz lief sie die Straße hinunter. Mutti würde sich freuen, über das Holz und auch über die Tischdecke. Für Käthe waren solche Sachen, die anderen wertlos erschienen, immer die schönsten Schätze, die ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern konnten. Helene hüpfte nach Hause.
Im Flur stand die Hausmeisterin und warf einen begehrlichen Blick auf das Holz in Helenes Armen. Die anderen Kinder hatten Angst vor ihr, sogar ihre große Schwester Ana. Manchmal fing man sich eine Backpfeife von ihr ein, einfach so, ohne jeglichen Grund. Aber das Schlimmste war, dass sie die Tür zum Keller schloss, wenn eines der Kinder dort hinabstieg, um Kohlen zu holen. Von innen konnte man sie nicht aufschließen. Dann saß man vor der Tür, auf den kalten, steinernen Kellerstufen und musste warten, bis ein anderer Hausbewohner die Hilferufe hörte. Die alte Mayer leugnete das natürlich, wenn die Kinder ihren Eltern davon erzählten. Auch Käthe hatte nur hilflos mit den Armen gezuckt, als Helene berichtete, wie sie eine Ewigkeit auf dem dunklen Kellerabsatz gehockt hatte.
Aber Helene wich der Hausmeisterin diesmal nicht aus. Im Gegenteil, sie ging direkt auf sie zu. Dabei drehte sie die Bretter so, dass sie mit den spitzen Ecken ihrer Kanthölzer nach vorne zeigten. Noch einen Schritt, kein halber Meter mehr, für eine Backpfeife hätte es schon gereicht, aber Helene ging noch einen Schritt weiter. Die hölzernen Enden berührten fast die dürr nach unten hängenden Brüste. Und da geschah es. Die Mayer senkte ihren Blick und drehte sich um. Helene ging langsam an ihr vorbei, sie nicht aus den Augen lassend, gerade von hinten hätte sie noch zuschlagen können, aber die Mayer ging in ihre Wohnung. Bei den nächsten Schritten spürte Helene, dass ihre Zähne schmerzten, so sehr hatte sie sie aufeinandergepresst.
Jetzt war dieses Holz noch mehr wert. Ein Schatz, ein Glück, ein Sieg. Für Mutti hatte sie es getan. Sie fühlte sich wie die größte Piratin aller Weltmeere, als sie die Küche betrat. Ihre Mutter und Ana würden sie feiern, bestimmt bekäme sie eine extra Stulle mit Butter.
Wie eine Goldkiste streckte sie zuerst das Holz zur Tür herein, bevor sie triumphierend ihr Gesicht nachschob.
Kein glücklicher Aufschrei, kein In-die-Hände-Klatschen. Weder Käthe noch Ana hatten es überhaupt bemerkt. Sie saßen nämlich beide am Tisch und lächelten einen Mann an, der bei ihnen saß. Und der Mann hatte eine riesige Stulle Brot vor sich, mit Butter. Ihr Brot. Allerdings hätte Helene nie so viel Brot, geschweige denn Butter dazu bekommen.
Käthe strahlte und hatte die Hand auf den Arm des Mannes gelegt. Helene starrte entgeistert auf Käthe, auf die Hand auf seinem Arm, auf den Mann.
»Lenchen?«, fragte er.
Er sah sie lächelnd an. Doch sie mochte dieses Lächeln nicht. Fremde Menschen sollten sie nicht so anschauen, fremde Männer erst recht nicht. Sie nickte und legte das völlig unbemerkt gebliebene Holz in der Küchenecke ab. Dann streifte sie ihre Hände ein wenig sauber, bevor sie zu ihm ging und ihm die Hand reichte, obwohl es ihr sehr missfiel, dass Mutti ihn berührte. Obwohl ihr einfach alles missfiel. Da stand er auf und drückte sie an sich. Sie erstarrte. Er roch nach Schweiß und Dreck und mehr Unangenehmem.
»Du kennst mich nicht mehr?«
Woher sollte sie ihn kennen, sie hatte ihn noch nie gesehen.
»Ich bin dein Vater. Setz dich.«
Ihr Vater? Das Wort drang nicht zu ihr durch. Andere Kinder hatten Väter, viele nicht. So wie sie. Wie kam er dazu, sie aufzufordern, sich zu setzen, als ob die Wohnung ihm gehöre? Sie setzte sich an ihren Küchentisch, wann immer sie wollte.
Vater. Langsam tropfte dieses Wort in ihren Kopf. Helene wusste, dass sie einen gehabt hatte, wusste seinen Namen, Ludwig. Käthe hatte von ihm erzählt, immer wieder gehofft, dass er bald käme. Sie selbst hatte sich ihren Vater nicht zurückgewünscht. Warum auch? Die Väter der anderen Kinder schlugen diese meist. Sie war noch nie von ihrer Mutter geschlagen worden und würde sich auch nicht von einem Vater schlagen lassen.
»Es ist sehr spät für ein kleines Fräulein wie dich. Es ist schon fast dunkel!« Sein Ton war vorwurfsvoll.
Sie sah ihn an und wusste eines ganz genau. Niemals, niemals würde sie sich von diesem fremden Mann etwas sagen lassen. Und wehe, er versuchte, sie je zu schlagen.
Und das Holz würde sie Mutti heute auch nicht geben. Sollte der Mann doch frieren heute Nacht. Denn dass der Fremde bleiben würde, war ihr klar.
Teil I
KAPITEL 1
Helene
München 1988
Ein Blitzen ließ Helene zur Seite sehen. Doch es war nur ihr eigenes verhuschtes Spiegelbild, das sich in einer Schaufensterscheibe bewegte.
Helene nahm es auf mit ihrem gewohnten Malerblick, ein Klick der Kamera, ein Foto, geschossen von ihrem inneren Auge. Flüchtige Streifen, eine dahinziehende Frau. Doch ihr Blick hielt auch in den Bruchteilen einer Sekunde Details fest. Die Bluse, ein Knopf zu weit offen, zu spitze Knochen offen legend. Der Mund, im Partylächeln gefroren.
Der Rock wehte hinter ihr her, ein schöner Stoff, wie eine Fahne nachschwebend, weiterrauschend im Drehen der Nacht. Der Rock tanzte noch. Die Augen nicht mehr. Ihre Pupillen dunkel und groß.
Helene hatte das Krankenhaus erreicht, ihre Hand lag auf dem Metallgeländer, das die Steinstufen hinaufführte. Sie hatte ihrer Schwester versprochen, ihre Mutter zu besuchen. Und wenn es ein Einziges gab, an das sie sich noch hielt, dann war es ein Versprechen, das sie Anastasia gab.
Es war absoluter Unsinn, ihre Mutter jetzt zu besuchen. Wenn sie wach wäre und einigermaßen klar, würde sie sofort sehen, dass ihre Tochter direkt aus der Nacht kam. Wenn sie noch schliefe, nützte ihr Krankenbesuch sowieso nichts.
Aber sie hatte es ihrer Schwester versprochen. Und wenn sie jetzt nach Hause ginge, fiele sie in einen tiefen Schlaf, der sie erst spät wieder erwachen ließ, bereit für die nächste 48-Stunden-Party.
Wenn sie nicht einmal mehr das täte, was sie Ana versprochen hatte, dann … Sie umfasste das Geländer so fest, dass sie das Zittern ihrer Hand bezwang.
»Ich suche Käthe Vahrenhorst.« Helene spürte den missbilligenden Blick des Mannes an der Pforte, der vermutlich ihren Alkoholatem sogleich gerochen hatte.
»3. Stock, Zimmer 12.«
Helene warf den Kopf in den Nacken, drehte sich dann bewusst schwungvoll um und lief langsam den Gang zum Aufzug hinunter. Sie glaubte, seine Blicke im Rücken zu spüren. Im Aufzug warf sie einen Blick in den Spiegel und versuchte, sich zu sortieren. Die Bluse gerade gezogen und einen Knopf mehr geschlossen, die wilden blonden Locken mit den Händen geglättet, die verschmierte Wimperntusche mit ein wenig Spucke entfernt. Sie hatte keinen Kaugummi dabei. Egal, die Haltung machte es, das hatte sie von ihrer Mutter gelernt. Contenance.
Betont fröhlich öffnete sie die Tür. Ihre Mutter lag da, als ob sie sie in eben diesem Moment erwartet hätte. Das Rückenteil ein wenig nach oben gedreht, so dass sie nahezu in ihrem Bett thronte, die dunklen Haare bereits frisiert, ein weißes Spitzennachthemd. Madame war bereit zur Aufwartung.
Käthe sah Helene an und bekam diesen spitzen Zug um den Mund. Das mit der Contenance war ihr wohl wieder einmal nicht gelungen. Anastasia, die perfekte große Schwester, wäre nicht um 9 Uhr früh noch im Rausch gekommen. Sie hatte die Mutter bestimmt hierher begleitet, das Privatzimmer besorgt, und der frische Blumenstrauß war sicherlich auch von ihr.
Sag bitte einfach nichts, dachte Helene und setzte sich wortlos auf Käthes Bett. Vergleich mich nicht mit ihr, bitte.
Käthe sagte nichts. Sie nahm Helenes Hand, als ob ihre Tochter die Kranke sei und nicht sie. Dennoch spürte Helene an ihren zitternden Fingern, dass es ihrer Mutter nicht gut ging. Kurz legte sie ihre Hand auf die heiße Stirn. Bei den glänzenden Augen hatte sie bestimmt Fieber.
»Du hast getanzt heute Nacht, nicht wahr?«, fragte Käthe plötzlich.
Helene nickte.
»Lenchen. Das ist in Ordnung, das muss so sein. Wir Vahrenhorst-Frauen, wir müssen tanzen. Zum Überleben.«
Helene dachte daran, dass sie Anastasia noch nie hatte tanzen sehen. Und Käthe natürlich auch nicht.
»Soll ich dir erzählen, welcher der wichtigste Tanz meines Lebens war? Es war der erste Tanz mit deinem Vater. Ich hatte Ludwig zuvor nur einmal beim Tennisspielen gesehen. Damals war ich noch mit Wilhelm verheiratet.«
Helene brauchte einen Moment, um diese Worte zu erfassen. »Du warst verheiratet? Bevor du Vater kennengelernt hast?«
Käthe nickte.
Helene wusste nicht, was sie spüren sollte. Ihre tadellose Mutter, Grande Dame, die ihr immer das Gefühl gegeben hatte, nicht »korrekt« zu leben, war mit Ludwig zum zweiten Mal verheiratet gewesen. Dass dies in der damaligen Zeit eine Unerhörtheit, ein Affront in der höheren Gesellschaft gewesen war, war Helene klar. Oft hatte ihre Mutter Helene und Anastasia von ihrer Kindheit und Jugend erzählt. Sie hatte ein Pony gehabt, das der Stallbursche vorführte, wenn sie reiten wollte. Ihre Mutter verbat ihr allerdings, Reithosen anzuziehen, das weiße Kleid fand Maman schicklicher auf dem weißen Pferdchen. Die große Schaukel unter der Linde neben dem Haus. Die Hausangestellten, die unter dem Dach lebten, wo es dem kleinen Mädchen aus dem Herrenhaus verboten war hinaufzusteigen. Immer hatte Käthe einen sehnsuchtsvollen Zug um den Mund, wenn sie ihren Töchtern von all dem erzählte. Und immer besser hatte Helene verstanden, dass sie diese Haltung aus der damaligen Zeit mitgenommen hatte und auch von ihren Kindern verlangte.
Sollte Helene jetzt triumphieren? Ein solcher Fauxpas ihrer Mutter. Doch Käthe blickte, peinlich berührt, auf die Bettdecke. Helene wurde bewusst, dass sie ihr soeben etwas gesagt hatte, das sie ihr ganzes bisheriges Leben verborgen hatte. Das Fieber ließ sie Dinge erzählen. Waren sie wahr oder nur im Fiebertraum erdacht?
»Erzähl, Mutti«, sagte sie.
KAPITEL 2
Käthe
Breslau 1931
Käthes Tennisspiel konnte man schon von Weitem hören. Traf sie den Ball, stöhnte sie leise hell seufzend auf, verpasste sie ihn, bejammerte sie den Schlag mit einem kleinen Aufschrei. In den Spielpausen schüttelte sie die dunklen Locken und lachte mit ihrem Tennispartner.
Sie war hinreißend. Er konnte sich nicht erinnern, je ein so bezauberndes Wesen gesehen zu haben. Mit geradem Rücken saß er da und beobachtete jede ihrer Bewegungen, jedes sinnliche Gurren, das aus ihrem süßen Mund kam. Er bewunderte die Linie ihres Halses, er sah die geraden, festen Schenkel, die schmalen Arme. Noch nie hatte ihn eine Frau so fasziniert. Blutjung, vielleicht zwanzig, zweiundzwanzig Jahre alt, absolut natürlich, sich ihrer Erotik in keiner Weise bewusst, stellte er fest.
Ab und zu blickte sie nach oben, winkte kurz hoch zur Zuschauertribüne. Ein Mann, kräftig und mit Doppelkinn, paffte dort oben eine Zigarre und sah nur ab und an auf das Tennisspiel hinunter. Vater oder Ehemann? Beides möglich. Eine Tragik, wenn diese Fee an den Zigarrenpaffer verschwendet wäre, dachte Ludwig.
Das Spiel war beendet. Sie hatte verloren, aber sie strahlte, als ob sie gewonnen hätte. Als sie auf die Tribüne kam, hauchte sie dem Zigarrenmann einen Kuss auf die Wange, der dies kaum wahrnahm und sich weiter mit seinem Tischnachbarn unterhielt. Kurz darauf verabschiedete sich der kräftige Mann und sie winkte ihm kokett zu – spürbar ohne Bedauern über sein Verschwinden. Fand Ludwig zumindest. Sie ging in die kleine Tennisgaststätte, er sprang geradezu auf und folgte ihr.
An der Theke wartete sie auf den Kellner, der gerade noch einen anderen Gast bediente. Er stellte sich neben sie. Einige Sekunden lang fiel ihm nichts ein, was er zu ihr hätte sagen können, als sie sich zu ihm drehte und das Wort an ihn richtete: »Na, der lässt uns aber lange warten!«
Es war wie ein Stichwort für ihn.
»Ja, aber neben Ihnen warte ich gerne.«
Er reichte ihr die Hand und blickte sie an. Mit einer Intensität, die nicht zu übersehen war. Sie schaute ihn unter den dichten schwarzen Wimpern mit ihren tiefblauen Augen an. Einen Augenblick zu lange. Einen ungehörigen Augenblick zu lange, bevor sie ihm die Hand reichte.
»Vahrenhorst, ich heiße Ludwig Vahrenhorst.«
»Käthe Peyinghaus.« Erst viel später stellte sie verwundert fest, dass sie sich mit ihrem Mädchennamen vorgestellt hatte.
»Käthe, Katharina! Wie die wunderschöne Zarin.«
»Oh nein! Einfach nur Käthe«, berichtigte sie und strahlte, »aber immerhin Käthe Margarethe Alexandra Marie. Käthe Margarethe – für den Klang, Sie verstehen?«
»Ich verstehe. Käthe Margarethe Alexandra Marie. Wundervoll!« Er versank in ihren Augen.
Sie trippelte von dem einen auf den anderen Fuß.
»Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?«, fragte er vorsichtig.
Sie zögerte. Ungehörig. War es ungehörig, Ja zu sagen, oder ungehörig, einen Kaffee zu verweigern? »Warum nicht?«, sagte sie leichthin. Und irgendetwas tief in ihr wusste, dass dieser Kaffee ihr Leben verändern würde.
*
Käthe drehte sich in ihrem Kleid. Ein weißes Kleid im Charleston-Stil. Ohne Ärmel floss es ihren Körper umschmeichelnd bis kurz über die Knie. Dazu trug sie einen dünnen weißen Schal, der ihren schmalen Hals noch betonte.
Ihre Mutter, »Maman« sprach sie sie geziemend auf Französisch an, saß in Käthes Zimmer am fast zwei Meter hohen Eichensekretär mit den gedrechselten Säulen, vor dem sie, obwohl immer Grande Dame, winzig wirkte. Es war Käthe nicht recht, dass sie sich genau dahin gesetzt hatte, denn dort lag noch eine Postkarte, die sie im Kolonialwarenhandel am Marktplatz gesehen hatte und einfach hatte kaufen müssen. Die Karte zeigte die Tänzerin Mata Hari in wild-eleganter Pose in ihrem durchsichtigen Tanzrock und dem orientalischen Büstenhalter. Käthe war fasziniert. Ihre Mutter aber wäre entsetzt gewesen, bisher hatte sie die Postkarte zum Glück noch nicht gesehen.
Maman saß da, wie auf einem Thron, und schüttelte missbilligend den Kopf. Mittlerweile war auch ihr klar, dass das Kleid dem Trend der Zeit entsprach, dennoch fand sie es zutiefst unschicklich, das war offensichtlich. Sie selbst hingegen trug ein hochgeschlossenes, knöchellanges dunkles Kleid mit einem großen Kragen, den vorne eine schwarze Schleife schmückte. Sehr schicklich. »Rücken gerade, Kinn hoch. Contenance!« – das war ihr Leitspruch in allen Situationen. Damit hatte sie ihre Kinder großgezogen. Keinen Schmerz zeigen, Haltung bewahren in jeder Situation. Das zeigte die Herkunft aus gutem Hause.
Eigentlich fand Käthe ihr eigenes Kleid auch unschicklich, genau das war ja das Phantastische daran! Sie drehte sich noch einmal vor dem Spiegel und beobachtete, wie der Rock dabei ein wenig hochflog. Genau so würde er fliegen, wenn sie nachher tanzte. Hausball. Dieses Wort liebte Käthe. Bereits ihre Eltern hatten immer Hausbälle veranstaltet, natürlich braver, mit Tanzkarte. Heute hatte sie ihren ersten eigenen Hausball. Und das mit diesem Kleid. Wilhelm würde nur leider nicht mit ihr tanzen, er tanzte nie. Einmal den Hochzeitswalzer. Aber das fühlte sich auch so grauenhaft an, dass Käthe gar nicht allzu unglücklich darüber war, wenn er nicht mehr mit ihr tanzte. Er war eben viele Jahre älter als sie, das war doch aber normal, üblich so. Ihre Eltern hatten die Ehe arrangiert, er war eine glänzende Partie! Sie konnte glücklich sein, so einen wohlhabenden Mann bekommen zu haben.
Ganz kurz blitzte in ihr die Erinnerung an die letzte Nacht auf und den Seufzer, mit dem er sich wie immer von ihr weggerollt hatte. Ob das auch normal war, bei allen so war, wusste sie nicht genau. Schnell wischte sie den Gedanken fort und drehte sich noch einmal rasant um sich selbst. Dann nahm sie den schmalen, dunklen Silberarmreif und streifte ihn bis zum Oberarm. Sie wusste, sie sah hinreißend aus!
Käthe hörte, wie mehr und mehr Gäste in die Eingangshalle kamen. Langsam hatte sich das Wohnzimmer, das sie den großen Salon nannten, gefüllt. Der große Salon war Käthes ganzer Stolz. Ein riesiger Raum, ein kleiner Saal. Vor den hohen Fenstern mit den zierlichen schmiedeeisernen Gittern hatte Käthe Vorhänge in einem dunklen Rosa mit goldenen Quasten anbringen lassen. Ein Traum! Selbst Wilhelm, der zuerst sehr ärgerlich gewesen war, weil sie die alten braunen Vorhänge abnehmen wollte, konnte nicht anders, als anerkennend nicken, als er sie sah. Auf dem schwarz glänzenden Piano hatte sie heute früh noch rote Rosen aus dem Garten arrangiert und davor eine Kristallkaraffe, die das Sonnenlicht aufnahm und in regenbogenfarbenen Strahlen im Zimmer verteilte.
Nun könnte sie als Hausherrin im Salon mit den Gästen zusammenkommen. Sie hatte das Haus auch wegen seiner Treppe ausgesucht, die in den großen Flur und ins Wohnzimmer führte. So musste man auftreten als Hausherrin.
Sie versuchte, das begeisterte Strahlen auf ihrem Gesicht in ein geziemendes Lächeln zu reduzieren, als sie Schritt für Schritt mit gemäßigt schwingender Hüfte die Treppe hinunterschritt, bis sie die letzte Stufe hinunterstolperte. Weil sie ihn gesehen hatte. Er stand da ganz lässig mit einer Zigarette in der Hand und beobachtete sie völlig ungeniert mit einem süffisanten Lächeln. Wo kam er her? Was hatte er hier zu suchen?
Ihre Cousine Marie nahm seinen Arm und schob ihn auf Käthe zu, die versuchte, sich zu fassen. »Käthe, du siehst wundervoll aus!«, rief sie, bevor sie mit einem unübersehbar stolzen Lächeln ihren Begleiter vorstellte: »Das ist Ludwig Vahrenhorst. Richter am Breslauer Landgericht.«
Er machte eine dezente Verbeugung, fasste ihre Hand zu einem sanft angedeuteten Handkuss und sagte: »Es ist mir ein Vergnügen, Frau Peyinghaus!«
Sie musste aufpassen, dass sie nicht stotterte: »Wieter. Peyinghaus ist mein Mädchenname.«
»Frau Wieter, entschuldigen Sie.« Er hörte einfach nicht auf, sie anzulächeln. Sie wusste nicht, wohin sie sehen sollte. Zum Glück kam Wilhelm in diesem Moment und zog sie fort, um sie die nächsten Gäste begrüßen zu lassen. Käthe schüttelte Hände, sie lächelte, sie unterhielt sich blendend, sie nahm einen Schluck Champagner, sie tanzte. Dennoch suchten ihre Augen immer wieder nur den einen. Und Ludwig Vahrenhorst ließ sie nicht aus den Augen. Auch wenn er meist bei Marie stand, so beobachtete er doch den ganzen Abend nur sie.
Zu später Stunde stand sie an der Balkontür und fächelte sich Luft zu. Sie hatte den ganzen Abend getanzt. Genussvoll sog sie die frische Nachtluft ein, als sie zuerst seinen Atem nah an ihrem Hals spürte, bevor er sagte: »Käthe Margarethe Alexandra Marie, bekomme ich auch einen Tanz von Ihnen?« Sie spürte, wie die Gänsehaut sich über ihre Arme zum Hals hochzog.
»Gerne«, antwortete sie förmlich, doch ihre Stimme zitterte.
Ludwig konnte tanzen. Und wie! Er wirbelte sie herum, drehte sie, bis ihr schwindlig wurde, und lachte sie mit offenem Mund an. Wie ungehörig. Und dann tanzte er sie zurück auf den Balkon hinaus.
»Käthe Margarethe Alexandra Marie, Sie sind die wundervollste Frau, die ich je gesehen habe. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht an Sie gedacht habe, seit dem Nachmittag auf dem Tennisplatz.«
Käthe antwortete nichts darauf. Und dieses Schweigen war ihm Antwort genug. Er zog sie sanft fragend an sich. Ihr Körper nahm seine Hand an, gab sich hinein. Sein Gesicht näherte sich ihr, sie schloss die Augen und spürte seine warmen Lippen auf ihren.
Es war ein Kuss, wie sie ihn sich nicht hätte vorstellen können. Warme, sanfte Lippen, die ihre suchten. Bis sie ihre Lippen öffnete, sich ihre Zungen in der Mitte trafen. Seine Hand drückte sich sanft in ihren Rücken und sie schmiegte sich an Ludwig. Und spürte ein Begehren, das sie nicht kannte. Ein Verlangen, eine Sicherheit, Geborgenheit und Lust.
Käthe hatte nachher keine Ahnung, wie lange sie sich küssten. Die Welt um sie herum versank. »Käthe«, sagte er in einem solch liebevollen Ton.
»Ludwig.« Sie spürte, dass sie diesen Namen noch hunderttausendmal sagen wollte, in genau diesem Ton. Seine Hand fuhr ihre Wange entlang, nie hatte sie eine schönere Berührung gespürt. Sie schloss die Augen, wollte seine Lippen noch einmal spüren.
Als sie ein Geräusch hörten, stoben beide auseinander. Gustav war auf den Balkon herausgetreten. Zum Glück hatte er nichts gesehen. »Käthe, ich hatte noch keinen Tanz von dir! Keine Widerrede. Nun bin ich dran!«, rief er und zog sie lachend zurück in das Wohnzimmer, das heute zum Ballsaal geworden war.
Sie hatte das Gefühl, sie ließe das Glück zurück.
KAPITEL 3
Helene
München 1988
»Kommst du morgen wieder?«, fragte Käthe Helene, als sie offenbar zu müde wurde, um weiterzuerzählen.
Helene saß noch immer da wie gebannt und konnte gar nicht antworten. War ihre Mutter gerade aus ihren Fieberträumen erwacht oder hatte Käthe tatsächlich jenes Leben einst geführt?
Hatte Mutter wirklich auch getanzt? War jung gewesen, verheiratet und verliebt in jemand anderen, war unvernünftig, wild gewesen. Ihre Mutter, die traurige Frau, immer mit dem Mund als langen Strich gezogen am Küchentisch sitzend, oft im Bett liegend, nicht aufstehend, ihren Kindern kein Essen zubereitend, was dann Helenes große Schwester Ana übernommen hatte. Ihre traurige, zusammengefallene Mutter sollte getanzt haben. Die Mutter, die immer noch gerne von Contenance sprach, aber durch Traurigkeit gebrochen war und oft genug statt Contenance zu wahren, sich in die Dunkelheit ihres Zimmers verschlossen und das Leben draußen gelassen hatte. Sie hatte Helene doch immer mit diesen abschätzenden Blicken bestraft, wenn sie zu spät nach Hause kam. Oder als sie in der Schule nie so gut war wie Ana, als sie zu früh mit Jungs loszog, als sie begann, ihre Kunst zu machen, zu malen. Immer abschätzend. War es vielleicht all die Zeit ein trauriger Blick gewesen? Helene war verunsichert. Jetzt, bei dieser Erzählung, hatte Käthe zum ersten Mal sanft und ein wenig glücklich ausgesehen.
»Kommst du morgen wieder?«, wiederholte Käthe ihre Frage.
Helene wollte nichts versprechen, das sie vielleicht nicht halten konnte. Sie wusste selbst, wie unzuverlässig sie war. Dass sie immer wieder versagte.
Als ob ihre Mutter ihre Gedanken gehört hätte, sagte Käthe: »Dann kommst du eben übermorgen. Oder später. Helene, es macht nichts. Es kann ja immer etwas dazwischenkommen. Nur komm nicht zu spät.«
Es war, als ob Käthe sich sammeln müsste, alle Kraft zusammennehmen. Und Mut. »Es wird Zeit«, sagte sie. »Lenchen, bitte. Ich muss dir endlich auch von Paula erzählen.«
»Wer ist Paula?«
»Sie ist mein Gegenbild«, sagte sie vage. »Entweder man ist wie sie oder wie ich. Das musst du wissen.«
»Wie ist sie denn, und wie bist du?« Helene, die noch ganz in den alten Erzählungen ihrer Mutter versunken war, verstand nicht, was Käthe ihr sagen wollte.
»Ich habe dich nach ihrer Tochter genannt, Paulas Tochter hieß Helene.«
Sie war benannt nach der Tochter einer Frau, von der sie noch nie etwas gehört hatte. »Warum?« Es schwirrte in Helenes Kopf.
»Paula war wie eine große Schwester für mich. Oder sogar wie eine Mutter, die ich nie hatte. Sie war mein Vorbild. Ich nannte dich wie ihre Tochter Helene, in dem Wunsch, du würdest genauso werden wie Paula und ihre Tochter. Aufgeklärt, selbstlos, im Leben stehend. Nicht so wie ich.« Käthe sah ihr in die Augen und sagte wie zusammenhanglos: »Ich bin jetzt erschöpft. Morgen. Du musst es nicht versprechen. Aber du kommst, wann immer dein ›morgen‹ ist.«
Dann fielen Käthe die Augen zu. Langsam hob und senkte sich ihre Brust mit ihrem Atem.
Als Helene ging, nahm sie sich vor, bald wiederzukommen. Sie würde jetzt schlafen. Und wenn sie wach würde, nicht losziehen, mal wieder eine Nacht ohne Drogen, ohne Alkohol verbringen. Das musste doch möglich sein.
*
Helene stand auf und streckte ihre müden Glieder. »Ich muss mich mal bewegen.«
»Ich auch. Mir fällt sogar sofort eine Art der Bewegung ein.« Lässig ein Bein auf das andere Knie gelegt saß Rainer noch vor der Leinwand, sah nun auf und Helene lächelnd an.
Sein Blick allerdings sprach nicht, wie bei vielen anderen Männern, von der reinen Lust auf ihren Körper. Helene wusste, dass er viel mehr an ihr mochte. In seinem Blick lagen Zuneigung, Wertschätzung, Freundschaft und das große Wort, das sie selbst nicht einmal denken wollte. Es bereitete ihr Angst, die große Liebe war nur eine Illusion, die doch immer enttäuscht wurde.
Er stand auf, ging zu ihr und blieb vor ihr stehen, als ob er ihr etwas sagen wollte.
Ein Moment der Gefahr, wurde Helene sofort bewusst. Wenn er jetzt die drei Worte ausspräche, gäbe es kein Zurück mehr. Schnell stand sie auf und entzog sich seinen Blicken. »Es ist Zeit für Champagner, nicht wahr?«, fragte sie.
»Ich würde dir nie deine Freiheit nehmen, Helene.«
Sie lachte, als ob sie nicht verstände, was er ihr sagen wollte. »Wo hast du denn die Gläser?«
Er drehte sich um und holte zwei Gläser aus dem Schrank. Währenddessen betrachtete sie das Bild. Sie war es, die dort auf dem Gemälde abgebildet war, und doch war sie es nicht. Ihre Augen, die Rainer zuvor noch mit einem grellen grünen Lidschatten, der von den Wimpern bis zu den Augenbrauen gezogen war, gemalt hatte, waren gut getroffen und dennoch Picasso-artig zu Katzenaugen gezogen. Ihr Körper, der halb liegend, halb sitzend auf dem Bett posierte, der schwarze BH, der ihre Brüste verbarg und doch von ihnen erzählte, das Bein hinaufgestreckt, den schwarzen Stiefel anziehend.
Helene deutete auf das Bild. »Die Dynamik ist unfassbar gut. Der Arm, der über das dunkle Blau hineinfließt in das Schwarz des Stiefels. Und das Dreieck, das Rücken, Bein und Arm bilden. Wahnsinn.«
Rainer öffnete die Flasche und goss die Gläser voll. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern hatte er genug Geld, denn er gehörte längst zum Kreis der etablierten, modernen Maler. Seine schrillen Werke verkauften sich hervorragend in der Galerie Pfefferle. Sie nahm das angebotene Glas, obwohl es noch früher Nachmittag war, und legte ihre Hand auf seine Schulter, die nur ein weißes Unterhemd bekleidete. Gemeinsam betrachteten sie das Gemälde.
»Die Augen …«, begann sie.
»… sind die einer Wildkatze«, fuhr er fort.
Rainer fuhr sanft ihr schmales Gesicht und die hohen Wangenknochen nach, als ob er sie ertasten wollte für das nächste Bild. Dann nahm er eine ihrer blonden Locken, zog sie sanft in die Länge und lachte, als er sie losließ und sie sofort wieder nach oben schoss und sich zusammenkringelte.
»Helene, du bist genauso wenig zu bändigen wie deine Locken. Absolut nicht zu zähmen.« Seine Stimme wurde leiser und nachdenklicher. »Lustvoll, genießend, verschlingend, brennend, sich und andere verbrennend.«
Wieder lachte sie laut, um weitere Worte zu unterbinden. »In meinem Alter verbrenne ich niemanden mehr. Ich bin weit über vierzig. Deine sonstigen Modelle kaum zwanzig.« Sie seufzte gespielt auf, seine traurige Stimme ignorierend.
»Helene, hör auf. Du weißt, dass du schöner als sie alle bist. Dass nicht nur ich, sondern jeder Maler hier in München dich als Modell haben will. Und gerne auch für mehr …« Er ließ die Worte im Nichts verhallen.
Helene schüttelte den Kopf. »Wirklich, das Bild ist wahnsinnig gut!«
»Wahnsinnig gut ist das Modell!« Er zog sie auf seinen Schoß und sah ihr dann ernst ins Gesicht. »Entschuldige. Du bist natürlich kein Modell. Du bist eine Künstlerin. Und manchmal auch meine Muse. Wofür ich dankbar bin.«
Helene war nicht so erfolgreich wie Rainer, aber immerhin, auch sie verkaufte ihre Bilder und Plastiken.
»Komm, hör auf.« Sie lachte. »Du brauchst mich nicht zu hofieren. Du bekommst mich doch auch so.«
Rainer sah sie zweifelnd an. »Eigentlich sollte ich das Bild nicht verkaufen, es lieber hier im Atelier lassen, dann habe ich dich immer bei mir.« Er vergrub seinen Kopf in ihren Brüsten.
»Nein. Verkauf es.«
»Wie viel willst du vom Verkauf?« Ein sachlicher Ton, der sie sofort als Geschäftspartnerin ernst nahm.
»Ich will kein Geld. Aber ich will etwas anderes. Ich will eine meiner Skulpturen neben diesem Bild in der Galerie Pfefferle stehen haben, in der du es verkaufst. Das ist mein Preis.«
Er lachte. »Du bist klug!« Dann hob er sie hoch und trug sie zum Bett.
Sie blieben danach noch einige Zeit Zigaretten rauchend nebeneinander liegen, bis er aufstand und zum Schreibtisch ging. Helene beobachtete ihn. Die meisten Maler waren seltsam klein, oder zu dürr, zu hakennasig, irgendetwas Unpassendes hatten sie immer. Rainer hingegen war sexy, fand sie. Groß war er, die wilde Tolle mit den Locken fiel ihm fast bis in die Augen. Vor allem aber warf er sie mit einer beiläufigen, kleinen Kopfbewegung hoch, die Helene liebte, um dann seinen stechenden Blick auf etwas zu legen.
Helene unterschied Männerblicke ganz genau, beobachtete sie, benannte sie. Es gab den gierigen Männerblick. Trieb lag in den Augen dieser Männer, Haltlosigkeit und Gewalt. Sie kannte den Blick bereits seit ihrer Kindheit. Seit der Kriegszeit, als es keine Väter mehr gab, die auf ihre Familie aufpassten, nur Frauen und Kinder.
Immer wieder sah sie ihn vor sich. Oft in der Nacht, kurz bevor sie schreiend aufwachte, manchmal auch am Tag in irgendeinem Männergesicht. Sie sah den alten Mann vor sich, dessen Mund sich verzog in dieser ganz bestimmten Art, nur den einen Mundwinkel anhebend. Der Blick voller Hohn, voller Überlegenheit und Gnadenlosigkeit. Voller Gier. Und sie sah den Frauenblick. Voller Angst. Ausweglosigkeit. Voller Grauen. Voller Schmerz. Dabei hörte sie das unerbittliche Rattern des Zugs, der weiterfuhr, als sei nichts geschehen, und das Stöhnen aufnahm in seinem zitternden Dröhnen.
Vor diesem Blick hatte sie Angst. Sah sie ihn an einem Mann, entstand in ihr eine Panik, die sich schwer niederringen ließ. Manchmal bekamen Männer diesen Blick, wenn sie mit ihr schlafen wollten, Männer, die vorher nicht diesen Blick hatten. Dann nahm sie Reißaus. Nicht nur einmal war sie im letzten Augenblick aufgesprungen und davongerannt.
Es gab auch den liebenden Blick. Ludwig, ihr Vater, hatte ihn immer gehabt, wenn er Käthe ansah. Aber Helene mochte auch diesen Blick nicht. Denn es war zugleich der Blick von Verklärung und Fortsehen-Wollen. Nie hatte ihr Vater gefragt, wie sie nach München gekommen waren, wie der Krieg alles um sie herum in Schutt und Asche legte, was auf der Flucht aus Breslau geschehen war. Wenn ein Mann sie mit einem liebenden Blick ansah, nahm sie ebenso Reißaus.
Es gab auch den ehrlichen Blick, den Helene so mochte. Der zeigte manchmal Liebe, manchmal Lust am Sex, einfach das, was da war, ohne Vorwand, ohne Gewalt, ohne Fortsehen und ohne Verklärung. Diesen Blick hatte Rainer. Zumindest bisher immer gehabt. Doch sie wusste, manchmal schlugen die Blicke der Männer um. Vom ehrlichen Blick in den liebenden oder in den gierigen. Man wusste nie, wann.
»Kommst du mit mir nach Berlin?« Rainer sah sie an, mit dem ehrlichen Blick.
Die ganze Zeit schon wollte er seine Zelte in München abbrechen und auf in die große Stadt, in der die Kunst radikaler war als hier.
»Vielleicht«, antwortete sie.
Nicht Berlin war es, was Helene abschreckte. Sondern die Angst davor, dass einer der anderen Blicke auf sein Gesicht träte, wenn sie sich zu sehr auf Rainer einlassen würde.
*
Wieder rückte sie die Stehlampe so zurecht, dass sie auf die rechte Hälfte des Bildes schien. Ärgerlich schüttelte sie den Kopf. Es dämmerte und in ihr kleines Zimmer fiel zu wenig Licht, um die Leinwand gleichmäßig auszuleuchten. Wenn sie den Lampenschein auf eine Stelle richtete, wurde die Farbe dort greller, während der Rest sich verdunkelte. Das verzerrte den Farbeindruck.
Die Deckenlampe warf bei Weitem nicht genügend Licht, und versuchte sie, die Stehlampe auf das gesamte Bild auszurichten, wurde alles gleichmäßig schummrig. Wie nur sollte sie so arbeiten? In Helene stieg Ärger auf. So ging es nicht. Ohne ein Atelier mit entsprechendem Licht, ohne genügend Platz, konnte sie nicht malen.
Gedanken, die immer wiederkamen, auch wenn sie sie hasste, zogen durch ihren Kopf. Irgendwann hatte ihr Vater mit gerunzelter Stirn gefragt: »Brauchst du denn tatsächlich eine eigene Wohnung? ›Kunst‹ kannst du ja auch hier machen.«
»Kunst« klang bei Ludwig ein wenig wie »Quatsch«, »Unsinn« oder einfach insgesamt wie das »Falsche«. Ihre Schwester Ana hingegen, die Richterin, liebte Ludwig als Kind wie als Erwachsene abgöttisch. Sie machte eben immer alles richtig. Wie viel Geld hatte Anas Studium gekostet? Kein Problem, wurde bezahlt. Jura war eben »vernünftig«, außerdem trat Ana damit in die Fußstapfen ihres Vaters, Richter Ludwig Vahrenhorst. Auch die erste Wohnung mit Anas Mann Jochen – auch wenn nie darüber gesprochen wurde – hätten die beiden ohne die Eltern nicht finanzieren können.
Was hatte sie selbst bekommen? Fast nichts. Sie hätte es erzwingen können. Aber dafür war sie zu stolz.
Nein, sie wollte ihre Kunst nicht im Kinderzimmer machen, auch nicht in der elterlichen Wohnung bleiben. Sie war damals zweiundzwanzig und wollte ausziehen. Aber ohne Studium, ohne Beruf, wie Ludwig ihn verstand, sahen ihre Eltern die Notwendigkeit nicht.
Käthe blickte dann immer zu Boden, wenn es um Helenes Zukunft oder ihre Kunst ging. So, als ob sie seufzte: »Schön ist es ja, ich mag es auch, aber du meine Güte, das ist doch wirklich nichts Vernünftiges!«
Ihr Vater drückte sich klarer aus: »Helene, wir können dich nicht ein Leben lang unterstützen. Kunst ist brotlos. Das hat keine Zukunft.«
Als Helene aus ihren Erinnerungen wieder auftauchte, war es so dunkel, dass der von der Lampe bestrahlte Ausschnitt sie blendete. Absolut unmöglich, so zu malen. Nein, ein Atelier statt dieser kleinen Wohnung würde ein unerfüllbarer Traum bleiben. Aber immerhin, es war ihre Wohnung.
Sie schaltete das Licht ganz aus und setzte sich im Dunkeln an den Tisch.
Dort lag der neu gelieferte Ton. Sie nahm ihn in die Hände, schloss die Augen, obwohl doch bereits fast nichts mehr zu sehen war, ihre Finger bewegten sich, formten ganz von alleine. Keine traurigen Gedanken mehr. Bewegungen, Drehungen, Wölbungen, Muskeln, Sehnen. Ihr Kopf war frei, sie war nicht da, nur das, was da unter ihren Händen entstand. Da war wieder das Gefühl in ihr, in ihrem ganzen Körper, in ihrem Geist, in ihrer Seele. Ein ziehender Schmerz, ein Treiben, ein Glück.
Es klopfte.
Mühsam nur löste sie sich von dem Ton in ihren Händen.
Schon bevor sie die Tür öffnete, wusste sie, dass Rainer davorstehen würde. Als ob sie es spüren könnte. Als ob er seine Strahlen an sie vorausschickte. Die einzigen Strahlen, die sie, außer dem Ton, glücklich werden ließen.
Er küsste sie nur sanft, fuhr in die wirren Haare. »Du hast gearbeitet.« Keine Frage, eine Feststellung.
Nachdem er den Lichtschalter angedreht hatte, lief er zu ihrem unvollendeten Gemälde, besah es genau und wandte sich dann zu ihr um. »Magst du mit mir in den Alten Simpl gehen?«
Wenn es ihm gefallen würde, hätte er es kommentiert, Fragen dazu gestellt. Sie konnte es ihm nicht verübeln, das Bild war eben nicht gut, konnte es nicht werden in diesem Licht.
Dann fiel sein Blick auf den Küchentisch. Er ging hin, lief einmal herum, besah sich den modellierten Ton.
»Das ist phantastisch! Zwei Löwen im Kampf, wie in der klassischen Antike, diese Muskelmodellierung. Doch dann abgebrochen, nur halb, wie zerstört. Wie ausdrucksstark! Helene, das ist großartig.«
Noch einmal umrundete er das kleine Modell auf dem Tisch. »Ich habe einen Marmorblock. Ich versuche, ihn dir zu bringen, er ist sehr schwer. Aber du musst die zwei Löwen einfach in Marmor gestalten!«
In ihrem Kopf gingen die Worte auf: Ich muss gar nichts. Sie hatte ihrem Vater nicht gehorcht, und auch keinem anderen Mann. Sie war noch immer die Piratenprinzessin.
Als ob er es gespürt hätte, lenkte Rainer ein. »Du musst natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es großartig wird.«
Es war ein Angebot, nur ein Angebot. Helene wusste nicht, ob Marmor ihr Material sein könnte, werden würde – für den Kampf der Löwen, den sie erst jetzt rational und bewusst wahrnahm. Vorher hatten nur ihre Finger es erspürt, geformt, gebildet, ihre Augen es im Dunkeln kaum gesehen.
Sie blickte nun selbst kritisch darauf. Ja, es war nicht schlecht. Es war wild und kraftvoll. Vielleicht sollte sie es mit Marmor versuchen, aber in der Kunstschule war er ihr zu hart und kalt gewesen. Vielleicht sollte sie es auch mit anderen Materialien versuchen. Mal sehen.
»Denkst du, Marmor ist das richtige Material für mich?« Sofort biss sie sich auf ihre Zunge. Mit dieser Frage hatte sie allzu viel Unsicherheit preisgegeben.
Rainer sah sie ruhig an. »Ich sage dir gerne meine Meinung und kann dir den Marmor bringen. Aber es ist nur ein persönliches Gefühl gewesen. Es kann falsch sein. Aber, Helene, ich werde der Raubkatze nicht erzählen, was sie zu fressen hat. Dir etwas vorschreiben, das würde ich nicht, das möchte ich nicht. Weil ich dich liebe.«
Jetzt war sie unvorsichtig gewesen, hatte die gefährlichen Worte nicht aufhalten können. Sie sah ihn lange an. Die etwas zu langen Gliedmaßen. Den muskulösen Oberkörper, der dennoch seltsam frei schwebte, das schmale Gesicht und die nachdenklichen Augen mit den für sein Alter bereits viel zu vielen Falten.
Sie ging zu ihm und küsste ihn langsam und bewusst.
»Oh ja. Jetzt ist genau der richtige Moment, um loszuziehen. Auf in den Alten Simpl.«
KAPITEL 4
Helene
München 1947
Wenn Ludwig nach Hause kam, ging er erst zu Käthe und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann zu Ana. Er fragte sie, wie die Schule gewesen sei, und Ana plapperte munter drauflos und erzählte ihm alles.
Durch die dünnen Wände hatte Helene alles mithören können. Sie wusste, dass er danach zu ihr kommen würde, und jeden Tag breitete sich wieder dieses seltsame, nicht zu benennende Gefühl in ihr aus. Er klopfte und wartete, bis sie »Ja« sagte. Was sie sehr schätzte. Weder Käthe noch Ana taten dies. »Guten Abend, meine liebe Helene.«
Sofort lag etwas Gezwungenes in der Luft. Als ob er Angst vor ihr hatte. Dabei hatte sie doch Angst vor ihm. Nein, er hatte sie nie geschlagen. Mittlerweile konnte Helene sich auch nicht mehr vorstellen, dass er es je tun würde. Er war immer höflich und liebenswert, wertschätzend zu allen »seinen drei Frauen«, wie er sie so oft lächelnd nannte.
Aber immer wieder versuchte er, sie zu erziehen. Käthe hatte das nie getan. Ana wies sie manchmal zu etwas an. Das tat Helene dann, allerdings tat sie es nur für Ana.
»Helene, wir müssen reden.«