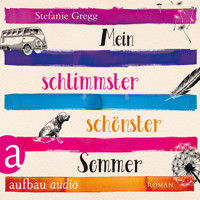9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schatten des Krieges
- Sprache: Deutsch
Zwischen uns ein ganzes Leben.
München, 1945. Zusammen mit ihrer Mutter Käthe ist Ana aus Breslau geflohen. Käthe ist traumatisiert, und so ist es an Ana, für ihre Familie zu sorgen. Als sie ihre eigene Familie gründet, scheint der Krieg verwunden, doch ihre Tochter Lilith bleibt ihr seltsam fremd. Viele Jahre später steht Lilith vor einer großen Entscheidung: Ausgerechnet sie, die doch immer unter ihrer distanzierten Mutter gelitten hat, soll den Sohn ihrer besten Freundin bei sich aufnehmen. Da fährt Ana mit ihr nach Breslau und erzählt ihr endlich, was damals wirklich geschehen ist ...
Eine berührende Familiengeschichte, die über drei Generationen bis ins 21. Jahrhundert reicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Zwischen uns ein ganzes Leben.
München, 1945. Zusammen mit ihrer Mutter Käthe ist Ana aus Breslau geflohen. Käthe ist traumatisiert, und so ist es an Ana, für ihre Familie zu sorgen. Als sie ihre eigene Familie gründet, scheint der Krieg verwunden, doch ihre Tochter Lilith bleibt ihr seltsam fremd. Viele Jahre später steht Lilith vor einer großen Entscheidung: Ausgerechnet sie, die doch immer unter ihrer distanzierten Mutter gelitten hat, soll den Sohn ihrer besten Freundin bei sich aufnehmen. Da fährt Ana mit ihr nach Breslau und erzählt ihr endlich, was damals wirklich geschehen ist.
Eine berührende Familiengeschichte, die über drei Generationen bis in das 21. Jahrhundert reicht.
Über Stefanie Gregg
Stefanie Gregg, geboren 1970 in Erlangen, studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Germanistik und Theaterwissenschaften bis zur Promotion. Nach Stationen im Bereich Bucheinkauf und als Unternehmensberaterin widmet sich die Autorin jetzt nur noch dem Schreiben. Mit ihrer Familie wohnt sie in der Nähe von München.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefanie Gregg
Nebelkinder
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Warum dieses Buch entstand
›Nebelkinder‹ – in der Forschung
Danksagung
Impressum
Für meine Großmutter Käthe, meinen Großvater Günter, meine Mutter Sabine und meine Tanten Lonny und Doi.
Und für mich.
Kapitel 1
Anastasia München, Februar 1945
»Hier könnt ihr schlafen.« Der Bauer machte eine abwertende Geste mit der Hand. Es war der Kuhstall, auf den er zeigte.
Im Umkreis von München waren sie in einem kleinen Dorf bei einem Bauern einquartiert worden, der die ›Flüchtlinge‹ – ein Schimpfwort für ihn – nur unter Zwang aufnahm.
Eigentlich hätte Käthe sich nun durchsetzen müssen, aber das Einzige, was sie herausbrachte, war ein nicht forderndes, sondern verzweifeltes: »Das ist doch nicht Ihr Ernst?«, auf das der Bauer nicht einmal reagierte, bevor er sich umdrehte und zu seinem Haus stapfte. Mit hängenden Schultern stand sie da, bis Anastasia sie in den Stall hineinzog. »Mutti, es ist warm dort drinnen!«
So weit war es, das Kind, das im Rüschenkleid auf dem Pony hätte sitzen sollen, begnügte sich mit einem warmen Kuhstall. Käthe wollte nicht mitgehen, aber Anastasias Wille war zu stark für sie. Ihr konnte Käthe nichts entgegensetzen.
Selma, die ältere Schwester Käthes, stand schon, die Hände in die Hüften gestützt, im Stall. »Es geht wohl nicht anders, wir müssen in der Mitte schlafen.« Mit diesen Worten hatte sie sich an Anastasia gewandt und an ihren Sohn Wolfi, der vier Jahre älter als seine Cousine war und auf der Flucht einen erheblichen Beitrag zum Überleben der zwei Familien geleistet hatte. Anastasia betrachtete den Kuhstall, in dem rechts und links die Kühe so angebunden waren, dass ihr Hinterteil zur Mitte stand, wo unter einem Rost eine Abflussrinne die Jauche abtransportierte. Nur eine schmale Gasse war zwischen den Kuhhintern frei. Selma seufzte und begann die Daunendecke herauszuziehen. »Wir werden bedeckt mit Kuhscheiße sein bis morgen früh. Ist aber sicher schön warm!« Selma hatte sich ihren Humor bewahrt. Wolfi schüttelte missbilligend den Kopf, wohingegen Lenchen, Anastasias kleine sechsjährige Schwester, zwischen den Kühen herumsprang, ihnen die Hintern tätschelte und gerade begeistert eine Box mit Kälbchen entdeckt hatte.
»Tante Selma, ja, so hat sich der Bauer das vorgestellt, aber warte, ich habe eine Idee.« Anastasia hinderte Selma daran, die Decke auf dem Boden auszubreiten. Fragend sah Selma ihre Nichte an.
Tante Selma hatte es geschafft, dass sie noch in den vielleicht letzten Zug aus Breslau hineingekommen waren. Auch wenn Anastasia sich nicht daran erinnern wollte, wie. Doch dann hatte Anastasia statt ihrer Mutter die Verantwortung übernommen. Während Käthe nur noch das Leben erlitt, hatte Anastasia sich um ihre Mutter und auch um ihre Schwester gekümmert. Schon als es Anastasia gewesen war, die ihre lethargisch verzweifelte Mutter zur Flucht bewegte, war sie zur Verantwortlichen für die Vahrenhorst-Familie geworden. Nach der Flucht war aus dem Kind Anastasia aus edler, schlesischer Abstammung die bayerische Ana geworden.
Ana stemmte die Hände selbstbewusst in die Hüften. »Wir legen uns in die Box zu den Kälbchen. Wenn wir das gute Stroh auf die eine Seite geben und die Kälbchen zur anderen Seite, kann uns gar nicht so viel passieren.« Selma legte ihre Hand auf Anastasias Kopf. »Du Kluge, du bist wirklich wie die Zarentochter! Du überlebst alles!«
Auch der größere Wolfi nickte ehrfürchtig, was Ana eine kleine, heimliche Freude war. Nur Käthe stand hilflos ein wenig weiter hinten, wie ein Kind, das abwartete, was die Eltern nun entscheiden. Dann schoben sie das saubere Stroh auf die eine Seite der Box und die drei Kälbchen auf die andere Seite, die sehr verdutzt darüber waren, aber es sich wohl oder übel gefallen ließen. Als sie schließlich alle mehr übereinander- als nebeneinanderlagen, krabbelte Lenchen über Ana, die ganz bewusst den schlechtesten Platz neben den kleinen Kühen übernommen hatte, und zwängte sich zwischen ihre Schwester und eines der Kälbchen. Lenchen streichelte den Kopf des Tieres, das dankbar ihre Hand abschleckte. »Ana, zu Hause, da hatte ich meine Stoffkuh, weißt du noch, mit der habe ich auch immer geschlafen. Das jetzt ist doch viel schöner!«
Ana lächelte und legte ihren Arm um Lenchen.
Es war die wärmste Nacht, die sie seit Langem hatten. Und es wurden weit mehr Nächte daraus, als sie gedacht hatten, denn über Wochen ließ man sie nicht weiterreisen. Keiner wusste, wohin mit dem Strom der Flüchtlinge. Seltsamerweise waren dennoch diese Tage auf dem Bauernhof wie eine zeitweise Erholung für alle, auch wenn die Nächte kurz waren, denn sie mussten alle vor dem Bauern wach sein, damit er nicht merkte, was sie mit den kleinen Kälbchen anstellten. Dass sie, ob er dies wollte oder nicht, die Kühe melkten und die frische Milch tranken, war ihm klar. »Gebt’s Wasser zur Milch, die frische macht Bauchweh«, war eines der wenigen Dinge, die er zu ihnen gesagt hatte, obwohl sie nicht wussten, ob dies stimmte oder ob er sie nur daran hindern wollte, zu viel Milch zu trinken.
Ana schlich früh am Morgen hinüber in den Hühnerstall und holte ihnen drei Eier – mehr nicht, damit der Bauer es nicht merken konnte. An einem Tag durften die Vahrenhorsts, Mutti, Lenchen und Ana, die drei haben, am nächsten Tag Tante Selma und Wolfi. Ana stach mit einem Holzstück ein kleines Loch, aus dem sie dann das Ei auszutschte. Herrlich! Wenn sie sich beherrschte, war es ein minutenlanges Vergnügen, das ein wundervoll sättigendes Gefühl im Magen hinterließ.
Ab und zu kam auch die Bäuerin vorbei mit einem Laib Brot und etwas Butter. Doch, es war fast wie Urlaub. Tagsüber stromerte Ana mit Wolfi und Lenchen über den Bauernhof und die dazugehörigen Felder. Keiner von ihnen hatte das Bedürfnis, schnell fortzukommen. Es gab mehr zu essen als vorher in Breslau, es war wärmer als im Zug, und es gab keinen Bombenalarm und keine Luftschutzkeller. Selbst Selma und Käthe waren sich unsicher, ob es irgendwo in der Stadt im Moment wirklich besser für sie wäre. Wie ein kostbarer Augenblick der Ruhe erschien es ihnen. Aber Käthe schüttelte den Kopf bei dem Gedanken, Ruhe im Kuhstall zu finden.
Abends ging Ana gerne noch unter dem Sternenhimmel ein wenig spazieren. Der Himmel dort oben, die Wiese unter den Füßen, es war so leise, man war so frei, es gab keine Gefahr.
Diesmal ging sie den Weg entlang, obwohl sie sonst meist durch die Wiesen lief. Obwohl sie am Bauernhof eigentlich nur entlanglaufen wollte, zog das hell erleuchtete Fenster des Bauernhauses sie an. Sie sah durch das Fenster in die Bauernstube hinein. Einfach so. Um nicht zu vergessen, dass es Zimmer gab, eine Bank, einen Tisch, eine Lampe, einen warmen Ofen. Nur heimlich natürlich, denn es war schon so dunkel, dass niemand sie von innen mehr sehen konnte. Bestimmt schon zehn Minuten stand sie da und beobachtete, wie die Bäuerin in einem großen Topf rührte, während der Bauer einfach nur auf der Bank saß, als ihr Blick auf den großen Tageskalender an der Wand fiel. 19. März stand darauf. Kurz zuckte sie zusammen. Keinem war es aufgefallen. Es war doch nur ein Jahr her, dass sie noch eine silberne Spieldose von Vati bekommen hatte. Ein Jahr. In einer anderen Welt. Es war ihr Geburtstag. Ihr dreizehnter Geburtstag.
Am nächsten Tag war Ana wieder früh wach im Stall. Sie hatte sich auf die Treppe gesetzt, die auf den Heuboden führte, und ließ ihre Beine durch das Geländer hinabbaumeln. Missbilligend wie immer hatten die drei Bauernbuben sie angesehen, als sie sie dort wie fast jeden Morgen sahen. Einen Gruß gab es nicht. Aber wo hätte sie denn sonst hingehen sollen? Sie beobachtete die drei Bauernbuben beim Ausmisten. Nach wenigen Malen war ihr klar, wie es zu bewerkstelligen war, das alte dreckige Stroh auf die Schubkarre zu geben und dann neues auszustreuen. Ana mochte es. Ihr gefiel diese ruhige Art des täglichen Tuns, die mit den immer gleichen Handgriffen vor sich ging. Wenn der Bauer ausmistete, tat er es mit gleichbleibender Geschwindigkeit, Schaufel für Schaufel, mit gleichbleibendem Gesichtsausdruck und mit dem eben gleichen festen Druck auf den Kuhhintern, um die Kühe beiseitezuschieben. Für Ana sah es so aus, als ob er dies sein Leben lang noch keinen Tag nicht getan hätte und es nie einen Tag geben würde, an dem er dies nicht tun werde. Das war gleichermaßen faszinierend wie beneidenswert, fand sie. Bei ihr hatte sich fast jeden Tag die Welt verändert und kein Mensch wusste, wie es am nächsten Tag weitergehen würde. Bei diesem Bauern war alles sicher.
Wenn aber die Jungs ausmisten mussten, arbeiteten sie nur ordentlich, solange der Vater in der Nähe war. Kaum schaute er fort, wurde der Kuhmist nur ein wenig platt gedrückt und das neue Stroh darübergegeben, so dass man es nicht sehen konnte. Ihnen lag offensichtlich nichts an dieser Tätigkeit. Auch dies beobachtete Ana von der Leiter aus, auf der sie so gerne saß. Der Bauernbub sah sie böse an und sagte etwas, das für sie klang wie »machstaugnwiakua«. Nach längerem Überlegen meinte sie herausbekommen zu haben, dass er ihr sagen wollte, dass sie Augen wie eine Kuh mache.
»Ich sehe gerne zu!«
»Du schaust uns gern beim Arbeiten zu.« Missmutig, fast wütend schüttelte er den Kopf: »Aber helfa tuast ned.«
Nach einem abermaligen kurzen Zögern glaubte sie auch diese Worte zu verstehen.
»Klar helfe ich! Wenn ich darf.«
»Wenn du darfst?« Er sah sie erstaunt an. »Helfen darfst schon.« Seine Augen deuteten auf die Schaufel, die an der Wand gelehnt stand.
Ana kletterte die Leiter hinunter, nahm die Schaufel und begann, bei der ersten Kuh auszumisten. Der Junge stützte sich auf seine Schaufel und sah ihr dabei zu, bis sie fertig war.
»Sauber!«, sagte er dann.
Ana schien das weniger eine Bemerkung zum Zustand des Stalls als vielmehr ein Kommentar zu ihrer Arbeit zu sein. Als sie dann die Stelle, die er gerade bearbeitet hatte, noch mal ordentlich säuberte, grinste er sie an.
»Woswuistdafüa?«
Sie hatte keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte, aber sie machte nun bei einer Kuh nach der anderen das Stroh sauber. Als sie die Schaufel in die Ecke stellte, war der Bauernbub fort. Ana wusch sich die Hände im Waschbecken und sah sich stolz im Stall um – nebenbei hatte sie die Box mit den Kälbchen ganz besonders sauber ausgemistet und sehr viel Stroh hingestreut. Weich würde es werden heute Nacht. Fast wie ein Bett. Da kam der Junge zurück und streckte ihr die Hand hin: »I bin der Franz.«
»Ich die Ana.« Das fand Ana hier irgendwie passender als den Namen der Zarentochter. Und auch älter. Franz sah sie an, fuhr bedächtig mit seiner Hand an ihren Zopf und zog einen dicken Strohhalm aus dem Haar. Dann reichte er ihr etwas entgegen, das in Zeitungspapier eingewickelt war. Vorsichtig packte sie es aus und sah etwas, das sie seit ewigen Zeiten nicht gesehen und gerochen hatte: ein Stück Schweinsbraten mit knuspriger Kruste. Dieser Abend im Kuhstall wurde zum Fest.
Ana machte von da an jeden Tag für Franz den Stall sauber und er brachte ihr dafür immer etwas zu essen vorbei: Fleisch, Würstchen, Semmelknödel, Germknödel. So viel, dass er es zwar für eine Portion für Ana alleine hielt, bei seinen drallen roten Backen aß er dies bestimmt täglich, aber ihnen schien es zusammen mit der Milch und den Eiern, mit dem Sauerampfer, dem Giersch und dem Löwenzahn, den sie mittlerweile schon manchmal auf den Wiesen fanden, mehr, als sie oft in den letzten Wochen in Breslau gehabt hatten. Dass der Bauer eigentlich Lebensmittelkarten für sie bekam und der Familie viel mehr zugestanden hätte, erfuhren sie erst viel später.
»Gehst tanzen mit mir heut Nacht?«
Ana sah Franz erstaunt an. Sie war doch gerade erst dreizehn. Tanzen gehen. Gut möglich, dass er sie für älter hielt. Die ausgemergelten Gesichter waren zeitlos. Dass sie irgendwie das Familienoberhaupt war, hatte er auch mitgekriegt. Und kräftig ausmisten konnte sie auch. Er hielt sie sicher für älter.
»Ist Tanz heut im Dorf.«
»Tanz.« Ana blickte Franz mit seinen roten Bäckchen an. »Tanz.« Eine Erinnerung blitzte in ihr hoch. Früher hatten Mutti und Vati von dem Hausball erzählt, bei dem sie getanzt und getanzt und getanzt hatten. ›Hausball‹. ›Tanz im Dorf‹. Hätte in Breslau ein Junge sie gefragt, ob sie mit ihm zum Tanzen gehe, hätte sie ihren Vater um Erlaubnis fragen müssen, und der hätte mit Sicherheit nein gesagt in ihrem Alter. Sollte sie Mutti fragen? Gleich nein zu Franz sagen? ›Tanz‹. Käthe merkte doch überhaupt nicht mehr, wo man war.
»Ich habe nichts zum Anziehen.« Ihre Kleidung stank nach Kuhstall und war zerrissen.
»Ich bring dir ein Kleid von der Gustl.«
»Wann?«
»Um sechs.«
Sie nickte und sah ihm nach, wie er offensichtlich hocherfreut wegstapfte. Eigentlich hatte sie ihn noch nie vorher angesehen. Er war so rund und kräftig, so gemütlich, so rotbackig, mit seinen kräftigen Waden so gar nicht wie die Jungen in Breslau mit ihren Zahnstocherbeinen. Wahrscheinlich war er sechzehn oder siebzehn. Und er wollte mit ihr tanzen gehen.
Am Abend wartete sie vor dem Stall auf ihn. Lenchen hatte sie gesagt, dass sie heute Abend mit Franz weggehe und sie solle nicht bei der Mutter nach ihr fragen. Mit großen Augen hatte Lenchen sie angesehen und nur genickt.
Franz kam mit Lederhose und Janker und reichte ihr ein Blümchenkleid, das sie, die sie sich vorher mit kaltem Wasser und Stroh abgeschrubbt hatte, hinter dem Stall schnell gegen ihre alte Kleidung tauschte. Es war zu groß und hing an ihrer schmalen, verhungerten Figur wie ein Sack herab.
»Schön schaust aus«, sagte Franz und strahlte sie an.
Sie gingen ins Gasthaus ins Dorf. Eine Kapelle spielte und man konnte allen Besuchern ansehen, dass sie sich zum ersten Mal seit Langem so schick gemacht hatten.
»Der Bürgermeister hat Geburtstag. Und er hat gesagt, der Krieg ist aus und wir feiern jetzt«, erklärte Franz und nahm Ana, ohne sie zu fragen, an der Taille und wirbelte sie zu den bayerischen Musikklängen herum.
Die Wirtshaus-Welt drehte sich um Ana, bis sie lachte und lachte. Hatte sie jemals schon so lange und so laut gelacht? Franz schien es zu gefallen. Er bestellte ein Bier und abwechselnd tranken sie einen Schluck. Irgendwie schmeckte es grauenhaft und irgendwie herrlich. Dann wurde wieder getanzt und gelacht und getrunken und getrunken und gelacht und getanzt. Es war spät in der Nacht, als Franz sie zurück zum Stall führte. Sie blieb stehen und wollte ihm sagen, wie schön der Abend für sie gewesen war, aber sie bekam kein Wort heraus. Sein Gesicht war ihr so nahe. Er öffnete den Mund, wie um etwas zu sagen, aber nichts kam.
Dann drehte er sich um: »Gute Nacht, Ana.«
»Franz!« Er wandte sich wieder zu ihr und sie flog zu ihm und gab ihm einen Kuss auf den Mund. Ganz kurz, ganz warm. Und lief dann schnell in den Stall, wo sie sich erst vorsichtig das Kleid auszog, es unter einem Strohballen verbarg und wieder in ihre alte Kleidung schlüpfte. Bevor sie sich in den Kuhstall legte, blickte sie aus dem Stallfenster und sah, dass Franz noch immer vor dem Stall stand, seine Finger auf seine Lippen gelegt hatte und zur Tür starrte. Als sie sich hinlegte, kuschelte Lenchen sich an sie.
Die Nacht wurde nicht lang, denn am frühen Morgen hörten sie einen Lastwagen auf den Hof fahren. Selma rüttelte die Kinder wach und scheuchte sie aus der Kälbchenbox. Kurz warf sie einen Blick mit zusammengezogenen Augenbrauen auf Ana, bestimmt hatte sie bemerkt, dass Ana am Abend gefehlt hatte. Auch Wolfi sah sie missbilligend mit schief gelegtem Kopf an. Aber es war keine Zeit, um jemanden zur Rede zu stellen. Mutti packte halb abwesend wie immer, den Koffer zusammen, wie Selma es ihr angewiesen hatte.
Ana blickte aus dem Stallfenster und sah, wie Polizisten erst am Bauernhof klingelten, dann vom Bauern zum Stall verwiesen wurden und auf den Stall zuliefen. Hinterher kam der Bauer, die drei Buben, als Letzter von ihnen Franz, noch ganz verschlafen, wie Ana lächelnd an seinen kreuz und quer stehenden Haaren feststellte. Die Polizisten öffneten die Stalltür und der Erste blieb stehen. Selma lief zu ihm, doch er begrüßte sie nicht mal. »Hier habt ihr die ganze Zeit geschlafen.« Da es keine Frage, sondern eher eine Feststellung war, antwortete keiner. Der Polizist drehte sich zum Bauern um. »Scheißpack. Ihr habt mehr Platz und mehr zum Fressen als bei uns in der Stadt ein ganzer Stadtteil – und die Frauen und Kinder hier lasst ihr im Kuhstall schlafen.« Er spuckte vor den Füßen des Bauern aus. »Und ihr wollt Christen sein!«
Während der Bauer keine Miene verzog, konnte Ana Franz ansehen, wie entsetzlich ihm das alles war.
Der Polizist wandte sich wieder an Selma, die vor ihm stand. »Ihr seid Familie Vahrenhorst und Familie Piontek?«
»Ja«, nickte Selma.
»Euch ist eine Wohnung in München zugeteilt worden, so wie ihr es als Wunsch angegeben habt. Da habt’s ihr ein gscheites Glück gehabt«, erklärte der Polizist mit dem für die Schlesier ungewohnten bayerischen Klang, »mei, weil der Vahrenhorst-Mann ein Richter ist und hoffentlich bald zurückkommt, die anderen Richter sind doch alle raus, sagen die Amis. Und der andere, der Piontek, ist den Heldentod gestorben, das zählt bei den Amis nichts, aber bei uns immer noch was. Kommt’s.«
Keiner sagte etwas, aber Ana konnte sehen, dass Selma die Tränen in die Augen traten.
Ana wandte sich um und wollte die zwei Koffer nehmen, die gerade noch hinter ihr gestanden hatten, doch sie erstarrte. »Tante Selma, die Koffer sind fort.« Mit einem Blick sahen Tante Selma und Ana, dass die hintere Stalltür offen stand. Während der Bauer und Franz noch vorne standen, waren die anderen zwei Buben weg.
Der Polizist hatte Anas Worte auch gehört. »In der Stadt wird euch etwas zugeteilt. Wir haben keine Zeit, wir müssen los.«
Selma und Ana blickten sich an. Die Daunendecken. Aber viel mehr der eingenähte Schmuck, das Geld, der Tabak. Alles war im Koffer. Und die Spieldose, fiel Ana siedend heiß ein. Sie rannte aus dem Stall hinaus, aber weit und breit war niemand zu sehen. Dann hörte sie die Haustür des Bauernhauses zuschlagen.
Als sie zurücklief, flehte Selma den Polizisten an: »Bitte gehen Sie und Ihre Leute ins Haus hinein. Unsere Koffer. Es ist alles, was wir haben.«
Der Bauer rührte sich nicht von der Stelle.
»Ich habe wirklich keine Zeit. Das Bauernhaus ist riesig. Ausgänge nach hinten gibt es auch genug.« Man konnte ihm ansehen, dass es ihm leidtat. »Ich habe keine Zeit. Entweder Sie steigen jetzt in den Laster ein oder Sie bleiben hier. Ob Ihnen dann aber wieder eine Wohnung zugeteilt wird, kann ich Ihnen nicht versprechen.«
»Los«, entschied Selma mit einem bitteren Blick und sie machten sich auf zum Laster. Ana sah sich um, nun war auch Franz verschwunden.
Sie kletterten hinten in den Laster hinein, wo einige andere Frauen und Kinder saßen, die die Polizisten bereits eingesammelt hatten. Der Laster fuhr an.
»Halt, halt, halt«, schrie es von hinten. Ana sah hinaus. Franz kam angerannt, in jeder Hand einen Koffer. Er keuchte. Seine Haare waren noch wilder als sonst. Unter seinem Auge war eine Platzwunde. Es sah nach einer heftigen Prügelei aus. Der Fahrer hatte Franz wohl gehört und hielt an. Franz hievte die Koffer hoch, die Selma und Ana ihm abnahmen. Der Laster fuhr wieder an und Ana sah Franz, dem ein Rinnsal Blut über die Wange lief und der an genau der gleichen Stelle regungslos stehen blieb und dem Laster nachsah, bis sie um die Ecke bogen.
Bei jeder Unebenheit der Straße wurde Ana durchgerüttelt. München. Sie glaubte, während der Zeit in Breslau kaum etwas von dieser Stadt gehört zu haben. München. Vielleicht in Geographie oder Geschichte. Aber sie hatte nicht wirklich Bilder im Kopf zu dieser Stadt. Mittlerweile jedoch hatte sie schon einiges gehört. Es war die größte Stadt im Süden, die Landeshauptstadt Bayerns. Tante Selmas Augen leuchteten, denn sie wollte unbedingt fort vom Land, in die Stadt. Auch München sei zerstört, hatte Ana gehört. Aber nicht verloren, wie Breslau. Ganz ruhig saß Ana da und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Breslau war verloren, an die Russen. Für immer. Das hatte ihre Mutter mehrfach wiederholt. Tante Selma nicht, sie hatte darüber nicht mehr gesprochen. München zerstört. Wie Bomben zerstörten, das wusste Ana genau. Sie hatte das Nachbarhaus in Trümmern gesehen, das Nachbarhaus, in dem ihr Freund Fritzchen gelebt hatte. Er lag unter den Trümmern. Sie hatten gesucht, aber es war nichts mehr da gewesen. Ana blickte traurig auf die Straße, die sie fort vom Bauernhof brachte. Fort von den Wiesen, hin zum Schutt, hin zu den Trümmern. Fort von Franz.
Auf dem Weg nach München machten sie mehrfach Station und holten Frauen und Kinder aus den ihnen zugewiesenen Unterkünften. Als Ana zu ihrer Mutter blickte, nahm sie sie zum ersten Mal seit Langem als lebendig wahr, fast schon aufgeregt. Ana beobachtete sie genau. Käthe sah nicht nach hinten aus dem Laster hinaus, auf den Weg, den sie hinter sich ließen, wie Ana. Sie sah nach vorne, und beinahe schien sie zu lächeln.
Geredet wurde nicht viel im Laster. Aber in Käthes Augen und in denen der anderen glomm etwas, das Ana schon lange nicht mehr gesehen hatte. Hoffnung.
Kapitel 2
Lilith München 2017
Lilith setzte sich auf einen der braunen Lederhocker in der Mitte des großen Museumssaals, um sich in aller Ruhe ein wundervolles Gemälde von Manet anzusehen. Der junge Mann auf dem Bild hatte einen Strohhut auf. Lässig, aber ein wenig zu klein war der Hut, schien Lilith. Sehr jung, fast noch ein Kindergesicht, die Lippen trotzig aufgestülpt, als ob … ja, wie? Zuerst hatte Lilith gedacht, dass er hochnäsig davonschreite und die ebenso junge Dienstmagd in der grauen Schürze und mit dem silbernen Krug in der Hand, aus dem sie vielleicht gerade noch dem jungen Herrn hatte einschenken wollen, hinter sich ließ.
Lilith liebte es, sich in ein Bild hineinzudenken. Lieber nur ein Bild je Museumsbesuch ansehen, aber dies richtig. Figur für Figur, Geste für Geste, Pinselstrich für Pinselstrich. Wieder betrachtete sie das Bild, es zog sie magisch in die Szene hinein, als ob es etwas mit ihr selbst zu tun hätte.
Die Frau, die dem jungen Mann einen unzweifelhaft wehmütigen Blick hinterherwarf, während der bärtige Vater mit einem seltsam unbeteiligten Blick zwischen den beiden hindurchsah. Doch nachdem sie das Bild bei jedem ihrer Besuche in der Neuen Pinakothek studiert, aufgesogen, neu gedeutet hatte, fand sie den Blick des jungen Mannes zwar immer noch trotzig, aber auch traurig-verzweifelt. An wen nur erinnerte sie dieser Mann auf dem Bild? Hatte er vielleicht die Dienstmagd seinem Vater überlassen müssen? Musste er gehen, von einem Vater, der übermächtig war, der mit Sicherheit nicht gezögert hätte, in jeder Art zu beweisen, dass er der Stärkere war? Vielleicht wussten sie das beide, die Dienstmagd und der junge Herr, sie ergaben sich in ihr Schicksal.
»Bella«, flüsterte es plötzlich in Liliths Ohr, und sie spürte, dass er sich neben sie setzte und sich nun mit ihr das berühmte Bild ansah. Sie musste sich nicht zu ihm drehen, um zu wissen, dass er es war, obwohl sie ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Sie roch seinen Duft, den sie sofort erkannte. Robert, die Liebe ihres Lebens. Wann immer er kam, spürte sie ein überbordendes Gefühl in sich aufwallen. Denn sie wusste, er blieb nie, bald würde er wieder fort sein.
»Immer noch dieser Hang zum simplen Pointillismus der Impressionisten.« Dieser ironische Tonfall, der ihr sofort in den Magen fuhr. »Und immer noch dieser Hang zu den Dandys. Du weißt, dass Manet auf diesem Bild seinen Stiefsohn porträtiert hat. Unehelich, Sohn der neuen Ehefrau. Wohl kaum geliebt. Très chic im Paris der damaligen Zeit. Ein Dandy, absolut unzuverlässig. Aber du hast ein Faible für ihn!« Sanft biss er dann in ihr Ohrläppchen und seine Zunge fuhr über die weiche Haut.
Sie lehnte sich zu ihm, ohne sich umzuwenden. »Nein, Robert, er ist verzweifelt, orientierungslos. Er kann nicht anders. Das Einzige, was er kann, ist flüchten. Es ist tief in ihn hineingeprügelt. Flieh. Nie bleiben, fliehen. – Ich glaube fast, ich weiß, an wen er mich erinnert. Aber sie, sie liebt ihn. Sie wartet.«
Wortlos nahm er sie bei der Hand und sie ließ es geschehen. Er führte sie in ein Café gegenüber, ignorierte die Kellnerin, die den beiden einen Zweiertisch in der Mitte anbieten wollte, und zog sie auf die Bank an einen größeren Tisch ganz hinten in der Ecke.
»Danke, Lilith, dass du hergekommen bist. Ich wusste nach unserem Telefonat nicht sicher, ob du wirklich kommen würdest.«
Sie setzen sich nebeneinander. Als ob sie sich nie getrennt hätten, nicht für Jahre nicht gesehen hätten, waren sie kurz danach in eine heftige Diskussion über Kunst verwickelt. Wenn er sprach, gab es nichts anderes als das, über das er sprach. Versunken, absolut in dem, an das er dachte, über das er nachdachte, leidenschaftlich, seine Hände gestikulierend, nicht abwägend, Meinung schreiend, nicht alles beachtend, aber brillant, emphatisch. So da. So da wie kein anderer Mensch, den sie kannte, so strahlend, so kraftvoll.
»Robert, ich habe dich seit sieben Jahren nicht gesehen.«
»Diese Impressionisten, Lilith …«, er tat einfach so, als habe er ihre Worte nicht gehört, »sie sind hängengeblieben, in der Betrachtung der Dinge, Verfeinerung, Verkleinerung, Verhübschung. Nähe und Ferne. Farben, Formen. Aber keine Abstraktion, kein Blick auf etwas, keine Kritik, keine Distanz!«
Lilith hatte Mühe, auf seine Worte zu achten, sie sog ihn in sich auf. Seine unglaubliche Kraft, dieses Leben im Hier und Jetzt, dieser Wille, Stellung zu nehmen, zur Kunst, zum Leben, sich zu positionieren, Meinung zu vertreten, die Welt zum Besseren zu ändern. Nie hatte sie sich seiner Faszination entziehen können. Wollte sie auch nicht. Sie kannte auch seine anderen Seiten. Das Beharrende, wenig Achtsame, das leicht Fanatische, fast schon Cholerische, das Übers-Ziel-Hinausschießen.
Wenn sie es ihm sagte, ging er zurück, hob sie auf, trug sie auf Händen. Und dann wieder dieses Brennen. Das manchmal seine Umwelt und manchmal ihn verbrannte. Aber sie musste auch gar nicht allzu sehr auf seine Worte hören, sie wusste, was er dachte, fühlte, sagte über die Impressionisten. Auch wenn sie ihn über all die Jahre hinweg nach den ersten Monaten der größten Liebe, die sie je gespürt hatte, immer nur Momente, Stunden, wenige Tage lang gesehen hatte, so wusste sie doch mehr über ihn als über jeden anderen Menschen, den sie kannte. Nicht zuletzt auch wegen der Nachrichten, die sie unregelmäßig, aber immer wieder erreichten, Briefe, Mails, SMS, er fand immer einen Weg zu ihr, mal wenige Worte, mal lange Träume.
»Sie fangen die Seele der Dinge ein, sie verwandeln das Gefühl in Farbe. Sie spüren und lassen uns spüren«, widersprach sie ihm.
Sie wussten beide, dass sie nicht nur über Kunst sprachen, vielmehr über sich selbst.
»Ach Lilith, schön hast du das gesagt! Aber falsch! Keine Distanz. Keine Reflexion! Zur gleichen Zeit die Expressionisten: die sahen und Stellung nahmen!«
»Robert, man muss nicht immer schreien. Man kann etwas auch leise sagen.«
Diesmal hielt er inne, mit den großen Brandreden, mit den fuchtelnden Händen. Und sah ihr in die Augen. Lilith kannte ihn so, wenn er einem zuhörte, versank die Welt um sie herum, nie fühlte sie sich so wahrgenommen, so hingenommen wie in dem Moment, wenn Robert ihr mit dieser Intensität, dieser Aufmerksamkeit, die nur er den Menschen schenken konnte, zuhörte.
Sie sprach weiter. »Die Impressionisten, sie wissen, dass alles nur ein Augenblick ist. Nur der eine Moment, in dem das Licht so fällt, wie es fällt. Nie wiederholbar. Keine Vergangenheit, keine Zukunft. Nur Jetzt.«
Er sagte nichts, versank nur in ihren Augen. »Du!« Leise, aber bestimmt. »Du bist die Sammlerin der Augenblicke. Kein Zuvor, kein Danach. Es ist wie früher. Und ich liebe dich immer noch, genau wie damals, Sammlerin der Augenblicke.« Seine Hand glitt an ihren Rücken, der zu den Hockern, zur Wand zeigte. Er fuhr entlang, spürte die Formen unter seinen Fingern, fuhr weiter auf ihrer Haut, streichelnd, tastend.
»Und du? Lebst du noch immer nur in der Reflexion? Holt dich die Vergangenheit immer noch ständig ein?«
»Ja«, er lächelte, »aber du kannst mich retten.«
Sie tat es, in dieser Nacht.
»Lilith«, er hatte die Hand auf ihren Bauch gelegt, der sich noch in tiefen, erschöpften Atemzügen hob und senkte. »Ich bin nun seit über zehn Jahren verheiratet.«
Als ob er ihr dies sagen müsste, als ob sie es nicht wüsste! »Dich werde ich heiraten«, hatte er zu ihr gesagt, nachdem sie sich zum ersten Mal geliebt hatten. Sie waren beide achtzehn gewesen. Sie hatte es damals schon nicht geglaubt, denn sie wusste immer, er konnte es nicht, konnte sich nie binden, war immer auf der Flucht. Hatte sie gedacht.
Vor sieben Jahren, als sie wieder eine kurze Affäre miteinander hatten, hatte er ihr von seiner Ehe erzählt. Es war ihr gleichgültig, dass er eine Frau hatte, es war ihr gleichgültig, dass sie deswegen Tobias verloren hatte. Denn sie wusste, was kommen würde, und so war es auch. Eines Tages war Robert wieder verschwunden. Immer auf der Flucht, vor seiner Vergangenheit, die ihn wieder und wieder einholte, auf der Flucht vor sich selbst, auf der Flucht vor allen Menschen, die ihm zu nahekamen. Sie wusste es doch längst. Auch wenn es weiterhin schmerzte wie die offene Wunde eines tödlichen Hiebs, warum musste er es wiederholen?
»Ich habe dich angerufen«, er zögerte. »Nicht, weil ich mit dir schlafen wollte. Sondern weil ich dich etwas fragen wollte. Nein, dich um etwas bitten.«
»Ja?« Sie konnte sich eigentlich nicht erinnern, dass er sie je um etwas gebeten hatte.
»Ich habe ein Kind.« Er zog die Hand von ihrem Bauch, stützte sich auf und blickte sie an.
Das allerdings hatte sie noch nicht gewusst. Plötzlich hatte sie wieder diese Worte im Kopf. Seine Worte.
Bald komme ich zu Dir.
Und unsere Liebe wird Früchte tragen,
die weit über uns hinaus gehen.
Wir werden eine Sippe gründen.
Der Liebe wegen.
Hatte er geschrieben. Damals, zu Zeiten der ganz großen Liebe. Als er ihr so viel schrieb. Gedichte. Poetisches. So viele wundervolle Versprechen. Aber er war nicht gekommen. Nicht zu ihr.
»Er ist dreizehn. Aaron. Eine Nacht. Einmalig. Dann war er da. Ich bin kein guter Vater, das ist dir wohl klar. Nicht da, wenn man mich braucht. Und wenn, sage ich das Falsche. Das meinte zumindest seine Mutter. Und sie hat recht. Ich habe versucht, ihn zu nehmen, aber alles war verquer. Wenn ich ihn erziehen wollte, verweigerte er sich. Wenn wir zusammen in den Urlaub fuhren, vermisste er seine Mutter. Lilith, ich habe es versucht, aber ich war einfach ein entsetzlicher Vater. Ich bin nicht dazu in der Lage, ihm ein Vater zu sein.«
Lilith hätte dies alles lieber nicht gehört. Es hätte sein sollen wie immer. Er verschwand und sie stellte ihn sich als Piraten auf dem Meer segelnd vor, bis er irgendwann wiederkäme und sie mit auf See nähme. Sie hatte seinen Worten nicht geglaubt und doch geglaubt, sie hatte sie geträumt. Wieder und wieder und wieder. Vor allem den einen, den schönsten Traum, den er ihr geschrieben, ihr versprochen hatte.
Wir werden reisen. Zwei Jahre. Wir lassen alles hinter uns, die Berechenbarkeit, die Gleichmäßigkeit. Wir ziehen durch Europa, reisen mit der Fähre von Zypern nach Alexandria. Dann werden wir oben auf dem Deck stehen und in das Endloswasser starren. Kein Zurück ins alte Leben.
In Kairo schlafen wir in einem großen Bett mit einem morschen Bettrahmen, der bricht, wenn wir uns lieben, nachdem wir auf die leuchtenden Pyramiden gesehen haben. Lachend und krachend wird es zusammenfallen. Aber nie den Boden berühren. Nie.
Wir brechen auf und wollen als neue Menschen zurückkehren. Robert und Lilith, aber ganz anders.
Ich werde die Trümmerstücke meines Lebens hinab in die Wellen geworfen haben. Und Du wirst bei mir sein. Danach werden wir alles in uns wachsen lassen.
Dies war sein wundervollster Brief an sie. Unzählige Male hatte sie ihn gelesen, bis sie die Worte auswendig kannte und in vielen Momenten vor sich hin sprach. Sich selbst versprach.
Nein, sie hätte es nicht hören wollen. Eine Frau hatte er. Und nun auch noch ein Kind.
»Lilith. Nur du kannst mir jetzt helfen.«
Wie das, fragte sie sich, ihm hatte sie noch nie helfen können.
»Du musst ihn nehmen. Aaron.«
Ein Kehllaut von ihr, die einzige Antwort.
»Seine Mutter hatte einen Autounfall. Sie ist dabei gestorben.« Sie merkte zum ersten Mal, dass ihm dies alles sehr naheging. Er rang nach den richtigen Worten, die er nicht zu finden schien. »Es gibt keine Verwandten.« Wieder stockte er, jeder Satz fiel ihm schwer. »Meine Frau kann ihn nicht ausstehen. Und ich bin nicht in der Lage, ein Vater zu sein. Das weißt du.«
»Ach so. Und da hast du an mich gedacht. So in der Art, Lilith war immer für mich da, wenn ich mal zu ihr kam. Die wird jetzt meinen Sohn nehmen.« Empört, sprachlos, entsetzt, sie wusste gar nicht, was sich alles an Gefühlen in ihr aufbauschte.
»Ja.«
»Robert. Das ist kein Spiel.«
»Nein.«
»Du meinst das ernst?«
»Es gibt keine andere Lösung. Das Jugendamt will ihn in ein Heim geben. Termin in vier Wochen. Ich werde mit ihm nun eine Reise durch Amerika machen. Dann kommen wir zurück. Es gibt keine andere Lösung. Ich würde ein Kind zerstören. Du weißt das.«
Am liebsten hätte sie geschrien, ihn angeschrien. Aber sie sprach ganz leise. »Du hast mir schon viel Unmögliches angetan. Aber diese Frage ist zugleich die lächerlichste und unverschämteste Frage, die ich je gehört habe. Ich soll dein Kind großziehen! Ich sage nein. Und du gehst jetzt bitte.«
»Es gibt noch einen Grund, warum du ihn nehmen musst.«
Sie wandte sich ab.
»Er ist der Sohn von Frederike. Du bist seine Taufpatin. Sie war deine beste Freundin. Sie schämte sich so sehr über diese eine Nacht mit mir, dass sie es dir nie gesagt hat.«
Lilith war kaum in der Lage, diese Information aufzunehmen. »Ich habe Frederike und den Jungen zum letzten Mal gesehen, als er fünf war. Sie sind dann nach Südamerika gegangen. Wir haben uns nur noch Briefe geschrieben. Sie hat mir Fotos von ihm geschickt. Aaron. Ja, genau.« Lilith sprach wie abwesend, ratternd. »Ich wusste nicht, dass …«
»In Santiago de Chile. Ein Laster ist in sie hineingerast. Aaron war nicht dabei.«
Robert wollte sanft seinen Arm auf ihren legen, doch sie zuckte zurück. Langsam ließ sie sich auf das Bett sinken und starrte an die Decke, die zu flimmern schien.
»Lilith, ich habe alles in meinem Leben falsch gemacht. Geliebt habe ich immer nur dich. Nur bleiben, Verantwortung aufnehmen, für dich, dann auch für eine Familie, ich konnte es einfach nicht. Ich dachte, du wärest bei einem anderen Mann besser aufgehoben als bei mir.«
Lilith sah ihn an und konnte seine Worte nicht erfassen. Frederike war tot. Ihr Sohn war auch der Sohn von Robert. Es war, als ob sie dies alles gehört hatte, aber es irgendwo außerhalb von ihr stehenblieb. So irreal.
»Meine Frau, weißt du, auf sie muss ich nicht aufpassen, sie ist so unfassbar praktisch, lebenstüchtig, sie passt auf mich auf. Aber du bist der einzige Mensch, dem ich zutraue, mein Kind aufzuziehen.«
Sie hörte ihn, aber die Worte drangen nicht in sie ein.
»Ich kenne niemanden anderen, der es könnte. Mich am allerwenigsten. Ich bin unfähig. Er ist dein Patenkind. Und Frederike wusste, warum sie dich dafür auswählte. Weil du ihre beste Freundin warst. Weil sie keine andere Familie hatte. Und nur dir wollte sie ihn anvertrauen. Das weißt du.«
Sie wunderte sich nicht, als Robert am Morgen verschwunden war. Alles war wie sonst, er verschwunden, nur ein Traum. Aber es waren Dinge geschehen, die wohl Wirklichkeit waren, die ihr erst nach und nach langsam bewusst wurden, noch weit entfernt von ihrem Gehirn, noch weit entfernt von jeglichem Verstehen.
Eine Telefonnummer lag auf dem Tisch. Daneben das Bild eines kleinen Jungen. Dunkle Locken, schmal, zu dünn, ernster Blick, viel zu ernst. Er war Robert wie aus dem Gesicht geschnitten.
*
»Weißt du eigentlich, wie ich aufgewachsen bin?« Anastasia schrie ihre Tochter an. Wut zitterte in ihrer Stimme.
Lilith saß ihrer Mutter in deren Wohnzimmer gegenüber und hatte ihr den Dialog zwischen ihr und Robert erzählt, als sei es der fremder Menschen. Fast erschien ihr dieser Emotionsausbruch ihrer Mutter völlig unangebracht.
»Nein, das weiß ich nicht.« Lilith antwortete leise, aber ohne die Augen von ihrer Mutter abzuwenden. »Weil du es mir nie erzählt hast, nie. Ich weiß nichts über dich, gar nichts. Nur dass du immer Verantwortung von mir verlangst. Verantwortung und noch mal Verantwortung und noch mal Verantwortung. Ich hätte dir gar nicht von diesem Kind erzählen sollen. Ich war nur so verzweifelt und wollte einmal etwas mit dir teilen. Ich dachte, du findest Roberts Bitte genauso absurd wie ich. Aber was bekomme ich von dir – Vorwürfe! Natürlich, was auch sonst. Nein, meine Entscheidung steht fest. Ich kann den Jungen nicht nehmen. Ich bin dazu gar nicht in der Lage!«
Das Schweigen hing schwer zwischen ihnen. Anastasias Hand flog in einer seltsamen Wellenbewegung durch die Luft, als ob sie Nebelwolken verscheuchen wolle, bevor sie ganz ruhig und sinnierend, wie für sich selbst, sagte: »Gib dir Zeit zum Nachdenken. Und Ruhe. Über einen Menschen kann man nicht schnell entscheiden. Über ein Kind, das keine andere Chance bekommt, schon gar nicht.«
Anastasia kniff die Augen zusammen.
»Deine Großmutter hat alles für ihre Kinder getan. Ich habe alles für dich getan. Und das ist das Einzige, was am Ende im Leben einer Frau wirklich zählt.«
»Aber es ist nicht mein Kind!« Diese Forderungen wurden Lilith zu viel. Alles, was sie immer gespürt und nie gesagt hatte, platzte aus ihr heraus. »Alles für mich getan hast du. Ja. Wäsche gewaschen, Essen gegeben, Schule beaufsichtigt. Aber hast du mich je geliebt?«
Ihre Mutter zögerte lange. »Er ist der Sohn von Robert. Des Mannes, den du als Einziges in deinem Leben je geliebt hast. Und je lieben wirst.«
Lilith sah ihre Mutter entsetzt an. Diese Worte machten sie fassungslos. Was sagte sie da? Wie kam sie dazu, so etwas zu behaupten?
Anastasia starrte lange vor sich hin. Dann gab sie sich einen Ruck, wie um lange in ihr Gehegtes auszusprechen. »Ein Kind von einem geliebten Mann großzuziehen, das ist das Einzige im Leben, das wirklich zählt. Es ist wundervoll.«
»Es ist nicht mein Kind!« Lilith schrie es.
Jetzt vermischten sich Sprachlosigkeit, Unverständnis und Fragen mit Entsetzen und Wut. Sie stand auf und ging.
Nachts um 23.00 Uhr klingelte Liliths Telefon. Verschlafen langte sie danach.
»Lilith?«
»Mama?« Lilith setzte sich sofort auf. Es musste etwas geschehen sein. Um diese Uhrzeit hatte ihre Mutter sie noch nie angerufen.
»Lilith. Ich finde keine Ruhe. Ich weiß, dass du mich so nicht verstehen kannst. Ich weiß, dass du vieles nicht weißt, ich es nicht erzählt habe.«
Lilith hörte zu. Nein, Ana hatte nie erzählt. Nichts. Die Sprachlosigkeit, das Schweigen hatte immer zwischen ihnen gehangen. Als ob Lilith permanent nur im Nebel gestochert hatte. Bei jedem Gespräch mit ihrer Mutter. Lilith hatte sie nie verstanden.
»Lilith, ich brauche Zeit, um es dir zu erklären. Warum es das einzig Richtige ist. Warum es sein muss. Warum man ein Kind retten muss. Was geschieht, wenn man zu Kindern nicht steht. Was geschieht, wenn man Kinder sterben lässt. Was Kinder des geliebten Mannes für eine Frau bedeuten. Warum es unwichtig ist, ob der Junge dein Kind ist.«
Die Stille hing zwischen ihnen, bis Ana beschwörend weitersprach. »Wir nehmen uns gemeinsam Zeit. Und Ruhe. Wir fahren nach Breslau«, erklärte sie. Keine Frage, eine Anordnung.
Lilith blickte auf. Warum denn das? Was sollte das jetzt?
»Du wirst sehen, die Landschaft ist wunderschön dort. Sie beruhigt. Und lässt dich nachdenken.«
Zweifelnd fragte Lilith: »Wenn die Landschaft so wunderschön ist, warum bist du dann nicht schon lange dorthin gefahren?«
»Weil ich mich dann meiner Vergangenheit hätte stellen müssen. Und das wollte ich nicht. Wir reisen zusammen nach Breslau, und ich erzähle dir alles, was ich weiß. Ich zeige dir, wie ich aufgewachsen bin. Und warum du Verantwortung für dieses Kind übernehmen musst.«
Lilith hatte ihre Mutter noch nie so entschlossen erlebt.
»Lilith, ich liebe dich. Und ich würde dir das gerne beweisen.«
In ganzen neunundvierzig Jahren hatte Lilith von ihrer Mutter noch nie diese drei Worte gehört. So oft hatte sie sich gefragt, ob es daran läge, dass ihre Mutter sie nicht liebte, es nicht sagen konnte oder überhaupt nicht lieben konnte. Mal hatte sie das eine, mal das andere angenommen. Kaum konnte sie sich erinnern, je in den Arm genommen worden zu sein. Auch hier hatte Lilith nie eine abschließende Erklärung gefunden. Weil ihre Mutter sie nicht in den Arm nehmen wollte, weil sie Berührungen, körperlichen Kontakt nicht mochte, weil sie so etwas einfach nicht tat. Keine Antworten. Aber Zweifel, auch an sich selbst, immer diese Unsicherheit, ob sie, Lilith, einfach nicht liebenswert war.
Und nun sagte sie das, was sie noch nie gesagt hatte, ›Ich liebe dich‹. In einem Moment, in dem Lilith eine lebenswichtige Entscheidung zu treffen hatte. In dem Moment, in dem sie sich nicht dazu in der Lage fühlte, ein Kind aufzunehmen, es zu lieben. In dem Moment, in dem ihre Mutter sie bat, auf eine Reise in die Vergangenheit mit ihr zu gehen. Vielleicht die Fragen zu beantworten, die Lilith nie gewagt hatte zu stellen. Eine leise Träne floss über Liliths Wange. Sie würde mit ihrer Mutter nach Breslau reisen. Ana hatte es noch nie gesagt. ›Ich liebe dich.‹