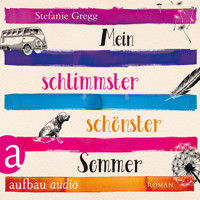Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erst wenn man alles loslässt, kann das Leben neu beginnen.
Als Isabel aus dem Krankenhaus entlassen wird, weiß sie, dass nichts mehr ist, wie es war. Zum ersten Mal ist sie spontan: Sie kauft einen VW-Bus und fährt einfach los. Eigentlich will sie in die Provence, aber dann kommt alles anders. Eine Reise beginnt, bei der sie Menschen trifft, denen sie sonst nie begegnet wäre, bei der sie ihr altes Leben loslässt und ein neues anfängt – und vor allem eines findet: die Liebe ...
„Stefanie Gregg zeigt uns, wo die Hoffnung liegt: Immer direkt vor uns. Aberwitzig und bittersüß.“ Nicole Neubauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Informationen zum Buch
Erst wenn man alles loslässt, kann das Leben neu beginnen
Als Isabel aus dem Krankenhaus entlassen wird, weiß sie, dass nichts mehr ist, wie es war. Zum ersten Mal ist sie spontan: Sie kauft einen VW-Bus und fährt einfach los. Eigentlich will sie in die Provence, aber dann kommt alles anders. Eine Reise beginnt, bei der sie Menschen trifft, denen sie sonst nie begegnet wäre, bei der sie ihr altes Leben loslässt und ein neues anfängt – und vor allem eines findet: die Liebe.
»Stefanie Gregg zeigt uns, wo die Hoffnung liegt: Immer direkt vor uns. Aberwitzig und bittersüß.« Nicole Neubauer
Stefanie Gregg
Mein schlimmster schönster Sommer
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Danke
Über Stefanie Gregg
Impressum
2.4.2010, 8:00
»Du wirst sterben.«
»Ja, aber noch nicht.«
»Ja, aber dann.«
»Interessiert mich nicht.«
»Aber, aber.«
Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur
Kapitel 1
Männerfaustgroß.
Männerfaustgroß ist größer als tennisballgroß. Klingt auch gefährlicher. Tennisballgroß konnte ich sportlich nehmen.
Tennisballgroß ist größer als kirschkerngroß, viel größer, besorgniserregend größer.
Taubeneigroß war für mich unklar. Legen Tauben kleinere oder größere Eier als Hühner?
Kirschkerngroß ist süß, jedenfalls im Rückblick. Damals jedoch der erste Schrecken.
»Machen Sie doch einfach Urlaub«, hatte der Typ in Weiß zu mir gesagt, »in vierzehn Tagen müssen Sie wieder hier sein zum Vorstellen.«
Vorstellen, mich kennt er ja schon, er möchte einen Blick auf die Männerfaust werfen. Vorstellen. Guten Tag, Herr Männerfaust, oder darf ich vielleicht Herr Tennisball sagen oder leider eher Herr Kürbis?
Ich habe ihn angesehen wie einen Kürbis. Machen Sie doch einfach Urlaub. Wie soll das gehen? Urlaub plane ich generalstabsmäßig Monate im Voraus.
»Krankgeschrieben sind Sie auf jeden Fall«, hat er hinzugefügt, als ob mir meine Zweifel auf der Stirn stünden. Und sich dabei über den Bart gestrichen. Wer so einen Bart trägt, macht wahrscheinlich Urlaub im VW-Campingbus, ganz spontan, dachte ich.
Während der Taxifahrt, auf dem Rückweg nach Hause, blickte ich aus dem Fenster und ließ die Häuser an mir vorbeiziehen. Schöne Häuser, hässliche Häuser, Wand an Wand. Als ob sie mich umstellten, um gleich darauf über mir zusammenzustürzen. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen, aber dieses Gefühl der Enge blieb. Zwischen den Häuserreihen waren nur wenige Meter Himmel zu sehen. Tiefblau, mit ziehenden Wölkchen darin. Schönwetterwolken, Sommerwolken, die einem zuriefen: Komm, leg dich auf eine Wiese und guck uns beim Dahinschweben zu. Leg dich ins Gras und sieh, was du in uns erkennen kannst.
Ich versuchte mich auf diesen kleinen blauen Streifen zu konzentrieren, aber rechts und links drängte sich grauer Beton ins Bild.
Der Taxifahrer beobachtete mich mit gerunzelter Stirn im Rückspiegel, wie ich da saß, im Sitz nach unten gerutscht, um besser in den Himmel blicken zu können. Eine Frau, die man vom Krankenhaus abholte und die dann im Wagen in sich zusammensackte; bestimmt nicht unbedingt das, was er brauchen konnte. Mühsam setzte ich mich also wieder gerade hin und versuchte, unbeteiligt ordentlich nach draußen zu schauen. Die auf mich einstürzenden Häuserfronten zu ignorieren. Dann sah ich ihn, den gelben Campingbus mit weißem Dach und Regenbogenaufkleber auf der Heckscheibe und dem großen Schild »Zu verkaufen« im Fenster. Mit seiner grellen Farbe sprengte er geradezu die graue Häuserfront.
Ich bat den Taxifahrer anzuhalten und stieg aus. Wie mechanisch wählten meine Finger die Telefonnummer, die mit dickem Stift auf den Pappkarton geschrieben war.
»Hallo. Ich interessiere mich für Ihren Campingbus.«
»Ja, gut.«
»Kann ich ihn mir ansehen?«
»Ja, klar.«
»Sind Sie auch dort, wo der Bus steht?«
»Äh, ja.«
»Dann würde ich mir den Bus gerne gleich anschauen.«
»Muss mich noch anziehen. Dann komme ich runter.«
Den Taxifahrer ließ ich warten. »Sie wissen aber schon, dass der Taxameter weiterläuft«, brummte er.
Ich nickte. Er sollte froh sein, dass ich nicht auf seinem Rücksitz zusammengebrochen war. Ich lehnte mich mit dem Rücken an eine der kühlen grauen Häuserfronten. Hinter sich konnte man sie einigermaßen gut ertragen. Mein Blick war nach vorne gerichtet und heftete sich auf den gelben VW-Bus.
Ein junger Mann mit lilagebatiktem Hemd, weiter Cargohose und Schlappen an den Füßen trat aus der Haustür neben mir und stockte, als er mich sah. Klar, ich war nicht der typische VW-Bus-Käufer: graue Anzughose, weiße Bluse, grauer, schmal geschnittener Blazer – wohl eher der BMW-Typ. Ich stellte mich betont gerade hin und blickte ihm direkt in seine skeptischen Augen.
Als er die Seitentür des Busses öffnete, schlug uns ein muffiger Geruch entgegen.
»Baujahr 85, 360000 km, ist aber schon ein neuer Motor, auf dem sind so etwa 100000 gelaufen.« Er sah mich fragend an.
»Wie viel?«, fragte ich.
Wieder betrachtete er mich stirnrunzelnd. »2900, hat noch fünf Monate TÜV.«
Ob er gerade den Preis erhöht hatte oder sowieso nicht daran glaubte, dass ich den Bus kaufen würde? Egal.
Ich sah mich im Inneren um. Abgewohnt, aber irgendwie gemütlich; in diesem Bus hatte man bestimmt schon viel Spaß gehabt.
»Fährt er sicher?«
»Seit dem neuen Motor fährt er eigentlich immer ordentlich. Ich bin ein Bastler, der Wagen ist so weit in Schuss, aber eine Garantie gibt’s in dem Alter natürlich auf nichts.«
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich zahle Ihnen 2000 Euro, und Sie leihen mir den Bus für 14 Tage.«
Er sah mich verblüfft an. »Wie? – Leihen – für 2000 Euro?«
»Ich möchte diesen Bus nur für 14 Tage leihen, dann kriegen Sie ihn zurück.« Ich sprach ganz langsam, wie zu einem kleinen Kind.
»Also, ganz ehrlich, dafür können Sie sich auch einen neuen Caravan mieten.«
»Ich will aber diesen Bus und jetzt sofort losfahren.«
»Jetzt sofort?«
»Jetzt sofort.« Wieder ganz langsam und mit weicher Stimme. Wobei ich nicht ganz sicher wusste, wen ich hier mehr überzeugen wollte: ihn oder mich. Dann wanderte mein Blick vom Bus zur wolkenhohen Häuserwand hinter mir und wieder zurück, zum gelben, häuserwändesprengenden Bus.
»Und wenn Sie dann einfach mit dem Bus weg sind?«
»Er ist ja ohnehin nicht viel mehr wert. Aber ich kann Ihnen auch noch ein Pfand dalassen.«
»Hm, klingt gut. Aber, ehrlich gesagt, da gibt’s noch ein Problem. Ich muss noch nach Freilassing. Meine Mutter ist gestorben, und ich habe einen Termin beim Bestatter. Außerdem habe ich versprochen«, er zögerte, »ihre alte Kommode zu ihrer Schwester nach Füssen zu fahren. Dafür bräuchte ich ihn noch mal.«
Ich überlegte kurz. »Okay, dann fahren wir gemeinsam nach Freilassing, danach nach Füssen, und von dort aus fahre ich alleine weiter.«
Ich hatte nur eine ungefähre Ahnung, dass Freilassing nicht allzu weit entfernt war, und Füssen lag zumindest im Süden. Und Süden war gut. Solche gelben VW-Busse fuhren doch immer in den Süden. Da sind die Häuserfronten auch nicht so hoch.
»Echt wahr?« Er konnte das Angebot offenbar kaum glauben. Ich irgendwie auch nicht. Was tat ich hier eigentlich gerade?
War ich wirklich im Begriff, einen abgewrackten VW-Bus zu mieten? Ich, Frau-von-Technik-null-Ahnung. Solche Busse liefen selten mehrere hundert Kilometer, ohne dass sich jemand drunterlegen und daran herumschrauben musste. Ich hatte noch nie unter einem Bus gelegen. Könnte ich natürlich locker machen, mich unter ihn legen. Locker. Nur würde ich nicht wissen, was man dann darunter tun sollte. Trotzdem. Völlig egal. Ein Blick zur Häuserwand genügte mir, um ganz sicher zu sein. Ich musste raus aus dem Betonschlund.
Ich streckte ihm die Hand hin. »Echt wahr.«
»Ey, das ist das Verrückteste, was ich je erlebt habe.«
Ich musste grinsen. Da stand dieser Hippie vor mir mit seinen blonden Rastalocken und erklärte mir, dass mein Vorschlag das Verrückteste sei, was er je erlebt hatte. Dann konnte das alles doch gar nicht so schlecht sein. Oder?
»Äh, und wann kriege ich das Geld?«
»Wir fahren gleich an einer Bank vorbei.«
»Okay – Deal.«
»Deal.«
Das hatte ich noch nie zu jemandem gesagt. Kurz überlegte ich, mich jetzt noch cowboymäßig, mit gespreizten Beinen, hinzustellen. Nur nicht übertreiben. Aber ich fand mich gerade sehr cool.
Wir schüttelten uns die Hände. »Ich heiße Isabel, Isabel Drievers.«
»Rasso, Rasso Liebermann.«
»Liebermann – schöner Name.«
»Ja, bin ich auch, ein lieber Mann.« Er grinste. Und obwohl er den Scherz wahrscheinlich jedes Mal machte, glaubte ich ihm.
»Wie lange brauchst du, bis du fertig bist?« Es war sonst nicht meine Art, schnell und fraglos aufs Du überzugehen, aber alles andere wäre lächerlich gewesen. Ich konnte ja einen Rastaman nicht siezen.
»Fünf Minuten. Habe schon alles gepackt.«
»Gut, dann bezahle ich das Taxi und warte hier.«
Der Taxifahrer war erst mal sauer, als ich ihm erklärte, dass ich hierbleiben würde, beruhigte sich aber sofort wieder, als ich ihm einen 50-Euro-Schein gab – »stimmt so«.
Kurz lehnte ich mich an einen Baum und blinzelte in die Sonne da oben über den Häuserdächern. War das hier wirklich ich? Miss Perfect, Miss Plant-alles-ganz-genau. Und jetzt stand ich hier und tat einfach mal ganz spontan das, was ich wollte. Ohne über irgendwelche Folgen nachzudenken. Trotzdem fühlte es sich absolut richtig an. Ich entfloh den Häuserfronten. Auch wenn ich die Männerfaust natürlich mitnahm. Aber in einem gelben VW-Bus war bestimmt kein gutes Lebensklima für eine Männerfaust. Undenkbar. Peace. Keine Faust.
Mit ungewohntem Stolz begutachtete ich meinen Bus. Genauso einen hätte ich mit achtzehn haben wollen, um damit durch Sardinien zu fahren. Stattdessen war es ein weißer Polo gewesen, und ich war nur bis Jugoslawien gekommen. Danach gleich brav das Studium begonnen. Betriebswirtschaft. Damit das geregelte Leben kommen kann. Das erfolgreiche Leben.
Mit dem ich bis jetzt auch immer zufrieden war. Alles lief rund. Erfolg im Beruf. Der smarte Georg an meiner Seite. Ein perfektes Paar.
Dennoch, offensichtlich ein gutes Lebensklima für die Männerfaust in meinem Bauch. Oder war das unsinniges Psychologisieren? Schließlich kennen Metastasen keine Befindlichkeiten.
Ich stieg noch mal in den Bus hinein und ließ die Tür offen, um den muffigen Geruch hinauszulassen.
Die grün-gelb karierten Sitzbezüge waren schon ziemlich abgenutzt. In einer Ecke hatte der Bus einen eingebauten Gasherd. Ob der wohl funktionierte? Eine uralte, unordentlich zerknüllte Bettwäsche mit bunten Mustern kringelte sich auf der hinteren Sitzbank, die man zum Doppelbett umklappen konnte.
Auf dem Armaturenbrett lag ein Gelblicht, wie es zivile Polizeifahrzeuge nutzten, um es sich auf das Dach zu setzen. Falls es funktionierte, war es sicher nicht legal, es zu benutzen. Über die vorderen zwei Sitze waren neue Bezüge geworfen worden: oranger Grund mit weißen Blumen.
Es roch nach Jugend, Party, Unbedachtsamkeit, Abenteuer. Und natürlich muffig.
Zehn Minuten später war Rasso wieder da. In einer bunten Umhängetasche hatte er offenbar alles, was er brauchte.
Er streckte mir den Schlüssel entgegen, an dem eine rote Wollbommel hing. »Hier.«
»Ehrlich gesagt wäre es mir lieb, wenn du zuerst fährst.«
»Okay«, sagte er und setzte sich auf den Fahrersitz, ich daneben. »Wo soll’s hingehen?«
»Erst mal nach Schwabing, zu mir.« Ich leitete ihn die Straßen entlang. Unterwegs hielten wir an einer Bank, wo ich 2000 Euro abhob und ihm hinblätterte.
»Echt krass. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Geld auf einmal abheben kann.«
Ich zuckte nur mit den Schultern, dann machte ich meine goldene Kette mit den kleinen eingearbeiteten Diamanten ab und streckte sie ihm hin. »Das ist dein Pfand. Hat 800 Euro gekostet.«
»Nein, ist schon okay. Ich vertrau dir. Hast auch recht, so viel mehr wert ist der Bus vielleicht gar nicht.«
Also zog ich die Kette wieder an. Georg hatte sie mir bei einem Juwelier in Hamburg gekauft, ohne Anlass, einfach weil sie mir so gut gefiel. An Großzügigkeit mangelte es Georg nicht.
Bei meiner Wohnung angekommen, ließ ich Rasso unten warten. Ich brauchte nicht lange. Die Kosmetiktasche nahm ich aus dem Krankenhauskoffer. Anschließend legte ich zwei Jeans, eine kurze Hose, ein paar T-Shirts, zwei Pullis, eine Regenjacke und Unterwäsche in eine Tasche. Die schwarze Sonnenbrille steckte ich mir aufs Haar, und aus dem großen Wandschrank holte ich noch meinen alten Schlafsack. – Wie viele Jahre der wohl schon unbenutzt war?
Ach ja, und einen Bikini packte ich schnell noch dazu. Süden, ich wollte ja in den Süden.
Mein Blick verfing sich an dem dunkelblauen Stoff. Knapp geschnitten, Escada, ich wusste, dass er mir gut stand, obwohl es ziemlich lange her war, dass ich ihn das letzte Mal angehabt hatte. Wo im Süden war eigentlich das erste Meer? Italien? Frankreich? Wo fuhr so ein Bus die Menschen hin? Ich wusste es noch nicht. Aber der Bikini würde sich überall gut machen.
Kurz bevor ich das Haus verließ, schrieb ich noch schnell eine SMS an Georg: »Bin aus dem KKH entlassen, so weit alles okay, für vierzehn Tage krankgeschrieben, ich fahre weg, mache Urlaub, hoffe, du kannst das verstehen. LG Isabel«
Dann schaltete ich das Handy aus und legte es gut sichtbar auf den Tisch.
Ich mochte es nicht bei mir haben. Damals, als ich nach dem Abi mit so einem Bus nach Sardinien wollte, gab es noch keine Handys. Da war man dann auch einfach weg. Weg, unerreichbar und frei. Das war genau das, was ich jetzt brauchte. Kurz hatte ich gezögert. Ob Georg das verstehen würde? Ich war mir nicht sicher. Schließlich hatte er kein Problem damit, immer erreichbar zu sein. Aber wahrscheinlich hätte er das Gleiche auch von mir behauptet. Immerhin würde er das Handy sofort entdecken und sich dann zumindest keine Sorgen machen, wenn er mich nicht erreichte.
Ich ging zur Tür, warf einen letzten Blick auf unsere schicke Designerwohnung mit der blitzend weißen Küche, dem riesigen Kochfeld inmitten der zum großen Wohnzimmer gerichteten Theke und dem langen Esstisch mit der blühenden Orchidee darauf. Nein, nichts hielt mich hier. Ganz weg.
Mit eiligen Schritten ging ich hinunter zu Rasso.
Kapitel 2
Als wir auf der Autobahn waren, holte Rasso eine Packung Zigaretten aus seiner Jackentasche und war gerade im Begriff, sich eine anzuzünden, als er stockte und mich fragend ansah: »Äh, oder soll ich nicht rauchen?«
Ich zögerte. »Lieber nicht.«
Ich könnte ihm jetzt erklären, dass Tumore auch durch Rauchen entstehen können. Obwohl meine Männerfaust wahrscheinlich nicht davon herrührte. Ich hatte nie geraucht. Egal.
Er steckte die Zigaretten wieder in die Tasche.
Mit einem gleichmäßig ratternden Geräusch fuhren wir weiter. Von meinen Autos kannte ich nur noch ein stark gedämpftes Brummen und ein höchstens sanftes Mitschwingen im Ledersitz. Das laute, vibrierende Tuckern des Busses erinnerte mich an mühsame, lange Autofahrten in meiner Kindheit, bei denen man entweder unter unerträglicher gestauter Hitze oder unter Fahrtwind und lauten Geräuschen bei geöffnetem Fenster zu leiden hatte. Gedämpftes Leben, ein Selbstverständnis von Luxus.
Mir ging eine Studie durch den Kopf, die ich vor kurzem gelesen hatte und die besagt, dass Geld Menschen nur so weit glücklich macht, wie man es braucht, um sich damit lebensnotwendige Dinge kaufen zu können: Essen, Kleidung, ein ordentliches Dach über dem Kopf. Alles Geld, das darüber hinausging, macht die Menschen nicht glücklicher. Kein Zusatz-Glück also bei reichen Menschen.
Was bedeutete das für mich? Wie viel Prozent Glück war die Grundabsicherung, und bis zu wie viel Prozent Glück konnte ich kommen? Gefühlt hatte ich mindestens 30% Glück durch das abgesicherte Leben. Hieß aber, dass 70 % fehlten. Wo sollten die eigentlich herkommen?
Meine Gedanken flogen wirr durcheinander, wie die Landschaft, die an mir vorbeizog.
Entstehen Männerfäuste in diesen fehlenden 70%?
Als Kind war man doch ziemlich glücklich, wenn man nicht gerade eine besonders unglückliche Kindheit hatte. Wann verlor man diesen Zustand des kindlichen Glücks eigentlich?
Was hatte ich als Kind, als Jugendliche eigentlich für Wünsche gehabt?
Ganz früher, fiel mir ein, wollte ich Seiltänzerin werden. Wegen des Kinderbuchs, das ich so geliebt hatte. Da war ein kleines Mädchen eine Seiltänzerin. Sie zog ganz alleine in Frankreich von Dorf zu Dorf und tanzte über den Dächern. Ich weiß nicht mehr, um was es in dem Buch ging, aber ich erinnere mich vor allem an eine Zeichnung. Das Mädchen tänzelnd, ein Bein hochgezogen, auf ihrem Seil zwischen zwei Kirchturmspitzen. Und hinter dem kleinen Städtchen erstreckte sich ein endloses Lavendelfeld. Dieses Bild hatte ich mir eine Zeitlang fast täglich angesehen. Ich war versunken darin, hineingestiegen, hatte dort gelebt, über den provenzalischen Dächern, unter mir das violettwogende Lavendelfeld.
Dass Seiltänzerin als Lebensziel natürlich Unsinn war, wird einem irgendwann klar. Unternehmensberaterin werden zu können war großartig. Selbstverständlich, dass man diese Chance ergreift, wenn sie sich einem bietet.
Der Bus schüttelte mich unsanft durch und zog mich aus den schlafmüden, wirren Gedanken.
Fielen eine Klimaanlage und eine gute Federung noch in die Kategorie Lebensnotwendig, oder war das bereits Luxus? Seit wann hatte eigentlich fast jedes Auto eine Klimaanlage? Klimaanlage und Navigationssystem waren für mich die großartigsten Erfindungen der Moderne. Na ja, neben der Flügelbinde.
Eine Bodenwelle hob mich ein wenig hoch.
»Wo willst du eigentlich hin mit dem Bus?«
»Nach Frankreich, in die Provence.«
»Cool.«
Ehrlich gesagt, hatte ich mir das in dem Moment ausgedacht. Ich hätte auch Italien, Gardasee oder Irland sagen können. Aber als es aus meinem Mund herauskam, klang es gut. Provence. Ich konnte plötzlich wieder die violetten Lavendelfelder sehen und ihren wundervollen Duft riechen. Das Mädchen, das so leicht darübertänzelte. Ja, das war genau das, was ich wollte, mit diesem gelben Bus in die Provence fahren.
»Du kannst dann am Bodensee vorbei und über die Schweiz fahren. Oder du nimmst die Strecke über Innsbruck und Italien, dann weiter bis nach Frankreich – das könnte aber vielleicht ein wenig länger sein.«
Ich hatte mir natürlich noch keine Gedanken über eine Reiseroute gemacht. Meine Orientierung war ziemlich schlecht, und die Autos, die ich sonst fuhr, hatten alle ein Navi. Aber in den Süden würde ich schon irgendwie kommen.
»Willst du lieber über die Schweiz oder über Italien fahren?«
Ich hatte keine Ahnung. »Hast du eine Landkarte hier?«
Rasso schüttelte den Kopf. Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen: »Aber mein Bus war schon dort: Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, Arles, bei den roten Bergen von Orange, Kajaktouren auf der Ardèche, kennt er alles, der findet den Weg.«
Ich musste lachen. »Kennst du den Film ›Herbie‹? Das war so ein Käfer, der sprechen konnte und mit seinem Besitzer alles Mögliche erlebt hat. So wird das dann mit mir und dem Bus.«
»Klar kenne ich Herbie, einer meiner Lieblingsfilme!«, erklärte Rasso stolz.
Ich sah ihn zweifelnd an. »Dabei bist du mindestens zehn Jahre jünger als ich.«
Rasso hob die Schultern. »Herbie soll sogar das Vorbild für Knight Rider gewesen sein, die Serie fand ich auch super!« Dann stellte er seinen linken Fuß auf dem Sitz ab und saß in einer Art Yoga-Haltung. Schien aber gemütlich zu sein.
»Kenne ich nicht, Knight Rider.« Ich rutschte auch im Sitz hin und her, um eine bequemere Position zu finden. Im Sitzen drückte die Männerfaust auf meinen Magen.
»Wahrscheinlich siehst du dir eher Kunstfilme an, so französische Langweiler-Filme«, er warf mir einen fragenden Seitenblick zu.
»Nein, eigentlich auch nicht.«
»Was ist denn dein Lieblingsfilm?«
»Das bin ich nicht mehr gefragt worden, seit ich fünfzehn war.«
»Na, und?« Er ließ nicht locker.
»Keinohrhasen«, sagte ich herausfordernd. »Keine Ahnung. Und deiner?«
»Mit ›Keinohrhasen‹ kann ich nicht mithalten.« Er grinste mich breit an.
Mir fiel ein, wie ich als Jugendliche den Film »Der Himmel über Berlin« gesehen hatte. Dieser Film hatte mich so beeindruckt, dass ich ihn drei Mal angesehen hatte. Ich musste einfach immer wieder ins Kino, war süchtig nach diesen Bildern. Natürlich gehörte es damals irgendwie dazu, Wenders toll zu finden. Aber es war noch etwas anderes: Diese große Sehnsucht, die er ausdrückte. Zwei Engel liefen durch Berlin und konnten hören, was in den Köpfen der Menschen vorging. Und diese Gedanken waren meist so traurig. Manchmal langweilig, alltäglich, manchmal träumerisch, selten glücklich. Aber zwischen all diesen Orgien von inneren Monologen, getränkt von Melancholie, schimmerte eine Sehnsucht nach mehr heraus, nach dem »Himmel über Berlin«, der Freiheit und Lust versprach. Und tatsächlich wechselten die Bilder irgendwann von tristen schwarzweißen zu bunten. Ich weiß nicht mehr genau, wann, aber es muss wohl die Stelle sein, wo der Engel sich entscheidet, ein Mensch zu werden, auf dieser grauen, grässlichen Erde. Er gibt seine Unsterblichkeit auf, damit auch er das irdische Leben spüren kann, die Erfahrung des Menschseins machen kann. Vor allem aber verliebt er sich in eine wundervolle Seilakrobatin. Und dann wird alles bunt. Bruchstückhaft erinnerte ich mich an einen langen Monolog, bei dem man die ganze Zeit ihr eigenwilliges, aber schönes Gesicht in Großaufnahme sah, während sie über Liebe, das Leben und keine Ahnung was sprach. Ob er irgendetwas entgegnete, weiß ich nicht mehr. Aber ein Satz der Seilakrobatin hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt, ich weiß noch, dass ich ihn mir mit riesigen schwarzen Lettern aufschrieb und über mein Bett hängte: »Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum?« Oder sagte es doch der Engel Damiel? Ich wusste es nicht. Aber dieses Plakat, das über meinem Bett hing, sehe ich heute noch.
Eine Zeitlang schwiegen wir beide.
»Ich war noch nie in Freilassing.«
»Da fährt man ja auch nur hin, wenn man da herkommt.«
»Deine Mutter ist gestorben?«
»Ja. Nach dem Tod meines Vaters vor vier Jahren wollte sie einfach nicht mehr. Und jetzt hat ihr Körper das auch eingesehen. Vor drei Wochen ist sie gestorben. Zum Glück hat sie aber alles vorbereitet. Vorsorgevertrag, weißt du, was das ist?«
»Nein, habe ich noch nie gehört.« Ich schüttelte den Kopf. Während er gesprochen hatte, sah ich ihn mir zum ersten Mal näher an. Seine dunkelblonden Haare hatte er zu Rastalocken gedreht, die ihm bis über die Schultern hingen. Trotzdem machte er einen gepflegten Eindruck, weder schmuddelig noch ungeduscht. Für mich hatten Rastafari-Typen und Schmuddel bisher immer zusammengehört. In seinem schmalen, länglichen Gesicht blitzten zwei wache blaue Augen. Immer schien er ein kleines Grinsen im Gesicht zu haben. Nicht mein Typ, so ganz und gar nicht. Aber nett, sympathisch.
»Meine Mutter hatte bestimmt zehn Termine beim Bestatter. Sie hat sogar das weiße Samtkissen ausgesucht, auf dem sie liegen möchte. Dazu einen sündhaft teuren Sarg und die Musiker, die bei der Beerdigung spielen. Alles genau geplant – und bezahlt.«
Ich konnte mir richtiggehend vorstellen, wie die alte Frau prüfend mit ihren Händen über einen Mahagonisarg strich und dann ein weißes Kopfkissen mit gehäkelten Spitzen probeweise hineinlegte. »Wow. Warum bereitet man seine eigene Beerdigung vor?«
»Na, weil sie’s ja eh schon lange wollte. Und auch weil sie mir misstraut hat, dass ich alles so ordentlich mache, wie man das in Freilassing will. Die richtige Beerdigung, das ist was Wichtiges! Wäre nicht das erste Mal, dass ich Sachen nicht so gemacht habe, wie es sich in Freilassing gehört. Und das wollte sie bei ihrer Beerdigung einfach nicht riskieren.«
»Bist du traurig?«
»Schon. Sie war immer eine gute Mutter für mich, nur dass ich nicht ganz in ihre Welt gepasst habe.«
Wir hingen beide unseren Gedanken nach. Vielleicht sollte ich das auch machen, einen Vorsorgevertrag abschließen. Aber einen teuren Sarg und ein weißes Samtkissen wollte ich nicht. Eine Bekannte von mir wurde in der Nordsee bestattet, in einer Urne aus Salz. Vorher hatte ich mir das wunderschön vorgestellt, aber als die Urne vor uns dann plötzlich mitten auf dem Meer ins Wasser gelassen wurde und ins bodenlose Schwarz fiel, war es, als ob sie noch einmal gestorben sei, absolut endgültig, verschwunden im nie mehr zu erreichenden Nichts.
Man musste so weit hinausfahren, damit die Salzurne nicht sprudelnd wieder auftaucht – deswegen gibt es auch keine Beerdigung beispielsweise auf der Isar, habe ich mir sagen lassen. Man muss bis zum tiefsten Nichts des Meeres fahren.
Nein, dann doch lieber auf dem Land bleiben. Bei einem Baum. Man konnte sich auch einen Platz unter einem Baum vorbestellen, aber ebenfalls nur als Urnenstätte. Baum klingt besser, nicht so unerreichbar. Aber wer würde mein Grab schon besuchen. Georg? Eigentlich sollte es mir egal sein, wo ich begraben werde, ich würde es sicher nicht mehr mitbekommen.
Rasso riss mich aus meinen Gedanken, als er plötzlich auflachte: »›Und spar bloß nicht am Kissen. Wenn ich ewig lieg, dann bittschön weich‹, hat sie immer wieder zu mir gesagt, bis sie gehört hat, dass es diesen Vorsorgevertrag gibt. Darin ging sie ganz auf. Wahrscheinlich war ihr ansonsten auch einfach langweilig.« Er dachte kurz nach und fügte dann hinzu: »Und das Ganze, obwohl sie doch danach eingeäschert wurde.«
»Teurer Spaß für die wenigen Minuten.«
»O ja, aber eine schöne Beerdigung war’s! Das Erbe ist damit allerdings futsch. Null und nichts.«
Komisch, Rasso wirkte nicht wie einer, der hinter dem Geld her war, dachte ich.
»Dabei könnte ich es gut gebrauchen«, sagte er ganz unvermittelt mit einem Stoßseufzer, als ob er meine Gedanken erraten hätte.
»Wofür brauchst du denn Geld?«
»Ich bin Musiker, Bassist und Sänger in einer Band. Weißt du, ich glaube an meine Musikkarriere, aber mir fehlt ein bisschen das Grundkapital. Ich müsste unsere Tour mitfinanzieren, das kostet einfach, und es kommt nicht immer gleich Geld rein. Die erste CD muss man eigentlich immer auf eigene Kosten produzieren. Ist alles nicht so ganz leicht in der Musikbranche. Ich bräuchte außerdem eine bessere Technik, damit wir wirklich mal auf große Tour gehen können. Und ich hätte gern einen neuen Bass. Der kann schon mal über 1000 Euro kosten.«
Ich nickte. Dafür brauchte er Geld. Um Musik zu machen. Seine Musik. Daraus entstand sein Glück. So kann also aus Geld Glück entstehen. Wenn man sich damit seine Träume ermöglichte, sich den Weg bereitete, um etwas zu finden, was man suchte. Seiltänzerin zu werden konnte man sich aber nicht kaufen.
Ich nickte noch mal, auch wenn Rasso das natürlich nicht sehen konnte. Männer haben ein weitaus eingeschränkteres Sichtfeld als Frauen. Während Frauen natürlich sahen, wenn der auf dem Nebenplatz sitzende Mann sich – beispielsweise – in der Nase bohrte, konnte das der Mann im umgekehrten Fall nicht sehen. Was Männer übrigens immer hochgradig verwunderte, wenn man sie darauf hinwies. Georg wollte das damals auch nicht glauben. Er hob dann an seiner Seite Finger hoch, und ich zählte sie, ohne zu ihm hinüberzusehen, Blick nach vorne auf die Fahrbahn gerichtet. Gleiches war ihm unmöglich. Damit konnte ich ihn überraschen. Fast ein wenig verärgern. Wir unterhielten uns die ganze Fahrt darüber. Ich erklärte ihm, dass ich gelesen hatte, dass dies weit in die genetische Vergangenheit zurückging. Der Mann als Jäger musste fokussieren, während die Frau als Sammlerin den breiten Blick brauchte. Deswegen finden Männer auch im Kühlschrank immer nichts, sie müssen jede Etage einzeln abscannen, während eine Frau sofort den ganzen Kühlschrank im Blick hat und sofort erkennen kann, wo die Butter steht.
Mit diesen Erkenntnissen konnte ich Georg wirklich mal beeindrucken. Derselbe Grund auch, warum Männer nicht mehrere Dinge gleichzeitig erledigen können, multitaskingfähig sind nur Frauen: gleichzeitig das schreiende Kind auf dem Rücken beruhigen, Beeren sammeln und die Umgebung nach Gefahren absuchen. Kann eine Frau. Ein Mann nicht. Der fokussiert sich auf seine Jagdbeute, bis er sie erlegt hat. Sonst sieht er nichts.
Georg hat gelacht, als ich das sagte. Ich glaube, er war stolz darauf, ein Mann zu sein.
Mich hatte die Einschränkung des männlichen Sichtfelds immer wieder aufs Neue verwundert.
Rasso und ich verharrten in unserem angenehmen Schweigen. Es gab selten Menschen, mit denen ich gut schweigen konnte. Bei Rasso aber hatte ich sofort die Vermutung gehabt, dass man es mit ihm gut konnte. Der Bus fuhr sein langsames Tempo und ruckelte mich mit seiner fehlenden Federung in einen unruhigen Schlaf. Das Rattern des Motors erinnerte mich an die Geräusche der letzten Tage.
»Sie haben bei Klaustrophobie ›ja‹ angekreuzt.« Der junge Radiologe sieht mich fragend an.
»Ich mag enge Räume nicht.«
»Na ja, wird schon gehen.« Er steht auf, nimmt kurz die Hände aus dem Kittel und weist mich in den nächsten Raum.
Ich muss meine Hose ausziehen, die Metallknöpfe könnten anfangen zu glühen, sagte die Schwester grinsend. Das T-Shirt darf ich anbehalten. Eine andere Schwester zeigt mir die Liege, auf die ich mich legen soll. Dahinter steht ein riesiges Gerät mit einer erschreckend kleinen, engen runden Öffnung. Wie ein Monster, das seinen kleinen Mund aufsperrt, um mich hinunterzuschlucken. Ich hatte mir vorher keine großen Vorstellungen von dieser Untersuchung gemacht.
Während die Schwester an der grünen Braunüle in meiner Hand das Kontrastmittel anschließt, das sie gleich einspritzen wird, beginnt die Panik in mir emporzuklettern.
Noch mehr, als sie mir einen Kopfhörer aufsetzt. »Das ist so angenehmer für Sie, es ist da drinnen sehr laut, wie unter einem Presslufthammer.« Dann schiebt sie mich hinein in die winzige Öffnung, durch die ich kaum hindurchzupassen scheine. Schnell die Augen schließen. Um Gottes willen nicht mehr öffnen. Wenn ich die Röhre direkt über mir sehe, müsste ich schreien.
Sofort beginnt der Lärm. Ein Presslufthammer, hatte sie gesagt, eher eine Technodisco mit ohrenbetäubendem, nervenzerfetzendem Beat.
Tatack, tatack, tatack.
Okay, denk an etwas. Ich sehe meinen Hund, den ich als Kind hatte. Er rennt über eine Wiese auf andere Hunde zu, und seine Ohren wippen wie in Zeitlupe auf und ab. Reinste Lebensfreude.
Tatack, tatack.
Denk an den Himmel. Ich konzentriere mich auf den Himmel, dessen Blau weiße Schlieren durchziehen, darunter mein Hund, der rennt.
Torock, torock, der Rhythmus hat sich geändert, tiefer, dumpfer, dröhnender. Aus dem Torock höre ich plötzlich Tod-Tod, Tod-Tod, Tod-Tod heraus. Unsinn, denk an deinen Hund, dann plötzlich Doktor, Doktor, Doktor, na, das ist ja immerhin besser, doch dann wieder Tod-Tod, Tod-Tod, Tod-Tod.
Und plötzlich Stille. Ein kleines, schrilles Zwitschern wie von Vögeln in der Ferne klingt in meinen Ohren. Ich bin nicht mal ganz sicher, ob es von der Maschine kommt oder nur der Nachhall des Lärms in der Stille ist. Vielleicht habe ich es ja jetzt überstanden. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Fünfundzwanzig Minuten, hatte mir die Schwester gesagt, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Die Stille ist genauso schlimm wie der Lärm. Weil man wartet. Bloß nicht aus Versehen die Augen öffnen, dann müsste ich schreien. Einatmen, ausatmen, ruhig bleiben, du musst das aushalten.
Wumm, wumm, wumm, es geht wieder los, wieder ein anderer Ton. Was tut diese verdammte Maschine eigentlich?
Plötzlich habe ich das Gefühl zu spüren, wie das Kontrastmittel durch meine Venen eingeschossen wird, die Bahnen werden heiß, mein Bauch tut weh. Nicht bewegen, das darf ich nicht. Einatmen, ausatmen. Ich kann nicht mehr. Ob ich doch den Notknopf in meiner Hand drücken sollte?
Durchhalten.
Einatmen, ausatmen.
Stille.
Das ist Psychoterror.
Ich glaube mich zu erinnern, dass man als Foltermethode Gefangene mit andauerndem Lärm beschallt hat. Ob man in diesem Lärm je einschlafen könnte? Ich glaube nicht, vor allem nicht, wenn das Geräusch wechselt.
Torock, torock, Tod-Tod, Doktor, Tod-Tod, Doktor.
Besinne dich. Zitiere! Ich suche in meinem Kopf nach etwas, das ich aufsagen kann. Der alte Goethe: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Torock, torock. Ich drücke jetzt den Notfallknopf, ich kann nicht mehr. Nein, es kann nicht mehr lange dauern. Walle! Walle manche Strecke, dass, zum Zwecke, Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.