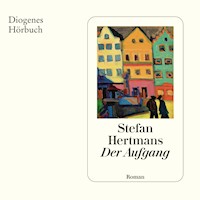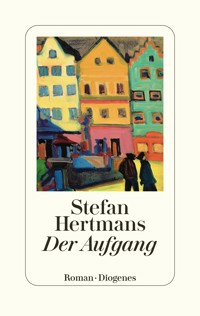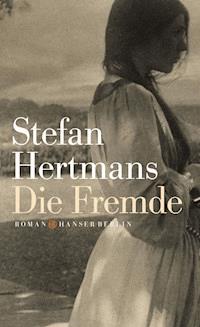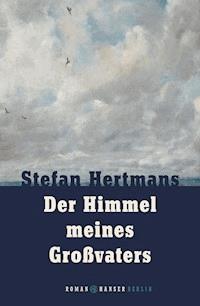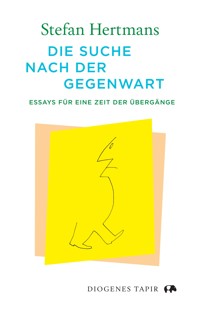
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tapir
- Sprache: Deutsch
Was wissen wir über die Zeit, in der wir leben? Eins ist sicher: Wir spüren, dass die Dinge sich verändern. In 20 kurzen, klarsichtigen Essays wagt Stefan Hertmans einen Versuch, den großen gesellschaftlichen Verschiebungen der Gegenwart auf den Zahn zu fühlen. Mutig und differenziert greift er in aktuelle Debatten ein und liefert dringend gebotene und erhellende Zeitdiagnosen zu Themen wie Klimakrise, Identitätspolitik, Demokratie, Migration und technologischem Wandel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Hertmans
Die Suche nach der Gegenwart
Essays für eine Zeit der Übergänge
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Diogenes Tapir
Where are we now, where are we now?
David Bowie
Vorwort
»Von der Gegenwart weiß ich nichts, weil ich dabei gewesen bin« – immer wieder in den letzten Jahren muss ich an diesen Satz denken. Er stammt aus den Tagebüchern des deutsch-jüdischen Autors Victor Klemperer, der ihn während des Naziregimes, inmitten von Leid und Unsicherheit, fast beiläufig notierte.
Kann man über die eigene Zeit überhaupt etwas sagen? Keiner konnte Ende 2019 voraussehen, dass wir auf jenes Jahr als »das Jahr vor der Pandemie« zurückblicken würden, und keiner, dass 2022 das Jahr wäre, in dem Europa wieder in einen Krieg verwickelt sein würde. Es ist immer heikel, Aussagen über die eigene Zeit zu treffen, was uns jedoch nicht der Pflicht enthebt, Tendenzen dieser Zeit festzustellen oder deren strukturellen Bezüge zu analysieren und zu verstehen. Mehr als Zeugnis abzulegen über die Zeit, in der wir leben, können wir ohnehin nicht tun – etwa für die, die nach uns kommen, oder einfach für uns selbst, weil sich in jedem Versuch, etwas verstehen zu wollen, ein Funken Hoffnung verbirgt. Über dem Eingang zum Warschauer Museum der Geschichte der polnischen Juden stehen die Worte geschrieben: Wer einem Zeitzeugen zuhört, wird selbst zum Zeitzeugen.
Ich war versucht, meinen Essayband mit Nietzsches bekanntem Motto zu beginnen: Ein Buch für alle und keinen. Einerseits wäre das ziemlich anmaßend, andererseits umschreibt dieser Satz genau das leicht ohnmächtige Gefühl, das ich bei der Niederschrift empfunden habe. Wie lange bleiben Gedanken über aktuelle Probleme eigentlich aktuell? Manche werden schnell von den Tatsachen eingeholt, durch andere nehmen wir diese unbeabsichtigt oft vorweg. Verallgemeinerungen sind dazu verurteilt, an Widersprüchen zu scheitern, und Anekdoten wirken manchmal schon nach kurzer Zeit veraltet. Aber eines spüren wir alle: Wir leben in einer Zeit des Übergangs und steuern auf etwas zu, das wir erst in Ansätzen begreifen. So manches verschwindet, anderes entsteht. Gerade deshalb wäre es sinnvoll, Gedanken und Perspektiven gegeneinander abzuwägen. Und für alle, die dieses Bedürfnis kennen, sind meine Überlegungen gedacht – die allzu naheliegenden Meinungen sowie die offenen Fragen und Zweifel. Schließlich sind wir alle Zeugen, auch wenn wir nur sporadisch wissen, wovon. Mit Sicherheit aber bezeugen wir unsere rätselhafte Gegenwart – und die Verschiebungen, die wir jeden Tag wahrnehmen, ohne sie erklären zu können.
Umwelt ohne Zentrum
Unsere Zeit wird von drei großen Themen bestimmt: vom Klimawandel, von der Krise der neoliberalen Weltordnung und von der Migration.
Der Klimawandel ist das weitreichendste der drei Probleme. Er umfasst die gesamte Lebensgrundlage unseres Planeten und spielt bei zahlreichen weiteren drängenden Herausforderungen eine große Rolle, wenn er sie nicht sogar verursacht. Globale Pandemien und Migrationswellen als Folgen des Klimawandels sind möglicherweise erst ein Anfang. Wie wir inzwischen wissen, entstehen Pandemien durch Zoonosen, das heißt dadurch, dass Viren von Tieren auf Menschen überspringen, weil diese in Biotope eingedrungen sind, die sie besser in Ruhe gelassen hätten. Auch Migration entstand dadurch, dass wir in den vergangenen Jahrhunderten das Leben der anderen nicht in Ruhe gelassen haben: durch den Kolonialismus, durch die Zerstörung früherer Formen des Zusammenlebens, durch das politische und soziale Chaos als Folge der absurden Überzeugung einiger Menschen, anderen ihre eigene Kultur, Religion und Ideologie aufdrängen zu müssen. Die wachsende soziale und ökonomische Ungleichheit wird – verursacht von der neoliberalen Marktlogik und durch den Klimawandel verstärkt – zu noch mehr Migration führen.
In all diesen Fällen handelt es sich um ein displacement: Lebewesen, die ihrem ursprünglichen Lebensraum entrissen werden und in einer Umgebung landen, in der ihre Anwesenheit unvorhersehbare Folgen hat. Menschen, Pflanzen und andere Lebewesen, die sich in vielen Jahrhunderten, ja vielleicht sogar Jahrtausenden, an einem spezifischen Ort auf dieser Erde eine bestimmte Form oder Kultur angeeignet haben, werden nun durch einen sich ändernden Kontext gezwungen, den Ort zu wechseln, sich anzupassen oder eine andere Gestalt anzunehmen. Solche Formen des displacement beeinflussen nicht nur die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, miteinander kommunizieren oder das Sprechen im öffentlichen Raum regulieren, sie verändern auch die Strukturen dieser Lebewesen selbst. Wir können beobachten, wie immer mehr migrierende Lebewesen sich aufgrund des Klimawandels an neue Biotope anpassen und dadurch neue Varianten ausbilden. Genetisches Material verändert sich schneller, als wir angenommen haben, geprägt, wie wir sind, von einer Biologie, die bisher vorwiegend standorttreue Arten erforscht hat. Amseln pfeifen in der Stadt anders als auf dem Land, und auch ihre Ernährung ist eine andere; Füchse passen Streifzüge und Speiseplan ihren städtischen Revieren an, sie folgen dabei einer Logik, die sich sehr von der Logik ihres früheren Lebensraums unterscheidet, da sich ihre Überlebensstrategie bezüglich Nahrung und Fortpflanzung an anderen Bedürfnissen orientiert; subtropische Eidechsen migrieren heute entlang neuer Routen, die noch kaum erforscht sind; aufgrund sich ändernder Wassertemperaturen suchen Fische andere Laichplätze, bisweilen Tausende Kilometer von den ursprünglichen entfernt; Exoten gelangen als blinde Passagiere auf Frachtschiffen in für sie ungewohnte Gebiete und plündern und zerstören ganze Biotope; Pflanzen verschieben die Grenzen ihres angestammten Klimas und wandern mit den veränderten Temperaturen mit. Ballungsräume führen nachweislich zu Mutationen in der DNA von Tieren und Pflanzen. Noch weiß niemand, welche negativen Einflüsse Luftverschmutzung und Erderwärmung in Zukunft auf die Tier- und Pflanzen-DNA haben werden und wie sich das auf deren Überlebensfähigkeit auswirken wird. Die in den Sperrgebieten um Tschernobyl und Fukushima lebenden Tiere verwandeln die verfallende Industriearchitektur nach und nach in einen surrealen Lebensraum, doch lässt sich nicht im Mindesten voraussagen, welche Folgen die genetischen Veränderungen, die sie durchlaufen, auf zukünftige Tiergenerationen haben werden.
Etwas durchaus Vergleichbares ist bei der Migration von Menschen zu beobachten. Sie passen die Erinnerungen an ihre Kultur an die neue Situation an, in der sie zu überleben versuchen. Die Sprache von Migranten unterscheidet sich mit der Zeit von der Sprache der Gemeinschaft, die sie verlassen haben, wodurch ihr Selbstbild zwischen Verwurzeltsein und Anpassung aufgerieben wird; außerdem beeinflussen Migranten die Sprache der Bevölkerung ihres neuen Aufenthaltslandes, vor allem, wenn sie in den Medien, der Forschung oder der Literatur tätig sind. Die Literatur Großbritanniens zum Beispiel ist bekanntermaßen schon lange sprachlich von der Literatur seiner Eingewanderten geprägt. Es herrscht nicht länger eine bestimmte Tradition vor; an ihre Stelle tritt ein dynamischer kultureller Pluralismus. Gemeint sind damit Muster, Prozesse und Modi, die zwar bei früheren Migrationswellen bereits in Erscheinung getreten sind, in unserer heutigen überbevölkerten und überhitzten Welt jedoch massenhaft und planetar stattfinden und ungekannte Dimensionen erreicht haben. Was Goethe noch Weltkultur nannte, ist für uns weitgehend zur europäischen Folklore geworden. Wie sich die Aufklärungsidee einer »Weltkultur« zur heutigen Globalisierung verhält, wird erst seit einer Generation konkret diskutiert.
Viele der sogenannten Naturvölker hatten früher keine Ahnung, wie abhängig sie von den Ressourcen waren, die sie endlos extrahierten oder vernichteten. Jahrtausendelang war es der Mensch gewohnt, den Reichtum der Erde für unerschöpflich zu halten, und niemand zweifelte daran, dass der Mensch diesen Überfluss verdient habe. Der amerikanische Evolutionsbiologe Jared Diamond beschreibt in seiner beeindruckenden Studie Kollaps ausführlich, wie polynesische und andere alte Kulturen ihren Untergang dadurch besiegelten, dass sie unbegrenzt Wälder rodeten, ausgerechnet jene Tierarten ausrotteten, die ihre Lebensgrundlage bildeten, und Biosphären, die seit Jahrmillionen in einem Gleichgewicht existierten, innerhalb weniger Generationen vollkommen zerstörten.
Auch die Kolonisatoren des 18. Jahrhunderts rotteten noch rein zum Vergnügen Tierarten aus, die dem Menschen gegenüber nicht den geringsten Argwohn hegten, weil ihre Evolution in einer Welt ohne Menschen stattgefunden hatte – man denke dabei an den Dodo, bestimmte Pinguin-Arten oder große Seekuh-Kolonien –, in der irrigen Annahme, dass dem Planeten gewissermaßen eine Unendlichkeit eigen wäre und die biblische, gottgegebene Natur ihnen alles erlauben würde. Nie hätten sie sich vorstellen können, dass zwei Jahrhunderte später Menschen auf dem Planeten unter Klaustrophobie leiden könnten, weil sie begreifen, dass sie den in der Natur sich abzeichnenden Problemen der Endlichkeit nicht entrinnen können.
Dabei hatte Immanuel Kant schon 1795 davor gewarnt, dass wir uns »nicht ins Unendliche zerstreuen können«, weil die Erde eine »Kugelfläche« besitze. Das heißt: Um den Weltfrieden zu schaffen, müssen die Völker, so Kant, unmissverständlich vereinbaren, wie sie mit der ihnen zur Verfügung stehenden »Oberfläche der Erde« umgehen wollen; von Natur aus ist kein Mensch mehr befugt als ein anderer, an einem bestimmten Ort der Erde zu leben. Aus diesem Grund verurteilt er den Kolonialismus der handeltreibenden Staaten, die, wie er sagt, zwischen Besuchen und Erobern fremder Länder und Völker keinen Unterschied machen, und er warnte davor, dass das universale Recht, die Erde friedlich bewohnen zu dürfen, im Moment überall gebrochen werde. Wie wir heute wissen, waren die Mächtigen, die Ökonomen und die Politiker taub für die prophetische Kraft seiner Worte.
Gustave Flaubert erzählt in einer spannenden Geschichte, wie der heilige Julian bei der Hirschjagd in einen wahren Blutrausch geriet, und die Chroniken des späten Mittelalters beschreiben königliche Festmahle, bei denen Tausende Vögel, Hunderte Hasen und Fasane und unzählige Stare aufgetischt wurden; im Himmel drängte sich eine Üppigkeit, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Noch in meiner Jugend, vor ungefähr einem halben Jahrhundert, lärmten in den Himmeln über den Feldern Goldammern, Feldlerchen, hoch fliegende Kiebitze mit ihrem verhaltenen Zwitschern, die Hecken quollen über vor Spatzenschwärmen und Meisen, die Wälder waren im Sommer durchdrungen vom trägen Ruf des Zilpzalps und dem Gesang der Gartengrasmücken und Drosseln, auf dem Land gab es im April noch überall Kuckucke, und in den Gärten fanden sich im September ganze Wolken lichttrunkener Tagpfauenaugen, die sich am gärenden Fallobst gütlich taten. Das alles ist vorbei – diese Geschöpfe haben Hunderttausende von Jahren auf der Erde gelebt und sind innerhalb nur einer Generation von Menschen fast vollkommen verschwunden. Kürzlich entdeckte man bei Untersuchungen in den Körpern einiger Insekten fast fünfzig unterschiedliche Insektizide. In den letzten dreißig Jahren ist mehr als ein Drittel der Insekten ausgestorben, Bienenarten sind durch den übermäßigen und weltweiten Einsatz von Pestiziden vom Aussterben bedroht. Regenwürmer, die für die Fruchtbarkeit der Humusschicht unverzichtbar sind, werden durch die in der Landwirtschaft eingesetzten Chemikalien stark reduziert. Auf keinen einzigen dieser Erdmitbewohner können wir verzichten, wenn wir Biodiversität und gesunde Biotope bewahren wollen.
Inzwischen ist das, was wir Natur nennen, vor allem still und leer. Die für unsere gemäßigte Klimazone typischen Baumarten wie Ulmen sterben ab, sogar die Buchenwälder, die seit Menschengedenken unsere Landschaften prägen, drohen zu verschwinden, weil sich das oberflächliche Wurzelsystem der Buchen durch die Trockenheit lockert und sie zuhauf von den immer stärker werdenden Stürmen gefällt werden. Das Artensterben vollzieht sich in einem Unheil verkündenden Tempo. Viele der Tiere, die in alten Gedichten besungen werden, kennen wir nicht mehr, der berauschende Duft unberührter Natur ist uns im eigenen Lebensraum gänzlich abhandengekommen. Mehr als neunzig Prozent der flüchtigen Gerüche der Natur werden von Auspuffgasen überdeckt, weshalb die »unberührte Natur« in dicht besiedelten Regionen nur noch eine erinnerungslose Fantasie darstellt. Wir betreiben zwar »Naturschutz«, doch der duftende Zauber einer alten Landschaft, wie es sie noch in meiner Kindheit gab, ist definitiv verloren. Jüngste Messungen zeigen, dass sich in den Gewässern der entferntesten Winkel des Planeten – in den Flüssen von Sibirien bis zu denen in Indien und im Amazonasgebiet (ganz zu schweigen von den Abwässern der städtischen Ballungsgebiete) – Spuren von Medikamenten wie Paracetamol, Antibiotika und blutdrucksenkenden Mitteln finden. Welche Auswirkungen das auf die DNA vieler Tierarten hat, ist nicht abzusehen. Es gibt keinen Ort mehr auf der Welt, der nicht in irgendeiner Weise durch menschliches Eingreifen in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Die meisten Menschen merken kaum etwas davon, sie sind zu sehr mit ihren Alltagssorgen beschäftigt. Außerdem ist es uns oft unmöglich, eine Verschlechterung festzustellen; schließlich kann man nicht vermissen, was man nie gekannt hat. Wir alle sind wie der Frosch im Kochtopf, der nicht merkt, wie sich das Wasser um ihn herum langsam erhitzt. In meinem Geburtsjahr hatte die Erde zweieinhalb Milliarden Einwohner; 2051, ein Jahrhundert später, werden es zehn Milliarden sein. Eine lebensbedrohliche, in der Geschichte der Erde bisher nie gekannte Bevölkerungsexplosion. Im vergangenen halben Jahrhundert hat meine Generation erlebt, wie die Biodiversität zurückging, Naturgebiete schrumpften und eine Verschmutzung und Verschwendung stattfand, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht. In diesem knappen halben Jahrhundert wurde die Erdoberfläche zunehmend versiegelt, mehr Wälder abgeholzt denn je, und das Aussehen des Planeten hat sich enorm verändert. Stellt man sich die Erdoberfläche als ein riesiges Gesicht vor, dann ist dieses Gesicht, verglichen mit den Milliarden Jahren, die der Planet alt ist, innerhalb der letzten Nanosekunde zu Stein geworden – als hätte Gaia in Medusas Augen geblickt.
Das alles setzte eine Kettenreaktion in Gang, die uns vor große Herausforderungen stellt. Die Megastädte, von Futurologen früher als glorreiche Zukunftsträume besungen, sind zu Hitze-Inseln geworden. Wir haben inzwischen erkannt, dass wir diese physischen Reaktionen zu sehr unterschätzt haben und dass die Phänomene nicht linear zunehmen werden, sondern exponenziell. Die Studie Grenzen des Wachstums, die 1972 vom Club of Rome in Auftrag gegeben wurde, formuliert bereits eine klare Warnung vor den Denkfehlern, die wir zu machen im Begriff waren: Die Autoren forderten dazu auf, sich die Zeichnung eines Teichs vorzustellen, auf dessen Wasseroberfläche eine Seerose wächst. Wenn diese Pflanze täglich ihre Ausdehnung verdoppelt und nach 14 Tagen die Hälfte des Teichs mit ihr bedeckt ist, wie lange dauert es dann, bis der Teich ganz zugewachsen ist? Die meisten Menschen sind der Ansicht: so lange, wie es gedauert hat, bis die erste Hälfte bedeckt war. Die Wahrheit lautet: Es bleibt nur noch ein einziger Tag. Deutlicher kann eine Warnung vor den exponenziell zunehmenden Klimakatastrophen nicht sein; doch man hat es als Schwarzmalerei abgetan.
Biologen sind überzeugt, dass sich mit dem neuen, für den privilegierten Teil der Menschheit kaum wahrnehmbaren Massenaussterben eine Katastrophe für die Nahrungskette anbahnt, deren Folgen für unsere eigene Biosphäre unabsehbar sind. Für ärmere Bevölkerungen des globalen Südens ist die Lage bereits jetzt schon dramatisch. Die amerikanische Autorin Elisabeth Kolbert vergleicht in ihrem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Werk Das sechste Sterben. Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt das vom Menschen verursachte Artensterben mit dem globalen Massenaussterben nach dem Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren. Dass ein nichtiges Wesen wie der Mensch so etwas zustande bringt, hängt mit dem Verhältnis von Ursache und Wirkung innerhalb einer geschlossenen Biosphäre zusammen: Die Entwicklung einer so unsichtbaren Kleinigkeit wie der Gehirnrinde beim homo sapiens führte dazu, dass der Mensch zu zielgerichteten Handlungen in der Lage war, die bis vor Kurzem die Grundlage dessen bildeten, was wir Fortschritt nannten. Doch inzwischen sind die ökologischen Bedenken gegen ein ungetrübtes Fortschrittsdenken so groß, dass wir Personen, die sich weiterhin zum alten Modell des unbegrenzten Wachstums bekennen, im Denken rasch für rückschrittlich halten. Jeder kennt den berühmten Schmetterlingseffekt, wonach ein Schmetterling mit einem einzigen Schlag seiner Flügel auf einem anderen Kontinent einen Orkan hervorrufen kann, weil alles mit allem zusammenhängt. Doch dieser fatale Flügelschlag scheint im Kopf des Menschen stattgefunden zu haben: in Form der evolutionären Entwicklung der Gehirnrinde. Eine bestimmte Tatsache, die sich schon seit einigen Jahrzehnten nicht leugnen lässt, schockiert den Menschen besonders: dass die bisher uneingeschränkt bejubelte Evolution – vom britischen Neurologen Oliver Sacks 1993 in einem Interview mit dem Filmemacher Wim Kayzer treffend als »A glorious accident« (Ein herrlicher Unfall) bezeichnet – zu einem Zweck- und Technologiedenken geführt hat, dessen Auswirkungen wir nicht mehr kontrollieren können, egal, ob einige enthusiastische Jünger weiterhin dem Fortschrittsglauben anhängen und ein Wachstum der Biosphäre und anderer Lebensformen propagieren oder nicht. Der absolute Tiefpunkt solcher Engstirnigkeit sind die kindischen Utopien über die Kolonisierung anderer Planeten. Schon der französische Philosoph Bruno Latour hielt in seinem Buch Das terrestrische Manifest das Festhalten an der Raumfahrt und den Fantasien über einen Planeten B für Paradebeispiele eines kolonialistischen Denkens, wie es im 19. Jahrhundert üblich war: Man verbraucht sämtliche Ressourcen, hinterlässt Ruinen und zieht einfach weiter. Aber dieses nomadische Ausbeutungsmodell funktioniert nicht mehr; der Mensch muss erkennen, dass er planetarisch gesehen zur Sesshaftigkeit verdammt ist. Das Fortschrittsdenken zu kritisieren heißt nicht, die Hoffnung auf Emanzipation aufzugeben. Nur sieht diese heute ganz anders aus als zur Blütezeit des modernistischen Rationalismus.
Damit gerät jedoch die Vorstellung einer zweckgerichteten Rationalität ebenfalls unter Verdacht. Auch in dieser Hinsicht wird inzwischen vieles infrage gestellt, und man diskutiert grundlegend darüber, wie wir am besten über unser Denken nachdenken sollten. Was wir heute das Anthropozän nennen – das Zeitalter des wachsenden Einflusses der Menschheit auf die Erde –, ist im Grunde nur ein Euphemismus dafür, dass ein Leben mit Biosphären, wie wir sie bisher kennen, auf dem Planeten nicht mehr möglich ist. Unser neuer Modus Vivendi gründet deshalb nicht mehr auf Verwurzelung, Tradition und Überfluss, sondern auf Entwurzelung, Anpassung und Knappheit. Das heißt auch, dass wir lernen müssen, in instabilen, sich ständig verändernden und dauerhaft prekären Gleichgewichten zu leben.
Das hat tiefgreifende Folgen selbst für die allerkleinsten Themen und Probleme, die unser Denken und unsere Diskussionen beherrschen. Unser Dasein ist kein stabiler Zustand mehr, sondern eine ununterbrochene Aggregation; aber das ist nicht alles: Wir müssen lernen, von Formulierungen wie »unsere Umwelt« abzusehen, denn dabei stellen wir uns weiterhin ganz naiv ins Zentrum von allem, und genau das ist der Hauptgrund für die Zerstörung des Planeten. Diese massiven Verschiebungen finden in einer Zeit statt, in der wir mithilfe von virtuellen Netzwerken, Algorithmen und computergestützten Medien eine vollkommen neue Art und Weise des Sprechens und Wissens entwickeln. Was allerdings dazu führt, dass wir ein gestörtes Verhältnis zu wissenschaftlichen Methoden und Autoritäten entwickeln. Nicht nur räumlich werden uns alle Grundlagen entzogen, sondern auch intellektuell und spirituell. Als Folge davon wissen wir nicht mehr, wie wir sprechen sollen – miteinander, aber auch zu uns selbst. Im öffentlichen Raum findet immer öfter verbale Gewalt statt; die jahrhundertealten Gewissheiten des rationalen Denkens scheinen für immer verloren.
Intimität und Ausgeliefertsein
Eine drastische Veränderung in unserem Leben stellt zweifellos der Umstand dar, dass Meinungsäußerungen und spontane Auslassungen nicht länger reine Privatsache sind, sondern sich viral verbreiten können. Als der Philosoph Jürgen Habermas in den 1960er-Jahren seine Theorie des kommunikativen Handelns vorstellte, ging er noch von einem deutlichen Unterschied zwischen der »Außenwelt« des öffentlichen Raums und der »Innenwelt« des Individuums – des privaten Raums – aus. Habermas’ Weltbild beruhte auf dem unerschütterlichen Glauben an die soziale Vernunft als eine charakteristische Errungenschaft unserer Zivilisation. Seit dem Aufkommen der sozialen Medien wurde nicht nur die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt immer durchlässiger, sondern auch der Glaube an die weltverbessernde Kraft eines solidarischen Zusammenlebens systematisch zerstört. Die Innenwelt, die subjektive Intimität jedes Bürgers, und die Außenwelt, unsere objektive Lebenswelt, die wir in der Öffentlichkeit mit anderen teilen, vermischen sich immer mehr – wodurch beide an Bedeutung verlieren. Oft tragen die Menschen auch noch aktiv dazu bei, indem sie es für besonders mutig halten, intimste Angelegenheiten mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Das alles hat weitreichende Folgen. Eine junge Aktivistin formulierte es vor einiger Zeit so: »Für uns ist es ein Akt des Widerstands, die intimsten Erfahrungen öffentlich zu machen.« Meiner Meinung nach liefert man sich aber genau dadurch den Mächten der Öffentlichkeit aus und verzichtet darauf, kontrollieren zu können, was mit den eigenen, für einen Ausdruck der Emanzipation gehaltenen Intimitäten dort passiert. Was als ein Recht der Selbstbestimmung dargestellt wird, ist alles andere als das: Es ist die freiwillige Aufgabe des Rechts auf Selbstbestimmung. Man redet uns ein, dass die öffentlichen Bekenntnisse anderer uns aus unserer Isolation befreien und uns in schwierigen Situationen trösten können. Doch oft genug tritt das Gegenteil ein: Menschen, die sich den öffentlichen Medien ausgeliefert haben, leiden an Panikattacken und mentalem Stress, werden Opfer von shaming and blaming. Die Medien tragen daran eine Mitschuld, indem sie suggerieren, dass die Trennung von Innen- und Außenwelt nur das Erbe einer altmodischen Bourgeoisie sei, die damit ihr privates Fehlverhalten verbergen wolle. Sie duzen uns einfach, als wären wir alte Bekannte, und missachten damit die soziale Distanz, die es uns ermöglicht, die Öffentlichkeit einigermaßen objektiv zu halten. Diese soziale Distanz, die in der bürgerlichen Welt früher eine gewisse Reserviertheit und die Unterdrückung von Emotionen bewirkte, ist weitgehend verschwunden. Je näher wir Menschen uns kommen, desto mehr Adrenalin wird freigesetzt. Die Mauer zwischen der Intimität und der Öffentlichkeit ist nahezu unsichtbar geworden, weshalb wir uns an ihr ständig Schürfwunden holen.
Die Intimität ist wie die »Rose des Paracelsus« in der unvergesslichen Geschichte des argentinischen Dichters Jorge Luis Borges in Die Bibliothek von Babel. Erst nachdem der nach einer besonderen Rose suchende Besucher gegangen ist, enttäuscht, weil seine Sensationslust nicht befriedigt worden war, lässt Paracelsus die Rose erneut aus der Asche erblühen. Wer seine Intimität einfach so der Öffentlichkeit preisgibt, gefährdet damit nicht selten die Gefühlsvielfalt seines Privatlebens. Wer die Diskretion nicht wahrt, unterschätzt den Wert der persönlichen Erfahrung und geht davon aus, dass das Einzigartige in seinem Leben austauschbar ist. Dabei weiß jeder, dass alle Dinge, die über längere Zeit in einem Schaufenster ausgestellt worden sind, merklich an Farbe und Glanz verlieren.
Die öffentlich gewordene Intimität setzt deshalb auch viele Bürgerinnen und Bürger einem hohen emotionalen Druck aus. Oft haben sie das Gefühl, dass sie im Konkurrenzkampf der bloßstellenden Bekenntnisse nicht mithalten können. Das dadurch entstehende emotionale Ungleichgewicht des sozialen Raums verändert das Feld der zwischenmenschlichen Beziehungen immer mehr – mit unabsehbaren Auswirkungen auf die öffentliche Meinung.
Parallel dazu hat die Werbeindustrie, die uns, der Öffentlichkeit, mit ihren sexualisierten Bildern vorgaukelt, wir befänden uns alle in derselben intimen Blase, dafür gesorgt, dass wir die psychische und körperliche Integrität eines Menschen nicht mehr ausreichend würdigen. Die daraus resultierende Pseudo-Intimität des öffentlichen Raums ist zweifellos für eine zunehmende Zahl von Angriffen auf die Menschenwürde verantwortlich, denn sie geht davon aus, dass der andere keine Geheimnisse mehr hat und sein Recht auf Integrität ihm jederzeit und mit allen Mitteln verwehrt werden kann. Die Aufhebung der Trennung zwischen unserer Innenwelt und der Öffentlichkeit beeinflusst unser Ich bis in den intimsten Winkel.
Die aktivistische Mobilisierung des intimen Lebens ist eine Bedrohung für das Intime selbst, das dadurch im Grunde doch erst verteidigt werden soll. Schließlich geht es bei der Intimität darum, vor den Blicken der anderen geschützt zu sein. Um in der Gesellschaft gefahrlos existieren zu können, braucht das Intime einen Schattenbereich. Wer der Ansicht ist, dass das intime Leben um jeden Preis dargelegt, kommentiert und bloßgestellt werden solle, damit es sich emanzipieren kann, gibt das Privatleben auf und propagiert – entgegen aller guten Absichten – eine totalitäre Öffentlichkeit, in welcher dem kontrollierenden Blick nichts mehr entgeht.
Eine vom eigenen Konsumzwang angeödete Käuferschaft schlurft samstags durch die Einkaufsstraßen, als wäre sie im eigenen Wohnzimmer, wodurch sie wenig geneigt ist, ein Verhalten zu akzeptieren, das sie im eigenen Wohnzimmer als Belästigung empfände: Der öffentliche Raum wird als Eigentum verstanden und der Kauf-Raum als Erweiterung des eigenen Wohnbereichs. Damit ist der Konsument, gemäß den berühmten Worten Walter Benjamins aus dem Passagen-Werk, selbst zur Handelsware geworden, um die sich doch alles dreht. Wer der Ansicht ist, der Einzelne solle sich im öffentlichen Raum so verhalten dürfen, dass er auf keine andere Person Rücksicht zu nehmen braucht, öffnet damit der Auflösung der Sozialgemeinschaft Tür und Tor. Wie spontan der neoliberale Raum sich auch zeigen mag,