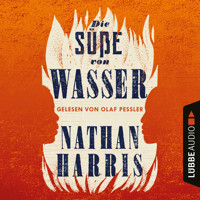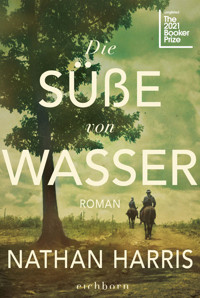
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georgia in den Nachwehen des Amerikanischen Bürgerkriegs: Ein aus der Sklaverei befreites, aber mittelloses Brüderpaar verdingt sich auf einer Farm, deren Besitzer um seinen im Krieg gefallenen Sohn trauert. Zwischen den dreien entwickelt sich eine zarte, bis dahin undenkbare Freundschaft. Doch nicht alle Bewohner von Old Ox sehen solche neuartigen Allianzen gern. Nicht lange, und die Angst vor der neuen Welt bricht sich Bahn in blinder Raserei.
Mit großem psychologischen Feingefühl erschafft Nathan Harris unverwechselbare Figuren und beschwört die erbarmungslose Zeit des Wiederaufbaus herauf. So fesselnd wie berührend, grandios komponiert und sprachlich brillant - ein fulminantes Epos!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorÜber den ÜbersetzerTitelImpressumKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30DANKSAGUNGÜber dieses Buch
Georgia in den Nachwehen des Amerikanischen Bürgerkriegs: Ein aus der Sklaverei befreites, aber mittelloses Brüderpaar verdingt sich auf einer Farm, deren Besitzer um seinen im Krieg gefallenen Sohn trauert. Zwischen den dreien entwickelt sich eine zarte, bis dahin undenkbare Freundschaft. Doch nicht alle Bewohner von Old Ox sehen solche neuartigen Allianzen gern. Nicht lange, und die Angst vor der neuen Welt bricht sich Bahn in blinder Raserei …
Mit großem psychologischen Feingefühl erschafft Nathan Harris unverwechselbare Figuren und beschwört die erbarmungslose Zeit des Wiederaufbaus herauf. So fesselnd wie berührend, grandios komponiert und sprachlich brillant – ein fulminantes Epos!
Über den Autor
Nathan Harris, Jahrgang 1991, erhielt seinen Master am renommierten Michener Center for Writers an der University of Texas. Sein Debütroman DIE SüßE VON WASSER sorgte in den USA direkt nach Erscheinen für großes Aufsehen und stieg sofort auf die NEW-YORK-TIMES-Bestellerliste ein. Neben vielen weiteren Auszeichnungen stand der Roman u. a. auf der Longlist für den BOOKER PRIZE 2021. Nathan Harris lebt in Austin, Texas.
Über den Übersetzer
Tobias Schnettler, Jahrgang 1976, studierte Amerikanistik in Hamburg und lebt als freier Übersetzer mit seiner Familie in der Nähe von Marburg. Zuletzt erschienen in seiner Übersetzung u. a. Romane von John Ironmonger, Francesca Reece und Neal Stephenson.
NATHAN HARRIS
Die
SÜßE
von
WASSER
ROMAN
Übersetzung aus dem Englischen vonTobias Schnettler
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Sweetness of Water«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by Nathan Harris
By arrangement with the author. All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Simone Jakob, Mülheim an der Ruhr
Umschlaggestaltung: Manuela Staedele-Monverde nach einem Originalentwurf von Lucy Kim © 2022 Hachette Book Group, Inc.
Umschlagmotiv: Sons of Negro tenant farmer go off visiting on Saturday afternoon. Granville County, North Carolina. Dorothea Lange, photographer. 1939 July. Courtesy of Library of Congress, Prints & Photographs Division, Farm Security Administration/Office of War
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2898-0
eichborn.de
KAPITEL 1
Ein ganzer Tag war vergangen, seit George Walker mit seiner Frau gesprochen hatte. Am Morgen war er in den Wald aufgebrochen, um einem Tier nachzuspüren, das ihm seit seiner Kindheit immer wieder entwischte, und nun brach die Nacht herein. Er hatte das Tier vor seinem geistigen Auge gesehen, als er morgens erwacht war, und die Suche nach ihm versetzte ihn in solch eine beglückende Abenteuerstimmung, dass er den ganzen Tag lang nicht ans Heimkehren denken wollte. Dies war seit Frühlingsbeginn die erste seiner Exkursionen, und als er über zerbrochene Kiefernnadeln und vom Morgenregen aufgequollene Pilze wanderte, stieß er auf ein Stück Land, das er noch nicht vollständig erkundet hatte. Das Tier, da war er sich sicher, war immer nur einen Schritt davon entfernt, in sein Sichtfeld zu geraten.
Das Land, das sein Vater ihm vererbt hatte, maß über achtzig Hektar. Die großen Roteichen und Walnussbäume rings um sein Zuhause dämpften die Sonne zu einem weichen Flimmern am Himmel, das zwischen ihren Ästen hindurchfiel. Viele von ihnen vertraut wie Wegweiser, seit der Kindheit jahrelang oft betrachtet.
Das Gestrüpp, das George durchquerte, reichte ihm bis zum Bauch und war voller Kletten, die an seiner Hose hängen blieben. Seit einigen Jahren machte ihm seine Hüfte zu schaffen, was er darauf schob, dass er sich einmal beim Verlassen seiner Blockhütte auf dem Waldboden vertreten hatte; doch er wusste, dass er sich etwas vorlog: Die Schmerzen waren beharrlich und stetig wie das Alter selbst gekommen – etwas Natürliches, wie die Falten in seinem Gesicht, das Weiß in seinem Haar. Sie machten ihn langsam, und als er sich eine Atempause gönnte und die Umgebung in sich aufnahm, bemerkte er, dass sich Stille über den Wald gesenkt hatte. Die Sonne, noch vor wenigen Augenblicken hoch über seinem Kopf, hing nun als blasser Ball kaum sichtbar über dem anderen Ende des Tals.
»Na, so was.«
Er hatte keine Ahnung, wo er war. Seine Hüfte schmerzte, als wäre etwas darin gefangen, das zu entkommen versuchte. Sein Gaumen war so trocken, dass seine Zunge daran kleben blieb, und bald übermannte ihn das Verlangen nach Wasser. Er setzte sich auf einen kleinen Holzstamm und beschloss zu warten, bis es vollkommen dunkel war. Wenn die Wolken sich verzogen, würden die Sterne hervorkommen, und das war alles, was er brauchte, um nach Hause zu finden. Selbst die größte Fehlkalkulation würde ihn immer noch nach Old Ox bringen, und auch wenn ihm die Vorstellung zuwider war, diesen hoffnungslos jämmerlichen Gestalten in der Stadt zu begegnen, würde ihm zumindest irgendjemand ein Pferd borgen, mit dem er nach Hause zurückkehren konnte.
Einen Moment lang dachte er an seine Frau. Normalerweise kehrte er um diese Zeit nach Hause zurück, die letzten paar Schritte von der Kerze geleitet, die Isabelle auf die Fensterbank gestellt hatte. Oft verzieh sie ihm sein langes Fernbleiben erst nach einer langen wortlosen Umarmung, auch wenn die verschmierten Handabdrücke von schwarzem Baumsaft, die er auf ihrem Kleid hinterließ, sie erneut verärgerten.
Der Holzstamm unter George brach ächzend entzwei, und er fiel mit dem Hinterteil auf den nassen Waldboden dahinter. Erst als er sich aufrichtete, um seine Hose abzuklopfen, sah er sie vor sich sitzen. Zwei Schwarze, auf die gleiche Weise gekleidet: weiße, aufgeknöpfte Baumwollhemden, Hosen so zerlumpt, als steckten ihre Beine in zusammengenähten Jutesäcken. Sie standen reglos da, und hätte sich die Decke, die sie vor sich aufgehängt hatten, nicht im Wind bewegt wie eine Fahne, die ihre Anwesenheit verkündete, wären sie vielleicht ganz mit dem Hintergrund verschmolzen.
Der Näherstehende sprach ihn an.
»Wir haben uns verirrt, Sir. Kümmern Sie sich nicht um uns. Wir ziehen weiter.«
George konnte sie jetzt deutlicher erkennen, und es waren weniger die Worte des jungen Mannes, die ihm nahegingen, als die Tatsache, dass er im selben Alter war wie sein Caleb. Dass er und sein Begleiter sich auf seinem Grund und Boden befanden, war George vollkommen gleichgültig. Das nervöse Beben in der Stimme des Mannes, der umherhuschende Blick, wie bei einem Tier, das sich vor einem Raubtier versteckt, weckten Georges Mitgefühl – den vielleicht einzigen kleinen Rest, der in seinem gebrochenen Herzen übrig war.
»Wo kommt ihr denn her?«
»Wir gehören Mr Morton. Also, gehörten.«
Ted Morton war ein Dummkopf, ein Mann, der eine Geige eher auf seinem Kopf zerschmettern würde, um sie zum Klingen zu bringen, als den Bogen über die Saiten zu streichen. Sein Grundstück grenzte an Georges, und wenn irgendein Problem auftrat – meist in Form eines Ausreißers –, veranstaltete er ein so unangenehmes Spektakel mit bewaffneten Aufsehern, großschnäuzigen Hunden und Laternen, deren heller Schein den gesamten Haushalt wach hielt, dass George den Umgang mit dieser Familie meist Isabelle überließ und sich selbst die Tortur ersparte. Doch der Umstand, Mortons ehemalige Besitztümer auf seinem Land vorzufinden, barg eine erfreuliche Ironie: Wegen der Emanzipationsproklamation musste der Blödmann hilflos mit ansehen, wie sie fortzogen, und trotz all seiner zur Schau gestellten Macht stand es diesen beiden Männern nun frei, sich genauso zu verirren, wie George es gerade getan hatte.
»Entschuldigen Sie«, sagte der Mann jetzt.
Sie fingen an, ihre Decke einzurollen und ein kleines Messer, ein paar Streifen Rindfleisch und etwas Brot zusammenzupacken, hielten jedoch inne, als George auf sie zutrat. Sein Blick wanderte über den Boden vor sich, als würde er etwas suchen.
»Ich bin einem ziemlich großen Tier gefolgt«, sagte er. »Schwarz, soll angeblich auf zwei Beinen stehen können, aber ist meist auf allen vieren zu finden. Es ist Jahre her, dass ich es mit eigenen Augen gesehen habe, aber es erscheint mir oft, wenn ich aufwache – als wollte es mir zu verstehen geben, dass es ganz in der Nähe ist. Manchmal nicke ich auf meiner Veranda ein und die Erinnerung an das Tier ist so stark, so klar, dass sie wie ein Echo in meinem Kopf und in meinen Träumen nachhallt. Was meine Suche nach ihm angeht, so muss ich leider sagen, dass es bisher die Oberhand hat.«
Die beiden sahen einander an, dann wieder George.
»Das … Also, das ist verdammt merkwürdig«, sagte der näher stehende Mann.
Im letzten Rest des Tageslichts konnte George den anderen, größeren Mann erkennen, dessen sanfte Augen so wenig Emotionen verrieten, dass er George ein wenig einfältig erschien. Sein Unterkiefer klaffte weit offen, sodass die obere Zahnreihe zu sehen war. Das Reden übernahm weiterhin der andere, kleinere Mann.
George fragte sie nach ihren Namen.
»Das hier ist mein Bruder Landry. Ich bin Prentiss.«
»Prentiss. War das Teds Idee?«
Prentiss sah Landry an, als könne der mehr dazu sagen.
»Ich weiß es nicht, Sir. Ich wurde mit diesem Namen geboren. Entweder er war’s oder die Missus.«
»Ich denke mal, es war Ted. Ich bin George Walker. Ihr habt nicht zufällig ein bisschen Wasser dabei?«
Prentiss reichte ihm eine Feldflasche, und George war sich bewusst, dass von ihm erwartet wurde, sie zu befragen, herauszufinden, warum sie hier auf seinem Land waren, doch derlei Dinge nahmen so wenig Raum in seinen Gedanken ein, dass es ihm vorkam wie Verschwendung der wenigen Energie, die ihm noch blieb. Was andere Männer taten, interessierte ihn kaum, und diese Gleichgültigkeit war der Hauptgrund dafür, dass er fernab von jeglicher Gesellschaft lebte. Wie so oft war er mit den Gedanken woanders.
»Sieht aus, als wärt ihr schon länger hier. Ihr habt nicht – ihr habt nicht zufällig das Tier gesehen, von dem ich sprach?«
Prentiss sah George einen Moment lang an, doch dann wurde George klar, dass der Blick des jungen Mannes auf irgendetwas hinter ihm gerichtet war.
»Leider nicht. Mr Morton hat mich manchmal auf Jagdausflüge mitgenommen, da hab ich alles Mögliche gesehen, aber nie das, was Sie da beschreiben. Meist war’s nur Geflügel. Die Hunde sind mit den Vögeln im Maul zurückgekommen, die noch gezittert haben, und ich musste sie mit den anderen zusammenbinden und sie auf dem Rücken nach Hause schleppen. Das waren so viele, dass man mich vor lauter Federn nicht mehr gesehen hat. Die anderen Jungs waren neidisch, weil ich einen Tag lang rauskonnte, aber die hatten keine Ahnung. Wär lieber auf dem Feld geblieben, als diese Last auf dem Buckel zu schleppen.«
»Das ist nicht ohne«, sagte George, der sich das Bild vorstellte. »Wirklich nicht ohne.«
Landry riss ein Stück Fleisch ab und reichte es Prentiss, bevor er sich selbst eines nahm.
»Jetzt sei nicht unhöflich«, sagte Prentiss zu ihm.
Landry sah George an und deutete auf das Fleisch, doch George lehnte mit einem Kopfschütteln ab.
Sie saßen schweigend da, und George empfand ihre Wortkargheit als wohltuend. Abgesehen von seiner Frau waren dies die einzigen Menschen seit Langem, die einen Augenblick so stehen lassen konnten, wie er war, statt ihn mit überflüssigen Worten zu übertünchen.
»Das ist also Ihr Land«, sagte Prentiss schließlich.
»Früher gehörte es meinem Vater, heute gehört es mir, und eines Tages hätte es meinem Sohn gehören sollen …« Die Worte verhallten im Dunkel, und er begann noch mal von vorn. »Jedenfalls habe ich mich wohl verlaufen und kenne mich nicht mehr aus, und dann diese verdammten Wolken am Himmel.«
Er hatte das Gefühl, dass der Wald selbst ihn verhöhnte, und erhob sich wie aus Protest – mit dem Ergebnis, dass der Knoten des Schmerzes in seiner Hüfte sich noch enger zusammenzog. Mit einem Aufschrei sackte er zurück auf den Holzstamm.
Prentiss stand auf und trat mit besorgtem Blick auf ihn zu.
»Was ist denn nur los mit Ihnen? Das ganze Schreien und Schimpfen …«
»Wenn du einen so höllischen Tag hinter dir hättest wie ich, würdest du vielleicht auch schreien.«
Prentiss stand jetzt ganz nah vor ihm, so nah, dass George den Schweißgeruch seines Hemdes wahrnahm. Wieso war er plötzlich so still? So bedrohlich?
»Tun Sie mir den Gefallen, und seien Sie jetzt ganz leise, Mr Walker«, sagte er. »Bitte.«
George fiel das Messer ein, das neben dem Einfaltspinsel gelegen hatte, und die Erinnerung war so lebhaft, dass er es fast im Dunkeln zu sehen glaubte. Er begriff, dass er hier draußen, verirrt im Wald, nur ein Mann war, der sich zwei anderen gegenübersah, und dass er ein Narr gewesen war, sich in Sicherheit zu wiegen.
»Was soll das? Meine Frau wird jeden Moment Hilfe holen, das ist dir klar, oder?«
Doch wieder blickten die beiden Männer nicht ihn an, sondern an ihm vorbei. Ein peitschenähnliches Geräusch ertönte irgendwo ganz in der Nähe, und als er herumfuhr, entdeckte er ein Seil mit einem großen Stein als Gegengewicht: eine raffinierte Schlingfalle, in der das Bein eines zappelnden Kaninchens steckte. Landry erhob sich schneller, als George es für möglich gehalten hätte, und kümmerte sich um das Kaninchen. Prentiss trat einen Schritt zurück und winkte ab.
»Wollte Ihnen keine Angst machen«, sagte er. »Es ist nur so. Uns war noch nichts in die Falle gegangen … Wir haben schon lange nichts Ordentliches mehr gegessen. Das ist alles.«
»Verstehe«, sagte George und sammelte sich. »Dann seid ihr wohl schon länger hier draußen, als ich dachte.«
Prentiss erklärte ihm, dass sie vor einer Woche bei Mr Morton aufgebrochen waren, das wenige mitgenommen hatten, was sie auf dem Rücken tragen konnten – eine Sichel, die im Feld vergessen worden war, etwas zu essen, das Bettzeug von ihren Pritschen –, und nicht weiter als bis zu der Stelle gekommen waren, an der sie jetzt standen.
»Er hat uns erlaubt, ein paar Sachen aus den Hütten mitzunehmen«, berichtete Prentiss von Mortons vorübergehendem Anfall von Großzügigkeit. »Wir haben nichts gestohlen.«
»Niemand hat hier von Stehlen geredet. Nicht dass es mich kümmern würde. Er besitzt mehr, als ein Trottel wie er je brauchen könnte. Ich frage mich nur, wieso ihr hierbleibt. Ihr könntet überall hingehen.«
»Das haben wir vor. Aber es ist einfach schön.«
»Was denn?«
Prentiss sah George an, als wäre die Antwort darauf glasklar.
»Eine Weile seine Ruhe zu haben.«
Landry beachtete sie nicht, sondern zerhackte einen abgebrochenen Eichenast zu Brennholz.
»Sind Sie nicht selbst aus diesem Grund hier draußen, Mr Walker?«
George zitterte jetzt. Er setzte an, um von dem Tier zu erzählen, davon, wie es ihn hierhergeführt hatte, doch das Geräusch von splitterndem Holz unterbrach seinen Gedankengang, und er ertappte sich dabei, dass er – wie schon den ganzen Tag – an seinen Sohn dachte. Als der Junge noch klein war, waren sie gemeinsam durch genau diesen Wald gelaufen, hatten Holz gehackt und so getan, als hätten sie kein Zuhause mit einem wärmenden Feuer, das stets brannte. Die Erinnerung beschwor weitere herauf, all die kleinen Momente, die die beiden verbanden: wie er ihn ins Bett brachte; mit ihm am Tisch betete – leere Gesten, begleitet von heimlichem Augenzwinkern wie geflüsterte Geheimnisse –; wie er ihn an die Front verabschiedete, mit einem Handschlag, der so viel mehr hätte sein müssen; bis die Erinnerungen verschwammen und zum Gesicht des besten Freundes des Jungen wurden, August, der ihn an ebenjenem Morgen aufgesucht hatte, um ihm die Nachricht von Calebs Tod zu überbringen.
Sie hatten sich in Georges kleines Arbeitszimmer zurückgezogen. August sah seinem Vater sehr ähnlich, dasselbe blonde Haar, das jungenhafte Gesicht und dieser leicht majestätische Habitus, der auf nicht viel mehr als Familienfolklore fußte. August und Caleb hatten Old Ox in ihren sauberen nussbraun-grauen Uniformen und polierten Stiefeln verlassen, und George hatte damit gerechnet, dass sein Sohn als schlammverkrusteter, zerlumpter Wildling zurückkehren würde; hatte schon vor sich gesehen, wie er und Isabelle, ganz die pflichtbewussten Eltern, ihn zurück zur Normalität pflegen würden. In Anbetracht dessen hatte Augusts Abendbekleidung etwas Ungebührendes; das gute Hemd, die gebügelte Weste, aus der die goldene Uhr baumelte. Es schien, als habe er seine Zeit im Krieg bereits hinter sich gelassen, was bedeutete, dass auch Caleb ein Teil der Vergangenheit geworden war, lange bevor George überhaupt wusste, dass sein Sohn ihn für immer verlassen hatte.
Während August vor dem Schreibtisch saß, hielt George es nur am Fenster stehend aus. August berichtete, dass er selbst sich verletzt habe, ein übler Sturz bei einem Patrouillengang, der zu seiner Entlassung vor nur einer Woche geführt habe, am ersten Tag des März. In Georges Augen wirkte der Junge vollkommen gesund, und er nahm an, dass dessen Vater für seine Sicherheit gezahlt hatte, als der Krieg in seinen letzten Zügen gefährlicher wurde. Doch seine Verdächtigungen zählten nichts verglichen mit dem, was sie beide zu diesem Moment geführt hatte. In diesen Raum. Als August zu erzählen begann, erkannte George schon beim ersten Satz die Hohlheit seiner Worte, die Theatralik seines Vortrags: Er konnte sich genau vorstellen, wie August in seinem leichten Einspänner saß und auf der Fahrt zu George jeden Satz, jede Silbe probte, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen.
Er erklärte George, Caleb habe ehrenhaft gedieht, habe dem Tod mutig und mit Würde ins Auge geblickt; Gott habe ihm ein friedliches Ableben gewährt. Caleb war schon mit dem Jungen auf Ausflüge gegangen, als die beiden George kaum bis zur Taille gereicht hatten. Er erinnerte sich, wie sie einmal zum Spielen in den Wald gelaufen waren und Caleb bei der Rückkehr so gedemütigt gewirkt hatte, August so voller Schadenfreude, dass George den Verdacht hatte, es müsse irgendeine Art von Wettkampf stattgefunden haben, was eine gute Gelegenheit für eine moralische Lektion war. Ertrage die Niederlage wie ein Mann, hatte George gesagt. Doch später, als sich Caleb nicht zum Abendessen setzen wollte und schon beim Gedanken daran zusammenzuckte, zog George die Hose des Jungen herunter. Sein Hintern war mit Striemen überzogen, manche noch tiefrot, die anderen dunkellila verfärbt. Er erzählte George von dem Spiel, das August ausgeheckt hatte, Master und Sklave, und dass sie an diesem Nachmittag bloß ihre Rollen richtig gespielt hatten. Die Striemen würden ihn weniger quälen, fuhr er fort, als die Angst davor, dass er sie nicht verbergen und George Augusts Vater davon erzählen könne. George musste dem Jungen schwören, dass es ihr Geheimnis bleiben würde.
Als er nun am Fenster seines Arbeitszimmers stand, seufzte George und machte August klar, dass er seine Lügen durchschaute. Sein Sohn habe über viele Eigenschaften verfügt, doch Tapferkeit habe nicht dazu gezählt. Mehr brauchte es nicht, um Augusts Fassade bröckeln zu lassen; er geriet ins Stocken, überkreuzte die Beine, sah auf seine Uhr, suchte verzweifelt nach einem Ausweg, den George ihm jedoch nicht gewährte.
Nein, nein. Sein Sohn sei tot. Und es stehe ihm zu, die Wahrheit darüber zu erfahren, was geschehen war.
George hatte nicht bemerkt, wie Landry das Feuer entfachte, doch jetzt erhellte der Widerschein der Flammen die Umgebung und ließ den größeren Mann im Relief erscheinen; er nahm das gehäutete Kaninchen und spießte die blutige Masse auf einen angespitzten Ast, um sie zu rösten. Die Wolkendecke riss auf und enthüllte einen Himmel voller Sterne, die so klar, so prachtvoll leuchteten, als hätte man sie nur für die drei Männer dort aufgehängt.
»Ich sollte nach Hause gehen«, sagte George. »Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Wenn ihr mir helfen könntet … Es soll euer Schaden nicht sein.«
Prentiss war bereits aufgestanden, um ihm hochzuhelfen.
»Ich meine, ihr beide könntet hierbleiben, wenn ihr wollt. Eine Zeit lang.«
»Darüber müssen wir nicht jetzt reden«, sagte Prentiss.
»Oder vielleicht gibt es ja sonst noch etwas, womit ich euch helfen kann.«
Prentiss ignorierte George, schob eine Hand unter seinen Arm und hob ihn in einem Zug hoch, bevor der Schmerz einsetzen konnte.
»Gut so«, sagte Prentiss. »Und jetzt schön langsam.«
Sie gingen im Gleichschritt zwischen den Bäumen hindurch, Landry im Schlepptau. Obwohl George zur Orientierung die Sterne brauchte, konnte er den Blick, um nicht zu stürzen, sich nicht dem Schmerz zu ergeben, nur starr geradeaus richten. Er legte seinen Kopf in die Kuhle zwischen Prentiss’ Brust und Schulter und ließ sich von dem Mann stützen.
Nach einer Weile fragte er, ob Prentiss wisse, wo sie sich befänden.
»Wenn das hier Ihr Land ist, so wie Sie sagen, dann hab ich Ihr Zuhause gesehen«, sagte Prentiss. »Ist ein hübsches Häuschen, stimmt’s? Ist nicht mehr weit. Gar nicht mehr weit.«
Als sie die Lichtung erreichten, wurde George bewusst, wie restlos erschöpft er war. Die Zeit, die den ganzen Abend lang stillgestanden zu haben schien, lief weiter, und das wirkliche Leben, in Form seiner vor ihm liegenden Blockhütte, holte ihn wieder ein. Durchs Vorderfenster war ein schwarzer Umriss zu sehen, der nur die in Schatten gemeißelte Isabelle sein konnte.
»Schaffen Sie’s?«, fragte Prentiss. »Wär wohl besser, Sie gehen von hier aus allein weiter.«
»Können wir noch kurz warten?«, fragte George.
»Sie müssen sich ausruhen, Mr Walker«, versuchte Prentiss ihn zu überreden. »Das hier draußen ist nichts für Sie.«
»Das stimmt. Es ist nur …« Das sah ihm gar nicht ähnlich. Es lag sicher nur am Flüssigkeitsmangel. Ja – er war etwas desorientiert, ein wenig verwirrt, und die Tränen waren eben ein Symptom seiner misslichen Lage. Es waren auch nur sehr wenige. »Ich bin nicht ganz bei mir. Entschuldige.«
Prentiss stützte ihn. Ließ ihn nicht los.
»Es ist nur so, ich habe – ich habe es ihr nicht gesagt«, sagte George. »Ich konnte mich nicht dazu überwinden.«
»Ihr was nicht gesagt?«
Und George dachte an das Bild, das er seit Augusts Besuch an diesem Morgen nicht mehr aus dem Kopf bekam. Sein Junge, wie er aus dem Schützengraben kletterte, den er selbst mit ausgehoben hatte – so außer sich vor Angst, dass er sich eingenässt hatte –, und geduckt auf die Reihen der Nordstaaten-Soldaten zulief; gerade so, als würden seine Entsetzensschreie ihr Mitleid erregen, als könnten sie ihn inmitten der dichten Rauchschwaden erkennen und seine Kapitulation annehmen, anstatt ihn zusammen mit all den anderen über den Haufen zu schießen. Ihm kam der Gedanke, dass Caleb diese Charakterschwäche vielleicht von seinem Vater geerbt haben könnte – denn wer war hier der größere Feigling: der Junge, der dem Tod nicht mit Tapferkeit ins Auge sah, oder George, der der Mutter des Jungen selbst nicht sagen konnte, dass sie ihren Sohn nie wiedersehen würde?
»Ach, nichts«, sagte George. »Ich bin nur oft so lange allein, dass ich manchmal mit mir selber spreche.«
Prentiss nickte, als würde seine Erklärung irgendeinen Sinn ergeben.
»Dieses Tier, von dem Sie erzählt haben. Mr Morton hat mir im Lauf der Jahre ein paar Tricks beigebracht. Vielleicht kann ich Ihnen morgen helfen, es zu finden.«
Mitleid klang aus seinen Worten, und George war bewusst, welche Ironie darin lag, dass ein Mann mit einem so harten Los ihm seine Unterstützung anbot. Er richtete sich auf und nahm das letzte bisschen Kraft zusammen, das ihm noch geblieben war, um seine Fassung wiederzuerlangen.
»Das wird nicht nötig sein.«
Er musterte Prentiss noch einmal eingehend, in dem Wissen, dass sie sich womöglich zum letzten Mal sahen.
»Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Prentiss. Du bist ein guter Mann. Jetzt aber gute Nacht.«
»Nacht, Mr Walker.«
George humpelte auf die Eingangstreppe zu, und die Kälte wich bereits aus seinen Gliedern, bevor er die Haustür überhaupt geöffnet hatte und ihn die Wärme des Feuers umfing. Vor dem Eintreten hielt er kurz inne und blickte in den Wald zurück, der still und bar jeglichen Lebens im Dunkel lag. Als wäre dort rein gar nichts.
KAPITEL 2
Georges Liebe zum Kochen war nur eine seiner Verschrobenheiten. Zu Beginn ihrer Ehe hatte Isabelle versucht, die Rolle der Köchin zu übernehmen, doch mit den Ansichten ihres Mannes zur Zubereitung von Eisbein verhielt es sich ganz genauso wie mit denen zum Sammeln von Pilzen oder zum Bau einer Schaukel: Sie waren genau durchdacht, sehr speziell und wurden wieder und wieder präzise ausgeführt. Wenn sie am Frühstückstisch saß, betrachtete sie seine Arbeitsabläufe mit einer Mischung aus Faszination und Vergnügen. Es waren Handgriffe, die er in seiner Zeit als Junggeselle perfektioniert hatte – ein Ei aufzuschlagen gelang mit einer Hand, eine elegante Bewegung des Daumens, eine leicht weiblich anmutende Bewegung, und die Schale brach entzwei; zum Fetten einer heißen Pfanne kam eine Scheibe Butter zum Einsatz, die genau einen halben Zentimeter dick war und halbkreisförmig auf der Fläche verrieben wurde, bis sie zischend verschwunden war.
Das Kochen bereitete ihm mehr Freude als das Essen selbst. Letzteres schien bloß eine lästige Pflicht zu sein, die es zu erledigen galt. Sie sprachen am Tisch nur wenig. Doch an diesem Morgen war es anders. Er hatte es irgendwie geschafft, vor ihr aufzustehen, was an und für sich schon eine Leistung war, wenn man bedachte, wie spät er heimgekehrt war. Und als sie nach unten kam, saß er am Tisch und starrte die Wand an, als könnte sich das splittrige Holz plötzlich erheben und seiner Wege gehen.
»Was hältst du von Frühstück?«, fragte sie.
Sein Blick war ausdruckslos. Er war nie gut aussehend gewesen, denn die Natur hatte ihn nicht mit der Harmonie ausgestattet, die Schönheit ausmachte. Seine Nase war groß, seine Augen klein, und sein Haar lag kreisförmig um seinen Kopf wie ein geschickt platzierter Lorbeerkranz; sein Bauch war so prall und rund wie der einer Schwangeren und steckte immerzu, sicher verstaut, zwischen seinen Hosenträgern.
»Ich könnte Pfannkuchen machen«, sagte sie.
Endlich nahm er Notiz von ihr.
»Wenn es keine Mühe macht.«
Als sie vor dem Herd stand und den Teig zubereiten wollte, merkte sie, dass sie vergessen hatte, wie das ging. Sie machte ihn schließlich aus der Erinnerung heraus – natürlich nicht aus der an ihre eigenen Kochversuche, sondern aus der an ihren Mann, den sie fast ein Vierteljahrhundert lang dabei beobachtet hatte. Sie lebten in einer bescheidenen Blockhütte – zwei Etagen, die durch eine Treppe in der Mitte des Hauses miteinander verbunden waren. Von der Küche aus konnte sie George im Esszimmer sitzen sehen, doch wann immer sie sich etwas bewegte, verschwand er hinter der Treppe, nur um gleich darauf wieder zum Vorschein zu kommen.
»Vielleicht ein paar mehr als sonst?«, rief sie ihm zu. »Du musst doch nach gestern großen Hunger haben.«
Dies würde ihr einziger Versuch bleiben, ihm eine Erklärung zu entlocken. Es war nicht so, dass er keine Fragen duldete (die waren ihm eher egal), sondern dass tieferes Nachbohren bei ihm nur selten zu tieferen Erkenntnissen führte. Sie hatte gelernt, sich ihre Worte aufzusparen.
»Hast du es gefunden?«, fragte sie noch. »Das Tier. Ich nehme an, du warst wieder hinter ihm her.«
»Es ist entkommen«, sagte er. »Sehr bedauerlich.«
Die Pfannkuchen brutzelten – Bläschen ploppten auf und schlossen sich wieder, als würden Fische an der Wasseroberfläche nach Luft schnappen. George hätte sie jetzt gewendet. Als eine Art Experiment tat sie es nicht.
Sie brachte zwei Teller an den Tisch, ging wieder in die Küche und kehrte kurz darauf mit zwei Bechern Kaffee zurück. Ihr Essen folgte einem Rhythmus. Der eine nahm einen Bissen, dann der andere, und in diesen kleinen Akten der Verbundenheit – ganz so, wie sie im Wechsel tief durchatmeten, bevor sie abends einschliefen – fügten sich Tag für Tag, Nacht für Nacht die Pinselstriche zum Porträt ihrer Ehe zusammen, das sehenswert, aber frustrierend schwer zu interpretieren war.
Als George am Vorabend nach Hause gekommen war, war sein Gesicht gerötet gewesen und er hatte heftig gezittert, sodass sie nicht genau wusste, ob sie ihn mit einem Lappen waschen oder ins warme Bett stecken sollte. Die Schmerzen in seiner Hüfte ließen ihn bei jedem Schritt wanken, als er sich die Treppe heraufkämpfte, aber jede Hilfe ablehnte. Er brachte kaum einen Satz heraus, von einer Erklärung für seine lange Abwesenheit ganz zu schweigen, und er schlief so schnell ein, dass sie sich fragte, ob er sich schon im Traumzustand befunden, ob sein Körper allein dorthin zurückgefunden hatte, wo er längst hingehört hätte. Sie erkannte, dass der Mann – abgesehen von der Erwähnung seiner Jagd nach jenem mysteriösen Tier, das sie noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte, dem er jedoch schon vor Jahren mit seinem Vater nachgestellt hatte, ein gemeinschaftliches Abenteuer der beiden – die Geheimnisse seiner Nächte für sich zu behalten gedachte. Was sie stärker verärgert hätte, wenn sie nicht selbst ein Geheimnis hüten würde.
Nicht dass sie es so wollte. Sie konnte sich kaum erinnern, je etwas vor George geheim gehalten zu haben, und die Bürde ihres Schweigens lastete so schwer auf ihr, dass sie manchmal kaum Luft bekam.
»Wie war euer Kränzchen?«, fragte George, ohne von seinem Teller aufzusehen.
»So ermüdend wie zuletzt immer. Katrina ist nach dem Tee aufgebrochen, und ich habe mich ihr angeschlossen. Sie reden nur davon, wer heimgekehrt ist, oder über Gerüchte darüber, wer heimkehren könnte, und ich ertrage es einfach nicht mehr. Sie behandeln die Entlassung ihrer Jungs mit derselben Selbstgefälligkeit wie einen Sieg beim Hearts. Deshalb habe ich ganz aufgehört, das Spiel mitzuspielen. Dass sie gewinnen, ist schön und gut, aber die Möglichkeit, dass ich verliere …«
»Man muss mit Würde verlieren, Isabelle«, sagte George zwischen zwei Bissen.
»Nicht in diesem Fall.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Für mich ist Hearts nicht anders als jeder andere Wettkampf.«
»Vielleicht rede ich gar nicht von Hearts.«
Daraufhin zuckte er nur mit den Achseln, als hätte er kein Wort von dem verstanden, was sie gesagt hatte. Als sie merkte, dass er wieder ganz in seine Gedanken vertieft war, wandte sie sich zum Fenster und betrachtete den Pfad, der in Richtung Hauptstraße führte. Sie hatte keinen grünen Daumen, doch das hatte sie nicht davon abgehalten, die gedrungenen, unscheinbaren Sträucher zu pflanzen, die den Weg säumten. Seitlich des Pfads stand die alte Scheune, in der sich noch immer die landwirtschaftlichen Geräte befanden, die Georges Vater dort gelagert hatte und für die George selbst sich nur wenig interessierte. Dahinter war, verborgen vor fremden Blicken, die – momentan leere – Wäscheleine aufgespannt wie eine schlichte weiße Linie im Morgentau. Dies war der Ort, an dem ihr Geheimnis geboren worden war, und schon beim Gedanken daran schoss ihr das Blut in die Wangen.
Sie ließ die Gabel auf den Teller fallen.
»Mir gefällt das alles nicht, George«, sagte sie. »Ganz und gar nicht. Wie soll ich es sagen … Ich glaube, wir sind nicht ehrlich zueinander. Du verschwindest zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. Lässt mich die Pfannkuchen verbrennen und sagst kein Wort dazu.«
Er blickte von seinem Essen auf und legte die Gabel ebenfalls auf den Teller.
»Na ja. Es war ja offensichtlich, dass du sie zu spät gewendet hast.«
Sie schüttelte trotzig den Kopf.
»Das ist eine Geschmackssache, was überhaupt nichts zur Sache tut. Egal ob du mir sagst, warum du so spät noch unterwegs warst oder nicht – ich kann die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, nicht länger für mich behalten.«
Er wollte etwas erwidern, doch sie räusperte sich und setzte leise, fast flüsternd, zu einer Erklärung an.
»Am Morgen nach dem Regen habe ich unsere Kleider zum Trocknen auf die Leine gehängt, und am selben Abend versuchte ein Mann, deine Socken zu stehlen.«
»Hast du meineSocken gesagt?«
»Hab ich. Die grauen, die ich für dich gestrickt habe.«
Endlich hatte sie die volle Aufmerksamkeit ihres Mannes. »Wer würde so etwas tun?«
Sie erzählte weiter. Wie sie vor Sonnenuntergang hinausgegangen war, um die Kleider zu holen; das Gefühl hatte, dass da noch jemand war; zunächst dachte, es sei George, weil sie seinen Duft wahrnehmen konnte, doch dass es nur der Geruch seiner Kleider war.
»Ich hätte fast aufgeschrien, aber als ich sah, dass er weit mehr Angst hatte als ich, empfand ich noch etwas anderes. Mitgefühl, denke ich.«
»Und das war gestern?«
»Es gab noch einen anderen Vorfall«, sagte sie, und diesmal war sie es, die auf ihren Teller starrte, ihm nicht in die Augen sehen konnte. »Ich hätte es dir sofort sagen sollen. Der Mann hatte sich hinter der Scheune versteckt. Als er hervorkam und fliehen wollte, sind sich unsere Blicke begegnet. Er war groß. Ein Schwarzer …«
Als sie aufsah, verriet sein Gesichtsausdruck nichts als milde Neugier. Trotz seines gelassenen Äußeren war er immer für ein wenig Klatsch zu haben – für den skandalösen ebenso wie für den bizarren –, und dass ihre Geschichte ihn nicht mehr fesselte, erschütterte sie fast.
»Und er wirkte vollkommen verloren. Nicht nur im buchstäblichen Sinne. Es lässt sich kaum beschreiben. Ich konnte sehen, dass er meiner Gegenwart weit lieber entkommen wäre, als ich mir gewünscht hätte, und so schnell, wie er gekommen war, verschwand er auch wieder.«
Einen Teil ihrer Gefühle behielt sie für sich. Vor allem, welch pures Hochgefühl die erste Begegnung mit dem Mann in ihr ausgelöst hatte. Sie konnte die wenigen Momente, in denen etwas halbwegs Aufregendes in ihrem Erwachsenenleben passiert war, an einer Hand abzählen, und dieser Moment gehörte ganz sicher zu den eindringlichsten. In jenem Augenblick hatte sie nichts als Angst verspürt, doch empfand sie diese nicht etwa als Bedrohung, sondern als unerwartetes Geschenk. An dem Abend der ersten Begegnung dachte sie im Bett neben George liegend daran, und auch am nächsten Morgen ging sie ihr nicht aus dem Kopf. Das Bild dieses Mannes: der herabhängende Unterkiefer, der an die offen stehende unterste Schublade einer Kommode erinnerte, die linkisch hochgezogenen breiten Schultern.
Sie redete sich ein, er könnte gefährlich sein; dass ihre Gedanken völlig zu Recht immerzu um seine mögliche Rückkehr kreisten, wenn man bedachte, was er in Zukunft anstellen könnte. Und so war nichts Seltsames daran, wie oft sie zur Wäscheleine hinüberschaute, wenn George auf der Terrasse ein Nickerchen machte oder durch den Wald streifte. Doch blieb der Schatten des Eindringlings am Abend aus, verspürte sie nicht etwa Erleichterung, sondern Enttäuschung. Was nur dazu führte, dass sie das Grundstück noch genauer im Auge behielt und auf seine Rückkehr wartete, so als könnte das Geheimnis, das ihn umgab, auch einen verborgenen Teil von ihr offenbaren. Wenn er doch bloß wiederkäme, um es zu enthüllen.
Als er zwei Tage später zurückkehrte, als hätte ihr Wunsch ihn heraufbeschworen, war dies ein Schock, etwas, von dem sie angenommen hatte, es würde nur in ihrer Vorstellung geschehen. Sie sah ihn, bevor er sie sah, weil er in seinem eigenen Schatten verschwunden war, seine Bewegungen so bedächtig wie die eines Kleinkinds, das seine ersten Schritte wagte. Sie beobachtete ihn aus der sicheren Umgebung des Hauses, in dem Wissen, dass sie jederzeit George herbeirufen konnte, der aus seinem Arbeitszimmer herunterkommen würde, um sich der Sache anzunehmen. Doch ehe sie sich’s versah, ging sie zur Hintertür, drehte den Türknauf und stand auf der Terrasse, von wo aus sie zusah, wie der Mann wieder die Kleider auf der Wäscheleine inspizierte.
Es gab nur wenig, das ihr Angst machte. Einmal, als Kind, hatte ihr Bruder Silas versucht, sie mit Gruselgeschichten zu erschrecken, als sich das Mondlicht in ihr gemeinsames Zimmer stahl und seine bleichen Tentakel die Dunkelheit durchdrangen. Es waren Geschichten, die Silas ihr auf Geheiß ihres Vaters nicht erzählen durfte, die nur für die Männer der Familie bestimmt waren und später einmal an Silas’ eigene Jungs weitergegeben werden sollten. Auf dem Höhepunkt seiner Geschichte voller Gewalt und Tod hatte sie so abgeklärt, mit so scharfsinniger Skepsis reagiert, die sich in ihrem Schweigen manifestierte, dass Silas ins Stottern geriet und verstummte. Es war nicht das letzte Mal gewesen, dass ein Junge ihren Mut auf die Probe gestellt hatte, und sie würde sich auch von diesem Mann an der Scheune nicht einschüchtern lassen, der es irgendwie geschafft hatte, sie schon einmal zu verunsichern.
Sie raffte ihr Kleid hoch und lief durch den Wiesenhafer so schnell auf ihn zu, dass er kaum Zeit hatte zu reagieren. Das Erste, was sie wahrnahm, als sie neben ihm stand, waren die dreckverkrusteten schwarzen Fingernägel. Er griff nach der Wäscheleine und nahm eine von Georges Socken, dann die andere und drehte sich schließlich zu ihr um. Isabelle wusste nicht, was sie sagen sollte. Er lief nicht davon. Regte sich nicht einmal. In seinen Augen war kaum etwas zu lesen, und er umklammerte die Socken, als wären sie sein einziger Besitz; etwas, das er gerade erobert hatte und für immer behalten würde.
»Darf ich fragen, was Sie da machen?«
Er sagte nichts.
»Wo kommen Sie her?«
Es lag etwas Frustrierendes in der Beschaffenheit seines Mundes, immerzu geöffnet, aber bar jeden Wortes.
»Sagen Sie doch was«, flehte sie. »Sie müssen.«
Doch während der Anlass seines ersten Auftauchens nicht klar war, hatte sein jetziger Besuch einen so offensichtlichen Beweggrund, dass er keiner Erklärung bedurfte. Seine Kleidung war noch immer feucht vom Regenguss in der Nacht zuvor, seine Lederschuhe dunkel vor Nässe und so ramponiert, dass sie aussahen, als hätte man sie in einen Brennofen gelegt und die verkohlten Überreste zu diesen Dingern neu zusammengesetzt. Sicherlich gab es für einen Mann in diesem Zustand nichts Verlockenderes als ein trockenes Paar Socken.
Sie ließ den Saum ihres Kleides auf die Haferhalme hinabfallen.
»Ich verstehe. Sie müssen in das Gewitter geraten sein.«
Die Erklärung war so naheliegend, dass Isabelle eine Welle der Scham überkam, und jetzt fragte sie sich, wie sie in eine so würdelose Lage hatte geraten können, mit diesem Mann allein zu sein. Sie erinnerte sich an eine Zeit, in der ihr Leben den Nähten eines gut geschnürten Korsetts geglichen hatte – ihr Ehemann und ihr Sohn die miteinander verflochtenen Bänder, die ihr aktives gesellschaftliches Leben zusammenhielten, jene Beziehungen, die sie seit ihrer Heirat und dem Umzug nach Old Ox gepflegt hatte. Doch im Verlauf des letzten Jahres, seit Caleb in den Krieg gezogen war, hatte sich das Korsett gelöst, und sie fühlte sich nackt vor diesem Fremden; desillusioniert nicht etwa von seinem Schweigen, sondern von ihren eigenen idiotischen Erwartungen an ihn.
»Bitte«, sagte sie. »Gehen Sie ruhig. Sie dürfen sie behalten. Ich habe nichts dagegen.«
Er blinzelte einmal, blickte auf die Socken und machte sich daran, sie zurück auf die Leine zu hängen – als würden sie bei genauerer Betrachtung seinen Ansprüchen nicht genügen.
»Haben Sie mich nicht gehört?«, fragte sie. »Ich sagte, Sie sollen sie mitnehmen.«
Er stand still, betrachtete sein Werk mit einer gewissen Zufriedenheit und machte gelassen kehrt, um zum Wald zurückzuspazieren, ohne auch nur einmal in ihre Richtung zu sehen.
»Wo wollen Sie denn hin?«, rief sie ihm nach. »Es könnte wieder regnen. Kommen Sie doch zurück. Sie fangen sich noch was ein. Warum hören Sie nicht?«
Er trottete weiter, und seine Schultern bewegten sich bei jedem Schritt hin und her, bis er wieder in der Dunkelheit verschwand und sich zwischen den Bäumen verlor. Ungehört und ungesehen blieb Isabelle noch einige Minuten dort stehen, reglos bis auf ihr Kleid, das vom Wind angehoben wurde. Neben ihr wippte die Wäscheleine. Sie kämpfte noch immer gegen die Scham an, als sie ins Haus zurückkehrte.
Jetzt, beim Frühstück mit George, erwähnte sie von all dem nur, was der Mann getan hatte, sein Schweigen und seinen abrupten Aufbruch. »Ich hab ihn verscheucht«, sagte sie schließlich, während sie die Teller vom Tisch räumte. »Er war wie der Blitz verschwunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er wiederkommt. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, aber ich dachte, es ist besser, wenn du Bescheid weißt.« Sie eilte in die Küche und wünschte sich, dass er etwas sagte, irgendetwas, das ihr erlauben würde, die Erinnerung hinter sich zu lassen.
»Ich glaube, ich habe den Mann schon getroffen«, sagte George und wischte sich mit der Serviette den Mund ab. »Du sagst, er hat nicht gesprochen.«
»Nicht ein Wort.«
»Dann ja. Und soweit ich es beurteilen kann, ist er vollkommen harmlos. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben.«
»Gut. Dann habe ich auch keine.«
Es gab Fragen. Es gab immer Fragen. Doch ihr war egal, ob George dem Mann tatsächlich begegnet war und unter welchen Umständen, denn seine Nonchalance wirkte sofort wie ein Balsam. Wie mühelos er die Vergangenheit hinter sich ließ, wie er die Sorgen abmilderte, die sie plagten. Auch wenn es ihm oft an Wärme mangelte, so wurde dies durch seine Fähigkeit, sie zuverlässig in den sicheren Hafen zu geleiten, wenn sie in unruhige Gewässer geraten war, um ein Vielfaches wettgemacht. Niemand war verlässlicher als er, und wenn das nicht der Gipfel des Mitgefühls war, dann wusste sie nicht, was sonst.
»Ich bin froh, dass ich es erzählt habe«, sagte sie, »einfach, damit ich es jetzt dabei bewenden lassen kann.«
Ihr Mann jedoch sah unverändert aus, so als hätte er ihre Schuldgefühle auf sich genommen. Es zeigte sich in seiner Hohlwangigkeit, den gebeugten Schultern. Erst jetzt, in dieser Sekunde, erkannte sie den Schmerz, den er mit sich herumschleppte. Als er sich ihr zuwandte, lag in seinem Blick solch eine Qual, solch eine Erschöpfung, dass sie einen schwächeren Mann wohl überwältigt hätte.
»Da ist auch noch etwas, das ich mit dir besprechen muss. Und es tut mir leid, dass ich gestern nichts gesagt habe, aber da wusste ich nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß es noch immer nicht. Isabelle …« Dann geriet er ins Stocken.
Dieser Tonfall. Sie war nicht ganz sicher, wann sie ihn zuletzt gehört hatte. Vielleicht, als er mit einer fast schon tragischen Schüchternheit bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hatte, ohne zu ahnen, dass sie in der Kutsche direkt vor ihnen saß; oder Jahre später, als er den Kopf zur Schlafzimmertür hineinsteckte und die Hebamme fragte, ob Caleb endlich geboren sei, so als wären dessen Schreie nicht Hinweis genug. Sie begriff, dass es nicht Distanziertheit war, die sie an diesem Morgen an ihm wahrgenommen hatte, sondern Nervosität. Und noch bevor er ein weiteres Wort sagte, wusste sie, dass sie ihm nicht verzeihen würde, was er ihr verheimlicht hatte – was auch immer es war. Sie verspürte den Drang wegzurennen, doch ihre Füße bewegten sich nicht vom Fleck. Als er schließlich den Mund wieder schloss, war der Teller in ihrer Hand in der Morgenluft getrocknet – es gelang ihr, ihn abzustellen, als wäre es besser, dass ihre Tränen auf den Boden fielen, statt etwas zu beflecken, das sie gerade gereinigt hatte.
KAPITEL 3
Prentiss nahm die Füße seines Bruders auf den Schoß und knetete jeden einzelnen von Landrys Zehen. Dann die Fußsohle, dann die Ferse. Er grub seine Daumen so tief in den linken Fuß hinein, dass der ganz weiß wurde, bis mit dem Blut die Farbe zurückkehrte. Landry lag, den Kopf auf einen Baumstamm gebettet, auf dem weichen Waldboden. Er starrte in den Himmel.
»Immer versuchst du, mich auszutricksen, was?«, sagte Prentiss.
Landry ächzte, aber es klang mehr nach Freude als allem anderen.
»Hast den Rest vom Kaninchen gegessen, als wär’s sonst abgehauen. Als wär ich zu blöd, das zu merken.« Er erreichte die Furche des Fußes, und Landry senkte den Blick, als wolle er die Technik seines Bruders ergründen, bevor er sich wieder der aufgehenden Sonne zuwandte. »Nur, wir haben sonst nichts mehr zu essen. Du hast dir vielleicht die paar Reste geschnappt, aber wir werden es nicht bis zum Abend schaffen, wenn wir nichts fangen.«
Landry blieb stumm, eine Sache, die für diesen Mann nichts mit Sprechen zu tun hatte, sondern eher mit den Sinnen, mit der Art, wie er existierte. Auf Fußmassagen reagierte er immer so. Prentiss spürte dann, wie sich der Körper seines Bruders so sehr verlangsamte, dass er beinahe einschlief, wie seine Atmung aussetzte, seine Schultern erschlafften – und das war ein Vorbild dafür, wie man etwas genoss, wie man ganz im Fühlen aufging.
Die Tradition stammte noch aus der Zeit ihrer Kindheit in den Hütten der Plantage, damals, als Landry noch gewesen war. Damals saßen sie einander auf ihren Pritschen gegenüber, und noch lange nachdem ihre Mutter die Talgkerze gelöscht hatte, bearbeitete der eine die Füße des anderen und bereitete sie für den Tag auf dem Feld vor. Prentiss erinnerte sich, wie Mr Morton einmal dem besten Arbeiter ein Paar Handschuhe in Aussicht gestellt hatte. Allen war klar, dass es sich um ein leeres Versprechen handelte, aber es zeigte, wie wenig er über sie wusste – die Hände waren durch das mühevolle Pflücken schnell abgehärtet, während Füße, egal, wie gut man sie schützte, immer einen Weg fanden zu schmerzen, von all den Stunden, die sie einen kaputten Körper tragen mussten.
Sie hatten gemeinsam auf Mr Mortons Land gearbeitet; sie hatten das einzige Leben hinter sich gelassen, das sie je gekannt hatten; und sie dachten oft im Einklang, wie ein einziger Kopf. Und so überraschte es Prentiss nicht, dass sein Bruder, als er selbst aufstand, bereits auf den Beinen war, obwohl keiner von ihnen ein Wort gesagt hatte.
Landry griff nach dem Seil, mit dem sie das Kaninchen gefangen hatten, doch Prentiss legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Schluss damit. Wird Zeit, dass wir uns ins Lager aufmachen, zu unseren Leuten.«
Sein Bruder betrachtete den Schlafplatz, den sie sich eingerichtet hatten.
»Nicht für immer«, versicherte Prentiss ihm. »Wir besorgen uns was zu essen und sind vor Sonnenuntergang zurück.«
Es gab Orte und Klänge, die Landry beruhigten, aber allem, was außerhalb des ihm Vertrauten lag, begegnete er mit Widerwillen. Noch eine Woche zuvor hatte das auch für diesen Wald gegolten. Als sie davorstanden, hinter sich die Hütten, die immer ihr Zuhause gewesen waren, vor sich das Unbekannte, ihre wenigen Besitztümer auf den Rücken gebunden, sahen sich die Brüder mit einem stillen, brütenden Mysterium konfrontiert. Ein einzelner Schritt nach vorne wurde für Landry zu etwas Unmöglichem. Seine Füße waren wie festgewachsen, und er schüttelte den Kopf, bis er schließlich, nachdem Prentiss ihn bestimmt eine Stunde lang angefleht hatte, aus eigenen Stücken voranschritt, als habe dieser Gang einer ganz bestimmten Menge an Mut bedurft, die er in genau diesem Augenblick angesammelt hatte.
Prentiss befürchtete, beim Gang ins Lager könnte es genauso sein. Er achtete darauf, dass sie Majesty’s Palace weit hinter sich gelassen hatten, bevor sie auf die Straße traten. Er wollte seinen ehemaligen Herrn und diejenigen nicht sehen, die sich entschieden hatten, bei ihm zu bleiben.
War das wirklich erst eine Woche her? Wie seltsam jener Morgen gewesen war. Sie hatten gehört, dass Soldaten der Union vorrückten, Gerüchte, wie sie seit Jahren von Hütte zu Hütte geflüstert wurden, schon seit der Krieg begonnen hatte. Die Idee wahrer Emanzipation war ihnen immer so fantastisch erschienen, dass Prentiss, sollte es dazu kommen, mit Trompetenstößen und im Gleichschritt marschierenden Truppen gerechnet hatte, die in Majesty’s Palace einfallen würden wie Engel, gekommen, um den Willen Gottes persönlich umzusetzen. Tatsächlich waren nur ein paar junge Männer aufgetaucht, in blauen Uniformen so dürftig wie die Kleider, die Prentiss und Landry selbst trugen. Sie kamen den Weg entlang und riefen sie aus ihren Hütten, dicht gefolgt von Master Morton, der in seinem Schlafanzug auf eine Weise bloßgestellt war, wie Prentiss es noch nie gesehen hatte. Morton flehte die Soldaten um Verständnis an und behauptete, seine Sklaven wollten in seiner Obhut bleiben, doch die jungen Männer ignorierten ihn und verkündeten, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Knechtschaft nunmehr frei sei und gehen dürfe, wohin er oder sie wolle.
Master Morton sagte, sie seien hoffnungslose Kreaturen, und beschwor die Soldaten erneut, das doch zu erkennen, obwohl allen klar war, dass er selbst der hoffnungslose Fall war und sich schlimmer aufführte als ein Kind, das man von seiner Mutter getrennt hatte. Trotzdem bewegte sich zunächst niemand vom Fleck. Prentiss war es, der von der Schwelle seiner Hütte trat und auf einen der Soldaten zuging, einen weißen Mann mit jungenhaftem Gesicht, der vielleicht sogar noch jünger war als er selbst und dem diese Farm offensichtlich genauso wenig bedeutete wie die nächste, wo er, wie Prentiss vermutete, schon bald genauso monoton dieselbe Botschaft verkünden würde.
»Wann dürfen wir gehen?«, fragte er den Mann so leise, dass Morton es nicht hören konnte, denn was, wenn das Ganze eine Falle war und wenn denjenigen eine Bestrafung erwartete, der es auch nur wagte, danach zu fragen?
Kostbarere Worte, als sie der Junge nun sagte, hatte er noch nie gehört.
»Wann immer Sie wollen, denke ich.«
Ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, fuhr Prentiss herum und blickte Landry an, denn jetzt konnte ihr Leben beginnen, und es wurde Zeit, es auf die Weise anzugehen, die sie für richtig hielten. Landrys zitterndes Kinn und sein Nicken verrieten ihm, dass sein Bruder es ganz genauso sah.
In den Wald hineinzugehen war eine Expedition für sich gewesen, und nun ließen sie mit ihm auch seine Geräusche zurück, bis sie in der Stille verschwanden; vereinzelt tauchten Kutschen vor ihnen auf, die sie rasch passierten. Sie gingen ohne Eile, Schritt für Schritt, und Erde füllte die ungeflickten Löcher in ihren Schuhsohlen. Jedes Haus, an dem sie vorbeikamen, war ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger beeindruckend als Majesty’s Palace, doch alle waren sie bemerkenswert, alle waren weiß.
»Meinst du, das könnte dir gefallen?«, fragte Prentiss, doch Landry hielt den Blick auf die Straße gerichtet. Die Veranda des Hauses vor ihnen war geräumig genug, um darauf eine größere Feier zu veranstalten. Kleine, blaue Büsche hatten vor jeder der Säulen ausreichend Platz.
»Mir auch nicht, genausowenig wie die anderen«, sagte Prentiss. »Was soll man mit so viel Platz? Wie soll man jemandem erklären, dass man sich in seinem eigenen Haus verlaufen hat? Das sag mir mal.«
Die Frage hatte er sich schon zuvor gestellt, doch weil er nie zuvor andere Häuser als Majesty’s Palace und die der Nachbarn gesehen hatte, hatte er nicht gewusst, dass der krankhafte Überfluss, unter dem sein ehemaliger Besitzer litt, offensichtlich die gesamte Stadt befallen hatte.
Sie hatten nichts bei sich. Ihnen begegneten mehr Ochsen als Menschen, und doch fühlten sie sich bei jedem Schritt beobachtet, wie so viele ihrer Bewegungen in der Vergangenheit beobachtet worden waren. Je weiter sie kamen, desto wirklicher fühlte es sich an – jeder Schritt eine Bestätigung ihrer Freiheit.
»Guck uns an«, sagte Prentiss. »Weltenbummler. Reisende. Ist das nicht was?«
Er stupste seinen Bruder in die Rippen, doch als sie an das Schild kamen, auf dem der Name Old Ox geschrieben stand, halfen seine schönen Worte nicht mehr. Landry blieb so abrupt stehen, als wäre er gegen eine Mauer geprallt. Mit einem Mal umgab sie ein Wirrwarr aus Geräuschen und Anblicken – die maulenden Rinder in unsichtbaren Ställen, das Geschrei jammernder Kinder, ein Mann, der seinen Kautabak einfach so von der Veranda spuckte. Prentiss nahm all das auf einmal wahr, ganz so, wie es sein Bruder tun mochte, und wusste, was für ein Kampf ihnen bevorstand.
»Es ist nur ein Schritt wie jeder andere«, sagte er.
Landry sah ihn mit ernster Miene an, als stünde seine Entscheidung fest.
»Gut«, sagte Prentiss. »Na dann.«
Er würde seinen Bruder nicht zwingen, in die Stadt zu gehen, genauso wenig, wie er ihn gezwungen hatte, in den Wald zu gehen. Ein so großer Teil ihres Lebens war ihnen von anderen Männern aufgezwungen worden, dass es sich richtig anfühlte, jede Entscheidung wertzuschätzen – als die ganz eigene.
»Ich frag dich eins. Warum durch die Stadt gehen, wenn man auch drum herumgehen kann? Würdest du dir die Frage nicht auch stellen?«
Landry blickte ihn erneut an. Er schaukelte leicht, machte sich bereit. Die Spitzen seiner Schuhe hoben sich vom Boden, um sich auf einen erträglichen Kompromiss vorzubereiten, und das war alles, was Prentiss brauchte, um weiterzugehen, um zu wissen, dass sein Bruder an seiner Seite sein würde.
Die Stadt schmiegte sich an den Wald, was es einfach machte, sie zu umgehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen – nicht dass jemand ihnen überhaupt Beachtung schenken wollte. Sie hielten sich an die Rückseiten der Gebäude. Hinter einem Zaun erspähten sie einen so großen dampfenden, blubbernden Kessel voller Schweineteile, dass darin problemlos ein Mann ein Bad hätte nehmen können, hätte er das gewollt. Aus dem Haus drangen Stimmen von, wie Prentiss vermutete, hungrigen Männern. In einem anderen Garten stand eine Frau und säuberte mit einer Bürste die Armlehnen eines Gartenstuhls. Sie fuhr so sorgfältig darüber, als würde sie dem Stuhl einen frischen Anstrich verpassen. Danach sah Prentiss nicht mehr hin. Seine Kleider waren feucht vom Schweiß, und ihm fiel auf, wie schnell er ging, als könnte etwas, das sie verfolgte, ihre Fährte aufnehmen. Nie zuvor hatte er solche Menschen ohne Erlaubnis angesehen, hatte er ganz normale Leute beobachtet, die im Privaten ihren Beschäftigungen nachgingen, und es erschien ihm gleich wie eine gefährliche Situation.
»Nicht mehr lang«, sagte er, auch wenn er gar nicht wusste, ob das stimmte, denn die Gerüchte, dass sich das Lager auf der anderen Seite von Old Ox befand, waren für ihn tatsächlich nur Gerüchte. Seine Worte waren nicht so sehr an Landry gerichtet, sondern eher an ihn selbst, ein Fitzelchen Zuversicht, eine Angewohnheit aus einem Leben, in dem sein einziger Begleiter keine Worte, keine Sicherheit mit ihm zu teilen vermochte.
Prentiss hielt dem Bruder seine Schwächen nicht vor – in diesen Eigenarten gründete seine Stärke. Denn sein Bruder blieb zwar oft an Ort und Stelle stehen, doch er wanderte nie einfach davon. Landry ging dorthin, wo man ihn erwartete, und es war ein Zeichen von Tapferkeit, wenn jemand bereit war, entweder immer weiterzugehen oder sich seiner Angst zu stellen, ohne mit der Wimper zu zucken, auch wenn ihn das manchmal erstarren ließ. Dieses Prinzip war Landry von Geburt an eingeschrieben, genauso wie seine Liebe zum Essen, was den Tag der Abrechnung nur noch schwieriger gemacht hatte.
Das war damals, zu einer Zeit, als sie noch nicht erwachsen, aber auch keine Kinder mehr waren, noch mit schmaler Brust, aber langen Gliedern; jung genug, um von ihrer Mutter genauso getriezt zu werden wie vom Aufseher, aber alt genug, dass man von ihnen erwartete, die volle Tagesmenge zu pflücken. Eines Morgens stellten sie sich vor ihren Hütten auf, was für sich betrachtet nichts Ungewöhnliches war, denn sie stellten sich jeden Morgen zum Durchzählen da auf, wo sich die Abdrücke ihrer Füße in den Boden eingegraben hatten. Doch es dauerte nur einen Augenblick, bis klar war, dass vor der gegenüberliegenden Hütte etwas fehlte. Wo Little James und Esther hätten stehen sollen, war nichts. Mit dieser Abweichung von der Routine ging ein stummer Schmerz einher, den Prentiss nie zuvor verspürt hatte. Sein Herz fühlte sich in seiner Brust riesengroß an. Er sollte starr nach vorne blicken, doch sein Instinkt veranlasste ihn, überall sonst hinzusehen, in der Hoffnung, sie könnten hinter einer Wäscheleine auftauchen oder von einer Weide herbeispringen, bevor Mr Cooley kam und ihr Fehlen bemerkte.
Mit einem Mal aber war Mr Cooley schon da. Er ließ sein Pferd vor ihrer Hütte anhalten, stieg jedoch nicht ab. Er nahm bloß seinen Hut vom Kopf, musterte jeden Einzelnen vor sich, und fragte geradeheraus, wohin die beiden gegangen seien. Niemand antwortete.
»Ihr bleibt, wo ihr seid«, sagte er, wendete sein Pferd und ritt im Galopp zu Majesty’s Palace zurück.
»Kein Wort von euch beiden«, hatte ihre Mutter geflüstert, während sie beiden eine Hand auf die Schulter legte und wie ein Schild zwischen ihnen stand.
Niemand wagte es, sich zu bewegen, als Mr Cooley zurückkam, mit Mr Morton an seiner Seite. Sie bauten sich vor der Gruppe auf, und Mr Morton strich sich schnaufend das Haar aus den Augen.
»Nicht mehr lang«, sagte er, »bis die Hitze mich packt. Und Mr Cooley kann euch erzählen, dass die Hitze mir noch nie gutgetan hat.«
»Das stimmt«, sagte Mr Cooley.
»Warum, glaubt ihr, bin ich nicht hier unten im Feld? Meint ihr, ich würde ein bisschen Gesellschaft nicht genießen? Nein, passt auf, ich bin einfach von Natur aus ein heißblütiger Mann, und ich will verdammt noch mal nicht noch heißer werden, als ich’s eh schon wär. Wenn mich die Sonne erwischt, wird mir schwindlig. Das macht mein Magen nicht mit.«
»Kann man wohl sagen.«
»Mr Cooley.« Mr Morton brachte ihn mit ausgestrecktem Arm zum Schweigen. »Also sagt mir, bevor ich die Hitze im Nacken spüre, wo die beiden hin sind, sonst könnte ich ein bisschen schlechte Laune kriegen, und wenn man mir so früh den Tag versaut, denke ich mir, weil ihr ja so mitfühlende Wesen seid, würdet ihr meine Not mit mir teilen.«
Als keine Antwort kam, fuhr Mr Morton mit seiner Ansprache fort. Ohne Little James und Esther, sagte er, würde er Produktionseinbußen erleiden, die noch zu den Ausfällen hinzukamen, die der Verlust der zwei Sklaven selbst darstellte. Und warum sollte er, ein Mann, der nichts Unrechtes getan habe, ein frommer, rechtschaffener Mann, für den rücksichtslosen Ungehorsam dieser zwei Individuen bestraft werden, die er doch immer so gewissenhaft mit Essen und Kleidung versorgt hatte? Und somit würde er, falls ihm niemand zu verraten bereit sei, wo Little James und Esther zu finden seien, einen Sklaven auswählen – und dieser Sklave würde am Ende jeden Monats die Peitschenhiebe für sie alle abbekommen. Jedes Vergehen würde bestraft werden, und er würde sämtliche Hiebe auf sich nehmen müssen, und falls jemand bereit sei, zum Märtyrer zu werden und diese Verantwortung zu übernehmen, brauche er sich bloß zu melden.
»Kommt schon«, sagte er, von einem zum anderen blickend. »Einer reicht.«
Landry trat nicht vor. Er fasste sich bloß an den Arm, um sich zu kratzen. Prentiss war sich später nie ganz sicher, ob Landry bewusst war, was er getan hatte. Er erinnerte sich bloß, dass der Blick seines Bruders auf einen Schwarm Fliegen vor ihrer Hütte fixiert war, seine Gedanken sonst wo, wie so oft.
»Das ist mein Mann!«, sagte Mr Morton, was sogar Mr Cooley überraschte, der zwar ein ebenso dummer, aber nur halb so grausamer Zuchtmeister war.
Prentiss wagte es nicht, seine um Gnade flehende Mutter anzusehen, oder Landry, und er würde für alle Zeiten mit der Schuld leben müssen, nicht selbst vorgetreten zu sein, um den einzigen Menschen zu retten, den zu beschützen er auf der Welt war.
Jeden Monat überwachte Mr Morton die Peitschenhiebe, als handele es sich um ein Fest – Landry bekam sie, wenn Mrs Etty verschlafen hatte oder wenn Lawson zu langsam arbeitete. Nach der Tracht Prügel, bei der Landrys Kiefer brach, dauerte es nur eine Saison, bis der Junge auch die wenigen Worte, die er hatte, nicht mehr benutzte. Ihre Mutter sagte, Landry sei einmal ganz gewesen, und dann halbiert, bis er unweigerlich aus so vielen Teilen bestand, dass sie den Jungen nicht mehr zusammensetzen konnte, den sie einmal ihren Sohn genannt hatte.
Die einzige Gnade, die Mr Morton Landry gewährte, bestand darin, es ihm nicht übel zu nehmen, wenn er auf sein Rufen hin nicht antwortete. »Ich verstehe das nicht als Zeichen von mangelndem Respekt«, sagte Mr Morton dann, laut genug, dass die anderen es hörten. »Manchmal wünschte ich, die anderen hätten eine ähnliche Vorliebe fürs Schweigen wie du, Landry. Wirklich. Das tu ich.«
Das letzte Vergnügen, das ihnen blieb, bestand in der verlassenen Hütte. Sie verhöhnte Mr Morton, wann immer er sie besuchte, weil sie die Demütigung seines Verlustes für alle sichtbar machte. Bei jedem Peitschenhieb schien er zu glauben, Little James und Esther könnten zurückkehren, und es verschaffte Prentiss eine leise Befriedigung, sich vorzustellen, sie wären so weit weg, so voll und ganz verschwunden, dass sie Landrys Schreie niemals hören würden; dass sie niemals zurückkehren würden, um Mr Morton den Seelenfrieden zu bescheren, den er so verbissen anstrebte.
ab
Nachdem sie Old Ox hinter sich gelassen hatten, war das Lager leicht zu finden, man brauchte bloß den regungslosen Körpern zu folgen. Es wurden immer mehr, je weiter sie der Straße folgten, einige zugedeckt mit den breiten Blättern des Holzapfelbaums, die überall herumlagen, andere mit Abfall aus der Stadt – eine Ansammlung von Männern und Frauen, die sich nach lebenslanger Schufterei ausschliefen. Irgendwann zweigte eine provisorische Straße ab, ein sumpfiger Pfad, von vielen Füßen platt getreten. Für ein paar Meter wuchs dichter Schachtelhalm um sie herum. Doch dann, an dem Bach, der durch die Stadt floss, weitete sich der Pfad zu einer Fläche voller Zelte, und aus dem Nichts tauchten Menschen auf. Eine Stadt ohne Gebäude, ohne Schilder und ohne Namen.
»Das muss es sein«, sagte Prentiss.
Anfangs wurden sie kaum beachtet. Reihen von Zelten, meist nicht mehr als zusammengebundene Laken, standen nebeneinander. Kinder ohne Schuhe spielten zwischen den Bäumen, während ihre Eltern schliefen oder einander besuchten.
Als die Brüder weitergingen, fiel der Blick gramerfüllter Augen auf sie, doch nur kurz. Hier war keine Feindseligkeit zu spüren, eher eine kollektive Demut, die Prentiss von sich selbst kannte. Dies war ihr neues Leben. Die Arbeit ersetzt durch zielloses Herumsitzen oder das Betteln um Nahrung, wie ein Tier. Keines der Gesichter kam ihm bekannt vor. Prentiss überlegte, ob er ein paar Namen rufen sollte, doch er wollte keine Aufmerksamkeit erregen.
»Was habt ihr dabei?«, fragte eine Stimme aus einem Zelt neben ihnen.