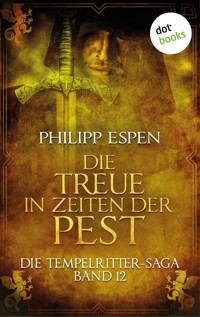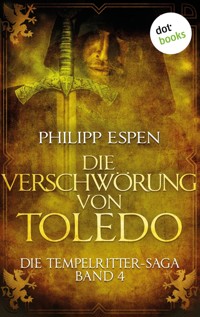Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
"'Lang sterbe der König!', sagte Henri. 'Und bald komme seine Beerdigung in der Abteikirche von St. Denis', fügte Joshua hinzu. 'Beim nächsten Mal gelingt es uns!' – 'Auge um Auge, Zahn um Zahn!'" Frankreich im Jahre 1314: Tod dem König! Der erste Anschlag auf Philipp den Schönen ist misslungen, doch die Flamme des Hasses lodert ungemindert weiter. Der schottische Tempelritter Henri de Roslin wagt mit seinen treuen Gefährten, dem Sarazenen Uthman und dem jüdischen Gelehrten Joshua ben Shimon, einen neuen Versuch, den niederträchtigen König zu töten. Doch dessen Truppen lauern überall – und statt auf sein anvisiertes Opfer trifft Henri plötzlich auf den fanatischen Generalinquisitor Guillaume Imbert … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich im Jahre 1314: Tod dem König! Der erste Anschlag auf Philipp den Schönen ist misslungen, doch die Flamme des Hasses lodert ungemindert weiter. Der schottische Tempelritter Henri de Roslin wagt mit seinen treuen Gefährten, dem Sarazenen Uthman und dem jüdischen Gelehrten Joshua ben Shimon, einen neuen Versuch, den niederträchtigen König zu töten. Doch dessen Truppen lauern überall – und statt auf sein anvisiertes Opfer trifft Henri plötzlich auf den fanatischen Generalinquisitor Guillaume Imbert …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Der in Dänemark geborene Philipp Espen ist ein ausgewiesener Kenner des Alltagslebens im europäischen Mittelalter. Er übersetzte unter anderem den »Polycraticus« des Johann von Salisbury ins Deutsche. Für die Tempelritter-Saga konnte er außerdem auf sein Expertenwissen zur englisch-schottischen Geschichte des Tempelritterordens zurückgreifen: Er erforschte für die Londoner Universität den ehemaligen Tempelbezirk in der City of London.
Philipp Espen lebt mit seiner Familie in England.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Philipp Espen bereits folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 4: Die Verschwörung von Toledo«
»Die Tempelritter-Saga – Band 6: Der Klostermord«
»Die Tempelritter-Saga – Band 12: Die Treue in Zeiten der Pest«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2003 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Andrey Kuzmin, artfirm und shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-779-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der König muss sterben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philipp Espen
Der König muss sterben
Die Tempelritter-Saga
Band 2
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Anfang April 1314, Passionszeit
Sie hatten sich den Hintern geküsst! Sie hatten in Sünde beieinander gelegen! Das Haupt Muhammads hatten sie angebetet!
Henri de Roslin schlug in Gedanken ein Kreuz und zügelte unwillkürlich sein Pferd. Die Anschuldigungen der Henker waren ungeheuerlich gewesen, aber man hatte ihnen geglaubt. Denn unter der Folter, den glühenden Zangen, den Streckbänken, den Keilen und Gewichten, den Daumenschrauben, hatten die Brüder schon vor dem Kirchenkonzil in Vienne, auf dem im Jahr 1311 der König zur Rechten des Papstes gesessen hatte, alles zugegeben. Und wenn sie später auch alles widerriefen, diese Geständnisse in Blut und Tränen entzündeten schließlich die Feuer in Paris, in denen sie elend verbrannten.
Henri roch noch immer den Rauch der Scheiterhaufen, den Geruch nach verkohltem Fleisch, und er hatte die Todesschreie der tapferen Brüder und das blutgierige Geschrei der Menge vor den düsteren Türmen des Castellums, des alten Palastes der römischen Imperatoren auf der Ile de la Cité, im Ohr.
Für einen Herzschlag schloss er die Augen, aber die Bilder und der Gestank, die Schreie blieben. Er hatte es nur ertragen können, weil er einen ganzen Tag lang inbrünstig in der Sainte Chapelle gebetet hatte. Diese heilige Kapelle allein mit ihrem drehbaren Reliquienschrein, in dem sich Dornen der Leidenskrone des Herrn Jesu befanden, war es, die ihm seinen Lebensmut zurückgegeben hatte. Bei ihrem Betreten glaubte er, zum Himmel emporgerissen zu werden, in einen der schönsten Räume des Paradieses einzutreten. Er hatte Stunden, auf dem Bauch liegend, das Gesicht auf den kalten Fliesen, zugebracht, das blaue und rote Licht bemerkte er nicht, das durch die mit biblischen Motiven und der Geschichte der Reliquien bemalten hohen Glasfenster auf ihn fiel. Aber er wusste auch so, dass er hier seinem himmlischen Herrn, der das Leid besiegt hatte, ganz nah war, in diesem Raum, der alles Materielle mit Geistigem, Göttlichem durchdrang. Er hatte den Trost gespürt, den diese Kapelle mit den schwerelosen, allem Irdischen entsagenden Gewölbebögen für ihn bereithielt. Er fühlte sich aufgenommen.
Dieses Gefühl des Trostes hatte ihn beflügelt und sicher durch den Mauerring dieser nun besudelten Insel geleitet, die Henri immer vorkam wie der Fußabdruck eines heidnischen Riesen im Wasser. Er ritt über die beiden hölzernen Doppelbrücken in den dicht bevölkerten Teil von Paris ein.
Es fiel Henri nicht auf, dass er in seinen aufgewühlten Gedanken so hart am Zaumzeug gerissen hatte, dass sein Pferd sich jetzt schnaubend und wiehernd im Kreis drehte. Henri de Roslin kam dadurch wieder zu sich. Er beruhigte den Hengst mit leisen Worten. Dann ritt er weiter.
Vor ihm lagen noch zweihundert Meilen. Es würde ein Ritt durch Feindesland werden.
Gerade passierte er, von der englischen Lehensherrschaft Bordeaux kommend, den Ort Cadillac im Tal der Garonne. Ihm fiel ein anderer, gegenwärtiger Geruch auf. Er kam von den ausgedehnten Lavendelfeldern und dem Gestrüpp des wilden Thymians, die bereits blühten. Heute war Herrentag, der Frühling hatte schon Einzug gehalten, und hier zeigte er sich schon in den bunten Teppichen der Gewürzfelder und Blumen. Aber der Pfad war schmal und unwegsam. Henri spürte trotz seiner festen Kleidung die Stiche der Dornen und musste sich oft mit dem kurzen Schwert Platz verschaffen. Er befürchtete, so oder ähnlich würde der gesamte Weg bis Avignon aussehen. Die Stadt der gewaltigen Burgen war noch weit.
Aber auf dem Weg dorthin hatte er noch ein anderes Ziel.
Er verhängte die Zügel, ließ seinem arabischen Hengst Barq jetzt freien Lauf und dirigierte ihn nur mit Schenkeldruck. Die letzten zwanzig Meilen von Bordeaux hinunter hatte er sich oft umgesehen oder im Schatten von Korkeichen und Olivenbäumen angehalten und zurückgelauscht. Waren sie hinter ihm her? Seit dem überstürzten Aufbruch aus der Bastide in Beaumont hatte er dieses Gefühl. Er wollte sich nicht noch einmal in trügerischer Sicherheit wiegen. Denn Bordeaux war zwar ein Lehen der englischen Krone, stand aber unter dem Druck des französischen Königs und damit seiner Schergen. Aber Henri war sich darüber im Klaren, dass sein Hass niemals versiegen würde, er würde alles, was er getan hatte, noch einmal versuchen! Es wurde ihm einmal mehr klar, dass sein Lebensweg seit dem Anblick des erbärmlichen Autodafés in Paris vorgezeichnet war.
Während er aufmerksam zurücksicherte, um seine Feinde rechtzeitig zu erkennen, spürte er auf seiner Brust das Siegel des Templerordens, seines Ordens der Armen Männer Christi und des Tempels Salomonis, so schwer und so mahnend, als würde es glühen. Es war eine goldene Münze, die er an einer Kette um den Hals trug. Er hatte sie angelegt, seit er wieder in Frankreich war. Im Morgenland hatte er die Münze seines dankbaren Gefährten Uthman getragen, dessen Vater er in Akkon das Leben gerettet hatte. Die Templermünze zeigte auf der Vorderseite den Tempel von Jerusalem mit einer Kuppel und dem krönenden Templerkreuz und auf der Rückseite ein Schlachtpferd, auf dem zwei bewaffnete Ritter saßen. Adeo pauperes erant ut unum tantum equum communem, musste er denken. Wir waren so arm, dass wir gemeinsam nur ein Reittier besaßen. Die Ankläger haben es nicht zu unseren Gunsten gelten lassen. Wir waren vom ritterlichen Ideal beseelt, den Schwachen beizustehen, treu zum christlichen Glauben zu halten und den Geist unseres Grals zu hüten. Und doch warfen sie uns in ihren Folterkellern eitlen Hochmut, Verblendung und Häresie vor.
Und jetzt sind sie dabei, die letzten noch lebenden Brüder zu vernichten.
Henri de Roslin schüttelte die unguten Gedanken ab, die ihn immer wieder überfielen. Er hatte ein klares Ziel vor Augen und verfolgte es. Er würde immer ein Tempelritter bleiben, auch wenn man es ihm jetzt nicht mehr ansah, denn er hatte das weiße Ornat mit dem blutroten, achteckigen Tatzenkreuz auf Brust und Rücken gegen den unauffälligen Tasselmantel eines Kaufmannes getauscht, darunter trug er ein schwarzes Oberkleid mit tiefem Halsausschnitt. Seinen Kopf mit den kurz geschnittenen, dunklen Haaren schmückte eine Bundhaube mit Haarbändern aus Stoff. Im Mantelsack führte er harmlose Dinge mit sich – einen Sommermantel, ein Laken, Unterzeug, Beinschienen und ein dickes Basttuch als Schlafunterlage. Nur das kurze, scharf geschliffene Schwert und der dünne Panzersteckdolch im Gürtel verrieten seine Wehrhaftigkeit.
Wenig später passierte er den Fluss. Er suchte eine flache Stelle und lenkte sein Ross durch die Strömung. Der Untergrund bestand aus erstaunlich weichem Sand und glatten Kieseln, aber das Pferd rutschte nicht aus. Am anderen Ufer warf es stolz seinen Kopf, und Henri unterließ es nicht, seine Kruppe zu streicheln. Während er weiterritt, überfielen ihn allmählich Hunger und Durst, denn es waren bereits sieben Stunden vergangen, seit er in der morgendlichen Dunkelheit aufgebrochen war. Aber er bezähmte sich. Zuerst musste er das Versteck finden. Und er würde die neu geprägten Bourgeoises und alten Goldmünzen mit dem Bild Philipps des Schönen darauf durch seine Finger laufen lassen, als könne die Glut seines Hasses sie einschmelzen.
Henri zog eine handgezeichnete Landkarte aus der Seitentasche und warf einen Blick darauf. Noch drei Meilen.
Die Templerkirche lag in der alten Commanderie des Ordens, er glaubte, sie stellte ein gutes Versteck dar. Denn würde man einen so bedeutenden Schatz ausgerechnet dort suchen, im Wehrturm dieser schlichten, mit einem löchrigen Strohdach bedeckten, jetzt stillgelegten Ordenskapelle? Henri hoffte, er täuschte sich nicht.
Er passierte endlos scheinende Wälder, dann kam Gironde in Sicht, die Türme des Städtchens in der Senke leuchteten in der Mittagssonne. Henri fiel jetzt trotz der Entfernung ein süßlicher Geruch auf. Er bemerkte einen Schwarm pechschwarzer Kolkraben, die sich auf etwas niederließen. Als er vorsichtig näher ritt, sah er, dass die Vögel auf schweren Wagenrädern hockten, die auf einer Stange in den Ackerboden gerammt waren. Und auf den mehrsprossigen Rädern befanden sich die Überreste von Hingerichteten. Rädern war die Strafe für Unbotmäßige. Was mochten die Unglückseligen getan haben? Henri wusste, dass in diesen gesetzlosen Tagen schon ein vager Verdacht ausreichte, um hingerichtet zu werden. Jedes Anschwärzen eines neidischen Nachbarn konnte Menschen und ihre Familien in einen Abgrund von Verhaftung, Folter und Tod reißen.
Voller Abscheu ließ er den Ort rechter Hand liegen und beschleunigte den trägen Trab seines Pferdes.
Kurz darauf kam der Kirchturm von La Reole in Sicht. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Sichernd beobachtete Henri de Roslin die Umgebung. Ringsherum Felder und Hügel, Waldstücke im Sonnenlicht, auf der Weide schon Ochsen und Schafe, den hohen, fast durchsichtigen Himmel durchmaßen fliegende Vogelschwärme, die irgendein Zeichen setzten. Henri blickte auf, verstand aber nicht, dieses Zeichen zu deuten.
Er ritt näher heran. Dann hielt er wieder. Umkreiste die ehemalige Commanderie einmal. Dann noch einmal. Er konnte nichts Verdächtiges entdecken.
Aber er wusste, die Feinde waren schlau, und sie lauerten überall. In der Bretagne, wohin er nach den ersten Hinrichtungen der Brüder vor einigen Jahren zuerst geflüchtet war, brachen sie während des Gottesdienstes sogar aus Altären und Chorräumen hervor – waffenklirrend, mit ihrem Geschrei die Würde des Ortes verletzend. Und hatten sie später, als er von der Bretagne nach Süden zog, nicht sogar Friedhöfe geschändet, um in den Besitz des Schatzes zu gelangen?
Sie waren plump, roh und menschenverachtend, diese angeblichen Verteidiger des allerchristlichsten Königs und seines Papstes, der ihn in der Kathedrale von Reims willfährig geküsst und gesalbt hatte. Henri schüttelte sich bei diesen Erinnerungen.
Vor seinen Augen blieb alles friedlich.
Er gab sich einen Ruck, schnalzte leise mit der Zunge und ritt in den Innenhof der kleinen, schmucklosen Kirche ein. Die Ruhe des sonnigen Nachmittags lastete über dem Ort. Er wollte gerade absteigen, als er etwas Verdächtiges bemerkte. In der Öffnung des spitz zulaufenden Turmes hatte etwas geblinkt.
Henri verharrte regungslos. Er flüsterte seinem Hengst beruhigende Worte zu, das Tier durfte jetzt keinen Laut von sich geben.
Henri de Roslin überlegte. Konnten sie dort oben auf ihn lauern? Möglich war alles. Sie wussten alles und erfuhren alles durch ihre überall willfährigen Spitzel. Selbst einfache Bauern und Tagelöhner standen inzwischen in ihren Diensten, auch wenn sie die Todeslisten, auf denen Henri de Roslin an der Spitze der Gesuchten stand, nicht lesen konnten. Warum sollten sie also nicht herausgefunden haben, dass hier jemand, der in einer herbstlichen Mondnacht vor vier Jahren von Norden gekommen war, einen Schatz versteckt hatte. Einen Schatz, an dem Blut klebte.
Kurz entschlossen sprang Henri vom Pferd. Er band die Zügel um einen Ast und ging auf die unverputzte, brüchige Vorderseite des Kirchengebäudes zu. Im Inneren empfing ihn schattige Kühle. Der bis auf einen einfachen Altar aus Holz leere Raum war mit Staub überzogen, an den Fensterhöhlen hatten Spinnen ihre Netzfallen gebaut und lauerten regungslos als schwarze Flecken auf Beute. Henri ging mit angespannten Sinnen in den Raum hinein. Er bemerkte nichts Auffälliges. Vor dem erbarmungswürdig vernachlässigten Altar sank er in die Knie, bekreuzigte sich und sprach sein Gebet. Es endete mit den Worten:
»Nicht uns, nicht uns, Herr, gib die Ehre, sondern deinem Namen!«
Danach blieb er noch einen Moment in seiner knienden Haltung und lauschte aufmerksam. Er stand auf und ging die wacklige Holztreppe hinauf, ein Geländer gab es nicht. Oben angekommen fiel ihm ein Sonnenstrahl ins Gesicht. Er schloss geblendet die Augen. Als er sie wieder öffnete, begriff er, woher das Blinken gekommen war. Eine Stimme sagte:
»Du kommst spät, Henri! Lässt man seine Freunde so lange warten?« Die kleine, hagere Gestalt neben dem Fenster rückte sich die schief sitzende Brille zurecht. Und Henri musste lachen. Ja, er war spät. Und Joshua ben Shimon war wie immer der Schnellere gewesen.
»Ich freue mich, Joshua, dass die Sonne im Brillenglas eines Freundes blinkt und nicht auf der Schwertschneide eines Feindes. Lass dich umarmen!«
Während sie sich begrüßten, sagte jemand mit schottischem Akzent im Hintergrund: »Und wer küsst mich?«
Henri war erfreut, auch den Knappen wohlauf zu sehen, den er bei dessen Mutter in Beaumont zurückgelassen hatte, denn sie hatten getrennt reiten müssen, um die Feinde zu täuschen. »Komm her, Sean of Ardchatten, auch du sollst nicht ohne Zuwendung bleiben, solange wir zu solchen Gunstbezeugungen als freie Männer noch fähig sind.«
So standen die drei männlichen Gestalten für einen Moment als ein Körper zusammengerückt im Schatten des Raumes, die Sonne deutete mit einem Zeigefinger aus Licht auf sie, und von unten her ertönte das Wiehern von Henris Reittier, in das zwei weitere Pferde von der Rückseite der Kirche her einfielen.
»Machen wir uns an die Arbeit«, schlug Henri vor.
Dem Juden war bei der überschwänglichen Begrüßung die gehörnte Kappe verrutscht, aber Henri bemerkte mit einem Seitenblick, dass er das Zeichen, einen Ring aus rotem Tuch, vorschriftsmäßig auf der linken Rockseite trug. Und der Knappe verstaute seine Querflöte.
Sie gingen in eine Kammer des Obergeschosses, in der früher der Schrank mit den Hostien und geweihten Geräten gestanden hatte. Die vier Bohlenbretter waren schnell gelockert. Darunter kam ein Hohlraum zum Vorschein, in dem vier eingewickelte längliche Kisten lagen. Sie lösten das graue Leinentuch, öffneten den Eisendeckel und starrten auf die Schätze.
»Mensch! Münzen! Gold! Silber!« Der Knappe wollte ungestüm zugreifen. Aber Henri hinderte ihn mit einer ruhigen Handbewegung daran.
»Warte! Es ist Mammon, nicht wert, den Verstand zu verlieren. Man kann es anschauen und für nützliche Dinge verwenden – das ist alles. Beherrsche dich.«
Sean war rot geworden. »Ich dachte nur, davon könnte ich meiner Guinivevre, die in Beaumont sehnsüchtig auf mich wartet, hundert hübsche Tücher mit Stickereien kaufen ...
»Es ist nicht ausgeschlossen«, erwiderte Henri, innerlich belustigt, »dass du auf irgendeinem Markt solche Tücher für dein Mädchen erstehen wirst. Aber nicht jetzt. Und nicht von diesem Geld. Es ist für andere Zwecke bestimmt.«
»Hier liegt es unberührt«, sagte Joshua heiter, »und der König sucht es mit seinen Hundertschaften immer noch verzweifelt auf Gisors.«
»Dort kann er suchen, bis ihm die Augen herausfallen. Auch in den benachbarten Tempeln von La Roche-Guyon und Chateau-Gaillard wird er nichts finden. Ich habe unseren Schatz schon vor Jahren von dort weggeschafft und über Verstecke im ganzen Land verteilt. Denn ich konnte mir ausrechnen, dass unsere Templerburg in das Visier Philipps und seiner Schergen fällt. Sie brauchen so dringend Geld für ihre Intrigen und Scharmützel gegen Fürsten und Fürstbischöfe, dass sie dumm werden.«
Sie zogen alle Kisten heraus. Sie waren sämtlich prall gefüllt mit Goldmünzen, aber auch mit silbernen Medaillons und schmalen Barren.
»Woher kommt das viele Geld?«, wollte Sean wissen.
»Das brauchst du nicht zu wissen. Achte nur darauf, dass du bei seinem Anblick nicht gierig wirst.«
»Kann ich es nicht trotzdem erfahren? Es hilft mir, es mit Abstand zu betrachten.«
Henri sah seinen Knappen an, dessen Blicke ohne Arg waren. »Nun. So viel kannst du immerhin wissen. Es stammt aus unserem Tempel in Paris, dort betrieben wir ein öffentliches Bankhaus.«
»Und das wirft so viel ab? Alle diese Schätze? Dann möchte ich auch ein Bankhaus eröffnen!«
»Sean of Ardchatten!«
»Verzeih, Joshua ben Shimon.«
Henri erklärte geduldig: »Viele Menschen überließen uns vertrauensvoll ihre Reichtümer, und nicht von ungefähr, denn wir arbeiteten korrekt. Es war alles legal, wir hatten sogar geregelte Kassenzeiten, die überall aushingen. Wir führten sechzig Privatkonten, die Mitgliedern des Hochadels, Kirchenfürsten, auch Würdenträgern unseres Ordens gehörten. Selbst der königliche Schatz lag dort.«
»Gab es solche Bankgeschäfte auch in anderen Stützpunkten deines Ordens, Meister Henri?«, staunte Sean. Da der alles entscheidende Tag näher rückte, war Henris Umgang mit Sean förmlicher geworden, dem Verhältnis von Meister und Lehrling angemessen. Dieses Mal bestand er auf Disziplin, wollte keine unnötigen Risiken mehr eingehen.
»Natürlich. In allen Komtureien. Wir benötigten ja Unsummen für die Befreiung des Heiligen Landes von den Ungläubigen. Und dafür war uns jede Münze willkommen.«
»Ich habe gehört, dass damals, als der König von Jerusalem – hieß er nicht Balduin? – euch Templern eine Unterkunft in der Nähe der Ruinen des salomonischen Tempels zur Verfügung stellte, ihr gewaltige Schätze entdecktet, unter anderem die Bundeslade der Israeliten?«
»Unsinn!« Joshua sah den Jungen scharf an.
»Ich war damals beim ersten Kreuzzug nicht dabei, mein Junge«, sagte Henri milde.
»Und woher weißt du das alles, worüber du sprichst, Meister?«
Henri sagte: »Ich war nach dem Ende der Kreuzzüge für den Geldhandel des Ordens zuständig.«
»Für alles Geld des gesamten Ordens?!«
»Ja. Ich verwaltete die Konten, stellte die Wechsel aus und bestimmte die Ausgaben für den Schutz der Pilgerstraßen vor Räubern und Plünderern, die es überall gab.«
Bewundernd blickte ihn Sean an. Joshua bemerkte diesen Blick des ihm anvertrauten Knappen und wurde plötzlich streitlustig. »Die Templer waren die einzigen Christen, die bisher jemals Geld gegen Zinsen verliehen haben, Junge. Ihre Zinsen waren niedriger als die der halsabschneiderischen lombardischen Bankiers, deshalb machten sie gute Geschäfte – jeder kam zu ihnen. Nur den Juden hat man das vorgeworfen!«
»Das gehört nicht hierher, Joshua.«
»Doch! Ihr habt Hypotheken gewährt, um Pilgern die Möglichkeit zu bieten, ihre Bittfahrten ins Heilige Land zu bezahlen. Ihr habt den Wechselbrief erfunden, das nenne ich den finanziellen Ablass der Sünden. Ihr habt Konten geführt für die Allerreichsten im Land, für Fürsten und Edelleute ...«
»Das sagte ich schon!«
»... und hohe Posten als Finanzberater bekleidet. In euren Gewölben bewahrtet ihr die Schätze der Adeligen, unter ihnen auch die Schatztruhen und Kronjuwelen der Könige. Ihr habt Geldtransporte und Werttransporte begleitet, Steuern eingezogen, mit der Erlaubnis der Kirche den Zehnten kassiert. Ihr selber bezahltet jedoch keine Steuern.«
»Das ist gewiss wahr, Joshua. Einige unserer Brüder sind wohlhabend geworden, und das war nicht recht. Aber wir haben auch die Straßen von Gesindel gesäubert und unseren Reichtum dazu verwendet, den Armen und Kranken zu helfen. Fragt einmal in den Tempeln nach, wie viele bedeutende Almosen wir gaben!«
»Bist du damit vor deinem Gott im Reinen, Henri?«
»Was meinst du?«
»War es nicht nur ein Vorwand, Reichtum für gottesfürchtige Zwecke anzuhäufen? Seid ihr nicht tatsächlich der Eitelkeit des Geldes erlegen?«
»Wenn es so war, dann strafe uns Gott!«
»Ihr seid schon gestraft. Hältst du die Geschehnisse dieser Jahre nicht für eine Antwort Gottes, die dir zu denken geben muss?« Joshua klang erbittert, vielleicht mit Recht. Doch trotz aller Kritik wusste Henri, dass der Gefährte treu an seiner Seite stand.
Henri schwieg einen Moment, sichtlich erschüttert. Dann sagte er schnell zu Joshua: »Nimm, was du für deine Aufgaben benötigst, jetzt brauchen wir nicht mehr Buch zu führen und abzurechnen. Dieses Geld ist nur noch dazu da, unsere Rachepläne auszuführen. Es ist genug da, ein paar Millionen Pfund Tournosen. Und wenn es aufgebraucht ist, ist hoffentlich auch unser Zorn aufgebraucht.«
Joshua sagte: »Uns Juden hat Geld immer viel bedeutet, weil nur sein Besitz uns vor Verfolgung schützte. Aber ich bin offenbar kein guter Jude, denn mir bedeutet Geld nichts. Ich verachte es. Es hat schon zu viel Unglück gebracht.«
»Ich weiß, Gelehrten sind tiefe Gedanken wichtiger. Aber du weißt, Gedanken können nicht töten. Und wir brauchen dringend gute Waffen.«
»Gedanken können nicht töten? Mein lieber Freund! Gedanken sind oft tödlicher als jede Waffe! Denke an die ersten lauten Überlegungen des Papstes auf dem schändlichen Konzil von Vienne! Das waren Todesurteile! Die Waffen in den Händen der Schergen führten später nur aus, was die Gedanken angerichtet hatten.«
»Schon gut! Ich weiß! Lasst uns jetzt nicht darüber streiten. Wir teilen das Geld und verschwinden wieder. Ihr wisst jetzt, wo sich der Schatz befindet. Wenn ihr etwas davon benötigt, holt es euch. Es ist für uns alle da.«
Den Rest der Arbeit verrichteten sie stumm. Auch Sean bekam eine Handvoll Silbermünzen in den Beutel gesteckt, damit er sich auch dann durchschlagen konnte, wenn er allein war. Joshua ben Shimon nahm nur das Nötigste, in seinem Gesicht war der Abscheu deutlich zu lesen. Dann murmelte er: »Der Herr, unser Gott, gelobt sei er, besitzt sieben Namen, die wir nicht nennen dürfen, Mammon ist darunter nicht.«
»Schon gut«, sagte Henri, während er aufteilte. »Auch unsere Regel, die uns der heilige Zisterzienserbruder Bernhard verlieh, sieht Armut, Keuschheit und Gehorsam vor. Findet man nach dem Tod eines Tempelbruders Gold oder Silber unter seinem Besitz, wird sein Leichnam in ungeweihter Erde begraben, und ist er schon bestattet, dann gräbt man ihn wieder aus.«
»Wie schrecklich«, entfuhr es Sean. »Ich hörte außerdem davon, dass euer Keuschheitsgelübde sogar den Kuss einer Mutter verbietet!«
Henri gab zur Antwort: »Wir dürfen ohne die Erlaubnis unserer Meister keinen Sack oder Kasten verschließen, nicht baden, uns nicht zur Ader lassen oder einen Brief eines Verwandten öffnen, und jeder Ungehorsam hat den Verlust des Gewandes und die Einkerkerung in Ketten zur Folge. Wenn dich diese Dinge erschrecken, Knappe, wirst du nie ein Templer werden können. Das weißt du doch längst!«
Sie verwischten die Spuren, streuten Staub über die losen Bretter und verließen die Empore rückwärts gehend. Sean stieß mit seinem Schnabelschuh das Gerippe einer verendeten Ratte auf das Versteck. Unten angekommen bekreuzigten sich Henri und Sean vor dem Altar, Joshua verneigte sich und murmelte etwas. Dann verließen sie gemeinsam die Kapelle.
Sie holten ihre Pferde und stellten sich noch einmal in einem kleinen Kreis zusammen. Als sie sich die Hände auf die Schultern legten, erneuerten sie ihren Bund fürs Leben. Seit dem Attentat auf Philipp den Schönen am Königshof von Fontainebleau taten sie es zum ersten Mal wieder.
»Lang sterbe der König!«, sagte Henri.
»Und bald komme seine Beerdigung in der Abteikirche von St. Denis«, fügte Joshua hinzu.
»Beim nächsten Mal gelingt es uns!«
»Auge um Auge, Zahn um Zahn!«
Sean wollte etwas sagen, verschluckte es aber.
Joshua und Sean ritten gemeinsam nach Süden weiter, wo Sean in einer ehemaligen Komturei Lektionen erhalten sollte. Henri machte sich nach Osten auf den Weg. Sie sahen sich nicht mehr um. Wichtig war nicht, was hinter ihnen, sondern was vor ihnen lag. Und je weniger sie von ihren unmittelbaren Absichten wussten, desto weniger konnten sie unter der Folter verraten.
Ihre Gestalten waren auf den Höhen der in dieser Gegend abgeholzten Hügel noch lange zu sehen. Aber bevor die Schatten des Nachmittags länger wurden, hatten sich die Gefährten aus den Augen verloren.
Henri de Roslin war es willkommen, allein zu sein. Sein ernstes Gemüt neigte ohnehin nicht zur oberflächlichen Unterhaltung, wenn ihn auch der schwärmerische Gesang des Knappen oder sein Spiel auf Schwögel, seiner Flöte, seine Guinivevre hatte sie ihm geschenkt, schon oft angenehm angerührt hatte. Und Joshua wusste so viel vom Leben und dem Universum, welches sich über die Erdenscheibe spannte, und er konnte so anregend davon erzählen, dass Henri seine Gesellschaft über alles schätzte.
Aber jetzt sollte es still um ihn sein. Er brauchte alle seine Gedanken für sich allein. Denn er musste einen weiteren Attentatsplan schmieden. Und dieser durfte nicht scheitern.
Wieder kam er durch dicht bewachsene, urwaldähnliche Gebiete, und der Weg war noch schmaler als ein Ochsenkarren. Unter den mächtigen Korkeichen und Olivenbäumen blühten und dufteten Thymianstauden und Rosmarinsträucher des aufbrechenden Frühlings. Die Natur und das Leben können schön und leicht sein, dachte Henri. Wenn nur der Mensch nicht wäre.
Die erste und die kommende Nacht verbrachte er im Freien, den Pferdesattel unter seinem Kopf. In der dritten Nacht wagte er es, eine Unterkunft zu suchen. Er fand eine abseits des Weges gelegene Priorei und genoss das karge Gemeinschaftsmahl mit den Gebetsbrüdern.
In der vierten Nacht fand er einen Schlafplatz im Portal einer Gemeindekirche, in der schon ein Kaufmann mit seinen beiden Knechten lag. Auch die Pferde hatten in dem schlichten, aber sauberen Vorraum Platz. Der Kaufmann aus Nimes war am Vorabend überfallen worden und warnte Henri vor provencalischen Räubern, die die Wege unsicher machten.
Henri hatte keine Angst um seinen Schatz. Er trug ihn in flachen Beuteln am Körper, das Metall hüllte ihn anstelle des Kettenhemdes, das er früher getragen hatte, wie eine Rüstung ein und verlieh ihm das Gefühl, in einen Kampf besonderer Art zu ziehen.
Am fünften Tag kam er durch eine heideartige Landschaft. In der Ferne türmten sich die Felsen eines Gebirgszuges auf, der Causses de Limoges hieß. Henris Aufmerksamkeit hatte durch den eintönigen Ritt nachgelassen, die Sonne brannte an diesem Frühlingstag beinahe sommerlich heiß vom wolkenlosen Himmel herunter, und der Staub der Straße schmerzte in seinen Augen. Er bemerkte die Rauchwolken nicht, die voraus aus einer unübersichtlichen, mit hohen Schlehenbüschen bestandenen Senke aufstiegen. Als er auf die flache, sandige Anhöhe hinaufritt, die sich in Richtung der Rauchwolken erstreckte, brachen hinter ihm plötzlich aus dem Unterholz mehrere waffenschwingende Gesellen zu Pferde hervor.
Henri riss, unsanft aufgeschreckt, sein kurzes Schwert aus dem Gürtel und streckte es in Richtung der Herankommenden. Er sagte laut mit seiner durchdringenden Baritonstimme: »Wer seid Ihr? Was wollt Ihr?«
Die Männer zügelten ihre wild schnaubenden Pferde dicht vor ihm. Sie trugen farbige Waffenröcke, die aber zerschlissen und schmutzig waren, die Wappen waren nicht zu erkennen. Ein Anführer mit einer wilden Mähne unter dem Lederhelm führte sein tänzelndes Reittier nahe heran. Henri bemerkte schaudernd, dass seine Nasenspitze abgeschnitten und die Wunde von wulstigem Narbengewebe entstellt war.
»Wir sind die Rächer aller verloren gegangenen Schlachten, hahaha! Und wer seid Ihr, wenn man hochlöblich fragen darf? Eurem merkwürdigen Tonfall nach müsst Ihr aus dem Norden kommen.«
»Aus Schottland, wenn Ihr mit diesem Namen etwas anzufangen wisst. Aber im Moment komme ich aus Bordeaux, das uns schützt, und reise nach dem französischen Avignon.«
»Das glaube ich kaum.«
»Was meint Ihr?«
»Eure Reise ist genau hier zu Ende. Wir beenden sie. Das meine ich.«
Henri lachte leise. »Und wie wollt Ihr das bewerkstelligen?«
Das freche Grinsen im entstellten, bärtigen Gesicht des Gesellen verstärkte sich. »Ihr seid allein, wir zu neunt. So bewerkstelligen wir das. Ist dieses Schwertchen da etwa Eure einzige Waffe, äh?«
Henri dirigierte sein Pferd mit einem schnellen Schenkeldruck neben den anderen. Er nahm das Kurzschwert in die Linke, zog blitzschnell den Panzersteckdolch aus dem Gürtel und setzte ihm die Klinge an den Hals. »Aber du wirst nicht mehr dabei sein, wenn es an das Verteilen meiner Kleidung und des Pferdes geht, denn mehr besitze ich nicht.«
Der Anführer erklärte erschreckt: »Vermeiden wir Blutvergießen! Ihr seid wohl Kaufmann und führt irgendwas mit Euch. Gebt uns ein Passiergeld, und wir reiten weiter.«
Henri sagte entschieden: »Ich besitze nur, was ich auf dem Leib trage. Aber ein paar Centimes kann ich euch geben, als Almosen, damit ihr eure Gesichter in Ordnung bringt.«
Der Mann leckte sich unschlüssig die Lippen. Ein listiges Funkeln trat in seine Augen. »Wieviel denn, äh?«
»Neun kleine Münzen. Das reicht für die ganze Bande.«
Henri sah, wie der Bandit rechnete. Zwar konnten die Wegelagerer, wenn sie alles daransetzten, auch den Rest mühelos erbeuten, aber Henri sah es dem Wortführer an, dass er feige war und an seinem erbärmlichen Leben hing.
Der Mann wendete sein Pferd, hatte aber offenbar kein Bedürfnis, die Lage mit seinen Kumpanen zu besprechen. Er drehte sich wieder zu Henri de Roslin um und sagte schlau lächelnd: »Wir sind friedfertige Leute, wenn man uns friedfertig kommt. Aber ihr müsst verstehen, die Zeiten sind schlecht. Da klopft man schon mal um Almosen an. Neun Centimes, äh? Also her damit!«
Henri blieb gewarnt. Er steckte den Dolch in den Gürtel, griff in seinen Mantel und zog eine Handvoll Kupfermünzen heraus, die er für solche Situationen dort verstaut hatte. Er zählte neun Kupfermünzen in die Hand und übergab sie dem anderen, peinlich darauf achtend, sich den Rücken freizuhalten. Dies war nicht einfach, denn die Pferde waren unruhig und tänzelten.
Als der Bandit das Geld in seinen Händen fühlte, schien er sofort befriedet zu sein. Er hob zwei Finger an den rissigen Lederhelm, eine trostlose Geste ehemaligen militärischen Schneids, wendete sein Reittier jäh und preschte an der Spitze seiner Männer in einer Staubwolke davon.
Henri sagte zu sich selbst: Die bin ich noch nicht los! Solche Kerle vergessen nicht die kleinste Niederlage.
Er ritt weiter, so schnell das den immer wieder einsinkenden Hufen seines Pferdes auf dem jetzt tiefen, sandigen Untergrund möglich war. Die Rauchwolken, die aus einem Ort im Tal kamen, der aber unsichtbar blieb, verwehten hinter ihm. Und bald ritt er wieder über flaches, oft auch morastiges Land mit einem heideartigen Charakter, das einen Rundumblick gewährte. Dahinter wurde die Straße besser.
Am Abend sah Henri Wölfe am Horizont und hörte in der folgenden Nacht, die er ohne Lagerfeuer verbrachte, ihr Heulen. Im Wald knackte es, und etwas schlich herum, näherte sich jedoch nicht.
Henri war auf der Hut, hielt sein nicht abgehalftertes Pferd neben sich und schlief nicht in dieser Nacht.
Im Morgengrauen, als er schon erleichtert aufatmen wollte, waren die Wegelagerer plötzlich wieder da.
Diesmal stellten sie es geschickter an. Ehe Henri sich versah, standen die Banditen, bewaffnet mit Dolchen und Piken, im Kreis um ihn herum. An Flucht war nicht zu denken.
»Aufstehen! Wir würden gern auch den Rest der Münzen haben! Das versteht Ihr doch sicher?«
Henri überschlug seine Möglichkeiten. Er hoffte, sie waren wirklich nur an Bargeld interessiert. Aber sie sahen aus wie skrupellose Mörder.
Die Männer kamen noch näher. Unheimliche Gestalten im Morgengrauen, die zu allem fähig sein mochten.
Henri de Roslin war kein Krieger, den Krieg hatte er nur in Akkon erlebt, aber er wusste sehr wohl mit Hinterhalten und Banden umzugehen. Er war darin geschult, abzuwarten, wie sich die Dinge zuspitzten. Jetzt hielt er es jedoch für ratsamer, die Flucht nach vorn anzutreten. Er ging furchtlos auf den Anführer zu und sagte ihm ins Gesicht: »Nun passt einmal auf! Mit Kerlen wie euch bin ich schon fertig geworden, die gibt es nämlich auch in Schottland wie Ungeziefer. Wenn ihr versucht, eure Waffen zu gebrauchen, werde ich euch töten!«
Seine Worte ließen den Banditen unsicher werden. Er dachte wohl, dass sich so entschieden kein Mann verhalten konnte, der nicht einen Trick in der Hinterhand besaß.
Henri hielt dem Anführer auf der flachen Hand einen Lederbeutel mit wenigen Münzen hin. Dieser blickte ihm noch immer misstrauisch entgegen, als wittere er hinter seiner Bereitschaft eine Arglist. Dann sagte er: »Wo steckt übrigens Euer wertvolles Schwert? Gebt es mir!«
Henri versuchte, Zeit zu gewinnen. Er wollte schon zu einer Entgegnung ansetzen. Im gleichen Moment sah er, wie sich am Waldrand ein Schatten mit etwas Länglichem in den Händen auf sie zu bewegte. Er begriff zunächst nicht, was da vor sich ging, es geschah alles zu schnell. Eine kräftige Gestalt sprang von hinten an den Anführer heran. Er schlug ihm den Helm vom Kopf, riss seinen Hals nach hinten und setzte ihm ein Messer an die Kehle.
»Die kleinste Bewegung, du Unmensch, und ich zeige dir, was ein Templer vermag!«
Die Begleiter des Banditen schrien durcheinander, hoben die Waffen und rückten näher. Offenbar trauten sie sich aber nicht, einzugreifen, denn der Angreifer machte ein wild entschlossenes Gesicht.
Henri war der Mann fremd, er begriff, dass es an ihm war, das Entscheidende zu tun. Er herrschte den Anführer der Rotte an: »Sag deinen Männern, sie sollen die Waffen hinlegen und sich zurückziehen!«
»Mach schon!«, brüllte der Ankömmling, dessen Stimme einen fremden Akzent besaß.
Der Bandit blieb stumm, schnaufte nur in sich hinein, als bekäme er keine Luft mehr.
Henri wiederholte seinen Befehl. Als die Meute sich nicht rührte, befahl er: »Dann schneide ihm die Kehle durch!«
Jetzt krächzte der Bandit: »Tut, was er sagt. Für den Moment bleibt uns keine Wahl.« Dann spuckte er Blut. Offenbar hatte der Angreifer tiefer geritzt, als es ausgesehen hatte.
Die Männer beeilten sich jetzt, zu tun, was ihr Anführer ihnen geheißen hatte. Sie zogen sich langsam zurück.
In diesem Moment, als habe sie bis dahin abgewartet, ging die Sonne auf.
Einer murrte: »Und was wird aus unserem Haufenführer?«
»Er bleibt bei uns. Wenn ihr noch einmal in unsere Nähe kommt, stirbt er.«
Henri wunderte sich nicht über seine innere Kälte, er hatte solche Situationen schon oft erlebt. Er wusste in diesem Moment, es würde ihm nichts ausmachen, den Banditen zu töten. Er würde es nicht dem anderen zumuten, sondern es selbst tun.
Zögernd ließen die Wegelagerer ihre Waffen fallen und stolperten rückwärts davon. Schnell hatte der Wald sie verschluckt.
Der Fremde stellte sich vor. »Gottfried von Wettin, Ritter aus Regensburg in teutschen Landen, seit einiger Zeit in der schönen Stadt Avignon.«
»Seit Ihr wirklich Templer?«
Der andere nickte. »Es ist mein eigentliches Geheimnis. Nur im Kampf vergesse ich es manchmal. Aber nach außen hin lebe ich als Mönch des Dominikanerordens.«
Henri gab sich ebenfalls zu erkennen. Sie zeigten sich ihre Ordensembleme und waren hocherfreut, einen Gleichgesinnten in der Nähe zu wissen. Henri vermied es aber, den Wettiner in seine Pläne einzuweihen – man konnte nie wissen. Aber hier, auf dem Lehensboden der englischen Krone, wo die Verfolgung der Templer nur zögernd verlief, war es möglich, freier zu sprechen. Der Bandit wurde gebunden und bäuchlings über Henris Pferd gelegt.
Die beiden Männer hatten das Bedürfnis, den Ort schnell zu verlassen. Und als die wärmende Morgensonne durch die Zweige der Ulmen schien, die den Platz des Überfalls umstanden, ritten sie nebeneinander auf schnaubenden Pferden davon.
*
Am Abend waren sie an einem Fluss namens Cergú. Er lag auf dem vierundvierzigsten Breitengrad, wie der Wettiner wusste. »Übrigens genau wie Avignon, wo ich als Mönch des Dominikanerkonvents tätig bin«, erklärte der Templer, der sich mit Astronomie auskannte und Henri unterwegs schon von seltsamen Sternbildern erzählt hatte, die kamen und gingen.
»Wie könnt Ihr nach all den schlimmen Ereignissen noch Dominikaner sein, Gottfried? Die Mönche jagen uns unbarmherzig«, sagte Henri traurig.
»Ich bin es mit Seelenqualen, das glaubt mir. Denn in Deutschland wurde unser Orden genauso verboten wie in Frankreich und anderswo ...«
»... England, Schottland, Aragonien, Kastilien, Portugal, Neapel.«
»Ja. Und ich hasse den Großinquisitor von Paris, Guillaume Imbert, der unseren Brüdern so übel mitgespielt hat, genau wie Ihr. Aber ich glaube nun einmal inbrünstig und brauche die Brüder im Glauben um mich. Viele Dominikaner sind übrigens wunderbare Menschen.«
Der Fluss war breit und besaß eine kräftige Strömung, aber sein Kieselbett stellte sich als so flach heraus, dass sie ihn mühelos überqueren konnten.
Der gefesselte Bandit schrie hin und wieder nach Wasser. Aber Henri hielt an und stopfte ihm das Maul mit einem Knebel und einem abgerissenen Stück Leinenlumpen. Dann ritten sie weiter.
Der Deutsche sprach nicht viel. Aber nachdem Henri sich bei ihm bedankt hatte, erzählte er: »Ich ritt schon einen ganzen Tag hinter Euch her, Bruder. Ohne Arg oder Absicht übrigens, denn ich will nach Millau und werde Euch dort auch wieder verlassen. In dieser Stadt versteckt sich ein Präzeptor vor der päpstlichen Kommission. Es ist Jean de Chalon, gewiss kennt Ihr ihn.«
»Aber ja! War er nicht zur Zeit der großen Verhaftungen Leiter des Templerhauses von Namur?«
»Derselbe. Ich kenne ihn aus Trier, woher ich komme.«
»Und was wollt Ihr von ihm?«
»Er ist mit dreißig anderen französischen Brüdern seit Jahren auf der Flucht. Sie wurden aufgegriffen, den Untersuchungskommissionen vorgeführt, gefoltert und konnten wieder fliehen. Man sagt, dass der Schatz des Visitators von Frankreich, Hugues de Pairaud, in seinem Besitz ist.«
»Das müsste ich wissen, denn ich war Schatzmeister unseres Ordens und Trésorier des Pariser Tempels.«
Der Wettiner zügelte überrascht sein Pferd. »Jetzt verstehe ich! Ihr seid Henri de Roslin!«
»Ja.«
Der Wettiner streckte ihm sprachlos die Hand hin. Henri bemerkte einen gerührten Schimmer in seinen hellen Augen. Sie ritten eine Weile stumm weiter.
Die Landschaft wurde in dem Maße immer öder, wie die Hitze zunahm. Der Weg führte an schon grünen Bäumen vorbei endlos geradeaus durch die immergleichen braunen Felder, die offensichtlich von den Bauern nicht bearbeitet wurden. Dann mussten sie wieder einmal eine trostlose Heidelandschaft durchqueren.
Bei Arvieu kamen sie an einen ausgedehnten Lac. Der See war umgeben von baumlosen Wiesen, sie konnten also, ohne einen Überfall zu befürchten, am Ufer lagern.
Sie wuschen sich ausgiebig. Die Pferde soffen das klare Wasser. Jetzt bekam auch der Bandit einen Schluck. Obwohl die Gegend freundlich wirkte, waren die beiden Männer angespannt.
Sie berieten sich.
»Was soll mit dem Räuber werden?«, wollte der Wettiner wissen. »Wenn du ihn weiter mitschleppen willst, isst er nur deinen Proviant weg, außerdem müssen wir seinen Gestank ertragen.«
»Ich behalte ihn als Geisel. So haben wir zumindest eine kleine Gewähr, nicht überfallen zu werden. Wir müssen aber ständig auf ihn aufpassen. Ich lasse ihn erst kurz vor Avignon frei«, entschied Henri.
»Was habt Ihr übrigens vor in Avignon?« Der Wettiner stellte diese Frage mit unschuldiger Miene, aber Henri beschloss dennoch, ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Einem Mann, der in der Gemeinschaft der Dominikaner lebte, konnte er sich nicht rückhaltlos anvertrauen.
»Ich muss es für mich behalten«, antwortete er deshalb, nicht glücklich darüber.
An diesem Abend suchte Henri den Gefangenen auf, kontrollierte seine Fesseln und nahm ihm den Mundknebel ab. Der Bandit ächzte und mahlte mit den verkrampften Backenmuskeln. »Wenn du das Maul hältst«, sagte Henri, »erspare ich dir den Knebel. Aber wehe, ich höre ein einziges Wort!«
Der Bandit starrte ihn nur hasserfüllt an und wandte sich ab.
Eine ruhige Zeit folgte. Das Wetter blieb gleichmäßig warm, der Himmel war klar und hoch. Nur einmal fielen ein paar Tropfen. Henri fühlte sich an seine Heimat Midlothian erinnert, wo die Tiefe des Himmelsblaus ihn immer an die Augen einer frühen Geliebten erinnert hatte. Er hatte sie als Jüngling verehrt, bevor er zum mönchischen Tempelritter geworden war. Es war lange her, und Henri seufzte unwillkürlich.
Die Sonnenuntergänge blieben purpurn und rot.
Die Wegelagerer ließen sich nicht blicken. Aber in den Augen ihres Anführers stand manchmal ein so triumphierendes Glitzern, dass Henri Verdacht schöpfte. Was mochten die elenden Gesellen im Sinn haben? Längst wachten er und der Wettiner nachts abwechselnd, bemerkten jedoch nichts Verdächtiges.
Am nächsten Tag erreichten sie Montiaux, eine Stadt an einem Fluss namens Claire, von hier war es nur noch ein Tagesritt bis Millau. Montiaux besaß eine gewaltige Basilika. Hierher pilgerten viele Wallfahrer zu einer Grotte am Ortsrand, und so fiel ihr kleiner Tross trotz des gefesselten Banditen nicht weiter auf.
Henri erfuhr in einem Stall, wo für ihre Pferde gesorgt wurde, dass Avignon noch sieben Tagesreisen entfernt war. Das war viel mehr, als er angenommen hatte, weil es ein Gebirge namens Causse de Sauveterre zu überqueren galt. Dort sollte es wilde Tiere, auch Bären, geben. Und Räuberbanden.
Henri kaufte bei einem Waffenhändler am Markt einen sarazenischen Streitkolben und ein langes Brotmesser, die er sich in den Gürtel steckte. Dazu eine neue Satteldecke und für seinen täglichen Bedarf einen Napf, einen flachen Kochkessel und ein verschließbares Kupferetui. Er fragte den Händler, ob man das Gebirge umgehen könne.
Der Mann antwortete: »Ja, über die Ebene bei Richaux, wenn Ihr fünf Tage Umweg in Kauf nehmen wollt.«
Die beiden Gefährten berieten sich und kamen zu dem Schluss, sich schon hier zu trennen. Henri wollte trotz der möglichen Gefahren durch den Causse reisen, der Wettiner auf geradem Weg nach Millau. In einem Waldstück hinter der Stadt verabschiedeten sie sich.
»Gott mit dir auf allen Wegen, Wettiner!«, sagte Henri und umarmte den Deutschen. »Sicher sehen wir uns bald in Avignon wieder!«
Gottfried legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: »Gott stehe Euch bei!« Dann verschwand er.
Henri hatte auch ein Packtier erstanden, über dessen Sattel er den Banditen legte. Am nächsten Abend erreichte er den Fuß des Causse und lagerte an einem Steilhang, der mit Steinbrocken übersät war. Ein Weg war nicht auszumachen. Der Gefangene bedeutete ihm, dass er einen Weg kenne.
»Wir waren mit den Kumpanen vor Jahren in dieser Gegend«, erklärte er missmutig. »Es ist ein Weg, der hoch hinaufführt. Aber er ist geräumt und passierbar. Und die Bären halten sich eher in den Tälern auf.«
»Warum erzählst du mir so bereitwillig davon?«
»Ich will, dass wir Euer verdammtes Avignon erreichen, damit ich freikomme.«
Henri glaubte dem verschlagenen Kerl nicht. Aber wenn er einen Weg kannte, sollte es ihm recht sein.
Bei Sonnenaufgang ging es los. Unruhig tänzelnd setzten sich die beiden Pferde in Bewegung. Entgegen den Angaben des Banditen war der Weg zunächst steinig. Sie verloren so viel Zeit mit dem Wegräumen von Felsbrocken, dass Henri ernsthaft überlegte, ob sie nicht doch den Weg durch das Tal nehmen sollten. Aber dann verschwanden die Hindernisse, der Weg war matschig, aber eben, dafür nahm ein eiskalter Wind zu. Das musste der Mistral sein, von dem Joshua ben Shimon ihm schon erzählt hatte. In dieser Gegend war der Wald verschwunden, die Höhen boten keinen Wetterschutz.
»Sie haben Schiffe gebaut, um über die Flüsse am südlichen Abhang des Causse de Sauveterre das Südmeer zu erreichen«, wusste der Bandit.
»Das Mare Magnum? Wer sind sie, und was wollten sie dort?«, fragte Henri erstaunt.
Noch mehr erstaunte ihn die Antwort des Wegelagerers. »Es sind Provencalen. Sie haben Sklaven aus dem Osten, die sie nach Sizilien in die Bergwerke verkaufen.«
»Täuschst du dich nicht? Es gibt keine Sklaverei in Frankreich mehr.«
»Hahaha! – Wo kommt Ihr her, mein hoher Herr Tempelritter? Aus dem Wolkenkuckucksheim? Ich selbst war noch vor zehn Jahren ein Sklave meiner Herrschaft in Clermont! Kennt Ihr das massif central? Dort machen die Herren Jagd auf jeden, der frei herumläuft. Und verhökern ihn spornstreichs auf die südlichen Inseln.«
»Wie bist du freigekommen?«
»Geflohen. Wollt Ihr sehen, was mich das gekostet hat?« Er zog das linke Hosenbein mit den Zähnen hoch, und Henri erblickte rote, schorfige Haut vom Knie bis zum Knöchel. »Sie haben mich mit flüssigem Pech verbrannt. Ich bin wieder abgehauen.«
Henri dachte: So entstehen Banditen. Wäre er ein Johanniter gewesen, hätte er jetzt womöglich mehr Mitleid mit den Wunden des Mannes aufgebracht. Aber er verfolgte den Gedanken nicht weiter. Er hatte andere Ziele. Und der Causse nahm seine Aufmerksamkeit in Anspruch.
Die Felsen rechts und links des Weges wirkten weiterhin feindselig. Sie boten einen idealen Unterschlupf für marodierende Horden, die sich vor dem Gesetz zu verstecken hatten. Aber gab es das überhaupt noch, das Gesetz? Und wer übte es aus?
In höchster Wachsamkeit ritt er weiter, immer wieder nach allen Seiten sichernd. Dass die Gegend so übersichtlich erschien, erleichterte sein Gefühl, sich gut getarnt vorwärts zu bewegen. Aber am zweiten Tag im Gebirge stellte es sich als entsetzliche Täuschung heraus.
Hinter einer Wegbiegung, in einer Verengung der Felsen zu beiden Seiten, brach plötzlich ein braunes Ungetüm aus einer Felshöhle. Erst nach einem Augenblick des Erschreckens begriff Henri, dass es sich um einen Bären handelte. Es war ein so riesiges Tier, wie sie es noch nie gesehen hatten. Der Bär brüllte mit aufgerissenem Maul und zeigte sein Furcht einflößendes Gebiss. Er sprang überraschend behänd auf das zweite Pferd zu – und schnappte nach dem Banditen.
Das Schreien des Unglückseligen hing Henri danach noch lange in den Ohren. Der Bär schien den Mann zu kennen, so ausschließlich beschäftigte er sich mit ihm, er schleifte den Gebundenen im Maul davon und verschwand im Gewirr der zerklüfteten Felsen.
Es war aussichtslos, ihn zu verfolgen.
Nach einigen Augenblicken verstummten die Todesschreie des Verschleppten.