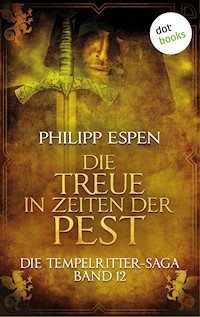4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tempelritter-Saga
- Sprache: Deutsch
„Was ist der vollkommene Mensch? Es ist der voll erwachte Mensch! Der Mensch, der verstanden hat.“ Nach Monaten des Kampfes und der Gefahr wünscht sich der schottische Tempelritter Henri nichts sehnlicher, als seine innere Ruhe wiederzufinden. In Toledo besucht er eine jüdische Schule und will sich in den geheimen Lehren der Kabbala unterweisen lassen. Aber die Zeit des Friedens findet ein jähes Ende, als Henri erneut in den Sog einer mörderischen Intrige gerät. Das Leben der gesamten jüdischen Gemeinde steht auf dem Spiel – und sein eigenes … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nach Monaten des Kampfes und der Gefahr wünscht sich der schottische Tempelritter Henri nichts sehnlicher, als seine innere Ruhe wiederzufinden. In Toledo besucht er eine jüdische Schule und will sich in den geheimen Lehren der Kabbala unterweisen lassen. Aber die Zeit des Friedens findet ein jähes Ende, als Henri erneut in den Sog einer mörderischen Intrige gerät. Das Leben der gesamten jüdischen Gemeinde steht auf dem Spiel – und sein eigenes …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Der in Dänemark geborene Philipp Espen ist ein ausgewiesener Kenner des Alltagslebens im europäischen Mittelalter. Er übersetzte unter anderem den Polycraticus des Johann von Salisbury ins Deutsche. Für die Tempelritter-Saga konnte er außerdem auf sein Expertenwissen zur englisch-schottischen Geschichte des Tempelritterordens zurückgreifen: Er erforschte für die Londoner Universität den ehemaligen Tempelbezirk in der City of London.
Philipp Espen lebt mit seiner Familie in England.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Philipp Espen folgende Bände:
Die Tempelritter-Saga – Band 2: Der König muss sterben
Die Tempelritter-Saga – Band 4: Die Verschwörung von Toledo
Die Tempelritter-Saga – Band 6: Der Klostermord
Die Tempelritter-Saga – Band 12: Die Treue in Zeiten der Pest
***
Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2003 bei Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2014 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Andrey Kuzmin, artfirm und Kiselev Andrey Valerevich
ISBN 978-3-95520-781-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Tempelritter an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Philipp Espen
Die Verschwörung von Toledo
Die Tempelritter-Saga
Band 4
dotbooks.
ERSTER TEIL
1
Frühsommer 1315, um Trinitatis
Auf hoher See kam Sturm auf. Die Wasser hoben sich schwerfällig zu Brechern, rasten heran und fielen urplötzlich mit Getöse in sich zusammen.
In der Nacht entstanden auf einmal gefährliche Wirbel. Sie schleuderten die »König Philipp« ohne Vorwarnung herum, das Ruder musste in Windeseile verstärkt werden. Bald darauf sah die Besatzung jedoch die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen ein und gab das Achtersteuer auf. Haushohe Wellenkämme wälzten sich heran, warteten einen Moment wie triumphierend in der Höhe, als wollten sie ankündigen, gleich alles zu zerschlagen.
Auch die hart gesottensten Matrosen gerieten bei diesem Anblick außer sich und klammerten sich an die Halteseile. Die Deckaufbauten gerieten immer wieder unter eiskalte Wassermassen. Die Stürme machten sich ein Vergnügen daraus, das Schiff wie einen Spielball zu behandeln. Die Küsten des spanischen Festlandes, wohin man von den Balearen aus aufgebrochen war, schienen unerreichbar weit.
»Kehren wir um nach Mahón, denn Barcelona erreichen wir nie! Diese Fahrt ist verflucht!«
»Halt's Maul! Sonst wirst du gekielholt!«
»Oder wir ersaufen alle!«
Wenn Henri de Roslin, den es nicht in seinem Kabinenverschlag auf dem Vorratsdeck hielt, nach vorn blickte, sah er eine graue Wasserwand. Schaute er zurück, sprühende, weiße Gischt. Der Himmel war niedrig, das Meer hautnah. Alles wollte zu Wasser werden. Und die Gespräche der Mannschaft wurden immer gereizter.
Es vergingen die Tage, die Nächte. Selbst die alten Seeleute beteten und schlugen Kreuze. Es war unmöglich, die Tage der Heiligen Dreifaltigkeit zu feiern. Wer von der Besatzung das Bedürfnis verspürte, das Glaubensgeheimnis der Dreieinigkeit Gottes zu begehen, wurde vom mitgereisten Priester vertröstet, der seekrank am Achtersteven saß.
Die einfachen Instrumente zeigten wegen des Schlingerns und des Falls ins Bodenlose längst nichts mehr an, gar nichts. Und die Vögel flogen nur noch so niedrig, dass sie sich in der Takelage verirrten. Henri sprach mit dem Kapitän, einem gedrungenen Katalanen, der Del Bosque hieß, darüber; gemeinsam beobachteten sie eine Seeschwalbe, die sich in den Tauen verhedderte. Das Tier schlug wild mit den Flügeln, es hing an einem Bein fest und hackte es sich am Abend ab. Henri erschien der Anblick wie ein böses Omen. Bevor der Meeresvogel in die Fluten stürzen konnte, sprang Henri hinzu und fing ihn auf. Er nahm sich vor, den Vogel zu pflegen, bis die spanische Küste in Sicht käme.
Dann, nach einer Woche Fahrt, unter Gebrauch des wieder getrockneten Magnetsteins und des noch immer mit einer dicken Salzkruste bedeckten Jakobstabs, glaubte Henri, der dem Navigator zur Hand ging, eine Küstenlinie auszumachen. Er starrte den ganzen Nachmittag hinaus in das trübe Grau, dann wusste er, dass es eine Täuschung war. Und auch der Schiffsjunge hoch oben im Ausguck schwieg.
Vor seinen Augen, die inzwischen ob der Anstrengung tränten, lag Wasser, das jede Begrenzungslinie nun wieder überspülte mit Sturzfluten von schäumenden Wellen. Die Welt versank im feuchten Element wie ein Kontinent, den jetzt die Sintflut holte.
Henri de Roslin grübelte darüber nach, wie unsicher das menschliche Leben war, wenn der Herrgott nicht auf ihrer Seite weilte. In Frankreich, woher Henri kam, herrschte nach dem gewaltsamen Tod des Königs das nackte Chaos. Und hier auf See drohte der endgültige Untergang. War denn nicht schon die Fahrt nach Menorca gefahrvoll genug gewesen? Hatten die Menschen etwas verbrochen, das dieses Unheil rechtfertigte? War er selbst, der Königsmörder Henri de Roslin, daran schuld? Henri spürte seine Zweifel und ein Schuldgefühl vor Gott, aber er wollte nicht beichten. Und der Priester, dem er nicht vertraute, murmelte nur ergeben das Motto von Trinitatis herunter: »Christus ist das Mensch gewordene Wort Gottes, aber wir beten zum Vater, durch Christus, im Heiligen Geist. Amen!«
Henris Grübeln nahm schnell ein Ende. Die banale Gegenwart nahm alle Sinne in Beschlag. Er musste sich krampfhaft an den Seilen festhalten. Er konnte nicht abschätzen, ob die Karavelle ausreichend seetüchtig war, um weitere Stürme auf offener See zu überstehen. Im Mahlwerk eines solchen Sturms schien sie verloren.
Die Seemänner an Bord waren gewiefte Handwerker und instrumentenkundige Navigatoren, auf allen bekannten Gewässern zu Hause. Aber konnten sie navigieren, wenn die Koordinaten in einem offensichtlich ungünstigen, göttlichen Ratschluss verloren gingen?
Die Matrosen fragten sich, was sie in den nächsten Stunden erwartete. Das Mittelmeer zwischen Menorca und der spanischen Ostküste war eine bekannte Zone, aber wenn die Prophezeiungen für dieses Jahr eintraten, von denen jeder munkelte, dann kehrte sich alles um. Dann versank die Welt in Dunkelheit, dann behielten die Unkenrufer zu Hause Recht. Und würde ihnen dann das Unvorstellbare hier im Süden der Weltenscheibe begegnen? Ein Antimond, schwarze Sterne, ein kopfstehender großer Wagen, das gehörnte Tierkreiszeichen des Stieres im Juni mit dem Schwanz eines Juli-Krebses? Furcht erregende Ausgeburten? Naturgewalten, die alles zermahlten, Wellen, die bis zum Himmel reichten und darüber hinaus? Strudel oder einfach nur Löcher im Wasser bis hinunter zum Grund?
Manche Seeleute an Bord hatten allerdings auch ohne den vorhergesagten Weltuntergang schon Wellen gesehen, die sich dreißig Meter hoch aufbauten, und sie erzählten Henri de Roslin jetzt mit bebenden Lippen davon. Wellen mit einem blendend weißen Kamm und leuchtenden Wasserfällen an der Frontseite; ein Plankenschiff, gleich, welcher Größe, das damit zusammenprallte, existierte zehn Herzschläge später nicht mehr. Die Männer hatten schon Stürme erlebt, die mit einem Stöhnen, als seien sie über sich selbst entsetzt, ganze Flotten in Stücke schlugen.
Auf Befehl des Kapitäns hatte die Besatzung schon am Vortag, als der Sturm sich ankündigte, alles von Deck geschafft, was nicht festgezurrt war. Die Taue um die Ladung im Unterdeck, dickleibige Fässer, Kästen, Jutesäcke und Lederbeutel, waren verstärkt worden, die Zurrringe in der Takelage angezogen. Jeder Matrose hatte freiwillig auf alles Überflüssige verzichtet und es über Bord geworfen. Die Karavelle musste leichter werden und tänzerischer mit den Fluten umgehen können. Im Proviantraum blieb nur das Nötigste. Halbleere Fässer mit Nahrung und Trinkwasser wurden umgefüllt, um neue Gefahren bei sich verändernden Gewichtsschwerpunkten zu vermeiden, geleerte Fässer gingen über Bord.
Henri de Roslin hatte eine solche Seereise noch nicht erlebt. Der Sturm bei der Überfahrt vor Wochen vom französischen Le Grau du Roi auf die Balearen war mit seemännischem Können beherrschbar gewesen. Und selbst die davor überwundenen Gefahren eines in Aufruhr befindlichen Frankreichs schienen ihm in der Erinnerung geringer gewesen zu sein. Jetzt zitterten selbst die Matrosen vor Angst. Sie arbeiteten mit wie gelähmt scheinenden Händen.
Wenn Henri de Roslin sich nicht daran erinnert hätte, warum er diese Fahrt über die tobende See auf sich nahm, wäre er genauso mutlos geworden. Aber er dachte an seine Gefährten, die buchstäblich die Steine des Kerkerturms von Fontainebleau erweicht hatten. Voller Liebe dachte er an Uthman ibn Umar, den sarazenischen Korangelehrten, der bereits vor Wochen nach Cordoba zurückgekehrt war. An Joshua ben Shimon, den jüdischen Mystiker, der ihn hoffentlich in Toledo erwartete. Und an die anderen, die ihn während der letzten schlimmen Monate begleitet hatten, seinen Knappen Sean of Ardchatten, der an Joshuas Seite geblieben war, die Tempelbrüder Gottfried von Wettin und Jacques de Charleroi.
Sie alle hatten ihn gedrängt, nach Toledo zu reisen. Dort, in der größten Stadt der iberischen Christenheit, würde er in die Geheimnisse der Kabbala eingeweiht werden, der neuesten, tiefsten und geheimnisvollsten jüdischen Kunst der Auslegung der Bibel. Denn Joshua ben Shimon behauptete, das Wort sei die Waffe, die Henri jetzt gegen seine Feinde brauche, die überall lauerten. Er war fest davon überzeugt, den Worten wohne eine verborgene, zwingende Schöpferkraft inne.
Joshua hatte beschwörend gesagt: »Uns genügt es, den Namen zu kennen, um damit Macht über seinen Besitzer zu bekommen. Es muss aber der wahre Name sein. Denn hinter jedem Wesen oder Ding steht eine Idee, die es formt – nomen est omen. Lerne diese Macht zu erkennen und für dich zu nutzen! Schmiede eine Waffe gegen deine Feinde daraus! Dann wirst du überleben!«
Henri wurde in seinen Gedanken unterbrochen und konnte sich nur mühsam auf den Beinen halten. Das Schiff wurde hin und her geschleudert. Er blickte in die bleichen, erschreckten Gesichter der Seeleute. Wenn die armen Seelen daran dächten, was ihnen in diesem Sturm wirklich passieren könnte, dachte Henri, würden sie vielleicht gleich über Bord springen.
Und als hätten sie seine Gedanken tatsächlich vernommen, konnten in der folgenden Nacht zwei Brüder aus Aigues Mortes ihre Angst nicht länger niederkämpfen. Die jungen Matrosen zogen ein schnelles Ende in den sturmgepeitschten Wellen vor.
Die Matrosen mussten von dem erschreckenden Gedanken überfallen worden sein, dass es da draußen etwas gab, das alles Vorstellbare überstieg.
Etwas, das es auf sie abgesehen hatte!
Die an Bord starrten in ihr nasses Grab. Sie waren darüber so bestürzt, dass sie für den Rest des Tages ihre Arbeit nur unter Ermahnungen verrichten konnten. Auch der Kapitän wusste keinen Rat mehr. Der Priester schlug mit bleichem Antlitz seine Kreuze, und die meisten Matrosen taten es ihm nach.
Henri streunte in den Stunden nach diesem Geschehen auf Deck herum wie eine nasse Raubkatze. Die Kabbala-Schule in Toledo war wieder aus seinen Gedanken verschwunden. Es gab nur das Hier und Jetzt. Eine gnadenlose Hellsichtigkeit bemächtigte sich seiner. Er sah in die Fluten. Jetzt war er nicht mehr der verfolgte Tempelritter aus Schottland, der in Frankreich seine Feinde und seine Bestimmung gefunden hatte, er war ein hinfälliger, ein namenloser Seemann wie die anderen. In seinem Kopf mahlte und mahlte es ebenso wie draußen auf See. Er dachte an die Seelenqual eines Matrosen, der über Bord sprang. Eine solche Tat, dachte er schaudernd, muss einem absoluten Unglücklichsein entsprechen. Denn man tauscht ja nur eine Hölle gegen eine andere ein. Wäre ich zu einer solchen Tat fähig?
Nein, dachte er überzeugt, es entspricht nicht meinem Glauben, das Leben wegzuwerfen. Und nicht meinem Naturell, aufzugeben. Ich muss kämpfen.
Aber wie furchtbar das sein muss, dachte Henri. Unter Wasser hört man gewiss das Toben der See nicht mehr, in den Ohren braust dann etwas anderes. Die Luft in der Lunge reicht noch eine Weile. Und die Ertrinkenden würden den Atem anhalten – gegen jedes bessere Wissen. Obwohl sie den raschen Tod gewählt haben, wollen sie wenigstens diese Zeit noch aushalten, das sagt ihnen ihr Lebenstrieb. Oder was ist es, was dann zu ihnen spricht?
Etwas Tröstliches?
Etwas Gemeines?
Henri wusste es nicht. Er wollte aufhören, sich das vorzustellen. Hatte er nicht ganz andere Sorgen? Um seine letzten verbliebenen Tempelbrüder in Frankreich? Ob sie nach der Ermordung des Papstes und des Königs entkommen konnten? Ob die Kerker in Paris sich endlich leerten? Ob die Gerechtigkeit doch noch siegte? Aber er schaffte es nicht, seinen inneren Mahlstrom zu beenden. In ihm dachte es weiter ...
... irgendwann ist keine Atemluft mehr da, und der Drang zum Atmen wird unerträglich. Wenn man nicht atmet, schwinden die Sinne, atmet man, dringt eisiges, salziges Wasser in die Lunge. Der Instinkt der Kreatur in uns, dachte er, führt sicher dazu, dass wir nach Luft schnappen. Nimmt man diesen Vorgang wahr, als löse man sich auf wie ein Farbfleck auf dem Ozean? Woran die beiden unglücklichen Matrosen wohl gedacht hatten? Wohl an das Nächstliegende. Zum Beispiel, ob noch ein Stück Segeltuch gesetzt werden kann, um dem Wetter zu trotzen. Wenn die Ertrinkenden den ersten unfreiwilligen Atemzug tun, beginnt der Todeskampf. Der Hals wird zugeschnürt wie von einem Galgenstrick. Man versinkt wie eine leckgeschlagene Galeere. In dem Gefühl, ein Felsklotz zu sein, der im Mahlstrom des Meeres auf den Grund sinkt, trudelt man ab und wird bereits tot sein, wenn man auf dem Grund aufschlägt.
Ja, so musste es sein. So schrecklich. Es wartete die Hölle.
Oder wartete ganz unten, auf dem Boden des irdischen Lebens, eine andere Helligkeit, ein neu geschenktes Leben, die Pforte zum Paradies?
Niemand auf der Erdenscheibe konnte etwas über diese Dinge wissen.
Über den Köpfen der Schiffspassagiere wanderte stumm und hell der Mond. Er lag waagerecht am Himmel und besaß die Form eines auf den Wassern des Nachthimmels fahrenden Nachens. Henri kannte die Mondsichel der südlichen Gefilde schon aus dem Heiligen Land und aus Arabien, sie kam ihm jetzt vor wie ein Kahn, der ihnen auf dem Weg in den Abgrund vorausfuhr. Er zog sie wie ein Lotse. Die Matrosen stießen sich an und zeigten mit den Fingern in die Höhe.
Kapitän Del Bosque sammelte seine Mannschaft um sich. Sie befanden sich alle im vorderen Teil des Schiffes. Nur ein Notdienst stand an den Brassen. Da die Sterne jetzt wieder zu sehen waren, holte der Navigator seinen nautischen Almanach, den er zuvor mit einem gotteslästerlichen Fluch von sich geworfen hatte, und versuchte, sich zu orientieren. Er hielt den Astrolab aus Holz und Messing, den ihm ein Maure aus Isfahan geschenkt hatte, an sein rechtes Auge.
»Was kannst du damit sehen?«, fragte ihn Henri.
»Ich habe eine drehbare Sternenkarte und darüber eine Scheibe mit Horizont, Höhenlinien und Himmelsrichtungen. Mit den gemessenen Gestirnshöhen kann ich die Zeit und den Ort bestimmen. Es ist ein Modell der Welt.«
»Und wo befinden wir uns, Navigator?«
»Im Nichts! Ich weiß es nicht besser auszudrücken.«
Er wendete sich ab und benutzte ein Viertelkreisinstrument, um die Höhe der Sterne über dem Horizont zu bestimmen. Während er seine Beobachtungen mit einem horologischen Rechenschieber verglich und in ein schon beschriebenes Äquatorium aus Pergament mit roter Tinte notierte, bangten die Zuschauer. Der Navigator murmelte: »Ich muss die Winkel bestimmen, die der Mond mit den Fixsternen bildet. Dann habe ich unsere Länge.«
»Wir müssen nach Westen, Mann! An die spanische Küste!«
Der Navigator versuchte es wieder und wieder. Dann seufzte er bekümmert und überließ das Schiff seinem Schicksal. »Es ist nicht Gottes Wille«, sagte er, »dass wir wissen, wo wir sind.«
Der Steuermann fluchte und stapfte nach Achtern zum Tiefenruder. Aber an eine kontrollierte Fahrt war im Augenblick nicht zu denken, denn die unbarmherzige Faust des Sturmes schob das Schiff widerstandslos hin und her, aber immer weiter hinaus auf die stockdunkle, schäumende See.
Schon längst hatten die beiden Schiffsjungen es aufgegeben, das Stundenglas der Sanduhr umzudrehen, denn es regierte ein anderes, gnadenloseres Uhrwerk als das von fallenden Sandkörnern, die sich zu einem unbarmherzigen Haufen aufschichteten.
Als die nächste Nacht hereinbrach und lange, zu lange, anhielt, taten die Seeleute das, was sie in ähnlichen Situationen immer taten. Sie waren damit beschäftigt, sich mit ihren wenigen verbliebenen Habseligkeiten zu umgeben. Auf kindische Weise bemühten sie sich, es sich erträglich zu machen. Ein Matrose balgte sich ausdauernd mit seinem Hund, ein anderer zählte seine vergoldeten Solidis und kupfernen Maravedis, ein dritter klammerte sich an seinen Talisman. Der Schiffsjunge betrachtete lange seine großen Hände. Der Gehilfe des Kochs legte die schönsten seiner Muscheln im Kreis um sich und veränderte von Zeit zu Zeit ihre Lage. Auf diesem Ozean war es in dieser Nacht so erschreckend, dass jeder sich bemühte, in seine eigenen kleinen Banalitäten abzutauchen. Jeder zog sich seinen persönlichen Kreis, um mit hilfloser Magie in der sichtbaren Welt zu bleiben.
Der Priester betete seit Stunden. Und er musste Fragen beantworten.
»Wenn wir jetzt Trinitatis feiern, sind die drei göttlichen Personen doch gleich gestellt. Bleibt diese Gleichheit auch danach noch bestehen?«
»Ja, mein Sohn. Trinitatis ist nur der Höhepunkt dieser Sichtweise. Wir glauben an die Dreieinigkeit Gottvaters. Wir beten gleichermaßen an Gott, Christus und den Heiligen Geist.«
»Zu jeder Zeit?«
»Jetzt und immerdar.«
»Amen.«
Henri beobachtete die gefährliche Stille an Bord mit Sorge. Der Beamte des Königshauses aus Segovia, der zu einem Prozess gegen Häretiker aus Frankreich zurückgerufen wurde, saß zusammengekauert unter dem Segeldach des Kapitäns. Ein junger Matrose aus Mahón schabte ungelenk mit Kohle seinen Namen auf einen Schal und wand ihn sich um den Hals. Einige Männer, die Empfindlichsten, waren unter Deck verschwunden und blieben dort.
Dann flaute der Sturm plötzlich ab. Henri besprach sich mit dem katalanischen Kapitän, und gemeinsam gingen sie auf dem Deck herum und sprachen den Matrosen Mut zu.
Aber am Ende der Nacht, noch war alles schwarz, zeigte die See wieder eine beunruhigende Seite. Ringsherum starrten plötzlich phosphoreszierende, grüne Augen aus dem Wasser auf das Schiff. Es leuchtete und blinkte. Ständig bewegte sich etwas im Wasser, stumpf oder leuchtend, tauchte empor, schmatzte und verschwand, Köpfe erhoben sich und zogen sich wieder zurück. Die Vorstellung, welche Ungeheuer direkt unter dem dünnen Plankenboden des Schiffes herumschwammen, sich vielleicht in ebendiesem Moment daran festsaugten, um es zu vernichten, ließ manchem hart gesottenen Seemann Schnee über den Nacken rieseln.
Danach starrten die Männer wieder hinaus, wo sich schwarzes Wasser mit tintenschwarzem Himmel verschwisterte. Es war tief in der Nacht, und das Schiff lief völlig ohne Kontakt zur bekannten Welt in die Dunkelheit hinaus. An Schlafen dachte niemand. Die meisten Sterne lagen hinter dicken Wolken. Und der Mond war längst verschwunden, der Nachen seiner weißen Sichel in einen unbekannten Hafen eingelaufen.
Der Navigator beschäftigte sich wieder mit seinen Instrumenten, aber sein Gesicht drückte Ratlosigkeit aus. Und die übrigen Männer starrten hinaus, um etwas zu erkennen. Sie lasen, soweit sie es vermochten, den Stand von Georgsharfe, Pegasus, Tigerthier und Berg Maenalus vom Himmel ab, jedes kleinste, sichtbare Ereignis wurde begierig aufgenommen. Jedes winzige Zeichen konnte entscheidend sein und musste gedeutet werden.
Dies war der Zeitpunkt, an dem sich die Männer, um wieder zu Verstand zu kommen, fragten, woran sie eigentlich glaubten. Henri de Roslin lauschte ihren lebendigen, kehligen Stimmen mit den Akzenten der provenzalischen Küstenregionen, im Brüllen des Meeres und im Schweigen unter diesem befremdlichen Himmel.
Als der Morgen graute, gab es die Karavelle immer noch. Der Priester sprach ein Dankgebet. Selbst die verletzte Seeschwalbe flatterte umher.
Aber noch bevor die Seeleute sich darüber klar werden konnten, warum die spanische Küste unter der aufgehenden Sonne nicht in Sicht kam, nahm der Sturm ohne Vorwarnung wieder zu. Eben noch war das Meer in fast völliger Windstille ölig glatt gewesen. Jetzt sah es grauschwarz aus wie verdorbener Fisch. Ein heimtückischer Wind kroch in Gegenrichtung zum Schatten der am Bug angenagelten Sonnenuhr aus Nordosten nach Südwesten. Der Kapitän war erfahren genug, um zu wissen, dass ein solcher Wind in diesen Breiten einen weiteren gefährlichen Sturm ankündigte. Man beobachtete die Wetterinstrumente.
Der Kapitän vertraute sich Henri an. »Die Wetter laufen gewöhnlich von links nach rechts. Ein trockener Sturm immer, nur ein nasser Sturm in Ausnahmefällen nicht. Dies hier ist so ein verdammter Ausnahmefall!«
Ein Matrose, der neben Henri an der Reling stand, brachte es auf den Punkt: »Es ist ein kranker Wind!«
Der Himmel bedeckte sich, aus dem Meer erhob sich plötzlich ein lautes Brüllen. Die Wasseroberfläche raute auf, als drängten Millionen von Tieren aus dem Meeresgrund herauf ans Licht. Wasserberge türmten sich erneut auf, bauten sich himmelhoch hinter der Karavelle auf und stürzten als Brecher auf sie, um das Schiff zu begraben. Der Abstand, in dem die Wellen kamen, wurde immer kürzer; sie schlugen aufeinander, die zurückrollenden Wellen brachen sich auf den nachdrängenden. Und mittendrin die Karavelle, die nur eines schaffen konnte – nicht querzuschlagen. Alle Matrosen kämpften verbissen dagegen an.
Eine volle Breitseite traf die Karavelle in einem Moment, als die Besatzung an Luv mit der Beseitigung des Wasserschadens beschäftigt war. Das Schiff wurde nach links geschleudert. Nur das beherzte Emporklettern der gesamten Besatzung auf dem sich schon gefährlich neigenden Deck verhinderte das Leckschlagen. Die Karavelle schwankte einen Moment lang zwischen Umkippen und Schwimmen, konnte sich nicht entscheiden – und senkte sich ächzend wieder.
Als die Mannschaft danach durchgezählt wurde, fehlten vier weitere Männer.
Vor ihnen schien nun ein Höllenschlund zu liegen, aus dessen aufgerissenem Rachen heißer Atem und üble Gerüche kamen. Beides fuhr in das Meer und wühlte es wütend auf. Heulend tobte der heiße Atem in der Takelage. Die erfahrensten Seeleute kannten diese Geräusche, sie waren gewohnt, die Stärke eines Sturmes danach zu beurteilen. Ein Heulen bedeutete Sturm. Wenn der Wind sich aber der Orkanstärke näherte, dann schrie er.
Er schrie.
Würde man jetzt den Wracks all jener Schiffe begegnen, die an der Stätte des kranken Windes schon vor ihnen zerschellt waren? Oder traf man sie unversehrt jenseits der Wetterbarriere, im neuen Glanz des unwirklichen Lichtes einer anderen Welt, von der die Schriftkundigen und Geistlichen erzählten?
Henri wünschte sich, die Geheimnisse der Kabbala schon jetzt zu kennen. Denn wenn es stimmte, dass einem die Menschen und die Dinge zu Willen sein mussten, sobald man ihren wahren, ihren geheimen Namen kannte und Buchstabe für Buchstabe aussprach, dann würde er die Unwetter bändigen. Er würde sagen: »Sturm!« Und der Sturm würde ihn anblicken und ergeben auf seine Befehle warten. Henri schüttelte den Kopf. Nein, so einfach war es sicher nicht. Daran glaubten nur die Narren und die Hexen. Vielleicht stimmte überhaupt nichts von dem, was die Kabbalisten behaupteten und was Joshua ben Shimon ihm erzählt hatte.
Aber seine Gefährten Joshua und Uthman hatten die Geheimzeichen der Steinmetze am Donjon des Königssitzes in Fontainebleau gedeutet und damit für ihn den Fluchtweg geöffnet! Sie hatten den wahren Namen der Mauern gekannt und beschworen!
Henri blieb ruhelos. Er vernahm die ganze Nacht über die monoton murmelnde Stimme des Priesters, der sein ganz persönliches Trinitatis zu feiern schien. »Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Geist ... Er hat die Welt so geliebt ... so geliebt ... dass er seinen einzigen Sohn hingab. Deshalb glauben wir an Deine Herrlichkeit und bekennen es ohne Unterschied auch von Deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geist ...«
Was niemand im Grab seiner hämmernden Herzschläge und der endlosen, todbringenden Minuten sich vorstellen konnte: Auch diese Nacht, wie alle Nächte, hatte schließlich ein Ende.
Es wurde Tag.
Der Sturm ließ nach, obwohl Henri seinen wahren Namen nicht kannte und nicht ausgesprochen hatte.
Die Sonne stach nun derart nieder, dass das Pech in den Planken zu schmelzen begann. In schwarzen Perlen, die in der Sonne schimmerten, trat es aus den Fugen. Die Planken rissen auf, Zwischenräume drohten zu entstehen. Schnell wurde Pech angerührt, die Flammen unter der Pfanne qualmten und verwehten, verlöschten aber nicht.
Im schwarzen Qualm des Dichtungsmaterials, den der Wind herumwirbelte, sahen die Männer plötzlich, wie sich das Meer mit weiß brodelnder Gischt bedeckte. Sie stürzten nach vorn. Unter dem Kiel kochte eine milchweiße Suppe. Das hatten ihnen die Alten immer wieder für das Weltende dieses Jahres vorhergesagt. Die Meere würden zu sieden beginnen! Jetzt erfüllten sich die Prophezeiungen.
»Das Meer wird heiß! Eine riesige, heiße Fischsuppe, in der wir untergehen!«
»Lasst ein Weinfass hinunter!«, schrie der Kapitän.
Zwei Matrosen folgten mutlos dem Befehl. Als sie das Fass gefüllt wieder emporzogen, tauchte der Steuermann seine Hand hinein. »Es ist nichts als kalte Gischt! Das Meer kocht hier ebenso wenig wie vor Le Grau du Roi oder an der Küste von Menorca.«
»Aber wo sind die Riffe, die diese Gischt hervorrufen? Wir haben die Riffe südwestlich der Balearen lange hinter uns gelassen!«
Henri versuchte, die Männer zu beruhigen. Er zwang sich zu einem heiteren Lachen und legte dem Steuermann den Arm um die Schultern. »Verdammte See mit ihren billigen Tricks!«
Die Fahrt ging weiter. Eine neue Nacht brach herein. Mond und Sterne waren nicht mehr zu sehen. Und wieder ging am nächsten Morgen an einem jetzt klaren Himmel die Sonne auf.
Der Bleimann senkte sein Lot. Drei Faden Tiefe! Hier habt ihr eure neuen Riffe, dachte Henri schaudernd. Untiefen, so weit draußen auf dem Meer! Sie drohten die Karavelle mit scharfen Felsenmessern aufzuschneiden wie einen Fischleib.
Zweihundert Meter weiter fand das Lot plötzlich keinen Grund mehr.
Der Sturm, launisch wie eine Schöne von den Landgütern des französischen Königs, nahm zu und wieder ab. Henri de Roslin sah zum Segel auf. Es war noch wie zu einer flotten Fahrt gefüllt. Bald darauf, als wäre nichts geschehen, glitt das Schiff ruhig dahin. Aus Backbord voraus streichelten eine matte Brise und eine unsichtbare Strömung das Schiff. Kapitän Del Bosque gab den Befehl: »Dicht am Wind gebrasst! 60 Grad heran!«
Das Schiff drehte plötzlich, wie von einer unsichtbaren Hand herumgerissen, auf Kurs Westen. Langsam glitt es in einer Flut dahin. Vor ihnen kam Dunst auf. Darin sahen sie, noch verschwommen, die Umrisse einer lang gestreckten Küstenlinie. Sandige Klippen lösten sich mit gelben und roten Umrissen aus dem Nebel.
Ist das wirklich die spanische Küste, dachte Henri, oder sind wir zu weit abgetrieben? Und wäre es wirklich so schlimm, wenn wir ins Nichts führen, immer weiter weg von verräterischen Päpsten und grausamen Königen, von Anklägern, die falsches Zeugnis reden, von Machtgier und gefüllten Folterkellern?
Und das vor uns – wird es böses Wasser sein?
Der Kapitän gab weitere Befehle aus. Je näher sie der Küste kamen, desto mehr nahm der Wind ab. Es wurde ganz heiß und still. Zum Rauschen der Wellen kam jetzt das Rauschen in den eigenen Ohren. Noch wagte niemand etwas zu sagen. Es konnte alles ein Trugbild sein, das die bösen Geister dieses Ortes malten. Vielleicht gehörte die Täuschung zum Szenario des Abgrunds wie eine Fata Morgana, von der die spanischen Mauren berichteten.
Der Schiffsbug schnitt eine scharfe Kontur in die milchige Luft. In den Wanten seufzte der Wind, von Land her flogen plötzlich drei Bartgeier heran und ließen sich auf dem Ausguck nieder. Sie starrten mit ausdruckslosen Augen auf die Männer herab. Zwei Matrosen hielten den Anblick nicht aus, sie liefen nach Achtern, schleppten eine plumpe Armbrust heran und feuerten. Als der Pfeil knapp an den Geiern vorbeizog, torkelten ein paar schwarzweiße Federn auf Deck, und die Geier waren fort.
Die Matrosen am Vorschiff legten ihre Hände über die Augen, um genauer zu sehen. Als sie der Küste näher kamen, sahen sie, dass sie flach wurde. Nach Süden hin schimmerte blendend weißer Sand in der Sonnenglut. Es gab kein Kap, keine Felsen, keine Riffe, nur gleichförmigen Sand, den der Wind zu Kaskaden aufwirbelte und über den Strand verteilte.
Die Männer suchten den Blick ihres Kapitäns. Wo waren sie? War das Spanien oder ein verräterisches Trugbild? Was zeigten die Instrumente an? Keine Stadt und kein Hafen in Sicht. War man in eines der feindlichen maurischen Länder an der afrikanischen Küste abgedriftet, die man in der schon viel zu lange währenden Reconquista bekämpfte?
Die Karavelle blieb auf Kurs. Mit aller Vorsicht näherte sich das Schiff der Küste.
Der feine Wüstenstaub, der vom Ufer herangetrieben wurde, legte sich unangenehm auf die schwitzenden Körper. Die Männer husteten und fluchten. Del Bosque gab Befehl, sich Halstücher vor Mund und Nase zu binden. Die Glut von der Küste her schlug ihnen entgegen, als würde urplötzlich die Tür eines Brennofens geöffnet. Wie ein Fieber hauchte etwas zu ihnen herüber. Und der Sommer hatte gerade erst begonnen!
Der Steuermann suchte eine Bucht. In einhundert Metern Abstand zum Ufer ließ er Anker werfen. Man bestimmte ein halbes Dutzend Männer, die sich bewaffneten. In einer schlanken Pinasse wurde der kleine Fußtrupp, der die Umgebung erkunden sollte, von den Matrosen, die als Wächter an Land bleiben sollten, hinübergerudert.
Am Morgen des zwölften Tages auf See setzten die Männer ihre Stiefel auf Sand, der sich nach drei Seiten bis zum Horizont erstreckte. Es war so weiß, dass sie die Augen schließen mussten.
*
»Wir wollten dem Unheil in unserem Heimatland entkommen. Aber hier ist es nur noch schlimmer!«
Der Matrose blickte Henri so treuherzig an, dass dieser ihm begütigend die Hand auf die Schulter legte. »Aber hier«, sagte er, »regieren keine falschen und untreuen Vorgesetzten, die uns verraten, sondern nur die Natur. Nattern, Sand und Hitze können wir bezwingen.«
Man hatte einen Tag und eine Nacht lang gewartet, die ausgesandten Matrosen kamen nicht zurück. Irgendetwas musste geschehen sein. Also beschloss der Kapitän, nach ihnen zu suchen. Henri schloss sich dem Trupp an, wollte aber, ob man sie nun gefunden hatte oder nicht, sollte sich der Landstrich als iberisches Festland herausstellen, allein weiterreiten.
Sechs Pferde wurden an Deck geführt, darunter Henris Hengst Barq. Die an die Dunkelheit gewöhnten Pferde bekamen Scheuklappen, spürten indes die Hitze und Fremdheit vor dieser Küste, scheuten und schnaubten. Die Deckwachen wurden neu eingeteilt, Wasser und Proviant verstaut, die Männer am Ufer zurückgerufen. Und wenig später ruderte eine andere, größere Pinasse mit neuen Leuten den Trupp und die mit Decken gesattelten Tiere an Land.
Dem Navigator war es inzwischen gelungen, eine Position von vierzig Breitengraden zu errechnen. Aber er fügte hinzu: »Wenn das stimmt, ist dies die iberische Küste. Vielleicht aber irre ich, und das ist die große Wüste Sahara, über der in diesem Monat die gleiche Mondsichel steht.«
»Aber sagen dir das nicht die Sterne?«
»Ich bin kein Maure, Mann! Wir Iberer dürfen uns nicht wie die Heiden orientieren, es ist verboten. Denn alles liegt nur in Gottes Hand!«
Der Trupp setzte sich langsam in Bewegung. Bis zum Einbruch der Nacht folgten sie den nicht verwehten Spuren im Sand. Keine Ansiedlung, kein menschliches Lebenszeichen tauchten vor ihren Blicken auf. Am nächtlichen Lagerfeuer, unter einem tiefschwarzen Sternenhimmel, patrouillierten Wachen im Abstand von drei Stunden. Henri teilte sich selbst als letzte Wache ein, für die Zeit kurz vor dem Morgengrauen, wenn die Augenlider am schwersten waren.
Alle schliefen unruhig, denn aus der Dunkelheit, aus den nur scheinbar friedlich hingestreckten Wellen dieser befremdlichen weißen Landschaft, aus der alle Farben verschwunden schienen und die in allen Formen zu leben schien, kamen seltsame Laute.
Henri unterhielt sich mit dem Navigator, der sich kopfschüttelnd mit seinen Instrumenten beschäftigte.
»Wenn wir uns wirklich auf der Höhe des vierzigsten Breitengrades befinden, wäre das großartig«, meine Henri, »dann müsste ich nur sechs Tage westwärts reiten, um Toledo zu erreichen. Aber müssten wir dann nicht den Ort Benicasim mit seinem Hafen sehen?«
»Nur ein Grad Abweichung in der Berechnung, und wir kommen fünfzig Leguas von der Route ab«, erwiderte der Seemann bekümmert. »Nach dieser stürmischen Überfahrt sind alle Instrumente wie von Sinnen. Seht Euch nur den Magnetstein an, er dreht sich wie ein betrunkener Narr um sich selbst.«
»Ich wünschte, mein Freund Uthman wäre an meiner Seite. Denn wenn du Recht hast, könnte dies das Land der Almohaden sein. Und die Iberer führen einen grausamen Krieg gegen die Mauren. Sind wir allerdings etwas nördlicher, könnten wir uns auf dem Boden des Königreiches Valencia befinden – also in Sicherheit.«
Am nächsten Morgen ging die Suche nach den verschwundenen Gefährten weiter. Nichts als welliger weißer Sand und verkarstete Täler. Gegen Mittag erreichten sie einen Fluss. Zuerst erblickten sie nur einen Streifen Grün im Weiß, der immer breiter wurde und sich schließlich zu einem unübersehbaren Wald weitete, der hauptsächlich aus Olivenbäumen bestand. Dann befanden sie sich am Ufer des breiten Wassers, dessen lehmige Fluten sich träge, dann wieder in Strudeln dahinwälzten.
»Was ist das für ein Fluss? Wie heißt er?«
Niemand wusste es.
»Und unsere Männer? Die Spuren enden am Ufer.«
Mehrere Abdrücke von Pferdehufen und von Sohlen verloren sich im schlammigen Uferwasser und tauchten weder nördlich noch südlich dieses Flecks wieder auf. Und auch nicht am gegenüberliegenden Ufer des Wassers, das den Reittieren bis zum Hals reichte.
»Vielleicht sind sie mit der Strömung nach Osten, dem Meer zu, zurückgeschwommen, sie wussten ja, dass wir sie suchen, wenn sie zu lange fort sind.«
Die Vermutung des Matrosen teilten auch die anderen.
Sie hatten jetzt den Fluss durchquert. Am Ufer gegenüber sahen die Männer plötzlich etwas Beunruhigendes. In der Ferne näherte sich ein Phantom. Es sah so aus, als schwebe es über den Wassern. Auf einem flimmernden Gürtel von Luft tummelten sich vier Umrisse, deren bunte Kleidung sich überdeutlich im Grün, Weiß und Grau des Flimmerns abzeichnete. Vier Spukgestalten, die durch die Luft zu fliegen schienen, und obwohl sie in heftiger Bewegung waren, sah es nicht so aus, als kämen sie näher.
»Aber das sind doch unsere Männer! Nuñoz, Patric, Paolo und Cabral! Ich erkenne sie an ihren Umhängen und Helmen!«
»Aber das ist unmöglich!«
»Aber seht doch selbst!«
»Nein, es ist nur eine Erscheinung.«
»Sie fliegen.«
»Ist ja unheimlich. Sind sie tot? Sie scheinen uns aus dem Himmel zu grüßen!«
Alle bekreuzigten sich.
Ein Matrose aus Tarifa sagte: »Es könnte etwas sein, das die Marroquinos in meiner spanischen Heimat eine Fata Morgana nennen, eine Luftspiegelung. Irgendwas mit unterschiedlich warmer Luft, übereinander geschichtet wie eine Tortilla de pastor aus Brot und Eischaum. Ein Spuk. Wenn wir darauf reinfallen, werden wir noch tagelang hier stehen und sie erwarten.«
Henri war daran interessiert, nach Westen zu kommen, also schlug er vor, der Erscheinung entgegenzureiten. Aber je näher sie den Gestalten zu kommen glaubten, desto weiter entfernten sie sich. Und während die vier bunten Gespenster auf ihrem flirrenden Luftteppich allmählich dünner und farbloser wurden und nach einer Weile ganz verschwanden, hielt der Trupp an und beratschlagte sich. Die Meinungen gingen auseinander, erst nach einer Weile setzte man sich wieder in Bewegung.
Am Abend war noch immer keine Ansiedlung in Sicht. Der Navigator fluchte die ganze Zeit über. Und als in der anbrechenden Dunkelheit plötzlich alle Tierstimmen verstummten und Vögel davonflogen, tauchte in einer hitzeflirrenden Ebene das Band des Flusses wieder auf. Und an seinen Ufern lag zu beiden Seiten eine Stadt.
»Wenn das Almazora ist, hatte ich Recht!«, schrie der Navigator. »Und dort treffen wir sicher auch unsere fliegenden Kameraden wieder!«
Kleine Hütten und flache, weiße Häuser kamen näher. Auf dem Fluss wiegten sich breite, beladene Flöße mit Hüttenaufbauten und kleine, wendige Binsenboote mit Netzen schwingenden braun gebrannten Fischern in weiten Umhängen an Bord.
Die Reiter passierten den letzten Sandhügel. Am Ufer verkehrten junge, mit Halsketten geschmückte Frauen, die Krüge und Körbe auf ihren Köpfen trugen, ihre Gesichter waren ebenmäßig und schön, ihre schlanken, hellen Körper umschmeichelten bunte, gewebte Stoffe. Jungen balgten sich im Uferschlamm, weiter hinten waren Verkaufsstände und Tragegestelle aufgebaut, die sich unter Bergen von Früchten, Stoffen, Salzblöcken bogen. Hühner gackerten in Weidenkäfigen, dicke, schwarze Schweine scharrten in morastigen Krälen, alte Frauen trieben Ziegen und Schafe durch die Marktgassen.
Langsam nahmen die Einheimischen die Fremden wahr. Es schienen tatsächlich Mauren zu sein. Ein Rudel dünner, nackter Jungen schlug mit biegsamen Gerten nach ihnen, neugierige Mädchenblicke aus dunklen Augen tasteten die Ankömmlinge mit der schmutzigweißen Haut unter schimmernden Kettenhemden ab. Die Gesichter der meisten Einheimischen waren markant, die Männer trugen spitze Bärte. Manche wirkten erstaunt, andere regelrecht entgeistert, und wie bei einem spätsommerlichen Laternenfest an der Küste der Provence sammelten sich allmählich alle hinter den unruhig tänzelnden Reittieren und ließen sich mitziehen. Es ging hinein durch ein Tor mit goldglitzerndem Dach in eine Stadt enger, staubiger Gassen, schlafender Hunde und einem Gestank wie aus einem Abtritt.
»Zur Hölle mit diesem Gestank! Und mit dem Geschrei gleich hinterher! Wie kann man hier leben!«
Der Matrose rümpfte die Nase, die anderen hatten sich längst ihre Halstücher vor die untere Hälfte des Gesichts geschlagen. Die Einheimischen, die ihnen in den jetzt breiter werdenden Straßen aus fest gestampftem Sand und dünnen Rinnsalen, die zum Fluss hinunterplätscherten, entgegenkamen, trugen ebenfalls eine Art Taschentuch über Mund und Nase, sie wirkten mager, waren nicht sehr groß und besaßen gekräuseltes schwarzes Haar, das bei manchen bis auf die Schultern fiel. Schwaden von Fliegen umschwirrten die Menschen, ein Umstand, der dem Fischfett zuzuschreiben sein konnte, mit dem sie sich offensichtlich einrieben – davon erzählten die Geruchswolken.
Die Ankommenden suchten einen Ort, an dem man eine Auskunft bekommen konnte. Aber die Straßen vor ihnen waren wie leer gefegt, und die Menge in ihrem Schlepptau antwortete nicht auf ihre gerufenen Fragen.
Hin und wieder kreuzte ein fleckiger Waran wie an einer Schnur gezogen den Straßenstaub, überall saßen Bartgeier, und Packtiere mit Körben, in denen die Ankömmlinge Wurzeln und Mais erkannten, trotteten durch noch engere Nebengassen. Schließlich weitete sich der unbefestigte Weg aber doch und mündete in einen Platz, auf dem sich gebleichte Knochen stapelten und den Palmen und Tamarindenbäume umstanden. Die Häuser drum herum waren dreistöckig, aus Lehm errichtet, weiß gestrichen und an den Firsten mit grünweißen Ornamenten verziert. Sie machten einen wohlhabenden Eindruck, in den Eingängen standen Blumenkübel.
Henri erblickte in einem Hauseingang einen großen Mann, den ein blitzsauberes weißes Leinen umhüllte, das in der leichten Brise flatterte. Auf seinem Kopf saß ein gewaltiger roter Turban. Er winkte sie heran.
Es stellte sich heraus, dass der Riese Tarfaya hieß, ein Yamshändler aus Tanger, der zwischen dem iberischen und afrikanischen Festland hin- und herpendelte und den es nun an die iberische Ostküste verschlagen hatte. Ein Maure, muskulös und kultiviert, er beherrschte Arabisch ebenso wie die Sprache der Balearen, das Katalanische, mit einem arabischen Akzent. Er redete, in diesen Sprachen hin und her wechselnd wie ein Läufer, der auf seinem Pfad Pfützen überspringt, unaufhörlich auf die Ankömmlinge ein.
»Nein, Eure Kameraden waren nicht hier, es wäre mir bekannt. Natürlich, es ist die Stadt Almazora, weiter westlich ist Onda. Hier leben nur Muslime. Natürlich ist es unser Iberien, was denn sonst ... überall leben die Almoharen, hoch gewachsene, kräftige Männer, ebenso wie ich. Die Bewohner weiter im Westen sprechen Spanisch, Ihr könnt dort sicher einen Fremdenführer kaufen. Sie tischen aber allen Fremden unglaubliche Lügen auf. Ich mag jedoch ihre Sauberkeit, sie waschen sich viermal täglich. Aber sie haben die unmöglichsten Tischmanieren. Sie sind gastfreundlich und großzügig. Wenn Ihr nach Toledo wollt, müsst Ihr zwei Grenzen und Gebiete des gefährlichen Raubadels passieren, und besser reitet Ihr nicht allein weiter ...«
Henri unterbrach ihn: »Und es waren wirklich keine spanischen Matrosen hier?«
Der Maure sah sie mit einem Seitenblick an. »Ihr seid die ersten Spanier seit langen Wochen, die wir sehen.«
»Ich bin kein Spanier«, sagte Henri. »Aber das ist einerlei. Könnt Ihr uns eine Herberge geben für die Nacht? Meine Gefährten wollen erst morgen früh zurückreiten.«
»Aber ja! Verzeiht, dass ich Euch hier stehen lasse! Selbstverständlich! Alle haben Platz!«
Sie ritten durch ein Tor in den Innenhof ein. Hinter ihnen wurde die Zufahrt sofort mit einem Querbalken verrammelt. Das hätte Henri stutzig machen müssen. Die Pferde wurden von grimmig dreinblickenden Männern mit Krummdolchen in breiten Gürteln versorgt, einige trugen Stirnbänder, alle Bärte.
Die Gäste durften sich waschen und streckten sich danach unter Bananenbäumen auf Flachsteppichen aus. Der Maure zeigte sich gastfreundlich, wenig später standen Essen und Trinken in Kalebassen und Schalen auf kleinen dreibeinigen Tischen, die aus Messing gehauen waren. Es gab braunen Reis, in dem Fleischstücke und weißes Fischfleisch schimmerten, dazu scharfe Soßen mit schwimmenden grauweißen Inselchen und Fladenbrot. Henri kannte solche Speisen aus dem Morgenland. In Krügen schwappte Wasser.
Die Angekommenen spürten jetzt erst ihren großen Hunger und Durst und griffen tüchtig zu. Zur Unterhaltung ließ Tarfaya Musikanten auftreten, die mit Maultrommel, Rebec und Knochenflöte einen klagenden Singsang erzeugten. Die Matrosen in Henris Begleitung rülpsten und seufzten. Schließlich bekamen sie noch ein Schauspiel geboten – zwei muskulöse Schwarze rangen mit gelb gefleckten Raubkatzen. Ein seltsames Spiel, halb Dressur, halb Überlebenskampf. Es endete, als das Genick eines der Tiere brach.
Henris Aufmerksamkeit galt jedoch einer Gruppe verschleierter Frauen. Sie standen an der Brüstung einer im Obergeschoss umlaufenden Empore zusammen, gehüllt in weiße, grüne und hellblaue Tücher, die Gesichter verdeckt. Sie tuschelten belustigt. Es waren Musliminnen, und plötzlich meldete sich in ihm ein Alarmruf, dem eine heftig bimmelnde Feuerglocke folgte. Henri wusste nicht viel über das Verhalten von Mauren im christlichen Iberien, die in weiten Teilen des Landes als Feinde angesehen wurden. Er erinnerte sich an das Verrammeln des Eingangstores – saßen sie als Christen jetzt in der Falle?
Henri schaute den Mauren an, der folgte ihrem Blick nach oben. Er nickte. »Wir glauben an Allah, er sei gepriesen, und an seinen Propheten Muhammad. Keine Angst. Wir sind keine Feinde. Unter uns gibt es neben gläubigen Buschrihns auch ungläubige Kafiren, ja, die sind sogar in der Mehrzahl. Hier draußen in dieser Einöde, die nur vom Meer her zugänglich ist, zählen Menschen, nicht Religionen.«
Halbwegs beruhigt lehnte sich Henri wieder zurück, aber er blieb jetzt wachsam.
Henri hörte den Navigator fragen: »Womit handelt Ihr hier, Tarfaya? Ich will hoffen, dass es keine Sklaven sind.«
Listig sah der Maure ihn an. »Sklaven? Schwarze? Bei Allah – dazu bräuchte ich Soldaten. Wir sind nicht in Afrika. Ich bin allein mit meinen Bediensteten, die Ihr hier seht. Schwarze Sklaven brächten mehr ein, aber ich habe gelernt, dem Allmächtigen für das zu danken, was ich bekomme.«
»Nun, und? Wovon lebt Ihr?«
»Unsere Schiffe fahren regelmäßig nach Tanger. Im Süden dieser Stadt wird grobes Salz in großen Mengen abgebaut. Oftmals im Jahr reisen wir dorthin, laden das Salz in Säcke und ziehen weiter tief in das Land hinein nach Tanbutu. Dafür brauchen wir vierzig Tage. Das Salz verkaufen wir schnell, in sieben Tagen für 300 mitigalli, das sind vierzig Unzen Gold – je nach Ladung. Mit dem Gold kehren wir hierher zurück.«
»Gold?«, echoten die Matrosen gierig.
»Ist die Reise dorthin gefährlich?«, wollte Henri wissen.
Tarfaya wiegte den Kopf. »Das kann man wohl sagen, sehr gefährlich. Allah, er sei gepriesen, schenkt uns nichts. Im Reich der Afrikaner herrscht eine furchtbare Hitze, dagegen ist das Klima bei uns milde. Von den Karawanenkamelen, die man dort benutzt, verenden drei Viertel, und das will etwas heißen, denn es sind bedürfnislose Tiere. Auch viele Männer sterben an der Hitze oder an Krankheiten. Aber wir bekommen Gold, dafür lohnt jede Anstrengung.«
Henri fragte weiter: »Sagt mir, warum braucht man in diesem Land das Salz so dringend, dass man es in Gold aufwiegt?«
Tarfaya blickte Henri hocherfreut an. »Nicht wahr? Das ist die Frage! Die Antwort kennen nur wenige Glückliche, ich bin einer davon. Sie lautet folgendermaßen: Nur ein geringer Teil des Salzes wird in Tanbutu verbraucht. Da man sich in dieser Stadt in der Nähe der Tagundnachtgleiche befindet, ist es zu gewissen Jahreszeiten so heiß, dass ihr Blut verfault, wenn sie dagegen kein Salz einnehmen. Was nützt Goldstaub? Er reinigt das Menschenblut nicht. Sie bereiten sich eine Medizin zu. Ein kleines Salzstück wird in Wasser aufgelöst und täglich getrunken. Sie haben herausgefunden, dass dieses einfache Gebräu ihr Leben erhält. Das restliche Salz zertrümmern sie in so große Stücke, dass ein Mann diese mit einer gewissen Geschicklichkeit bei Reisen auf dem Kopf transportieren kann. Im Land Melli, diesem reichen, stolzen Land, begegnet man vielen Karawanen und vielen Eingeborenen zu Fuß, ganzen Heeren, die Salz auf dem Kopf balancieren, denn sie legen ständig große Entfernungen zurück.«
Alle Ankömmlinge warteten gespannt, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Selbst die Musikanten spielten leiser.
»Die Salzträger führen auf ihrem Marsch zwei Gabelstöcke mit. Einen in jeder Hand, um diese, wenn sie müde sind, in den Boden zu rammen, darauf die Last abzulegen und sich so auszuruhen. So ziehen sie von Wasserstelle zu Wasserstelle. Und jetzt wird es spannend. Denn warum sie an eine ganz bestimmte Wasserstelle ziehen, das weiß ich. An dieser Wasserstelle nämlich, es ist eigentlich ein großer See, markieren sie ihre Salzblöcke mit Zeichen – und ziehen sich eine halbe Tagesreise weit ins Land zurück.«
»Mit Zeichen? Warum das denn?«, fragte ein Matrose verdutzt.
»Tjaaa! Während ihrer Abwesenheit, mitten in der Nacht, legen nämlich große Boote an den Flussufern an. Schwarze steigen aus. Sie wollen nicht gesehen, erkannt, angesprochen werden. Niemand weiß, wer sie sind, welchem Stamm sie angehören, ob sie von Inseln in dem See kommen, nur dass sie schwarz sind, hat man gesehen.«
»Sind sie Betrüger?«
»Nichts dergleichen. Sie lassen ja sowohl das Gold als auch das Salz liegen, versteht Ihr? Es geht folgendermaßen weiter: Wenn die Salzträger mit der Menge Goldstaub, die neben ihrem Salzblock liegt, zufrieden sind, lassen sie das Salzstück liegen, nehmen das Gold an sich und ziehen sich erneut eine halbe Tagesreise weit zurück. Sind sie nicht zufrieden mit dem Gegenwert, lassen sie ihn neben dem Salz liegen. Die geheimnisvollen Schwarzen von den Inseln kommen erneut, sie nehmen nur das Salz mit, neben dem kein Gold mehr liegt. Sind sie am Kauf der übrigen Stücke interessiert, legen sie noch mehr Gold hin, wenn nicht, lassen sie das Salz unberührt.«
»Und die Handelspartner bekommen sich nie zu Gesicht?« Henri konnte es kaum glauben.
»Niemals. Es muss ein uralter Brauch sein, der bis in die Zeiten des Propheten zurückgeht, und alle halten sich daran.«
»Aber sagt«, wollte Henri wissen, »hat noch niemand versucht, den geheimen Herkunftsort der schwarzen Goldkundigen ausfindig zu machen?«
»Doch«, meinte der Maure bedeutungsvoll. »Natürlich.«
»Ja und? Erzählt doch!«
»Vor einigen Jahren nahm sich der damalige Kaiser von Melli vor, gleichgültig, was es koste, einen dieser schwarzen Goldmänner in seine Gewalt zu bringen. Nachdem er darüber Rat gehalten hatte, zogen einige seiner Leute mit dem Vorsprung von ein paar Tagen vor der nächsten Salzkarawane an den genannten See. Sie hoben Gräben aus und versteckten sich darin. Die Karawane traf ein, die Nacht kam, und aus ihrem Schatten lösten sich die schwarzen Männer mit ihrer kostbaren goldenen Fracht in Säckchen aus Leinen. Der Austausch sollte vor sich gehen wie all die Hunderte von Jahren zuvor. Doch da waren die Häscher. Sie fesselten drei der Schwarzen, der Rest ergriff unter wüsten Rachedrohungen die Flucht auf Schilfbooten. Bevor sich die Häscher auf den Weg zurück nach Tanbutu machten, ließen sie zwei Gefangene frei. Mit dem übrig gebliebenen Gefangenen versuchten sie ein Gespräch, doch er sprach keine ihrer Sprachen. Nicht nur das. Er weigerte sich auch, zu essen und zu trinken. Sie versuchten alles. Doch es war vergeblich. Er starb noch auf der Rückreise. Natürlich war daraufhin der Kaiser sehr verärgert. Er wollte wissen, wie der gefangene Neger ausgesehen habe. Tiefschwarz, schwarze Augen, lange Zähne, wohlgeformter Körper, größer als sie selbst, antworteten die Häscher. Und seine Unterlippe sei eine Spanne größer gewesen als alle anderen Unterlippen, breiter, blutrot, und sie hing bis über sein Kinn. Aus Lippen und Zahnfleisch sei unaufhörlich Blut ausgetreten.«
»Ist der Tauschhandel nach diesem Vorfall weitergegangen?«, wollte Henri wissen.
»Nein. Er ruhte ganze drei Jahre lang.«
»Dann nahmen die Leute vom See ihn wieder auf?«
»Sie mussten. Sie verfaulten in der Sonne. Sie brauchten Salz.«
»Seitdem läuft der Handel wieder?«
»Ohne Probleme. Die eine Seite braucht Salz, die andere Gold. Wollt Ihr ein bisschen von dem Goldstaub sehen, Freunde?«
Die Matrosen bekamen erneut einen gierigen Gesichtsausdruck.
Der Maure schnipste mit den Fingern, daraufhin brachten Diener auf leisen Sohlen zwei braune Säckchen. Der Gastgeber legte sie vor sich hin, öffnete sie – und ließ den feinen Staub auf eine Unterlage aus Palmblättern rieseln. Die Männer rückten näher und starrten.
Der Maure sah triumphierend in die Runde. Er gab noch diese und jene Geschichte zum Besten.
Henri wusste von der gefährlichen Wirkung des Goldes auf die Menschen. Als Schatzmeister des ehemaligen Templerordens hatte er diese Wirkung studieren können. Er verwünschte das Gold.
Gäste und Gastgeber plauderten angeregt, jeder lauschte den Geschichten Tarfayas, fühlte sich wohl und sicher. Die Sichel des Halbmondes zog einmal ganz über den Himmelsausschnitt, der vom Hof aus zu sehen war.
Nach und nach wurden die Stimmen leiser. Man trank noch einige Becher, dann sanken alle auf ihr Lager und schliefen dort ein, wo sie lagen.
Auch Tarfaya schien zu schlafen.
Die grimmigen Männer mit den Krummdolchen standen in den umlaufenden Säulenarkaden und wachten. Nichts geschah.
Bis zum Morgengrauen.
Dann war plötzlich alles anders.
Henri, der sich vorgenommen hatte, nicht einzuschlafen, war im Morgengrauen doch eingenickt. Seine Gefährten erwachten aus den tiefsten Tiefen eines kurzen Schlafes, der ihre Gedanken in matte Schleier hüllte, und tauchten auf, hinein in einen weißgrauen Nebel, dazu lag ein immer lauter werdendes Flirren in der heißen Luft, das in diesem Moment eine schreckliche Gestalt annahm. Eine Art Gestalt jedenfalls, die gebildet wurde durch eine rote Masse aus länglichen, zuckenden Einzelteilen, die sich zu einem wütenden, flirrenden Gesamtkörper vereinten.
Die Gäste des Mauren schreckten hoch.
Offensichtlich war eine Art Strafgericht angebrochen.
»Oh, Allah sei uns gnädig, und er sei gepriesen!«, schrie der Maure. »Raus aus dem Haus, wir müssen sie vertreiben! Hinunter zum Fluss!«
Seine Männer hatten schon das Tor aufgerissen und stürmten hindurch, ohne zurückzublicken.
Alle anderen Bewohner des Ortes waren ebenfalls unterwegs. Wie Bienen im Stock brummten sie durch das Labyrinth der schmutzigen Wege, drängelten und behinderten sich gegenseitig, und das Flussufer unten war schon bedeckt von Leibern – eine unabsehbare Menge, so weit das Auge reichte, die schrie und sang und mit Ruten um sich schlug. Zum Nebel in der Luft, den nur das Rot der flirrenden Masse teilte, stieg jetzt auch der Staub der Straßen auf zum Himmel, die Morgensonne verdüsterte sich. Und die trampelnden Füße zertraten auf dem Weg hinunter kleine Tiere, schon schienen die staubigen Pfade befestigt durch einen klumpigen, feuchten Matsch, der sich gleichmäßig in alle Fugen legte.
»Wenn sie sich niederlassen, fressen sie alles ab!«, schrie Tarfaya. Und schon war er weiter, wild um sich schlagend, seine weiße Tunika färbte sich rot, schwarz, feucht.
Henri schauderte vor Ekel, dann kam ihm langsam die Erleuchtung. »Es ist eine der ägyptischen Plagen! Heuschrecken!«, entfuhr es ihm fassungslos. »Ich habe von solchen Plagen gehört. Sie kommen alle zwei Jahre von der afrikanischen Küste herüber. Wenn sie öfter kämen, könnte hier niemand mehr leben.«
Den mandelfarbenen Frauen um sie herum fielen die Kopfbedeckungen zu Boden, die sie Alchezeli nannten, Männer kamen mit langen, dünnen Lanzen und kleinen Schilden aus hartem Leder heran, die Auta hießen, jeder wedelte mit dem, was er hatte, sprang und tanzte und schrie, aber das war kein Spiel, es ging um Leben und Tod.
Der Kampf ging verbissen weiter. Und erst nach zwei Stunden, alle waren schweißüberströmt, husteten und keuchten nach Luft, erhoben sich die Heuschrecken wie auf ein geheimes Kommando – und flogen knatternd davon.
Es war, als zerspränge der Himmel in winzige Teile.
Dann legte sich eine Stille über das Land am Fluss, die an einen Gedenkgottesdienst gemahnte. Alle waren zu Tode erschöpft. Und die Frauen setzten ihre Alchezelis wieder auf.