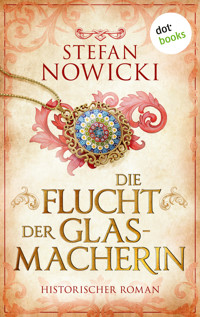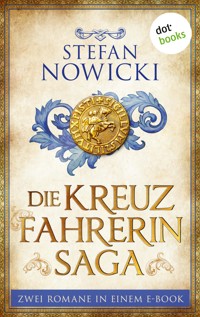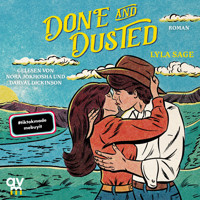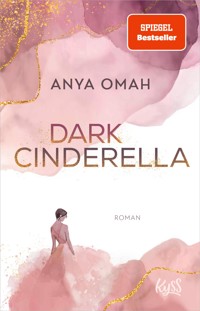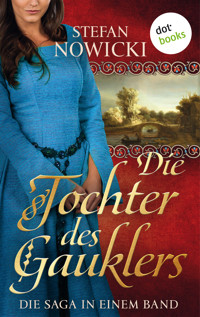
8,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie die Abgründe des Mittelalters: Die historische Saga »Die Tochter des Gauklers« von Stefan Nowicki als eBook-Sammelband bei dotbooks. Darf eine Frau ohne Rechte es wagen, von einer besseren Zukunft zu träumen? Als Uta im Jahre 1283 mit der Gauklertruppe ihres Vaters durch das Stadttor schreitet, ist sie voller Hoffnung: Kann Hameln ihre neue Heimat werden? Noch ahnt Uta nicht, dass sich hinter den prachtvollen Fassaden ein Sturm zusammenbraut, denn jeder der reichen Händler und Handwerker muss einen Erben bestimmen – und verdammt so dessen Geschwister zu einem Leben in Abhängigkeit. Die Stadtmauern sind längst zu eng … aber wohin sollen die jungen Menschen gehen, um ihr Glück zu finden? Für Uta scheint sich indes alles zum Guten zu wenden: Sie beherrscht wie keine Zweite die Kunst des Rattenfangens, was sie beliebt macht bei den Herren der Kornspeicher. Und noch dazu findet sie in Lorenz, dem Steinmetz-Lehrling, ihre große Liebe. Doch sie macht sich auch erbitterte Feinde, die das »Rattenmädchen« aus der Stadt jagen wollen … Wir alle kennen die Legende, aber was ist damals wirklich passiert? Bestsellerautor Stefan Nowicki begeistert in seiner Trilogie mit einer ganz neuen Interpretation des Rattenfänger-Mythos – voller sympathischer Protagonisten und überraschender Wendungen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Die Tochter des Gauklers« vereint die drei fesselnden Romane von Stefan Nowickis historischer Saga. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 985
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Darf eine Frau ohne Rechte es wagen, von einer besseren Zukunft zu träumen? Als Uta im Jahre 1283 mit der Gauklertruppe ihres Vaters durch das Stadttor schreitet, ist sie voller Hoffnung: Kann Hameln ihre neue Heimat werden? Noch ahnt Uta nicht, dass sich hinter den prachtvollen Fassaden ein Sturm zusammenbraut, denn jeder der reichen Händler und Handwerker muss einen Erben bestimmen – und verdammt so dessen Geschwister zu einem Leben in Abhängigkeit. Die Stadtmauern sind längst zu eng … aber wohin sollen die jungen Menschen gehen, um ihr Glück zu finden? Für Uta scheint sich indes alles zum Guten zu wenden: Sie beherrscht wie keine Zweite die Kunst des Rattenfangens, was sie beliebt macht bei den Herren der Kornspeicher. Und noch dazu findet sie in Lorenz, dem Steinmetz-Lehrling, ihre große Liebe. Doch sie macht sich auch erbitterte Feinde, die das »Rattenmädchen« aus der Stadt jagen wollen …
Wir alle kennen die Legende, aber was ist damals wirklich passiert? Bestsellerautor Stefan Nowicki begeistert in seiner Trilogie mit einer ganz neuen Interpretation des Rattenfänger-Mythos – voller sympathischer Protagonisten und überraschender Wendungen!
Über den Autor:
Stefan Nowicki, geboren 1963, studierte Germanistik, Politik, Kunstgeschichte, Philosophie und Theologie. Er arbeitet unter anderem als freier Kulturjournalist für verschiedene Zeitungen und lebt in der Nähe von Augsburg.
Der Autor im Internet: www.stefannowicki.de
Stefan Nowicki freut sich darüber, über Facebook in Kontakt mit seinen Lesern zu treten: http://www.facebook.com/stefannowicki.w.u.t
Stefan Nowicki veröffentlichte bei dotbooks bereits den Bestseller »Die Kreuzfahrerin«, in dem er die abenteuerliche Lebensgeschichte der jungen Deutschen Ursula erzählt, und »Der Sohn der Kreuzfahrerin«, in dem er sich Ursulas Sohn Shakib widmet.
***
Sammelband-Originalausgabe September 2020
Coypright © der Einzelbände 2018 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Everett Art, Marta Jonina und Period Images Mary Chronis Dunraven Productions
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-001-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Tochter des Gauklers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stefan Nowicki
Die Tochter des Gauklers
Die Saga in einem Band
dotbooks.
ERSTES BUCHDie Tore von Hameln (Anno Domini 1283)
»Anno 1284. Am Dage: Johannis et Pauli.War der 26. Iunii. Durch einen PiperMit allerlei Farve bekledet gewesenCXXX Kinder verledet binnen Hameln GebonTo Calvarie bi den Koppen verloren.«
Inschrift auf dem »Rattenfängerhaus« in Hameln – mehr darüber erfahren Sie am Ende dieses eBooks im Nachwort des Autors
Kapitel 1
»Es reicht jetzt!« Die Wut in der Stimme des Familienoberhaupts und die Zornesfalte auf seiner Stirn ließen alle am Mittagstisch der Steinmetzfamilie furchtsam innehalten. Die Jüngsten trauten sich nicht einmal mehr, den Bissen im Mund herunterzuschlucken. Nur Lorenz sah seinen Vater mit beinahe ebenso zornigem Gesicht an, nicht bereit, sich geschlagen zu geben.
»Nein! Ich …« Weiter kam er nicht.
»Schluss!«, brüllte der Vater und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass Schüssel und Becher erzitterten. Erschrocken weiteten sich die Augen der Kinder. Eine Ratte, die sich mit ihrer spitzen Schnauze gerade hinter dem gemauerten Herd hervorgewagt hatte, um eine Brotkrume zu ergattern, machte blitzschnell kehrt und warnte ihre Artgenossen mit einem Fiepen. Im Sonnenlicht, das wie ein goldener Balken schräg durch einen Spalt in der Bretterwand auf den Tisch fiel, erhob sich ein Wölkchen von der Hand des Steinmetzen. Der Hieb hatte den feinen Steinstaub aus den Falten und Poren der Haut getrieben. Die umherwirbelnden, im Licht aufleuchtenden Hinterlassenschaften der Steinmetzarbeit, die stets Haut, Haare und Kleider des Vaters bedeckten, waren für einen Wimpernschlag die einzige Bewegung im Raum. Auch unter dem Grau des Gesteinsmehls war die Zornesröte in Willins Gesicht deutlich zu sehen. Leise, fast tonlos zischend, fuhr er fort: »Ich dulde kein weiteres Widerwort in meinem Haus, Sohn. Du wirst dich fügen.«
»Nein!« Lorenz sprang auf. Sein Schemel polterte über die Dielen. »Nein. Ich werde die Müllerstochter nicht heiraten. Sie ist gemein, und sie stinkt aus dem Maul wie ein toter Ratz.« Er wischte zur Tür hinaus, ließ den Staub und die Gewitterwolken des seit Monaten schwelenden Streits hinter sich und eilte auf die Gasse.
Willin wäre seinem Sohn am liebsten nachgesprungen, hätte ihn mit starker Hand gepackt und ordentlich durchgeschüttelt. Aber er blieb sitzen und hustete. Der Staub unzähliger behauener Steine lag ihm auf der Lunge, und besonders, wenn er sich aufregte oder es eilig hatte, bekam er immer schwerer Luft. Er wusste, dass er nicht mehr schnell genug war. Vor über 20 Sommern, in Lorenz’ Alter, da hätte das anders ausgesehen. Sein Vater, ein tatkräftiger Mann, hätte ihm ein solches Verhalten nie durchgehen lassen. Er war hart gewesen gegen sich selbst und gegen seine Kinder.
Vor vier Generationen war die Familie hierhergekommen und hatte sich, wie manch anderer auch, im Schutz des Stifts niedergelassen. Das Stift und die Lage der Stadt am Fluss und an der Heerstraße nach Osten hatten gutes Gedeihen versprochen. Und so hatten seine Ahnen ihren Teil dazu beigetragen, den Ort zum Erblühen zu bringen. Immer waren sie fleißig gewesen und hatten ihre Pflicht erfüllt. Sein Vater war mit all den anderen Männern der Stadt in die Schlacht von Sedemünder gezogen. Damals hatte der Bischof von Fulda die Stadt über die Köpfe der Siedler hinweg an seinen Amtsbruder, den Bischof von Minden, verkauft, sodass die Hamelner um ihre Unabhängigkeit fürchteten. Sie griffen zu den Waffen und zogen in den Kampf, doch gegen die Truppen des Mindener Bischofs hatten sie keine Chance gehabt. Willins Vater war erst von einem Pfeil getroffen und dann mit einem Schwert erschlagen worden. Viele waren damals getötet worden und der Rest in Gefangenschaft geraten. Es war ein Segen für alle, als der mächtige Herzog von Braunschweig vermittelnd eingriff und die Stadt, die immer mehr an Bedeutung gewann, unter den Schutz der Grafen von Spiegelberg stellte.
Willin musste von da an die väterliche Werkstatt weiterführen, Bruder, Mutter und Schwester durchfüttern. Bereits damals, mit 15 Lenzen, brachte man ihm Respekt entgegen. Er war bekannt für seine Kraft und seinen Durchsetzungswillen. So verhalf er der Werkstatt, die sich auf die Herstellung von Mühlsteinen verlegt hatte, zur Blüte und mehrte sein Ansehen in der Stadt. Hameln war, seit wieder Frieden eingekehrt war und die Ratsherren erfolgreich ihre Geschicke lenkten, beständig gewachsen. Vielen Handwerkern und Händlern innerhalb der Mauern ging es gut. Der Wohlstand sorgte aber auch dafür, dass die Familien wuchsen und immer mehr Leute vom Land kamen, um als Städter in Freiheit zu leben. Nicht nur am Münster und an der Marktkirche wurde gebaut, überall wollten die Menschen ihre Häuser vergrößern, und immer häufiger kam es zu Streitereien um den wenigen Grund, auf dem sich noch jemand niederlassen konnte. Der Platz in der von der Weser und der Hamel umschlossenen Stadt reichte längst nicht mehr aus, und besonders die Ackerleute errichteten ihre Häuser jenseits der Stadtmauer bei ihren Feldern.
Schon lange war Willin sich mit seinem Freund Gallus, dem Müller, einig: Die Mitgift seiner Tochter Viktoria würde zusammen mit dem Besitz der Steinmetzfamilie aus einem zerstückelten Areal am Rande der Stadt einen Bauplatz machen, der bis ans Wasser reichte. Man könnte dort eine Mühle bauen und den Rest neuen Bürgern verkaufen. Das versprach gute Einnahmen und vor allem größeren Einfluss im Rat der Stadt.
Lorenz war anders als sein Vater. Nicht nur größer von Statur, sondern auch sehr klug. Im Umgang mit den Ausgaben, Löhnen und Einnahmen war er ihm eine große Hilfe. Es war Willins Wunsch, dass sein Sohn einst in den Rat der Stadt aufgenommen würde. Aber sein Erstgeborener wollte einfach nicht verstehen, dass es um das Wohl der ganzen Familie und auch um die Zukunft seiner Geschwister ging. Die Weigerung des Jungen, sich in die Pläne der beiden Väter zu fügen, war Willin ein großes Ärgernis, und als Familienoberhaupt konnte er das nicht akzeptieren.
Der Rest der Familie saß immer noch verschreckt und bewegungslos am Tisch. Keiner traute sich, seinen Löffel in die Schüssel mit Brei mitten auf dem Tisch zu tauchen. Missmutig pochte Willin mit seinem hölzernen Löffel auf die Tischplatte, schaute kurz auf, schöpfte eine ordentliche Portion aus der Schüssel und brummte: »Esst!«
Der väterlichen Aufsicht und dem Streit entkommen, stürmte Lorenz voran. Doch die ersten verwundert aufschauenden Nachbarn gemahnten ihn, seine Flucht zu bremsen. Wütend stapfte er durch den Unrat der Gasse, der Zorn stand ihm ins Gesicht geschrieben. Entgegenkommende wichen vorsichtshalber aus. Er hatte den Weg zum Markt eingeschlagen, wo er ein paar Freunde und Altersgenossen zu treffen hoffte. Er musste seinem Ärger Luft verschaffen, auch wenn er wusste, dass sie nur die Augen verdrehen würden, wenn er zum wiederholten Male den Streit zwischen ihm und seinem Vater ansprach. Es war bereits der zweite Sommer, seit Vater den Plan kundgetan hatte, durch eine Vermählung der Kinder die Beziehungen zwischen den Familien des Steinmetzen und des Müllers zu festigen. Beide Väter erhofften sich davon Gewinne und stärkere Positionen innerhalb der Stadt. Was die Kinder von dem Plan hielten, spielte keine Rolle.
Bei dem Gedanken verfinsterte sich seine Miene erneut. Nein, selbst wenn Vater ihn vor die Tür setzen würde, war er nicht bereit, seinem Wunsch zu entsprechen. Die Tochter des Müllers war nicht nur gemein und eklig, wenn sie den Mund aufmachte, sie war auch hinterlistig und verwöhnt. Sie zu freien, würde ihn zu ihresgleichen machen, und seine Freunde würden sich von ihm abwenden. Missmutig trat er gegen einen Korb mitten auf der Gasse. Zwei nacktschwänzige Schatten suchten das Weite. »Drecksviecher!« In seiner Wut hätte er die Tiere am liebsten auf der Stelle erschlagen, aber sie waren längst verschwunden. Die Besitzerin des Korbs allerdings, die gerade über die Schwelle ihres Hauses ins Licht der hochstehenden Sonne trat, protestierte: »He, Bursche! Was fällt dir ein?«
Lorenz beachtete sie nicht. Zwischen den vielen Leuten, die heute die Gassen der Stadt bevölkerten, war er schon bald nicht mehr zu sehen, und ihr Gezeter ging im allgemeinen Trubel unter.
Er erreichte den Marktplatz, und schon von Weitem konnte er seine Altersgenossen am Brunnen sehen. Es war die übliche Gruppe jener, die es sich leisten konnten, am helllichten Tag auf dem Marktplatz rumzusitzen.
Jakob und Gunnar waren beide Kaufmannssöhne und fanden häufig Gelegenheit, den väterlichen Häusern zu entfliehen. Außerdem hatten sie immer genug Münzen dabei, um sich und den Freunden den ein oder anderen Krug Bier oder Wein zu gönnen. Dieser Wohlstand war ihnen schon von Weitem anzusehen. Ihre Beinlinge waren eng anliegend geschnitten, der Kittel aus grünem Tuch besaß einige Ziernähte, und über dem ledernen Gürtel wölbten sich recht ansehnliche Bäuche. Den neuen Ideen der Zeit folgend, trug besonders Gunnar einen deutlich von der Bruche abgesetzten Hosenlatz. Ganz anders sah der Dritte im Bunde aus, Singulf, der Sohn des Gewandschneiders. Er war groß gewachsen; schmal und lang wie eine Bohnenstange überragte er die Freunde um mindestens zwei Handbreit, und so feingliedrig wie seine Hände mit den langen, dünnen Fingern – die wie Spinnenbeine wirkten – war seine ganze Statur dürr und klapprig. Selbst die Haare waren dünn und hingen glatt und dunkelbraun bis auf die Schultern. Auch sein Kittel war farbig und verziert, die Beinlinge allerdings schlotterten um die mageren Beine. Im Gegensatz zu den anderen trug er an den Füßen nicht lederne Lappen, die mittels Riemen über dem Spann und den Knöcheln zusammengezogen und gebunden waren, sondern ein Paar spitz zulaufender Schuhe, wie sie neuerdings immer mehr in Mode kamen. Die drei befanden sich im Gespräch mit zwei Fremden, als Lorenz den Marktplatz überquerte.
»Glaubt mir! Ungelogen! Vom Schwanz bis zur Nasenspitze maß das Biest mindestens eine Elle.« Die Größe andeutend, hob Gunnar die Hände in die Luft. Die anderen quittierten es mit ungläubigem Grinsen. »Ihr könnt mir ruhig glauben. Ich habe selbst noch nie eine so große gesehen. Und just in dem Moment, als ich meinen Knüppel hob, um sie zu erschlagen, sprang sie mich an. Ich konnte gerade noch den Arm hochreißen, um mein Gesicht zu schützen.«
Die Umstehenden lachten.
»Das ist nicht lustig! Das Biest hing an meinem Arm und versuchte, mich zu beißen. Ich habe jetzt noch die riesigen gelben Zähne vor Augen. Ich stolperte und fiel rücklings zwischen die Fässer. Da ließ sie ab und rannte davon. Ich sage euch, so einem Untier wollt ihr nicht begegnen.«
»Lorenz, sei gegrüßt. Komm, das musst du dir anhören.« Singulf war der Erste, der von ihm Notiz nahm. »Gunnar erzählt uns gerade von seiner neuesten Heldentat. Er hat sich von einem Ratz über den Haufen rennen lassen.«
Alle lachten.
»Das ist nicht wahr.« Gunnar hob erneut die Hände. »Sie war mindestens so groß, und ich bin gestolpert«, verteidigte er sich. Doch gegen den Spott der anderen konnte er nichts mehr ausrichten.
Einer der beiden Fremden ergriff das Wort: »Eine einzelne große kann einen schon erschrecken, aber komm mal auf unseren Kahn, wenn wir Getreide geladen haben. Dann traust du dich kaum in den Laderaum. Wirklich fürchten muss man sich nur, wenn es viele sind. Ich stand einmal so einer Meute gegenüber. Manchmal denke ich, sie können sich untereinander verständigen und sind listiger als Wegelagerer im Wald.«
»Lorenz, grüß dich. Das hier sind Brun und Heimerich, Schiffer. Sie haben gerade neuen Stein aus dem Bergland gebracht. Da wirst du jede Menge neue Mühlsteine hauen können.« Gunnar grinste schadenfroh.
Lorenz achtete nicht darauf und griff nach dem Krug, den Jakob ihm zur Begrüßung hinhielt. Er nickte dankend, setzte an und nahm einen kräftigen Schluck. Als er sich den Mund mit dem Handrücken trocken wischte, hatte sich sein Zorn bereits gelegt. Die Freunde mit ihren Späßen und wortreichen Erzählungen waren genau das richtige Mittel, um seinen Geist zu zerstreuen.
»Ob eine einzelne große oder eine ganze Meute, sie greifen dich nur an, wenn du sie in die Enge treibst«, nahm Jakob das Thema wieder auf. »Ansonsten sind sie listig und feige. Erst gestern, als ich mich schlafen legen wollte, habe ich zwei erwischt, die offensichtlich zusammenarbeiteten.«
»Ach, arbeiten nennst du das jetzt.« Gunnars Grinsen ließ keinen Zweifel, worauf er hinauswollte.
»Quatsch!« Jakob ging nicht weiter auf die Anspielung ein. »Weil Vater während des Markts ein paar Händler bei uns aufnehmen möchte, müssen wir Kinder alle zusammen in einem Zimmer schlafen. Ich komme also zu den Betten, und Gott sei Dank hatte ich noch ein Licht. Ich schlage also die Decke zurück, unter der mein kleiner Bruder liegt, und da sehe ich sie. Max hatte einen Kanten Brot mit ins Bett genommen. Er hielt ihn noch in der Hand, ganz nahe an seinem Mund, schlief aber schon fest. Die Ratten waren zu ihm unter die Decke gekrochen und labten sich an dem Brot. Als ich sie nun störte, stellte sich die eine vor die andere und fauchte mich an, während die zweite versuchte, den Brotkanten wegzuzerren. Ich nahm meinen Schuh und schlug nach ihnen, erst da suchten sie das Weite.«
»Du hast recht.« Singulf ergriff das Wort und streckte die Hand in Richtung Lorenz aus. Lorenz verstand das Zeichen und reichte den Krug an ihn weiter. »Die Biester sind überall, und sie werden immer frecher. Ich habe so etwas Ähnliches auch schon erlebt. Sie sind schlau und meistens nicht allein. Es dauert nicht mehr lange, und sie werden sich nicht mehr mit Brotkrumen begnügen, sondern kleine Kinder und Schlafende annagen. Da kannst du doch froh sein, dass ihr alle zusammen das Lager teilt und so doch einigermaßen sicher seid.«
»Pah! Das schreckt die Viecher doch nicht ab. Wir liegen da wie eingesalzene Fische in den Fässern, trotzdem kriechen sie zwischen uns umher.«
»Jetzt stell dich nicht so an. Du findest es doch gut, wenn jemand zu dir kriecht, und eine Rättin ist wohl das einzige weibliche Wesen, das mit dir das Lager teilen mag.« Mit dieser Anspielung nahm Gunnar Singulf den Krug ab. Wieder mal versuchte er, das Gespräch auf sein Lieblingsthema zu lenken.
Lorenz wurde leichter ums Herz bei diesem derben Geplänkel, und er sprang für Singulf ein. »Na, Gunnar, wer oder was würde sich denn zu dir legen? Von welchem Weib hast du letzte Nacht geträumt? Du selbst liegst doch mit deinen Brüdern unter einer Decke.«
Gunnar gab nicht klein bei und holte zum Gegenschlag aus. »Stimmt. In der ganzen Stadt gibt es wohl kein Lager, das sich nicht mehrere teilen müssen, außer vielleicht die Bettstatt der Müllerstochter.«
Die Worte und das verschlagene Grinsen weckten erneut den Zorn in Lorenz. Am liebsten hätte er Gunnar beim Kragen gepackt und ihm eine gehörige Maulschelle verpasst. Er schluckte, versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, griff nach dem Krug und bemerkte betont gleichmütig, bevor er ihn an die Lippen setzte: »Ach, Gunnar, bist du noch immer nicht darüber hinweg, dass Viktoria dich keines Blickes würdigt?«
Die anderen lachten nur kurz auf. Die Spannung zwischen Gunnar und Lorenz war deutlich zu spüren.
»Ha, ich hab es nicht nötig, in anderer Kerle Tümpel zu fischen. Ich hätte da schon einige andere Fischlein an der Angel.«
»Wie nennst du das? Angeln? Was dir fehlt, ist ein richtiger Haken. Die Fischlein, die du zu fangen glaubst, knabbern doch noch nicht einmal an deinem Würmchen und sind verschwunden, wenn du versuchst, sie an Land zu ziehen. Aber nur zu, fisch weiter. Den Tümpel, in dem du mir in die Quere kommst, gibt es noch nicht. Und die Müllerstochter. Geschenkt. Fang sie dir. Vielleicht hab ich dann endlich meine Ruhe. Mein Vater fing erst heute wieder von seinen Plänen an. Ich kann es wirklich nicht mehr hören.«
»Ist das wirklich wahr?« Brun, der eine Schiffer, war hellhörig geworden. »Gibt es in der ganzen Stadt keinen Platz mehr für Reisende und Händler?«
»Jetzt, da Markt ist, wirst du in den Herbergen wohl kaum eine bequeme Schlafstatt erhalten. Wenn du Glück und Freunde hast, findest du vielleicht bei einer Familie Unterschlupf. Brauchst du denn eine Unterkunft?«, antwortete Jakob. Die anderen nickten dazu.
»Nein, ich habe mein Lager auf unserem Kahn. Aber wir haben zwei Reisende mitgenommen. Sie haben letzte Nacht noch bei uns verbracht. Wir würden sie sehr gerne loswerden. Der eine schnarcht so laut, dass die Planken des Schiffes erzittern, und der andere furzt in einem fort.«
»Versuch es doch beim Müller.« Wieder grinste Gunnar und bedachte Lorenz mit einem versöhnlichen Blick. »Seine Tochter ist bildhübsch, und da sie von unserem Lorenz verschmäht wird, möchte sie sich vielleicht mit ein paar Handelsleuten trösten. Mir scheint, die beiden von eurem Kahn sind ihr geradezu auf den Leib geschnitten. Die Müllerstochter ist auch auf ihre Weise laut, und stinken tut sie auch, zwar am anderen Ende, aber das könnte wirklich passen.«
Jetzt lachten alle. Auch Lorenz konnte sich dem nicht entziehen. Es waren genau diese deftigen Scherze, die ihn die Gesellschaft von Gunnar, Jakob und Singulf suchen ließen.
Der Klang einer Pfeife und das dumpfe Pochen einer Trommel drangen plötzlich an ihre Ohren. Auf der anderen Seite des Platzes spuckte eine Gasse immer mehr Menschen aus, hüpfend und rennend einige Kinder vorneweg. Dann tauchten ein paar bunte Gestalten auf und zwei Wagen. Die Kinder scharten sich besonders um einen Mann, dessen Gewand aus vielen verschiedenfarbigen Stoffen zusammengefügt war. Er sprang von einem Kind zum anderen, schlug Rad, lief auf den Händen, um gleich wieder aufrecht zu stehen und mit einigen Kugeln zu jonglieren. Er war beständig in Bewegung, erntete Beifall und Gelächter, während sich die beiden Fuhrwerke einen geeigneten Standort am Rande des Marktplatzes suchten. Trommel und Pfeife setzten zu einem neuen Stück an, und ein Mann mit Sackpfeife stimmte mit ein. Zwei Frauen begannen, sich zu den Klängen im Kreis zu drehen. Den jungen Männern am Brunnen kam die Abwechslung gerade recht. Es bedurfte nur eines aufmunternden Nickens von Gunnar in Richtung der Spielleute, und die Freunde setzten sich in Bewegung.
Kapitel 2
An diesem Morgen waren sie früher aufgebrochen als sonst. Schon am Abend zuvor, als sie das Lager aufschlugen, waren alle in Erwartung der Stadt gewesen. Jene unter ihnen, die sich auskannten, hatten gesagt, dass sie heute ihr Ziel erreichen würden. Aber die genaue Entfernung wusste natürlich niemand. Eigentlich spielte es auch keine Rolle. Ob sie heute oder morgen ankämen, würde kaum einen Unterschied machen. Unerfreulich war es immer nur, wenn sie einen Ort erreichten und die Tore bereits verschlossen waren. Dann mussten sie vor den Mauern kampieren und den nächsten Tag abwarten. Keiner von ihnen war erpicht darauf. Die Bleibe für die nächsten Tage oder Wochen direkt vor der Nase, hatte niemand Lust, ein Zelt aufzubauen oder irgendetwas auszupacken. Man behalf sich in solchen Situationen mit dem Nötigsten und blieb insgesamt unzufrieden. Dann lieber früh aufstehen, sich auf den Weg machen und rechtzeitig ankommen.
Seit sie denken konnte, waren sie so unterwegs. Schon die Großeltern waren Possenreißer, Akrobaten und Spielleute gewesen, und sie hatten ihr auch das meiste beigebracht. Das Häufchen Fahrender war keine feste Gesellschaft, es kamen immer wieder welche hinzu, derweil andere an Orten hängen blieben, sich für einen anderen Weg entschieden oder ganz plötzlich einfach weggingen oder verschwanden. So wie ihre Mutter. Sie war angeblich gleich nach ihrer Geburt im Kindsbett gestorben. Vielleicht hatte sie Vater auch wegen eines anderen Mannes verlassen. Ihr waren nur der Vater und die Großeltern geblieben. Nie wurde über die Mutter gesprochen, und soweit sie zurückdenken konnte, war man ihren Fragen ausgewichen. So war es eben. Die Großeltern waren immer für sie da gewesen, bis zuletzt, als sie beide nach einem langen, nassen Sommer im Winter Opfer eines Fiebers geworden waren.
Sie war mit Vater weitergezogen, von Ort zu Ort, kreuz und quer durch die Lande, nur gesteuert von den Berichten anderer Reisender, die Auskunft darüber gaben, wann und wo ein Markt oder ein Fest bevorstand, wo ihre Künste geschätzt wurden und gute Einnahmen lockten. Sie, das fahrende Volk, die Leute von der Straße, hatten irgendwie ein Gespür dafür, wann sie wo sein sollten. Nicht immer wurden sie von diesem besonderen Sinn richtig geleitet. Manchmal bestand der erhoffte Markt aus dem Wagen eines Kesselflickers und ein, zwei bäuerlichen Ständen. Es gab gute und schlechte Orte. Es kam auch vor, dass man sie verjagte und die Tore vor ihnen verschlossen hielt. Grund dafür war meist die Angst der Leute, die Fremden brächten Krankheiten mit. Es gab Orte, da lebten die Menschen in ständiger Angst vor Musik und Tanz. Meist gab es dort einen fanatischen Priester oder Mönch, der in seinen Predigten das fahrende Volk als Teil des Schlechten, das sich der Welt zu bemächtigen drohte, verdammte und die Gemeinde ermahnte, sich von den Fremden – deren Künste einzig und allein dazu da waren, Seelen zu verführen – nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen. Schon zweimal hatte Uta erlebt, wie sich ein Ort vor ihnen nicht nur verschlossen, sondern ein Mob, angeführt von ihrem Geistlichen, sie mit Feuer und Waffen bedroht und den Reisenden nach dem Leben getrachtet hatte. So war ihr Herz jedes Mal, wenn sie sich einem neuen Ort näherten, erfüllt von einer Mischung aus Neugier und Furcht.
Ihr selbst ging es eigentlich genauso wie den Bewohnern der Siedlungen. Auch sie fühlte sich ängstlich und unsicher gegenüber Fremden. Das war diesmal nicht anders, auch wenn sie durch den Bericht eines Händlers, der ihnen begegnet war, wussten, dass sie in der Stadt vor ihnen bereitwillig aufgenommen werden würden. Das seltsame, ungute Gefühl blieb aber, denn sie wusste, dass Menschen, die fest an einem Ort lebten, den Umherziehenden gegenüber immer argwöhnisch waren. Sie war schon an so vielen Orten gewesen und nicht sicher, ob sie vielleicht schon einmal in dieser Stadt haltgemacht hatten. Die wenigsten Dörfer hinterließen einen bleibenden Eindruck. Sie waren irgendwie alle gleich. Die größeren Städte prägten sich mit ihren teilweise imposanten Bauwerken da schon eher ein.
Sie waren ein paar Tage durch Wälder gezogen. Die Landschaft war flach und der Weg selten schwer gewesen. Heute hatten sie sich allerdings über eine Hügelkette mühen müssen, und nun öffnete sich vor ihnen eine Ebene mit einem Fluss. Wenn sie mit den Augen dem im Sonnenlicht glitzernden Band des Wassers folgte, konnte sie in der Ferne Rauch über Dächern aufsteigen sehen und zwei Kirchtürme ausmachen, die alle anderen Gebäude überragten. Vater hatte gemeint, es wäre gut möglich, dass sie schon mal hier gewesen waren, aber wirklich gewusst hatte er es auch nicht. Er vollführte seine Späße, Kunststücke und Tricks überall, ob Dorf oder Stadt. Er war auf seine ganz spezielle Art ein Künstler, dem es in kürzester Zeit gelang, die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Ob er ein Ei hinter dem Ohr eines Kindes hervorzauberte, Rad schlug, jonglierte oder Grimassen schnitt, er zog die Menschen in seinen Bann. Manchmal half er auch bei den Theaterleuten aus und übernahm eine kleine Rolle. So wie er auf den Marktplätzen umherhüpfte, ständig von einem zum anderen eilte, von einem zum nächsten Kunststück wechselte, so lebte er, und so hatte er es ihr beigebracht. Sie waren ständig in Bewegung, wechselten die Orte, ließen sich nicht festlegen und waren frei. Vater genoss diese Freiheit, und auch wenn sie nichts anderes kennengelernt hatte, so wusste sie doch, wie teuer es erkauft war und wie sehr sie abhängig waren von vielen Dingen, die man nicht gleich sah, aber vor allem von den fremden Leuten.
Sie war des Umherziehens müde, und ab und an machte sich in ihr der Wunsch breit, irgendwo dazuzugehören. Manchmal schien es besonders schön und erstrebenswert, zu wissen, was einen am nächsten Tag erwartete und was es zu tun gab; zu wissen, wo man schlafen würde und was es zu essen gab. Ihr Platz war stets im Zelt neben Vater, auf dem Strohsack unter ihrer eigenen Decke. Aber mal stand das Zelt auf einem Marktplatz, mal lag der Strohsack auf mit Tannennadeln bedecktem Waldboden. Mal gab es Brei, ein paar Pilze, das Fleisch eines Vogels oder Hasen, einen Fisch, den einer gefangen hatte, oder gar nichts. Nicht selten hatten sie Hunger gelitten, besonders wenn sie von einem Ort abgewiesen worden waren und ihnen so die Möglichkeit genommen war, ihr Essen zu verdienen. Dann mussten sie weiterziehen und sich mit dem begnügen, was sie am Waldrand fanden, oder dem wenigen, was sie noch bei sich hatten. Am schlimmsten war es im Frühling. Meistens war es kalt und nass, und in der Natur gab es noch nicht viel. Der Sommer und der Herbst dagegen waren fette Zeiten. Überall wuchs und reifte etwas, das man im Vorbeigehen pflücken und gleich in den Mund stopfen konnte. Den Winter verbrachten sie immer innerhalb einer Siedlung, manchmal auch im Schutz einer Burg oder eines Klosters. Sie nahmen Arbeit an und durften bleiben. Je länger so ein Winter allerdings dauerte, umso missmutiger wurde ihr Vater, und er platzte geradezu vor Tatendrang, sobald er ihr Hab und Gut auf einen der Wagen werfen konnte und es wieder losging.
So waren sie Anfang des Jahres zuerst nach Osten und dann entlang eines Flusses nach Norden gezogen. Mit dem zur Neige gehenden Sommer hatten sie sich dann wieder nach Süden gewendet. Schon immer hatte Vater von einem Land hinter den Bergen geschwärmt, wo es selbst im Winter warm sein sollte. Jedes Jahr sprach er davon. Aber nie waren sie so weit gekommen. Gab es dieses Land überhaupt? Wo würden sie den kommenden Winter verbringen? Diese Fragen beschäftigten Uta seit einigen Tagen. Nun aber, da sie ihr Ziel erblickte, wurde sie durch Vaters Ruf aus ihren Grübeleien gerissen.
»Duhtar, Duhtar, schau!«
Uta hasste es, wenn er sie so rief. Als ihre Mutter gegangen war, hatte er sich so gegrämt, dass er außerstande gewesen war, ihr einen richtigen Namen zu geben. Er hatte sie einfach »Tochter« genannt, in der alten Sprache des Großvaters. Als sie sprechen lernte, war es ihr nicht gleich gelungen, den ersten und den letzten Laut zu formen, und aus dem kleinkindlichen »Duta« war so »Uta« geworden, und bald hatten alle sie so genannt. Nur er weigerte sich standhaft. Nun kam er heran, wie immer unstet und voller Vorfreude, die er kein bisschen zu verbergen suchte. Genau das war sein Zauber, dem die meisten erlagen: Er verstellte sich nie, versuchte nie, irgendeine Form zu wahren, sondern handelte immer völlig unbeherrscht, wie es ihm gerade einfiel.
»Schau!«, rief er noch einmal. »Das ist eine schöne Stadt. Und da ist auch noch ein breiter Fluss. Es ist derselbe, an dem wir im Norden waren. Sicher werden zum Markt auch Schiffe aus fernen Ländern kommen. Da werden einige Leute versammelt sein.« Er rieb sich erwartungsvoll die Hände. Mit strahlenden Augen und einem breiten Lächeln sah er sie an. Obwohl sie wusste, dass er das niemals tun würde, war ihr, als würde er ihr gleich um den Hals fallen und sie vor freudiger Erwartung umarmen. Doch über den Graben, den er gleich nach ihrer Geburt gezogen hatte, spannte sich keine Brücke. Immer hatte er sie pflichtbewusst umsorgt, ihre Fragen beantwortet, sie geduldig in Kunststücken und vielen anderen Dingen unterwiesen, nur wirkliche Nähe hatte der Schmerz über den Verlust seiner Frau nie zugelassen. Lange war Uta überzeugt gewesen, dass er ihr die Schuld daran gab, doch die Großeltern und auch er selbst hatten diese unguten Gedanken schließlich doch vertrieben.
»Ich muss mein Gewand anziehen.« Mit diesem Satz war er auch schon wieder auf dem Weg an die Spitze des Zuges, wo sich der Wagen mit ihrem Bündel befand. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis sie die Stadt erreichten – vermutlich gegen Mittag. Sie würden kurz vorher anhalten, und alle würden sich zurechtmachen und die Wagen für den Einzug in die Stadt vorbereiten. Alles, was an Dingen des täglichen Gebrauchs außen an den Fuhrwerken hing, musste abgenommen und auf den Ladeflächen verstaut werden. In den Gassen war es meistens eng, und es wäre nicht das erste Mal, dass ein am Wagen hängender Kessel zwischen all den Schaulustigen plötzlich Beine bekommt. Unterwegs auf der Straße machte sich niemand von ihnen Gedanken über Eigentum, doch manche Städter nahmen es mit ihrem Besitz nicht so genau. Überall gab es arme Schlucker, die nur auf eine Gelegenheit warteten, um sich zu nehmen, was sie gerade brauchen oder verkaufen konnten. Und als Fremde und Heimatlose hatten sie keine Rechte. Gelächter wäre alles, was sie ernten würden, sollten sie einen Verlust anzeigen. Also sicherten sie ihre Sachen, und auch wenn der Einzug in einen Ort ungeordnet und sorglos erschien, jeder Einzelne hatte seine Aufgabe und behielt jeweils seinen Teil der Habseligkeiten im Blick.
Bei dem Gedanken stellte sich in Utas Magen ein flaues Gefühl ein. Ihr Vater war da ganz anders. Es war bei jeder Ankunft das Gleiche: Einmal von Vorfreude und Aufregung ergriffen, war er nicht mehr zu bremsen. Erst recht, wenn er sein Gauklerkostüm übergeworfen hatte. Er hatte es sich selber ausgedacht und zusammengestellt. Die Beinlinge hatten, so wie auch die Ärmel des Kittels, unterschiedliche Farben. Ein Bein war grün, das andere blau, ein Ärmel gelb mit roten Streifen, der andere rot mit grün. Der Kittel selbst schien aus vielen unterschiedlichen Stoffen und Farben zusammengesetzt. Selbst seinen Gürtel hatte er mit Stoffbändern verziert und auch noch ein paar Glöckchen daran befestigt. Sobald er sich dergestalt zurechtgemacht hatte, war er nicht mehr irgendein Possenreißer, sondern »Buntin«, und dieser Name eilte ihm durch die Gassen voraus. Uta begnügte sich damit, mit einem feuchten Tuch den Staub der Straße von Gesicht und Armen zu wischen und ihre Haare zu einem Zopf zu flechten. Alles, was sie sonst brauchte, verwahrte sie in einem Beutel aus Sacktuch.
Kaum waren sie durch das Tor und drangen, den Gassen folgend, immer tiefer in die Ansammlung aus dicht aneinandergedrängten Hütten und Häusern ein, kam es ihr vor, als hätte jemand einen ledernen Riemen um ihren Hals gelegt und immer enger gezogen. Nach all den Tagen in den Wäldern und auf dem Land schien es ihr unmöglich, diese Luft zu atmen. Die Ausdünstungen von Kot, Urin, faulendem Gemüse, verwesenden Speiseresten oder Tierkadavern und sonstigem Unrat ließen sie würgen. Verzweifelt versuchte sie, flacher zu atmen und sich abzulenken. Ihr Zug geriet immer wieder ins Stocken. Es war auffallend eng in dieser Stadt. Die Bewohner schienen vor der Enge ihrer Behausungen hinaus auf die Gasse geflohen zu sein und verrichteten ihr Tagwerk trotz des Unrats auf der Gasse. So war an vielen Stellen kaum ein Durchkommen. Ihr Vater und zwei andere bahnten ihnen den Weg. Sie sprangen vor den Wagen her, machten Kunststücke, drängten Schaulustige etwas zurück und rückten scheinbar ganz zufällig Hindernisse wie Tische und Körbe zur Seite.
Uta sah sich um. Vor einer Hütte zu ihrer Rechten saß ein Kleinkind mit nacktem Hintern im Dreck. Aus dem schmutzigen Gesicht stach ein Paar heller Augen hervor, das staunend den Einzug der Gaukler beobachtete. Aus der kleinen Nase darunter floss der Rotz, und auch aus dem halb geöffneten Mund sabberte es. Hinter dem Kleinen, in seinem Schatten, nahm sie eine Bewegung wahr und sah genauer hin. Und richtig, vom Dreck kaum zu unterscheiden, zuckte da etwas, das sie zuerst an einen Regenwurm denken ließ, doch fast im selben Moment wusste sie es besser. Sie machte einen Schritt vorwärts und konnte so hinter das Kind blicken. Ungestört von dem Trubel um sie herum, saß da eine Ratte und nagte an etwas. Mit dem dunklen Fell fiel sie im Schatten kaum auf. Die Bewegungen des spielenden Kindes schienen das Tier nicht zu kümmern. Eine Frau erschien auf der Schwelle der Hütte, sah zuerst auf das Treiben vor ihrem Haus, dann auf das Kind herab. Als sie die Ratte entdeckte, packte sie schnell das Kleine. Die Ratte hielt inne, und als die Frau nach ihr trat, fauchte sie kurz, bevor sie sich trollte.
Utas Blick folgte dem Tier an den untersten Balken der Gebäude entlang. Sie waren überall. Schwarzgrau huschten sie von Schatten zu Schatten. Uta sah die nackten Schwänze, die spitzen Nasen und die schlauen schwarzen Knopfaugen unter dem Gebälk hervorschauen, einzelne Tiere, von den Menschen um sich herum völlig unbeeindruckt, zwischen den umherstehenden Zubern, Trögen und Körben und auf dem Unrat sitzend. Ihr Vater hob gerade einen Korb zur Seite, und schon suchten zwei Tiere, ihrer Deckung beraubt, das Weite. Wenn sich die Ratten schon tagsüber so sorglos zeigten, dann musste es in dieser Stadt viel zu viele von ihnen geben.
»He, Uta, hast du das gesehen?« Radolf, einer der Schauspieler, gesellte sich zu ihr. »Hier kannst du offensichtlich fette Beute machen.«
»Ja, da magst du recht haben.« Uta lächelte siegessicher. Unwillkürlich musste sie an die vielen gemeinsamen Stunden mit ihrem Großvater denken, als dieser ihr zeigte, wie man den verhassten Nagern auf unterschiedlichste Weise nachstellte, sie fing und tötete. Seit die Großeltern gestorben waren, bot sie den Leuten überall, wo sie länger verweilten, ihre Dienste alleine an – und verdiente sich auf diese Weise ein bisschen was dazu. Die Menge der Ratten, die sie hier am helllichten Tag in der Gasse sah, versprach ein ordentliches Zubrot. Gerade in den ersten Tagen wäre es ein Leichtes, ohne viel Aufwand mehrere Dutzend zu erwischen. Aber Uta wusste genau, wie schlau diese Tiere waren. Nicht lange, und sie würden misstrauisch werden, sich kaum noch am Tag zeigen und ihre gefräßigen Raubzüge in aller Heimlichkeit unternehmen. Aber eine Stadt wie diese war groß genug. Wenn man sich immer für ein paar Tage auf ein kleines Gebiet, ein paar Speicher und Scheunen beschränkte, konnte man den Zeitpunkt, bis alle Ratten gewarnt waren, hinauszögern. Und bis dahin war viel Beute zu machen. Danach musste man Geduld haben und sich außerdem an die schwierige Arbeit machen, die Nester zu finden.
Das hatte ihr der Großvater immer wieder eingeschärft: »Du musst ihre Brut finden. Nur wenn du die Nester aushebst und die Jungen tötest, werden es wirklich weniger. Jede Rättin kann mehrmals im Jahr Junge kriegen, und die sind bereits nach wenigen Wochen ebenso in der Lage, sich zu vermehren. Man muss das Übel immer an der Wurzel bekämpfen.« Das waren seine Worte gewesen, und er hatte ihr gezeigt, wo sie suchen musste, welche Plätze Ratten liebten. Ja, und da war ja auch noch Engelsflaum. Sie war ihr eine große Hilfe.
Ihr Zug setzte sich wieder in Bewegung. Es dauerte nicht lange, und die Gasse öffnete sich zum Marktplatz hin. Buntin sprang von einem zum anderen, entdeckte den Stand einer Bäuerin, und ehe die sichs versah, hatte er vier Eier geschnappt. Mit dreien begann er zu jonglieren, das vierte verschwand in seinem Ärmel. Die Marktfrau begann sogleich zu keifen: »Gib sofort meine Eier her! Was fällt dir ein? He! Wenn du eines zerschlägst, bezahlst du es mir!«
Utas Vater ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er schnitt Grimassen in Richtung der Frau und jonglierte weiter. Schließlich fing er die Eier, warf eines noch einmal über sich hoch in die Luft und verschränkte die Arme. Alle erwarteten, dass das Ei auf dem Pflaster zerschellte, doch er fing es mit sanft nachgebendem Fuß auf. Begeistert jubelten die Umstehenden.
Die Bäuerin zeterte indes weiter: »Gib mir jetzt sofort meine Eier wieder!« Buntin machte einen Schritt in ihre Richtung, tat, als würde er stolpern, und ließ ein Ei fallen. Erwartungsvoll richteten sich alle Blicke auf die Besitzerin der Eier.
Die schrie auch gleich wieder los: »Da! Hab ich es nicht gesagt? Das wirst du mir ersetzen!«
Der Gaukler sah in die Gesichter der Schaulustigen, hob den Finger und deutete so an, dass er eine Idee hatte. Dann schritt er auf die Händlerin zu, gab ihr die verbliebenen zwei Eier, breitete die Arme aus, um zu zeigen, dass er nichts weiter hatte. Doch bevor die Frau etwas entgegnen konnte, reckte er den Kopf vor, als habe er an ihr etwas entdeckt. Er griff ihr hinters Ohr, und als er die Hand wieder zurückzog, hielt er in ihr ein Ei. Die Frau wusste nicht, wie ihr geschah, griff aber schnell zu und war zufrieden damit, ihre drei Eier wiederzuhaben. Die Umstehenden lachten. Das vierte Ei vermisste nach diesen Kunststückchen niemand mehr.
Buntin war aber schon weiter. Während die Wagen einen geeigneten Platz suchten, spielte einer die Sackpfeife, und die Frauen tanzten zu den Klängen der Pfeifen und der Trommel. Die Kinder und auch die erwachsenen Gaffer scharten sich um sie. Uta sah sich um. Abgesehen von den Kindern, die ihren Einzug begleitet hatten, waren nicht allzu viele Städter anwesend. Das war um diese Zeit, kurz nach Mittag, nicht anders zu erwarten. Einige Händler saßen im Schatten ihrer Stände und Zelte, sie hatten bei der Ankunft nur kurz den Kopf gehoben, gingen dann wieder ihrer Beschäftigung nach oder schlossen sogar die Augen, um weiterzudösen. Der Markt würde erst in den nächsten Tagen beginnen. Noch war viel Platz für Stände und Wagen und reichlich Raum für die Bühne der Possenreißer.
Kapitel 3
Uta brauchte keine Bühne und auch keine Bürger. Ihr Publikum waren die Kinder. Die waren aber noch von den Späßen ihres Vaters gefesselt. Sie wartete ab, ließ ihn Rad schlagen, Handstand machen, den Kindern die Kappen klauen und mit ihnen jonglieren. Sie wusste, dass er sie nicht vergessen würde.
Plötzlich hielt er inne und fixierte eines der Kinder. Dem Jungen war das sichtlich unangenehm. Buntin sprang vor, griff dem Bub ans Ohr, und als er die Hand zurückzog, hielt er diesmal einen Knopf aus Horn zwischen den Fingern. Den Kindern standen vor Staunen die Mäuler offen. Er schenkte dem Jungen den Knopf, ein Lächeln war der Dank dafür. Nun streckte er den Arm aus und beschrieb mit dem Zeigefinger einen Halbkreis entlang der umstehenden Kinder. Den anderen Arm streckte er hinter sich und machte mit der Hand eine lockende Bewegung in Utas Richtung. Sie schritt vor. Er hob nun den Zeigefinger, machte dazu ein wichtiges Gesicht, wies mit beiden Händen auf seine Tochter und verbeugte sich. Erneut klatschten alle.
Nun war sie dran. Den Lederriemen hatte sie schon längst bereit. Sie trat auf eines der Kinder zu und drückte ihm ein Ende in die Hand. »Hier, halt das«, befahl sie in sanftem Ton. Sie zog das schmale, etwa vier Armlängen messende Band zu einem anderen Jungen. »Gespannt halten. Und nicht loslassen!« Eindringlich sah sie ihn an. »Du bist doch mutig und hast keine Angst, oder?« Sie prüfte kurz die Spannung des Riemens und stieß kaum hörbar einen kurzen Pfiff aus. Sogleich spürte sie, wie sich in ihrem Kleid oberhalb des Gürtels etwas rührte. Weicher Pelz strich über ihre Haut. Als Erstes erschien die kleine, rosa Schnauze mit den langen Tasthaaren im Ausschnitt des Kleids. Engelsflaum witterte vorsichtig, bevor sie ihren Kopf vorstreckte und sich mit ihren roten Augen neugierig umblickte. Doch schon im nächsten Augenblick saß die schneeweiße Albinoratte auf der Hand ihrer Herrin. Die Kinder wichen erschrocken zurück. Ausrufe des Staunens und der Furcht waren zu hören.
Uta hob den Zeigefinger. Engelsflaum richtete sich auf und machte auf ihrer Hand Männchen. Fasziniert kamen die Kinder wieder näher. Nachdem sie die Spannung der Lederschnur noch mal geprüft hatte, hielt sie die Hand mit der Ratte daneben. Engelsflaum wusste genau, was zu tun war. Ohne zu zögern, krabbelte sie auf den Riemen und lief auf ihm entlang. Dem Jungen am Ende der Leine war das gar nicht geheuer. Sein Gesicht sprach Bände. Uta stoppte das Tier mit der flachen Hand quer über der Schnur. Die Ratte hielt an, machte folgsam kehrt und balancierte flink in die entgegengesetzte Richtung. Der Junge am anderen Ende der Leine war tapferer. Fasziniert beobachtete er das Tier bei seinem Seilakt. Uta stieß wieder einen Pfiff aus, und Engelsflaum machte kurz vor der Hand des Kindes kehrt. In der Mitte des Riemens angekommen, folgte sie Utas Zeichen und machte erneut Männchen.
»Tretet beide einen halben Schritt vor«, wies Uta die Jungen an. Das Band hing nun durch, doch Engelsflaum stand nach wie vor aufrecht. Uta legte sanft die Hand an den Riemen und brachte ihn langsam in Schwingung. Die Ratte blieb standhaft und balancierte die Schwünge geschickt aus. Mit beiden Händen forderte sie nun die Jungen auf, das Band langsam zu senken, bis es auf dem Boden lag. Die Ratte hockte sich daneben aufs Pflaster. Uta übernahm nun selbst ein Ende des Riemens, begann, ihn zu schwingen und in eine Kreisbewegung zu bringen. Die Ratte sprang jedes Mal, wenn das Leder auf ihre Füße zueilte, darüber hinweg. Die Kinder juchzten und schlugen begeistert die Hände zusammen. Uta legte das Band nieder, ließ Engelsflaum Männchen machen und beschrieb direkt über ihrem Kopf mit dem Zeigefinger kleine Kreise. Die weiße Ratte drehte sich auf den Hinterläufen stehend um die eigene Achse. Es sah aus, als würde sie tanzen. Die Kinder klatschten dazu. Ein weiterer Hinweis mit dem Zeigefinger, und Engelsflaum hielt an, ließ sich auf die Vorderpfoten fallen, um sich sogleich wieder aufzurichten. Das wiederholte sie ein paarmal; es sah aus wie Verbeugungen.
Für eine erste Vorstellung war das genug. Uta legte die Hand auf das Pflaster. Das Tier kam sofort zu ihr, huschte den Arm hinauf und nahm auf ihrer Schulter Platz. Das Mädchen erhob sich und rief: »Leute, hört! Diese Seiltänzerin und Künstlerin ist niemand anderes als die viel gerühmte Engelsflaum. Ihre Kunst verlangt viel Ausdauer, Kraft und Achtsamkeit. Das geht allerdings nur, wenn täglich ihr Magen gefüllt wird. Engelsflaum und ich sind euch für jedes Korn und jede kleine Gabe dankbar. Wir freuen uns erst recht über die ein oder andere kleine Münze. Wenn es euch gefallen hat, zeigt uns eure Anerkennung.« Mit diesen Worten holte sie eine hölzerne Schale aus ihrem Beutel und stellte sie vor sich auf den Boden. Die Kinder stoben in alle Richtungen auseinander. Sie wartete geduldig ab und fütterte derweil die Ratte zur Belohnung mit einem Stückchen getrocknetem Apfel. Schon kamen die ersten Kinder zurück und leerten vorsichtig den Inhalt ihrer Hände in die Schale. Es waren nicht wenige, und so füllte sich die Schale zusehends.
Es funktionierte überall. Eine Kinderhand voller Körner hatte für die meisten keine Bedeutung. Kinder wussten, in welchen Ecken etwas unbeachtet herumlag, in welchen Topf oder Eimer sie schnell mal ihre Hand stecken und zugreifen konnten, ohne Ärger zu bekommen, sie fanden immer etwas und waren stolz, Engelsflaum den Lohn selbst zahlen zu können. Manchmal waren sogar ein Apfel oder ein paar getrocknete Beeren dabei. Münzen brachten die Kinder nie. Die bekam sie meist nur von gut gelaunten Händlern, die sich über die Kunststücke der Ratte amüsierten, oder als Almosen von Reichen.
Das metallene Klingen eines Geldstücks auf dem Pflaster ließ sie aufschauen. Die Münze zu ihren Füßen stammte von einem hochgewachsenen jungen Mann, der bei ihrem Einzug mit ein paar anderen am Brunnen gestanden hatte. Sie bückte sich rasch und nickte ihm mit dem Geld in der Hand zum Dank freundlich zu. Er wich ihrem Blick nicht aus, für einen Augenblick war ihr, als wolle er sogar lächeln. Er tat es aber nicht, sondern schaute sie nur an. Uta hatte das Gefühl, als würde sein Blick in sie dringen, und spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Er hatte ein freundliches Gesicht, dunkelblonde, fast braune Haare und den struppigen Bartwuchs eines Jünglings. Seine Augen drückten eine Mischung aus Neugier und Mitleid aus. Ihr Geist mahnte sie, dass es sich nicht schickte, jemanden so lange anzusehen, und sie wusste nicht, warum sie den Blick nicht von ihm wenden konnte. Er machte aber auch keine Anstalten zu gehen.
»Beißt die?«
Eine junge Frau etwa in Utas Alter war zu ihr getreten und deutete vorsichtig mit dem Finger auf Engelsflaum. Uta wandte sich ihr zu und gab bereitwillig Auskunft: »Nein, nur wenn man sie ärgert oder ihr wehtut. Möchtest du sie mal streicheln?«
Das Mädchen machte große, ungläubige Augen. »Darf ich?«
»Ja, komm her.« Uta griff auf ihre Schulter, hob Engelsflaum behutsam herunter und setzte sie auf die flache Hand vor dem Bauch. Sehr zögerlich bewegte sich das Mädchen auf sie zu. Auch als sie den Arm in Richtung Ratte ausstreckte, wirkten ihre Bewegungen sehr langsam und unentschlossen. Das war mehr als reine Vorsicht oder Angst. Uta bemerkte das, ergriff die Hand der jungen Frau und kam ihr einen Schritt entgegen.
»Lass sie erst einmal an deinem Finger schnuppern. So, und jetzt kannst du ihr ganz sanft über das Fell fahren.« Sie führte die Hand der anderen und achtete darauf, wie Engelsflaum auf die Fremde reagierte. Die Ratte zeigte keinerlei Scheu oder Misstrauen. Ob es die Langsamkeit ihrer Bewegungen war oder ihr Geruch, das Tier schien sie zu mögen.
Uta sah auf. Der junge Mann war nun doch gegangen. Sie ließ den Blick über den Platz schweifen und meinte ihn gerade in einer Gasse verschwinden zu sehen. Sie wunderte sich über sich selbst und hätte ihm weiter nachgeblickt, wenn Engelsflaum nicht plötzlich ihre Hand verlassen hätte. Uta staunte nicht schlecht. Die Ratte war ganz zutraulich auf den Arm des Mädchens gekrabbelt, saß nun in der Armbeuge und ließ sich ausgiebig streicheln. Das Mädchen war ganz darin versunken. Uta sah, wie es konzentriert die Stirn zusammenzog, mit den Lippen zuckte und eine angestrengte, nachdenkliche Miene aufsetzte. Doch erst nach einer Weile öffnete sich der Mund, und zögerlich geformte Worte kamen hervor: »Sie ist … ganz weich. Und so weiß.«
Engelsflaum schien sich wirklich wohlzufühlen. Längst kamen keine Kinder mehr, um etwas in die Schale zu geben. Uta hob sie auf, holte den ledernen Beutel, den sie zu diesem Zweck in ihrer Tasche trug, hervor und leerte den Inhalt der Schale hinein. Die Körner würden nicht nur den Hunger der Ratte stillen. Sie verschnürte den Beutel sorgfältig und gab ihn zusammen mit dem Riemen für Engelsflaums Kunststücke zurück in den aus Sacktuch genähten Umhängebeutel, den sie immer bei sich trug.
»Wie heißt du?«
Das Mädchen sah sie erneut mit großen Augen an. Sie öffnete den Mund, holte Luft, hielt aber inne, als müsse sie überlegen. »Lisel.« Sie zog den Laut in der Mitte in die Länge, versank dann gleich wieder in die Liebkosung des Tieres.
»Ich bin Uta. Willst du Engelsflaum noch ein wenig halten? Ich muss zu den anderen und nachsehen, wo wir unser Nachtlager richten. Oder musst du gehen?«
Lisel sah auf, bewegte den Kopf hin und her. Uta war sich nicht sicher. War das ein Kopfschütteln, oder sah sie sich um? Dann öffnete sie doch den Mund und sagte: »Ja.«
»Ja, ich muss gehen? Oder ja, ich will Engelsflaum halten?«
Lisel machte einen zögerlichen Schritt in Utas Richtung. »Engelsflaum streicheln.«
»Gut, dann komm.« Uta wandte sich den Wagen zu, und Lisel folgte ihr auf dem Fuß. Die Pferde waren schon ausgespannt und versorgt. Jetzt waren alle damit beschäftigt, Zeltplanen aufzuspannen und den Boden darunter mit Stroh zu bedecken. Auch Buntin war dabei, ihr Zelt herzurichten. Gerade versuchte er, mit einer Stange unter die Zeltplane zu gelangen.
»Warte, Vater, ich helfe dir«, rief Uta und schlüpfte behände unter den Stoff. Mit beiden Armen hob sie die Plane in die Höhe, sodass ihr Vater leichter darunter gelangen und die hölzerne Stütze aufrichten konnte. Das Zelt war nicht sonderlich groß. Es hatte gerade mal Platz für zwei Schlafplätze und den wenigen Besitz. Aufrecht stehen konnte man nur direkt in der Mitte neben der Stange.
»Gut, dass du kommst«, brummte Buntin. »Du kannst uns dort drüben ein paar Armvoll Stroh besorgen. Ich muss die Schnüre noch spannen.«
»Ja, und dann hole ich unsere Decken und die anderen Sachen.« Es war nicht nötig, dass er sie anleitete. Uta wusste genau, was in welcher Reihenfolge zu tun war. Aber sie kannte auch seine Art und dass er ihr trotz des brummigen Tons dankbar war. Sie trat vor das Zelt und sah sich um.
Lisel hatte sich auf die Deichsel eines Wagens gesetzt und streichelte immer noch Engelsflaum, die nun auf ihrem Schoß lag. In Vorbereitung auf all die Händler und Marktleute war eine Fuhre Stroh zum Rand des Platzes gebracht worden. Es waren bereits einige Leute dabei, sich ihren Teil zu holen. Uta nahm von einem der Wagen ein großes Sacktuch und lief zu dem Strohhaufen. Sie häufte, soviel sie konnte, darauf, nahm es dann an den Ecken auf und konnte auf diese Weise sehr viel mehr auf einmal transportieren als nur mit den Armen. So musste sie den Weg nur zweimal machen. Immer wieder fiel ihr Blick auf Lisel. Das Mädchen war ganz versunken in die Beschäftigung mit der Ratte. Es war schon etwas seltsam, die Art, wie sie sprach, die zögerliche Weise, wie sie sich bewegte. Aber sie schien nett zu sein.
Uta verteilte das Stroh im Zelt, breitete zwei grobe Decken darauf aus und schickte sich an, ihr Bündel vom Wagen zu heben. Lisel schaute auf, als sie an den Wagen trat. Utas Sachen befanden sich in einer Kiepe aus geflochtenen Weidenruten. Die konnte man sich auf den Rücken schnallen, und Uta hatte sie schon so manchen Tag tragen müssen, wenn kein Fuhrwerk sie begleitete. Sie war heilfroh über die Spielleute mit ihrem Wagen, den sie als Bühne nutzten. Denn mit der Kiepe auf dem Rücken erschienen einem die Wege von Markt zu Markt noch mal so lang. Sie stellte den Korb neben Lisel ab, räumte die Sachen aus, die sie in den nächsten Tagen brauchen würde, und brachte sie ins Zelt.
Lisel sah ihr neugierig zu. »Was sind das für Körbe?«, fragte sie, als Uta das zuoberst liegende Bündel auf die Seite stellte, um an die Dinge darunter zu gelangen.
»Das?« Uta hob eines der Teile hoch. Es war ein aus dünnen Metallbändern zusammengefügter Käfig. Lisel nickte. »Das sind Fallen. Ich fange Ratten damit. Schau, hier die Seite lässt sich nach innen klappen. Hier gebe ich etwas zu fressen hinein. Wenn eine Ratte dann hineinschlüpft und daran nagt, fällt die Klappe herunter, und sie kann nicht mehr raus.«
Lisel machte große Augen. »Ratten? Brauchst du denn noch mehr?«
»Nein, ich töte sie und verdiene mir damit ein Zubrot. Dort, wo es viele Ratten gibt, sind die Leute froh, wenn jemand etwas dagegen unternimmt.«
»Was bekommst du für eine Ratte?«
»Für eine? Nichts. Für ein Dutzend kann ich etwas verlangen, für zwei Dutzend bekomme ich einen Heller. Meistens gibt man mir aber Korn, Brot oder anderes Essen.«
»Bei uns gibt es viele Ratten. Vater sagt, sie fressen uns alles weg.«
»Na, vielleicht kann ich mit deinem Vater ja einen Handel machen.«
»Ich weiß nicht. Wir haben nichts.«
»Ihr seid Bauern, nicht wahr?«
»Ja.«
»Wohnst du hier in der Stadt?«
»Ja, bei der Brücke über den kleinen Fluss. Unsere Felder sind aber auf der anderen Seite. Wir haben drei Äcker und eine Wiese. Vater sagt immer, das reicht gerade so zum Leben.«
»Hast du Geschwister?«
»Ja, drei Brüder und drei Schwestern.«
Uta nickte. Eine so große Familie durchzufüttern, war für einen Kleinbauern ein hartes Los. Bei dem Gedanken kam ihr das Stück Fladenbrot in den Sinn, das sie noch im Beutel bei sich trug. »Hast du Hunger?«
Lisel zögerte, nickte dann aber.
»Hier, komm, wir teilen uns das.« Uta riss den Fladen in zwei Stücke und gab dem Mädchen das größere.
»Oh, danke.« Lisel griff mit beiden Händen nach dem Brot und biss sofort davon ab. Engelsflaum richtete sich auf und schnupperte. Das Mädchen riss ein kleines Stück vom Fladen ab und hielt es ihr hin. Die Ratte schnupperte daran, ergriff es mit den Zähnen und setzte sich auf die Hinterbeine. Das Brot mit den Pfoten haltend, knabberte sie drauflos. Uta musste schmunzeln. Beide, das Mädchen und die Ratte, aßen auf die gleiche Weise.
Sie selbst aß nun auch und musterte, während sie schweigend kaute, die junge Frau. Sie hatte ein sehr hübsches Gesicht. Die großen, blauen Augen standen im Kontrast zu der sonnengebräunten Haut. Ihr Haar, das die gleiche Tönung hatte wie ihr eigenes, trug sie zu einem einfachen Zopf geflochten. Ihre Hände und Arme waren so braun wie das Gesicht, die Finger feingliedrig. Schwarze Ränder unter den Fingernägeln zeugten von Arbeit auf den Feldern. Auch an der Kleidung sah man Spuren von Erde. Lisel trug einen einfachen braunen Rock und darüber einen beigen Kittel, den sie mit einem groben Strick um die Taille zusammengebunden hatte. Der Kittel und der Rock hatten einige Flicken und grob ausgebesserte Stellen. Sie trug keine Schuhe, Füße und Unterschenkel waren fast bis zu den Knien braun vor Schmutz.
Im Augenwinkel nahm Uta eine schnelle Bewegung wahr. Schon im nächsten Augenblick stand ein Junge neben ihnen, holte aus und schlug Lisel mit der flachen Hand auf den Kopf.
»Lisel!« Seine Stimme war voller Missfallen. »Was treibst du dich hier rum?« Schon holte er erneut aus.
Engelsflaum sprang aufgeschreckt von Lisels Schoß und flüchtete sich auf Utas Schulter. Auch sie sprang auf und fiel dem Kerl in den Arm, bevor er das Gesicht des Bauernmädchens treffen konnte. Zornig fuhr er herum und funkelte Uta an.
»Wag es, sie noch einmal zu schlagen, und du bekommst es mit mir zu tun«, zischte sie. Die weiße Ratte auf ihrer Schulter schien ihn zu irritieren, und sie merkte, wie sich sein Arm, den sie am Handgelenk ergriffen hatte, entspannte. Auch sie ließ locker.
»Was mischst du dich hier ein? Hau ab und kümmere dich um deine eigenen Sachen«, herrschte der Kerl sie an. »Und du, steh auf und komm! Vater fragt schon nach dir. Auf, sonst setzt es gleich noch was!«
Uta gab dem Jungen einen kräftigen Stoß, sodass er rücklings über einen Korb stolperte und hinfiel. »Uta, lass! Das ist mein Bruder.« Lisel stand auf. »Ich muss gehen.«
Der Junge rappelte sich auf, und Uta war darauf gefasst, dass er sie gleich wieder angehen würde. »Pass auf, Bursche. Lass dir eins gesagt sein: Wenn du Lisel noch einmal anfasst, bekommst du es mit mir zu tun, und ich hetze dir die Ratten der ganzen Stadt auf den Leib. Hast du verstanden?«
»Gibt es Ärger, Duhtar?« Buntin trat hinter dem Zelt hervor.
»Nein, Vater, nur ein frecher Lümmel, der sich besonders stark vorkommt.«
Die Gegenwart des Mannes war dem Burschen unangenehm. Er traute sich kaum aufzuschauen. »Lisel, komm!«, raunte er.
Uta sah sich zu dem Bauernmädchen um. Die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Laut, sodass es ihr Bruder genau hören konnte, sagte sie: »Lisel, du kannst jederzeit wiederkommen. Und wenn der da dir etwas tut, sagst du es mir, ja?«
Lisel machte große Augen und nickte. »Danke für das Brot«, sagte sie und lief hinter ihrem Bruder her.
»Wer war das?« Mit gerunzelter Stirn schaute der Gaukler hinter den beiden her.
»Ein Bauernmädchen hier aus der Stadt. Sie ist sehr nett. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich sie gleich gemocht. Der Kerl ist ihr Bruder.«
»Pass auf! Es ist nicht gut, wenn du dir gleich Ärger einhandelst. Misch dich besser nicht in Familienangelegenheiten ein.«
»Nein, Vater. Mach dir keine Sorgen. Ich mag es nur nicht, wenn sich so einer an Schwächeren vergreift und so tut, als wäre er ein Herr.«
»Gut. Dann hol jetzt Wasser.« Buntin hielt ihr einen hölzernen Eimer hin. Obwohl sie sich innerlich ärgerte, nahm sie wortlos das Gefäß und machte sich auf den Weg zum Brunnen. Es war jedes Mal das Gleiche: Wenn Buntin sich ihr in Sorge oder vertrauensvoll zuwandte und sie für einen Augenblick so etwas wie Zuneigung spürte, brach er die Situation abrupt ab und ging zu etwas anderem über, als wäre ihm das Band zwischen Tochter und Vater unangenehm. Sie konnte sich einfach nicht daran gewöhnen. Etwas in ihr weigerte sich standhaft, dieses Verhalten hinzunehmen.
Am Brunnen schöpfte sie Wasser, trank selbst ein paar Schlucke aus der hohlen Hand und kehrte dann mit dem vollen Eimer zum Zelt zurück. Die Sonne schickte sich gerade an, hinter den höchsten Giebeln der Häuser zu verschwinden. Buntin richtete vor dem Zelt eine kleine Feuerstelle ein, Uta stellte den Eimer wortlos neben ihm ab, bückte sich unter der Zeltöffnung hindurch und richtete ihr Lager her. Sie spürte die Müdigkeit nach den langen Fußmärschen der vergangenen Tage. Es war ihr mehr als recht, dass sie nun für ein paar Tage an ein und demselben Ort bleiben würden und nicht den ganzen Tag durch Wälder und über Hügel wandern mussten. Mit der untergehenden Sonne machte sie sich zum Schlafen bereit. Sie öffnete den Gürtel, zog sich das Kleid über den Kopf und rollte es zusammen, um ihr Haupt darauf zu betten. Engelsflaum hüpfte wie jeden Abend auf die Decke und wartete geduldig ab, bis sie sich hinlegte. Dann schlüpfte sie unter die Decke und baute sich in dem Stroh ein Nest für die Nacht.
Uta schloss die Augen, konnte aber nicht gleich einschlafen. Sie dachte an das Bauernmädchen. Und der Blick des jungen Mannes auf dem Marktplatz ging ihr nicht aus dem Kopf.
Kapitel 4
Es war warm und weich um sie herum. Da war eine Frau. Sie summte ganz sanft eine bekannte Melodie. Sie versuchte, die Frau zu erkennen, aber alles, was sie von ihr erfassen konnte, waren das Summen, die Geborgenheit und die Farbe ihres Haars. Es glich ihrem eigenen. Das Summen wurde leiser, und die Frau schien sich zu entfernen. Uta wollte sich an ihr festhalten, sie nicht gehen lassen, aber sie konnte es nicht verhindern. Um die Frau herum wurde es immer dunkler, und das Dunkel verschlang die Fremde. Uta wollte sie rufen, aber sie kannte den Namen nicht. Ein Wort fiel ihr ein, und leise, ganz unsicher stammelte sie: »Muoter, Muoter.« Die Dunkelheit wurde tiefer, ein zischender Laut erklang, und auf einmal war alles weg.
Engelsflaums Fauchen riss Uta aus dem Schlaf. Für einen Augenblick sträubte sich alles in ihr, doch dann riss sie die Augen auf und setzte sich mit einer raschen Bewegung auf, gerade noch rechtzeitig, um zwei dunkelgraue Artgenossen der Ratte unter der Zeltplane hindurch nach draußen entwischen zu sehen.