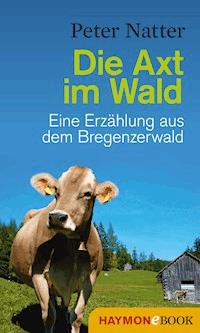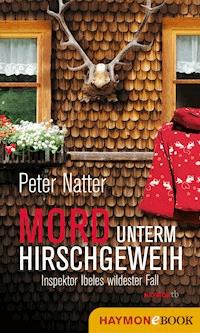Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ibele-Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf der Schubertiade im Bregenzerwald kommt es zu einem bösen Zwischenfall - eine Gesellschaftsdame wird ermordet, ein wertvolles Cello verschwindet spurlos. Inspektor Ibele ermittelt in den prächtigen Gasthöfen von Schwarzenberg. Er trifft auf betuchte Konzertbesucher und polternde Bauernbuben und ist trotz jahrelanger Erfahrung mehr als gefordert: Die Neigungen eines Trachtenfetischisten bringen selbst den bodenständigen Vorarlberger Inspektor gehörig ins Schwitzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Natter
Die Tote im Cellokasten
Inspektor Ibeles schwärzester Fall
Wie schon aus den Namen ersichtlich wird, sind alle Personen dieses Buches fiktiv. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit wirklichen Personen oder Ereignissen, selbst dann, wenn sie, wie hier, nicht beabsichtigt sind, in der Regel unvermeidbar. Das liegt in der Natur der Sache.
Es scheint, dass die Ereignisse weiter ausgedehnt sind als der Augenblick, in dem sie stattfinden, und diesem nicht gänzlich angehören.
Marcel Proust
In Wirklichkeit waren es ganz erstaunliche Geschöpfe.
Eugen Ruge
An solchen Tagen zitiert man bei sich alle zehn Minuten die Benn-Formel: jenseits von Sieg und Niederlage.
Peter Sloterdijk
Die Blöße, die sich der Idiot gibt, erschreckt wie jede Epiphanie durch Unverständlichkeit.
Botho Strauß
Für Sabine
Prolog im Amt
Unmöglich kann es sich um einen Scherz handeln, nicht einmal eine Posse kommt in Frage. Wenn, dann ist es eine Farce. Aber keine, wie sie Chefinspektor Ibele und Hobbyköche seinesgleichen aus der Küche kennen: nichts Feines, Schmackhaftes oder meinetwegen Deftiges, Raffiniertes. Nichts, was knusprige Pasteten oder einen zarten Braten füllen würde. Gerade einmal die Seiten des Vorarlbergboten und die kargen Sendeminuten des Lokalfernsehens sind damit notdürftig zu bestücken, auf dem schmalen Grat zwischen Quotengier und Gewinnmaximierung, den man dort tagein, tagaus im Namen des sogenannten Kulturauftrags ungeniert beschreitet. Eigentlich kann es nur ein schlechter Witz sein. Denn, Hand aufs Herz, mit vielem, mit allem hätte und hat Isidor Ibele eher gerechnet als damit: Über Jahre hinweg verschleppte innerparteiliche Beziehungsgeschichten (von deren sittlichen und moralischen Folgen wir lieber schweigen), grenzwertige Grundstücksgeschäfte am Rhein, die völlig unpolitisch agierenden Überwinder lokaler Ferienhaus- und Zweitwohnsitz-Baugesetze oder die kleinkriminellen Betrügereien im Bereich der kriselnden Landessportförderung – all das hätte das etwas angeschlagene, aber im Großen und Ganzen stabile Weltbild des Inspektors nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. So aber, wie es ihm der Chef, der seiner bevorstehenden Pensionierung harrende General, und die Sekretärin, das ist Antoinette Hagen in all ihrer Pracht und Herrlichkeit, und vor allem die Schlag auf Schlag aus dem Bregenzerwald eintreffenden Berichte nun unausweichlich präsentieren – nein: So hat sich Ibele das nicht vorgestellt. Das Wochenende nicht und gar nichts. Daran ändert vorläufig auch der Duft nach Provence und Mittelmeer wenig, der mit Antoinette Hagen aus dem Vorzimmer hereinweht, und auch nicht das dazu passende spätsommerlich farbenfrohe Outfit der jungen Dame, das überhaupt ein eigenes Kapitel ist und hier jetzt leider gar nichts verloren hat. Oder doch; obwohl fast im gleichen Atemzug eine Tote zu beklagen ist. Antoinette Hagen aus Lustenau mit ihren unverbrauchten zwanzig Lenzen, die der General – um damit wem auch immer einen Gefallen zu tun – vor zwei Jahren in ihrer ungebremsten postpubertären Girly-Blüte im Vorzimmer des Chefinspektors installiert hat. Mit Schrecken erinnert sich Ibele noch manchmal an minimale Röckchen und knappe Hemdchen, an stelzenhafte Absätze und coole Lover; nicht zu vergessen Antoinettes mit der Stabilität einer Seifenblase ausgestattetes Selbstbewusstsein und ihre alle Bildungsbemühungen ad absurdum führende Rechtschreibung. Seither ist viel Wasser in den Bodensee geflossen. Mit Hilfe eines ebenso reichen wie kulturbeflissenen Onkels – eines wohlhabenden Textilfabrikanten – hat Antoinette ihren Kopf gerettet, den Kopf, die Seele und erfreulicherweise auch den prächtigen Leib, um den es einem vielleicht am vordergründigsten, sicher auch am offensichtlichsten hätte leidtun können. Sie hat sich zu einer starken jungen Frau entwickelt, der niemand etwas vormachen muss – und kann.
Eine Tote ist zu beklagen. Wenn es nur ums Beklagen ginge! Doch zuerst will sie identifiziert werden. Auch wenn ihr selbst alles Wollen definitiv abhanden gekommen ist.
Freitag, 6. September 2013
I.
Dem von innen unerreichbaren Außen entspricht das von außen unerreichbare Innen.
Michel de Montaigne
Endlich ist es Nacht geworden in Schwarzenberg, dunkle, stille Nacht. Alles schläft. Lange genug hat es heute gedauert. Zum einen sind die eleganten Schubertianer noch Stunden nach dem abendlichen Konzert in den Gaststuben der Wirtshäuser gesessen und haben sich, Flasche um Flasche teure Weine trinkend, erregt über die Interpretation der Mozart-, Haydn- und Schubert-Streichquartette unterhalten, oder war es Die schöne Müllerin in einer bahnbrechenden Darbietung? Sie haben im Adler, im Hirschen, in der Krone und im Ochsen die lukullischen Kostbarkeiten der Schwarzenberger Spitzengastronomen genossen und sich über das nächstjährige Programm unnötig den Kopf zerbrochen. Unnötig, weil sich der Maestro nicht dreinreden lässt und vielleicht sowieso bald alles hinschmeißt, wenn es nicht endlich gelingt, die dörfliche Bauernschaft zur Vernunft zu bringen. Den Rest hat der Nacht nämlich schlussendlich das Fest gegeben, mit dem alljährlich der lange Alpsommer sein Ende findet; ein Fest, das sich neben der gediegenen Gesellschaft der internationalen Musikfreunde polternd und lärmend rund um den malerischen Dorfplatz abspielt. Gestern erst sind die Senner, Hirten und Knechte nach einem langen Sommer fern der Menschen und ihrer zivilisatorischen Errungenschaften mit dem Vieh von den Hochalpen heruntergekommen. Da war heute kein Halten und fast kein Aufhören mehr zu finden im allgemeinen Erzählen, Schmausen, Tanzen und erst recht nicht im Trinken. Schließlich sind sie doch satt geworden und müde, oder von einer wenn schon nicht Angebeteten, so doch Angesabberten erhört und abgeschleppt. Nach und nach haben sie in diversen Scheunen und Kammern Unterschlupf und Quartier gefunden. Jetzt ist es mucksmäuschenstill im Dorf. Vom Kirchturm erklingen soeben zuerst vier helle und dann drei dunkle Schläge. Als sie verklungen sind, ist die Stille noch stiller, die Nacht noch dunkler und der letzte einsame Waldgänger noch einsamer.
Keine zwei Stunden wird es dauern, dann erwacht das Leben im Dorf von Neuem; in der örtlichen Backstube zuerst, dann in den zahlreichen Kuh-, Hühner- und Ziegenställen, in der Dorfsennerei und den Küchen. Für den, der ungesehen und ungehört agieren will, ist jetzt die richtige Zeit. Für den oder für die. Es scheint einigen Bedarf an solchem Tun zu geben. Klamm und heimlich geht es zu, wo scheinbar Nachtruhe herrscht. Im Konzertsaal, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, dürfte jetzt eigentlich niemand mehr sein. Er trägt den Namen der berühmtesten, allerdings quasi illegitimen Tochter des kleinen und umso stolzeren Dorfes; einer Barock-Malerin, deren Vater aus dem Dorf stammte. In London und Rom lebend, war sie ein paar Wochen zu Besuch und hat sich mit einigen Gemälden in der Pfarrkirche verewigt. Auch der Gigant Goethe ließ einst im Taumel seiner italienischen Reise ein paar gönnerhafte Bemerkungen über die weltgewandte Künstlerin fallen.
Niemand dürfte hier im Angelika-Kauffmann-Saal sein, aber jemand ist es doch. In der winzigen Künstlergarderobe flackert unruhig das Licht einer Kerze und wirft dunkle Schatten auf die hell getäfelten Wände. Eine junge Frau, eine wunderschöne junge Frau, sitzt dort auf einem hölzernen Schemel. Eben schickt sie sich an, mitten in die Lautlosigkeit hinein mit grazilen Bewegungen die Saiten eines Cellos zum Klingen zu bringen. So gespenstisch wie harmonisch ertönt eine einfache Melodie, etwas verspielt Tänzerisches und zugleich klagend Elegisches. Das dunkelbraune Instrument fest zwischen die Knie gepresst, den Kopf leicht schräg haltend, die Augen geschlossen, den Mund mit den vollen kirschroten Lippen halb geöffnet, die Zungenspitze sichtbar, die langen Haare zu einem dicken Zopf geflochten. Über ihre Kleidung ist nichts zu sagen. Sie trägt keine. Sie spielt so nackt, wie Gott sie schuf. Doch nicht nur Gott, zumindest nicht der sogenannte liebe Gott, sondern auch andere Hände waren am Werk.
Wer so spielt wie sie, braucht keine Zuhörer, will keine Zuhörer. Dennoch gibt es einen. Es ist ein vierschrötiger, bärtiger Kerl. Seit einiger Zeit schon schleicht er um das Gebäude herum. Endlich findet er, wonach er sucht. In einem der Räume im Erdgeschoß ist das Fenster nicht ganz geschlossen, lediglich angelehnt. Mit wenigen Handgriffen hat er es lautlos geöffnet und steigt ein. Er ist im Kartenbüro gelandet, sieht sich um, lauscht. Keinen Deut interessieren ihn die hier lagernden Schätze: Konzertkarten noch und nöcher für die in den kommenden Tagen anstehenden musikalischen Leckerbissen. Zwei Stockwerke und etliche lange Gänge trennen ihn von seinem Ziel. Obwohl es streng genommen nicht richtig ist, von einem Ziel zu sprechen; der da hat kein Ziel. Nur ein dumpfes Gefühl, dass hier etwas Brauchbares zu holen oder etwas Fälliges zu erledigen sei, treibt ihn weiter. Brauchbar, wenn es darum geht, die Stimmen in ihm verstummen zu lassen, den nagenden, wortlosen Zorn zu besänftigen, der ihn verzehrt, die Fratzen und Gesichter zu bannen, die seiner spotten bei Tag und Nacht. Stimmen, die schon seit Langem keine Ruhe mehr geben. Hierher haben sie ihn geführt, ohne dass er zu sagen wüsste, weshalb. In dieses Haus, wo all die verrückten Touristen aus ganz Europa, Amerika und Asien aufmarschieren, um das ihm selbst völlig fremd Bleibende zu erleben. Die betuchten Konzertbesucher, die Sänger und Musiker kommen aus einer Welt, die ihm in jeder Hinsicht verschlossen ist. Wäre da nicht diese ferne Musik, der er jetzt folgt, ohne zu wissen warum – er wäre völlig verloren. Nie zuvor hat er einen Fuß über die Schwelle des Gebäudes gesetzt, nicht einmal zu einem der Bälle, zu den Käseprämierungen und Blasmusik-Aufmärschen, die hier manchmal stattfinden. Erstens sagt ihm das Zeug nichts und zweitens ist das hier nicht sein Dorf. Was ihn antreibt, ist seine Gemeinheit. Sie ist sein wahres Erbe und sein Kapital. Woher zum Teufel kommt diese Musik? Woher kommen diese Melodien, die sein zerstörtes Denken noch mehr aufwiegeln und seinen irren Willen noch mehr von der Welt abschneiden?
II.
Die Hyäne folgt dem Löwen.
Iwan Bunin
Längst ist das Violoncello zwischen ihren Knien lebendig geworden, ist es der Geliebte, den sie wiegt und der sie verzaubert. So gut wie vergessen ist der Besitzer, ein gutmütig-schussliger Kerl, der es ihr überlassen hat, ohne dass ihr je wirklich klar geworden wäre, was er von ihrem Spiel hält, was sich hinter seiner Großzügigkeit womöglich noch verbirgt. Vergessen sind der Impresario und das nichts als selbstzerstörerische Schauspiel, das sie ihm noch vorgestern geliefert hat. Es ist genug. Mehr wird sie ihm nicht gewähren. Er muss sich entscheiden. Höchstens eine vage Gedächtnisspur führt noch zum Doktor draußen im Tal; und selbst die ist überlagert von den zarten Klängen einer meisterlich vom Blatt gespielten Etüde. Sie braucht ihn nicht mehr. Auch wenn das hier in wenigen Tagen vorüber ist, braucht sie ihn nicht mehr, sein Geld nicht und nicht sein Skalpell; den misstrauischen alten Schweden und seine eifersüchtige Frau genauso wenig. Sie können ihr gestohlen bleiben. Am wenigsten aber braucht sie den angeberischen, kaltschnäuzigen Schlaumeier, der meint, so ganz besonders raffiniert zu sein. Als wäre seine mickrige Schwarzgeldkasse etwas, worauf sie angewiesen ist! Viel näher als all die Realität um sie herum sind ihr im Augenblick die Noten, die irgendein Justus Johann Friedrich vor bald zweihundert Jahren aufs Papier gekritzelt hat. So nahe, dass sie eins wird damit, ist ihr der Bogen, mit dem sie über die Saiten streicht, ist das warme Holz an der nackten Haut ihrer wohlgeformten Schenkel.
Eine Stehlampe mit dunkelgrünem Schirm erhellt die Noten und taucht die kleine Kammer in sanftes Licht. Die Kerze flackert im kaum merklichen Luftzug, der einzelne Haare ins Gesicht der Spielerin weht, als sich Millimeter für Millimeter die schwere Tür hinter ihr öffnet. Espressivo steht auf dem Notenblatt, dann allegro energico. Sie nimmt das ernst, so ernst, dass sie den Schatten nicht wahrnimmt, der sich langsam über sie legt. Noch einmal hält er inne, wie um all die sphärische, himmlische Energie der Musik in sich aufzunehmen und sie umzuwandeln in ihr satanisches Gegenstück. Das folgende andante amoroso zu spielen, ist der Künstlerin nicht mehr vergönnt. Der Druck zweier Hände um den Hals schnürt ihr die Luft ab; mehr instinktiv als entschlossen greifen ihre Finger danach und krallen sich in das schwielige Fleisch. Es ist aus. Die Tote sackt schwer in sich zusammen, kommt quer über dem Cellokasten zu liegen. Der Mörder fängt das zu Boden gleitende Instrument auf, nimmt den Bogen an sich und verschwindet lautlos. Für sein schönes Opfer hat er keinen Blick übrig.
III.
Das allseits mit großer Ungeduld erwartete Solokonzert um elf Uhr muss selbstverständlich abgesagt werden. Altmeister Kunrich Kahn wird nicht spielen. Eine Katastrophe! Haben gestern die Älper mit ihrem Vieh für den Ausfall einer Matinee gesorgt, ist es heute schon wieder so weit. Eine echte Katastrophe! Aber ohne Cello gibt es keine Cello-Sonaten, und auf einer Leiche kann niemand spielen. Wenigstens kein Konzert. Wirklich nicht. Fassungslos und schwer atmend starrt der berühmte Cellist in seinen Cellokasten, rauft sich den schütteren Bart. Kein Cello im Kasten, dafür eine Leiche. Der wie aus dem Nichts an seiner Seite aufgetauchte Impresario tobt, dass es sich gewaschen hat. Telefonisch und mit groben Worten beutelt er den Bürgermeister wie einen Schulbuben. Dieser elende Saftladen hier! Dieses vermaledeite Kuhdorf! Ich habe es euch gesagt, habe es euch immer gesagt! Rumpelstilzchen ist nichts dagegen. Nicht genug damit, dass während der Konzerte draußen das blöde Vieh muht und scheißt; nun haben wir den Mist auch noch hier herinnen! Eh klar, dass in den Augen des Festivalgründers wieder einmal die desolate Hotelsituation im Dorf nebst dem pathologischen Unverständnis der Bauern die Schuld an der Misere trägt! Dieser etwas ungerechte und kurzsichtige Vorwurf wiederum kommt unverzüglich dem Hirschenwirt zu Ohren. Der kennt die Litanei, kann mit ihr aber naturgemäß wenig anfangen; umso saurer stößt sie ihm auf. Seit Jahren nämlich tut er, was irgendwie machbar ist, unterstützt von besten Zigarren, altem Cognac und einer couragierten Direktrice, um sein einst sogar von Mörike und dem einen oder anderen bayrischen König heimgesuchtes Haus auf kosmopolitisches Niveau zu heben. Jüngst hat er es unter Einbeziehung der bregenzerwälderischen Kreativ-Elite ganz unverkrampft zum Kunsthotel emporstilisiert. Dem Impresario ist das zu wenig, wenn nicht gar ein weiterer Dorn im Auge. Unerbittlich und hartnäckig fordert er dazu auf, endlich ein ordentliches, ein richtiges Hotel auf eine der zahlreichen Wiesen des Dorfes zu stellen, statt sinnlos mit riesigen Traktoren darauf herumzukurven und stinkende Gülle zu verspritzen. Regelmäßig droht er mit der Abwanderung seiner prestigeträchtigen und für die Gastronomie der Region unverzichtbaren Veranstaltung. Das ist allerdings starker Tobak und ein Druckmittel erster Güte. Denn etliche führende Häuser, Hotels und Restaurants, verdanken den Schubertianern mehr als viel. Aber nicht einmal die gelegentliche halbherzige Intervention des Landeshauptmannes kann etwas ausrichten gegen die bäurische Wettermännchen-Logik der mit schweren Holzschuhen aufmarschierenden Landwirtsfraktion. Wie auch!
Gäbe es in diesem verkommenen Kaff ein richtiges Hotel, zetert der Impresario cholerisch, könnte so etwas nicht passieren. Dann hätte der Künstler seinen Kasten samt unbezahlbarem Instrument nach der gestrigen nächtlichen Probe nicht in der Künstlergarderobe des Konzertsaals gelassen, um ihn nicht noch eine Nacht der zugigen Bude aussetzen zu müssen. Weniger sachlich lässt sich kaum mehr argumentieren. Außerdem entspricht die Argumentation nicht der wahren Motivlage des Meisters. Die ist nämlich um einiges egoistischer, außerdem nicht unbedingt künstlerischer, wenn auch im weiteren Sinne ästhetischer Natur. Aber ein Sündenbock muss natürlich gefunden werden und wenigstens dabei herrscht allgemein kein Mangel an Phantasie und Entschlossenheit. Wäre der Hirschenwirt einer, der nach schnellen und billigen Lösungen sucht, sein Blick auf Herrn Nadirer, den Impresario, müsste sich schleunigst und umfassend verändern! Er ist es nicht.
Unbestreitbar wäre einiges anders gelaufen heute Nacht, hätte der Maestro das teure Stück nicht aus der Hand gegeben. Wieso hat er das eigentlich getan? Denn jetzt ist das Cello fort und an seiner statt liegt eine Tote. Nicht gerade im, aber quer über dem weit geöffneten, schwarz lackierten Cellokasten, dessen mit weißer Seide ausgeschlagenes Inneres von wenigen roten Blutstropfen wie ein Sternenhimmel übersät ist. Das Cello: Ein von der Nationalbank gesponsertes Instrument von Jakob Stainer aus dem Jahr 1650. Auf ihm hat bereits der unschlagbare Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern – so hat man vor ein paar Jahrhunderten noch geheißen – gespielt, dessen Mysteriensonaten, auch Rosenkranzsonaten genannt, heute in einer Cello-Bearbeitung hätten aufgeführt werden sollen. Daraus wird nichts. Eher aus Rosenkranzbeten. Darin hat man auch mehr Übung hierzulande. Die Tote ihrerseits: jung, schön, nackt, fremd.
Wo also liegt das Problem, wo der Skandal? Für die einen im verschwundenen Cello mit seinem mindestens sechsstelligen Versicherungswert; für die anderen in der Toten selbst. Nicht unbedingt in der Toten schlechthin. Gestorben wird immer und zum Tod – wie zu allem religiös Besetzten – hat man in der Gegend ein recht auf- oder zumindest abgeklärtes, ein animalisch-archaisches, sprich ein katholisch-verqueres Verhältnis. Eine solche Tote passt jedoch gar nicht in die Idylle von Musik und Landpartie, die dem aus aller Welt angereisten Festspielpublikum suggeriert werden soll. Erstens präsentiert sie sich so, wie der liebe Gott sie erschaffen hat, allerdings, wenn man näher hinschaut, unter nicht unbeträchtlicher Mithilfe chirurgischer Nachbesserung, und zweitens nimmt sie einen Platz ein, der für sie weder vom einen noch vom anderen Demiurgen vorgesehen war, sollte man meinen.
Der Chefinspektor aus der Stadt, Isidor Ibele aus Bregenz, müsste jeden Augenblick eintreffen. Noch halten die Dorfpolizisten tapfer die Stellung. Wohl zumute ist ihnen nicht dabei. Dann schon lieber eine Wirtshausrauferei schlichten oder einen gestohlenen Heuladewagen suchen, heimtückisch versetzte Grenzsteine protokollieren oder entlaufene Zuchtbullen einfangen, aber nur mit Unterstützung schwer bewaffneter Spezialeinsatzkräfte. Das hier, oder doch eher: die hier, ist ihnen nicht geheuer. Nackt und tot und so betörend schön, dass man es selbst als Landpolizist direkt spürt. Ein bisschen viel auf einmal für die beiden wackeren Ordnungshüter.
IV.
Der ethische Primat des Morgens: dann entscheiden wir, ob wir das Programm wiederaufnehmen.
Peter Sloterdijk
Mit dem unwiderstehlichen Geruch des frisch aufgebrühten Kaffees dringt das Klingeln seines Mobiltelefons in Ibeles schlaftrunkenes, noch mit ganz anderem beschäftigtes Gehirn. Das von den recht bunt gemischten Reizen erzeugte Traumbild formt sich zu einem Trompete blasenden Meinl-Mohr samt Kaffeetasse, aus der er steigt wie eine burleske Varieté-Tänzerin aus dem Martini-Glas. Das ist mehr als genug, um Isidor und den Inspektor gleichzeitig mit einem Satz aus dem Bett springen zu lassen, was nicht so selbstverständlich ist, wie man denken mag. Der Kaffeeduft ruft Isidor in die Küche, wo seine Frau bereits zugange ist; das Telefon hingegen ruft den Inspektor ins Kommando. Es ist Freitagmorgen, der sechste September, gerade einmal Viertel vor sieben. Die beste Zeit für richtig guten Kaffee und Rösles Guten-Morgen-Kuss; keine gute Zeit für einen dienstlichen Anruf. Rösles Kuss und Kaffee halten, was der Morgen verspricht. Leider wird auch der Rest den Erwartungen gerecht: Es pressiert! Man braucht den Inspektor dringend. Mordalarm in Schwarzenberg. Jahrzehntelange tägliche Übung ist die Grundlage für die Ruhe, mit der Ibeles nun der äußeren Unbill zum Trotz frühstücken. Ein Amalgam aus Gelassenheit und Konzentration, bei dem jeder Handgriff sitzt. Ohne dass etwas in bloßer Routine erstarren würde, verschafft sich die Gewohnheit ihr Recht. Man gibt der Welt, was der Welt gehört und sich selbst, was man braucht. Alles hat seine Zeit. Der schwarze Kaffee, die Buttersemmel und das Vier-Minuten-Ei ebenso wie Rösles nicht gänzlich ironiefreie Kommentare zu Isidors letztlich unfreiwillig überstürztem Aufbruch. Rösle, eigentlich Rosalia, kann sich das, wie so manch anderes, erlauben. Sie macht es wett, mehr als wett, mit der Nonchalance und dem Engagement der geborenen Gastwirtstochter, einbetoniert im unerschütterlichen Wissen um ihren Platz in der Welt. Diese ermöglichen ihr, immer wieder Grenzen zu überschreiten, ohne sie deswegen gleich abzuschaffen.
„Immer pressiert es bei euch am meisten, wenn es nicht mehr pressiert. Möchtest du nicht einmal vor der bösen Tat am Mordschauplatz eintreffen?“ So direkt kann das Rösle Ibeles Freude an der in den starken, heißen Kaffee getunkten Semmel unterwandern.
„Als ob es je darauf angekommen wäre, was ich möchte, Liebling. Doch das weißt du besser als alle anderen, oder?“ Man schenkt sich hier nichts, wenn es darum geht, Ironie zu zelebrieren. Isidor erspart sie seiner Frau so wenig, wie er deshalb einen Grund sieht, auf den innigen Abschiedskuss zu verzichten.
Von der Pfarrkirche herüber ertönt der Viertelstundenschlag. Der Inspektor macht sich auf den Weg in die Bahnhofstraße. Zehn Minuten später sitzt er an seinem Schreibtisch. Kollege Baldreich steht vor ihm, fertig adjustiert zur Ausfahrt, in einem tadellosen zivilen Aufzug. Vielleicht eine Spur sportlicher, als man ihn in Erinnerung hat. Entspannt und leger, frisch rasiert und munter, bereit für die Fahrt in den Bregenzerwald. Überhaupt hat sich Inspektor Baldreich schnell eingelebt in seiner Vorarlberger Wahlheimat, integriert nennt sich das heutzutage. Es fällt ihm natürlich umso leichter, als seine Frau nun ebenfalls ihre Tiroler Heimat verlassen hat, um Vorarlberger Kindern Lesen, Rechnen und Schreiben nebst einigen sozialen Basisqualifikationen wie Gewaltfreiheit und Respekt vor Andersgläubigen beizubringen. Meine Gebieterin nennt Baldreich seine Regina nicht nur ob ihres sprechenden Namens liebevoll. Neben Baldreich trippelt der General wie ein nervöses Rennpferd hin und her, ein paar halb zerknüllte Blätter Papier in der Rechten, sein piepsendes Telefon in der Linken. Auch er ist fertig adjustiert, aber wofür? Wozu hat er sich in dieses martialische Kampfdress geworfen; mit derben Schnürstiefeln, einem erdfarbenen Overall und einem breiten Gürtel, an dem ein monströses Messer, eine Pistole und sogar ein tarnnetzbewehrter Stahlhelm baumeln? Wird er nach Afghanistan abkommandiert? Nein, er ist zum großen Bundesheer-Manöver ins hinterste Montafon geladen, zu dem ihn in Kürze ein Helikopter abholen soll. Knapp vier Monate vor seiner Pensionierung per Jahresende muss das eines der letzten Highlights seiner Karriere werden und vor allem ein mediales Feuerwerk erster Klasse.
„Ich habe den Schubertiade-Boss in der Leitung, Ibele, was soll ich ihm denn sagen?“, mault er mehr hilflos als drohend.
„Sagen Sie ihm, wir sind schon unterwegs“, erwidert Ibele lakonisch.
„Mein Gott, unterwegs, Ibele, der macht mir die Hölle heiß. Er will wissen, wo du bleibst und wo das Cello ist. Die Versicherer sind schon vor Ort!“
„Wir sind von der Mordkommission, General, nicht von der Musikalienhandlung. Wenn die Herren Versicherer nur überall so entschlussfreudig und schnell wären! In einer Stunde kann er mit uns rechnen, bis dahin soll er nur ja nichts angreifen, auch wenn er sich gern die Finger verbrennt, sagen Sie ihm das.“
„He, Ibele, bleib am Boden! Der hat’s schon so nicht leicht. Soll ich dir einen Hubschrauber einfliegen lassen?“ Einer, der am Boden bleiben soll, braucht keinen Hubschrauber und einer, der einen Hubschrauber braucht, hebt leicht ab. Abheben aber ist leichter als landen, manchmal sogar leichter, als am Boden zu bleiben.
„Sicher nicht, mon Général, da hinein schaffen wir es selbst. Und lieber gehe ich zu Fuß, als in eine solche Kiste zu klettern. Adieu, mon Capitaine.“ Ibele zwinkert Baldreich ob des Dienstgradkarussels schelmisch zu, gibt dem General förmlich die Hand, schlägt sogar die Absätze zusammen und salutiert im Stil des alten Kaisers Franz Joseph. Dann wendet er sich ohne weitere Umstände an Antoinette Hagen, während der hohe Herr in beinahe weinerlichem Ton sein Gespräch mit dem berserkernden Impresario zu beenden versucht, was in denkbar komischem Gegensatz zu seiner kriegerischen Gewandung steht. Ibele übergibt seiner Sekretärin einen Zettel mit etlichen Notizen und Aufträgen, den sie lächelnd entgegennimmt. Bei aller Hektik, die sich um den General verbreitet, kommt Ibele nicht umhin, der Hagen die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Auch heute wieder agiert sie in größter Selbstverständlichkeit und mit geradezu kolossaler Unbefangenheit. Schon allein ihre Art sich zu kleiden: ein weiter, blütenweißer, mit riesigen roten Rosen bedruckter, eine gute Handbreit über den Knien endender Rock aus Leinen, Glockenrock fährt es Ibele durch den Kopf, den sie zu einer zwar hochgeschlossenen, aber hauchzarten und durchscheinenden Bluse trägt, unter der, in Spitzenwunderwerke verpackt, deutliche Reize vielsprechende Präsenz demonstrieren, und um die schmale Hüfte ein breiter, blutroter Lackgürtel. Schon allein diese Art, diese Kunst, ergänzt sich auf das Entzückendste mit Antoinettes unbestechlicher Fröhlichkeit; nicht zu reden von der Frische des Lavendelduftes, der um das Fräulein weht, seit es von einer frühsommerlichen Reise ans Mittelmeer zurückgekehrt ist. Nach Marseille genauer gesagt, in die zur europäischen Kulturhauptstadt ausgerufene Metropole. Wiederum war ihr reicher Onkel, der Seidensticker, von dem sich halb Nigeria in sündteure Stoffe wickeln lässt, maßgeblich am erzieherischen Werk beteiligt, und wieder hat er eine exorbitante Wandlung in der jungen Dame bewirkt. Ein Glücksfall, dieser Onkel, bei dem die Kultur dem Geld vorangeht, statt ihm hirnlos hinterherzuhecheln. Er hat sie von ihrem Schlabberpulli- und Biogemüsetrip zurück in die Realität geholt, in die Realität mediterraner Lebenslust, luftig und leicht, fröhlich und klar zugleich. Scharf wie der Mistral bläst sie seitdem jeden Mief aus dem Chefbüro. Ma Marseillaise, wie Ibele sie neckisch nennt, oder auch ma Bouillabaisse, wenn das Stimmungsbarometer höher steigt, sorgt für klare Luft, und was nicht Hand und Fuß hat, fegt sie gnadenlos hinweg. Jetzt aber los, auf nach Schwarzenberg!
V.
Dokus Bilgeri erwacht allein und verkatert im zerwühlten Bett. Allein und verkatert – das eine wundert ihn so wenig wie das andere, beide Zustände sind ihm allzu sehr in Fleisch und Blut übergegangen. Nur schwer und langsam findet er zu sich. Dokus Bilgeri ist ledig. Mit seinen 35 Jahren nicht unbedingt ein Grund zur Sorge; für wen auch? Für ihn selbst sicher nicht, weil er nicht nur heute Morgen kaum einen Gedanken an sich selbst verschwendet; auch an nichts anderes und erst recht nicht an jemand anderen. An seine Mutter am ehesten, aber die ist tot. Damit sind auch ihre Mahnungen verstummt, sich nach einem schneidigen Moatle oder einem ghöriga Schmelle umzutun, was nichts anderes bedeuten sollte, als das mütterliche Kommando gegen das eines Eheweibs auszutauschen. Kein Wunder, dass Bilgeri dieses Projekt sehr nachlässig betrieben hat. Seinen Beruf als Holzhändler verdankt Bilgeri in erster Linie einer Reihe von Zufällen, am wenigsten irgendwelchen lobenswerten Charakterzügen, einer inneren Überzeugung oder gar besonderer Leidenschaft. All das sucht man an dem Kerl vergeblich. Allerdings ist da weit und breit niemand, der danach suchen würde. Der früh verstorbene Vater hat den Buben tagelang mit in den Wald genommen, ihn gelehrt, der Natur ins Auge zu schauen und nebenbei auch dem einen oder anderen Stück Wild, das man gelegentlich den Jägern weggeschossen hat. Mit dem Musikfestival im Dorf, der mondänen Schubertiade