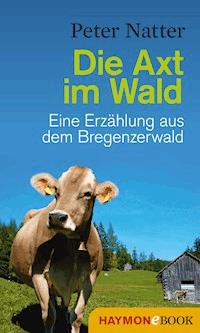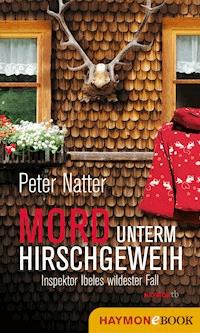Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ibele-Krimi
- Sprache: Deutsch
Hoch droben in den Bergen, bei den Reichen und Schönen, tut sich Grausiges. Ein tödliches Mikadospiel fordert Opfer im Kreis erlauchter Wintersportgäste. Aber auch der Schneider-Bauer muss mitten in der Stallarbeit dran glauben: Hätte er doch seinen Boden verkaufen sollen! Inspektor Isidor Ibele kehrt zurück an seine erste Wirkungsstätte. Eine Heugabel als Mordwaffe, halsbrecherische Skiabfahrten, Wodka in Strömen und blutgetränkte Pisten: Wofür das alles? Peter Natter ist ein Meister der authentischen Darstellung von Ländle und Leuten und überzeugt mit sympathischen Figuren, trockenem Humor, großer sprachlicher Kunstfertigkeit und Krimi-Spannung pur. ***************** Kriminalfälle mit Inspektor Ibele • Die Axt im Wald • Ibeles Feuer • In Grund und Boden • Die Tote im Cellokasten • Mord unterm Hirschgeweih ***************** "ein kurzweiliger und lebhafter Ausflug nach Vorarlberg" Die Presse, Duygu Özkan "ordentliche regionale Kost mit einem guten Schuss Humor" Tiroler Tageszeitung, Christian Windner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Natter
In Grund und Boden
Eine Geschichte von Sein und Haben
Diese Geschichte widme ich allen, die mich durch meine Lecher Zeit (1978–1980) begleitet haben; ganz besonders dem Aufklärer und Provisionierer Ambros Strolz. Die Wegzehrung war solide und ausgiebig.
Wenn Armut die Mutter des Verbrechens ist, dann ist Mangel an Geist sein Vater.
La Bruyère, Les Caractères
Ich schreibe für mich allein, für mich allein, wie ich rauche oder schlafe. Es ist eine fast animalische Funktion, so persönlich und intim ist sie.
Gustave Flaubert an Louise Colet, 16. August 1847
Zwei Spuren im Schnee
Sein Zuvielhaben dringt dem Reichen andauernd aus allen Poren.
Martin Walser, Über Rechtfertigung, eine Versuchung
Maximilian Antonius Petersen ist immer quer über die Skipisten gegangen. Zu Fuß, versteht sich. Nur heute braucht Petersen das nicht, denn es ist noch nicht so weit. Jung ist der Tag; unverbraucht, ausgeruht und frisch lädt er ein. Zur Stunde finden sich die Müßiggänger unter den Urlaubern am Frühstückstisch; die Sportlichen in den Skikellern und Wachsstuben; die andern im Bad, beim Friseur oder in den Armen, pardon: in den Händen der Masseurin. Man überlässt sich einem milden Diktat von Urlaubs-to-do’s; man gibt sich scheinbar willenlos einem vagen Getriebenwerden, dem vielzitierten und noch mehr strapazierten dolce far niente, der gehobenen Muße hin. Dr. Petersen jedoch ist keiner, der sich gehen lässt, Ferien hin, Ferien her. Meinetwegen: gehen hat lassen. Kein Mann der großen Worte, aber einer, der weiß, was zu sagen und zu tun oder eben nicht zu sagen und nicht zu tun ist. Je nachdem. Korrektheit ist seine Natur, durch und durch, bis zum sorgfältig gebügelten reinweißen Tüchlein in der linken Hosentasche. Dort, wo er herkommt, wird es gerne, also mit einem bewusst antiquierten Ausdruck, Büsdook genannt. So wie hierzulande in gewissen Landstrichen Lederhosen und Dirndlkleider dem selbstverherrlichenden Ausdruck überholter Geisteshaltungen dienen, so greifen Petersen und seinesgleichen auf die Sprache ihrer untergegangenen Ahnen zurück. Da, wo wir uns gerade befinden, ist das Büsdook zum profanen Sacktuch geworden oder überhaupt verschwunden und von billigem Einweg-Papierzeug abgelöst. O tempora, o mores. Kein Monogramm auf dem Tüchlein, so weit treibt Petersen den Kult um sich selbst nicht. Gar kein Kult, denn Kultisches liegt ihm, wie alles Neuheidnische, fern. Aber korrekt und vor allem konsequent ist er. Besonders wenn es um seine ureigensten Interessen geht, die er stets tunlichst im Verborgenen zu halten weiß. Seine ureigensten Interessen, so viel sei verraten, sind ökonomischer Natur. Das weiße Hemd trägt er wie eine zweite Haut, die Krawatte ist unvermeidlich und unauffällig, die Hose stets streng gebügelt, gerne mit Bundfalten und diskreten Stulpen. Warum nicht auch jetzt, im Skiurlaub? Noch dazu, wo man ausgesprochen mondän untergebracht ist, in einem Dorf, in einer Destination allererster Kategorie und in einem Haus von höchster Noblesse.
Das Aldoro in Lech kommt Petersen so weit entgegen wie irgend möglich. Mangelnde Tradition verbirgt sich geschickt hinter spektakulärer Zeitlosigkeit, pompöser Stil übertüncht fehlende Wurzeln. Antonius Petersen ist Anwalt, das heißt, er waltet überall dort, wo lukrative Agenden, renditereiche Investitionen und bevorzugterweise attraktive Immobilien winken. Nicht umsonst entstammt er einer uralten Hamburger Reeder- und Kaufmannsfamilie. In seinem Denken vereinen sich kühl kalkulierendes Hanseatentum, generationenübergreifender Sinn für bleibende Werte und ein couragiertes, um nicht zu sagen heißblütiges Element, das er seiner brasilianischen Großmutter verdanken dürfte. Dass das Alter der Familie, des Clans, mit dem erworbenen Reichtum direkt korrespondiert, versteht sich von selbst. Die gut und gern hundert hoch qualifizierten Spezialisten und Spezialistinnen in Petersens auf internationales Wirtschaftsrecht, Vermögensmanagement und Treuhändertum spezialisierter Kanzlei ihrerseits bestätigen auf das Eindrücklichste bzw. das Einträglichste das schöne Schriftwort, wonach jenen gegeben wird, die haben.
Die zweite Hälfte dieses berüchtigten Verses (Mt 25,29) birgt außer einer im gegebenen, leider nicht vernunftdominierten Kontext nicht weiter zu verfolgenden logischen Inkonsequenz eine tragische Wahrheit, die für unsere Geschichte, wie sich bald zeigen soll, größte Wichtigkeit erlangen wird, wenn es im heiligen Text lapidar heißt: »Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden.«
Prägnanter kann es nicht ausgedrückt werden, was Eugen Schneider im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte widerfahren ist. Mit der scheinbaren Widersprüchlichkeit des Bibelwortes hat er keine Probleme. Eugen Schneider ist Landwirt, Bauer. In Lech am Arlberg. Schon lange fühlt er nicht nur, er erfährt es am eigenen Leib, dass man einem immer noch etwas wegnehmen kann, auch wenn schon lange nichts mehr da ist. Denn wenn die materiellen Güter längst weg sind, dann holen sie deine Ehre und dein Ansehen, und zuletzt pressen sie die Lebensfreude und den Glauben aus dir heraus. Bauer sein in Lech, da bist du per se ein Relikt, ein Fossil, ein Überbleibsel, ein Anachronismus, ein Wiedergänger fast schon, ein Unwesen. Eugen Schneiders Hof war einst so weit das Auge reichte von saftigen Wiesen und Weiden umgeben. Einst, als noch der Urgroßvater darauf wirtschaftete. Jetzt bleibt den wenigen Kühen auf den verbliebenen Grünflächen kaum Platz, sich umzudrehen, umgeben von bedrohlich nahe gerückten, schneller als einem lieb sein kann aus der Mode geratenen Neubauten: Hotels und Pensionen, Restaurants, Cafés, Geschäfte. Kein Meter wird verschenkt. Nur hinter dem Haus, dem Wald zu, wo er zuerst sanft und dann steil ansteigt nach Hochlech hinauf, dort bleiben Schneider und seinem Erben noch ein paar Hektar Boden. Noch.
Maximilian Antonius Petersens Korrektheit beruht im Wesentlichen auf einem weiter nicht hinterfragten dynastischen Selbstverständnis. Richtig ist, was Petersens nützt. Wer Petersens nicht nützt, schadet sich. So einfach ist das. Petersens Weltbild folgt dem Drall, der ein einstmals praktisches, kaufmännisch orientiertes Interesse im Lauf der Jahrhunderte zusehends in ein aristokratisch-elitäres Denken hat kippen lassen. Naturgemäß auch in ein Denken, das mit Fug und Recht schlicht ein Rechnen genannt werden darf und nicht zuletzt unter dem viel geschmähten Namen Kapitalismus, oder neudeutsch new economy, Berühmtheit erlangte. Wie es so ist, folgt auch hier das Menschenbild jenem von der Welt unweigerlich nach. Somit ist, um exakt zu sein: war der Weg geebnet für Petersens über weite Strecken ebenso sorgloses wie letztlich menschenverachtendes Dasein. Im Augenblick, auf dem Sonnenbalkon seiner Suite, hoch über dem Lecher Dorfzentrum, umgeben von glitzernden Skipisten, fröhlichen Millionären und willigem Personal, fühlt er sich folglich ganz in seinem Element. Seine Frau Mathilde ist unterwegs. Wenn er sich an ihren Abschiedsgruß richtig erinnert, dem er kaum seine halbe Aufmerksamkeit geschenkt hat, ist sie in der Obhut ihres Shopping-Coachs ausgeflogen. Der Skianzug von gestern dürfte über Nacht aus der Mode gekommen sein; oder war es nur das Seidencape? Der Shopping-Coach, er nennt sich Cyril, ist von unsäglicher Fröhlichkeit und Glätte und steht im Dienst des großen, siebenstöckig in den Berg hinein gebauten Modehauses unten in der Dorfmitte. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von der sich Petersen die Sicht auf das extravagante und zugleich gewöhnliche Treiben gerne versperren lässt, steht nichts von dem, was hier heroben Sache ist. Aber viel anderes, dem der allzeit arg beschäftigte Mann sich nicht verschließt. Das Rumoren, Klappern und Rauschen hinter ihm dringt nicht in sein Bewusstsein. Das Tun und Treiben der Zimmermädchen geht ihn nichts an; die Zimmermädchen selbst noch weniger. Da ist der hanseatisch stolze Charakter denn doch solider als die Triebkraft internationaler Finanzbosse, die schon einmal einen Strauß zu viel ausfechten. Petersens Kahn segelt in weitaus stilleren Wassern. Sie sind so still wie tief, und nur wenn man genau hinhört, zischt und braust es, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt.
Nur manchmal schiebt Petersen den FAZ-Vorhang zur Seite und lässt ein Bild auf sich wirken, das sich ihm zur Linken präsentiert. Er schaut dann auf ein derzeit meterhoch mit Schnee bedecktes, von wenigen Tannen bewachsenes, für hiesige Verhältnisse erfreulich ebenes, noch unbebautes Stück Land zwischen Lechbach und Wald. Es bildet ein bevorzugtes Objekt von Petersens Begierde. Er will diesen Boden haben. Hat er ihn erst einmal, wird er dem milliardenschweren Krösus, in dessen Haus er jetzt sitzt, zeigen, dass Reichtum mehr ist als Geld. Dann wird es ihm nicht mehr passieren, mit einem Typen wie diesem Salvatore Scarlatti aus Neapel mit seiner lächerlichen weißen Weste auch nur die Tiefgarage teilen zu müssen! Kommt doch schon leichte Unordnung in Petersens rigid beherrschte Züge, wenn er nur daran denkt, wie er nach Jahrzehnten als Stammgast aus dem Alpenhof ausgezogen ist, nachdem es bei aller Grandezza des Hauses nicht mehr klar war, ob man sich in einem Luxushotel oder auf einem balkanischen Rummelplatz befindet. Vielleicht war auch die Grenze des Zumutbaren endgültig überschritten, als man begann, mit einem Höllenkerl namens Raoul Kenner halblegale Kochsessions zu veranstalten, bei denen sich Herr Petersen zu seinem ausgesprochenen Missfallen von aufgeputzter Ländle-Prominenz umringt sah, die sich in den Augen des Hamburger Großbourgeois eben doch etwas anders, etwas weniger unwiderstehlich darstellt als in der kleinräumig-engstirnigen Ländle-Betrachtungsweise. Wo sich ausgemusterte Airline-Beautys mit arg gestutzten Flügeln, im Glanz trendsettender Mode-Labels schattenhaft auftretende Kleiderhändler oder die üblichen abgehalfterten Donald-Trump- und Jay-Gatsby-Verschnitte aus der lokalen Großindustrie tummeln, kann sich Petersen ohne Weiteres heraushalten. Braucht er diesen Umgang, um überteuerte Leckerbissen von zweifelhafter Beschaffenheit löffelchenweise schlucken zu dürfen? Es mag ja sein, dass man für solche Semiseria-Kulinarik von Lustenau, Lochau oder Lauterach herauf fährt, aber sicher nicht von Hamburg herunter! Zugegeben, als Zwischenlösung ist das Aldoro nicht zu verachten. Typen wie Signor Scarlatti und der schwarze Helikopter auf dem Dach der Garage oder das aufgekratzt-arrogante Getue der Geschäftsführerin machen aber auch hier schnell klar, dass à la longue kein Bleiben ist. Es wäre ja gelacht, wenn einer wie Petersen sich in dem Gebirgsnest nicht sein eigenes Domizil zu beschaffen wüsste!
Wenn da nur nicht dieser sture, verbohrte Bauer wäre, Eugen Schneider, der partout nicht verkaufen will. Das Reden mit dem Kerl ist völlig sinnlos. Erstens versteht Petersen den Dialekt nicht, in dem es von seltsamen Lauten nur so wimmelt. Zweitens geht von dem Mann ein schwer erträglicher Mief aus, der Petersen nach jeder Begegnung zwingt, gründlich zu duschen, den Anzug zu wechseln oder gar zwei, drei Seiten Zauberberg zu sich zu nehmen. Drittens aber ist Schneider nicht zu durchschauen, selbst nicht für einen wie Petersen, dem doch nun wahrlich wenig Menschliches fremd ist, vor allem wo es mit Geld, Besitz und Kalkül zu tun hat. Was der Eingeborene wirklich will, ist Petersen nach mehreren Gesprächen mindestens so unklar wie zu Beginn. Ihm Geld, unverschämt viel Geld anzubieten, hat nicht den geringsten Erfolg gezeitigt. Andererseits geht es ständig nur um Geld. Petersen ist mit seinem Latein am Ende. Die beiden Söhne von Schneider, der im väterlichen Dunstkreis vegetierende Jungbauer und der Skilehrer, ein Schnösel, vor dessen gockelhaften Avancen man mit Müh und Not Frau und erst recht Tochter in Sicherheit gebracht hat, scheinen noch verstockter zu sein als der Alte. Einzig Schneiders Frau, eine Zugereiste, punktet mit einer gewissen Zugänglichkeit für Formen, für nordländischen Charme und für Bares.
Allerdings ist Schneider nicht das einzige Obstaculum. Das Sperrigste, was sich Petersens Ambitionen entgegensetzt, ist, um es gleich zu sagen, ein windiger Landsmann. Der hat sich neulich ebenfalls in den mittlerweile offen ausgetragenen Wettstreit um den Boden eingeklinkt. Offen, aber mit verdeckten Karten. Gustav Glück aus Wuppertal, ein Industrieller, der mit Frischhaltetüchlein und altem Frittieröl ein Vermögen gemacht hat. Ein Mann mit der Aura eines erkalteten Wienerwald-Hühnerflügels. Der ist sich natürlich nicht zu blöd für alle möglichen Allianzen. Sei es nun der alte Schneider selbst, der eine oder andere der heillos verschuldeten Hoteliers aus dem Dorf oder auch die oligarchischen Bewohner der Aldoro-Welt: Niemand ist vor Glücks unseligen Verbrüderungen sicher. Er tanzt auf allen Hochzeiten, d.h. auf allen Fünf-Uhr-Tees, in allen Discotheken, trinkt aus allen Becherchen, isst von allen Tellerchen, schläft in allen Bettchen und wirft mit seinem Geld herum, als wären es Schneebälle.
Da sind die lokalen Investoren mit ihrem pennälerhaften Auftreten geradezu harmlos. Ihre vom vernebelten Rheintal aus gesteuerten Bemühungen, Schneider den Boden abzuluchsen, sind im Vergleich zu dem, was Petersen als gang und gäbe oder zur Not noch ehrlich anzusehen gewohnt ist, so harmlos wie eine schnurrende Hauskatze gegen einen hungrigen Löwen im Circus maximus. Noch dazu sind sie mit den kriminalpolizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Hausdurchsuchungen in ihren Büros ausreichend beschäftigt. Schneiders Grundstück, auf dem Petersen bereits seine Villa in der Form eines überdimensionierten Schiffschornsteins stehen sieht, eines etwas schiefen Prismas also, das man den Einheimischen im Notfall als eine stilisierte Schneewächte verkaufen wird, dieses Grundstück will er denen erst recht nicht überlassen. Ihr leicht bigottes, zwischen Heimattümelei und Möchtegernfinanzhai angesiedeltes biederes Getue macht ihm auch keine Angst, schon eher könnte es einem langsam auf die Nerven gehen. Der Bauer Schneider selbst mit seinen paar Rindviechern: Wie mühsam es doch immer ist, wenn einer oder eine nicht einsieht, dass seine oder ihre Zeit abgelaufen ist. Gerade er, Dr. Petersen aus Hamburg, als Bewahrer einer jahrhundertealten Familientradition, hat für das Auf und Ab der Zeitläufte, für die Gezeiten des Lebens, für den rechten Augenblick ein feines Gespür entwickelt. Dem Schneider scheint es ebenso vollständig zu fehlen wie, peinlich und peinigend genug, der eigenen Frau, Mathilde Petersen, geborene Kirchler. Denn dass ihre Zeit an seiner Seite höchstens noch aus einer Gnadenfrist besteht, sagt sich Petersen, müsste ihr trotz einer geradezu phänomenalen Fähigkeit zur Verdrängung und kreditkartenbasierten Kompensation unangenehmer Wahrheiten spätestens im Laufe dieses Lech-Aufenthalts klar werden.
Zweitens als man denkt
Es gibt schlechthin keine Pflicht, alles zu sagen, was man sagen könnte.
Hans Blumenberg, Quellen, Ströme, Eisberge
Während Petersen mit zwei, drei ungeduldigen Raschlern das Feuilleton der gestrigen FAZ überblättert, öffnet sich die Terrassentür unhörbar. Doch nicht die zarte Hand des slowenischen Zimmermädchens ist es, die sie lautlos zur Seite schiebt. Vielmehr eine dicht mit blonden Härchen bewachsene, auffallend sorgfältig manikürte Pranke. Antonius Petersen ist in seiner täglichen FAZ-Lektüre im Wirtschaftsteil angekommen. Das Weltpolitische hat die gebührende, wenn auch etwas unkonzentrierte und von allerhand Kopfschütteln unterbrochene Aufmerksamkeit gefunden, die innenpolitischen Ränke schon etwas weniger. Was soll er mit den Informationen zu abgeschriebenen freiherrlichen Dissertationen anfangen? Was können ihm die Abhörmethoden englischer Revolverblätter Neues erzählen? Der mehr als tollpatschige Umgang des Bundespräsidenten mit milliardenschweren Freunden und aufdeckerischen Medien kostet den Herrn im Liegestuhl ein mehr als mitleidiges Lächeln. Und das Feuilleton, wie gesagt, überspringt Petersen quasi mit geschlossenen Augen. Kaum dass die eine oder andere Schlagzeile über Theaterskandale, Bestsellerdumping und Literaturpreisschieberei oder betrunkene und zugekokste Popdiven in sein Bewusstsein dringt. Nur einen kleinen Text des Feuilletonchefs persönlich, der sich euphorisch über eine literarisch-musikalische Veranstaltung äußert, nimmt er wohlwollend zur Kenntnis; und dem ausführlichen Interview mit einem der letzten großen Dirigenten, einem greisen Italiener, dessen dramatische und ungemein produktive Lebensgeschichte Petersen seit Jahren verfolgt, möchte er sich nach dem Studium der Börsen- und Wirtschaftsnachrichten in Ruhe widmen. Umso mehr, als der Maestro, wie eine dicke Überschrift verkündet, davon spricht, sogar den Schnee hören zu können: Schnee, der auf Schnee fällt – das ist Musik! Das Unhörbare, in Petersens Fall nicht unbedingt der Schnee, schon eher das Aktien-Auf-und-Ab, hörbar zu machen, darin nicht zuletzt besteht immer wieder die Strategie und der Erfolg des verwöhnten Anwalts. Jetzt allerdings überhört und übersieht er das Naheliegendste, wenn auch schwer Hörbare in eklatant leichtfertiger Manier. Das ist im vorliegenden Fall von leider fataler und letztlich letaler Konsequenz.
Man kann dem Herrn Anwalt angesichts seiner so radikalen Gleichgültigkeit der unmittelbaren Umgebung gegenüber einen gewissen Vorwurf nicht ersparen. Es laufen doch einige Fäden bei ihm zusammen und das Netz, das er mit ihrer Hilfe gesponnen hat, ist ohne Weiteres dazu angetan, die darin Gefangenen zu recht heftigen Befreiungsbewegungen zu provozieren. Ein solcher Gefangener setzt eben dazu an, sein Zappeln endlich in spürbare Befreiung umzusetzen. In seiner Rechten, es ist die Pranke, von der die schwere Terrassentür lautlos beiseite geschoben worden ist, funkelt in der hellen Vormittagssonne metallisch etwas Langes, Schmales, spitz Zulaufendes. Fast wie ein Dirigentenstab. Doch nur fast, denn der Fortissimo-Einsatz, zu dem das Instrument nun in die Luft fährt, markiert auch schon das Crescendo-Finale der allzu kurzen Alpen-Sinfonie und gleichzeitig Maximilian Antonius Petersens Ende. Kurz, laut- und wortlos ist dieses Finale, beinahe möchte man es sauber nennen, aber das wird ihm denn doch nicht ganz gerecht, wie wir gleich sehen werden. Die Arme mit der aufgeschlagenen FAZ sinken matt auf die breiten Lehnen des protzigen Tropenholzterrassenmöbels, in dem Petersen ruht. All die brandheißen Neuigkeiten, tiefschürfenden Analysen und gewitzten Kommentare, die heute so brisant erscheinen und morgen schon wieder bar jeder Relevanz in Vergessenheit geraten, wachen nunmehr über den ewigen Schlaf des so unvermittelt Dahingegangenen. Denn Petersen ist augenblicklich tot. Die spitze, krumme Waffe erreicht, geführt von muskulöser Hand, mühelos Petersens Herz. Noch ist dem toten Anwalt ein gutes Stündchen wahrer Ruhe gewährt, ehe sein Ableben beträchtliche Verwirrung in der Nachwelt stiften wird.
Den behänden Abgang über die seitliche Terrassenbrüstung, der ihn direkt vor den Aldoro-Skikeller katapultiert, schafft der sportliche junge Mann und Mörder ohne große Anstrengung, vor allem aber, ohne bemerkt zu werden. Nicht ganz zwar; doch der, der ihn wie aus dem Nichts als Raubtierschatten auf sich zuspringen sieht, hat seinerseits keinen Grund, jemanden zu sehen, der gerne ungesehen bleiben möchte. Gregorji Kobolnev hat in den letzten Monaten zu viel gesehen, um noch Energie für irgendwelche Neugier zu verspüren. Außerdem tut jetzt der Morgenkaffee seine Wirkung und sein Weg führt ihn weiter hinein in die Katakomben des Aldoro. Allerdings sind ihm Verstand und Seele in dem heillosen Krieg, in den ihn sein Präsident geschickt hatte, so weit geschärft und geschunden worden, dass er des Vergessens so wenig fähig ist wie des Erinnerns. Am ehesten noch alles zusammen in einer aufwühlenden Mischung! Wie heißt es doch: Die Erinnerung ist eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens. Kobolnev hat gelernt, das eine vom andern zu unterscheiden. Unser junger Sportler greift tief in den pulvrigen Schnee und wischt sich ein paar dunkelrote Blutstropfen von den Händen; dann packt er seine Skier, neuestes Modell, also deutlich länger und schlanker als das Zeug, das sonst herumsteht, schultert sie und stapft hinunter Richtung Skischule. Sein Püppchen wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mathilde Petersen ist eine so gelehrige wie willige Schülerin. Sie begegnet in Kürze ihrem Lebensretter wider Willen. Natürlich weiß sie davon im Moment so wenig wie von ihrem Witwentum. Ein paar Schwünge gehen sich noch aus, bevor ihr die Augen aufgehen.
Media vita in morte sumus
If nothing is self-evident, nothing can be proved.
C.S. Lewis, The Abolition of Man
Salvatore Scarlattis in Petersens Richtung posauntes »Ciao dottore« findet wider Erwarten keine Beachtung. Sein »brutto teppista« samt eindeutiger Geste in Richtung von Dr. Petersens Terrasse zeigt dieselbe enttäuschende Wirkung. Verblüfft bleibt der Mann mit der weißen Weste stehen. Bislang hat sich der deutsche Avvocato nie um ein Wortgefecht gedrückt. Scarlattis in ihren dicken Skianzügen etwas teddybärenhaft wirkende Bodyguards, drei sind es heute Vormittag, sind dem Anwalt für seine diskrete Zurückhaltung dankbar. Ihr Müllbaron schießt leider gerne ein wenig über das Ziel. Und wo schon das Ziel, das heißt den deutschen Gast um des reinen Vergnügens willen in seiner Behaglichkeit zu stören, eine deutliche Brüskierung darstellt, ist das ein so unnötiges wie aufwendiges Spiel mit dem Feuer. Die Kollegen aus dem Aldoro, wahre Gorillas in Maßanzügen, haben den neapolitanischen Sicherheitsleuten sehr schnell klar gemacht, welche Sprache hier den Ton angibt. Eine Sprache, die sich nicht so sehr in Worten als eher in kyrillischen Tätowierungen ausdrückt und darüber hinaus in Zahlen; Zahlen, wie sie auf den bündelweise kursierenden Banknoten zu lesen sind. So marschiert Salvatore weiter. Den sportlichen Teil des Tages bringt er gerne so schnell wie möglich hinter sich. Überhaupt lässt er sich nur darauf ein, weil seine Gattin auf diesen zwei Stunden an der frischen Luft besteht. Wir lassen ihn also mit seinen Mannen ruhig ziehen. Er ist für den Rest des Vormittags mit sich selbst mehr als beschäftigt. Macht er doch auf den Skipisten, im Gegensatz zu Signora Scarlatti, alles andere als eine gute Figur. Abgesehen davon, dass die gute Figur, wiederum ganz im Gegensatz zur Signora, generell nicht das vorherrschende Interesse oder gar eine der wenigen Stärken von Signor Scarlatti ausmachen würde. Vielleicht ganz einfach, weil er sie nicht hat, die gute Figur.
Leider nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt wie der neapolitanische Saubermann ist Kajetan, des Bauern Schneider zweitgeborener Sohn. Ihn lenkt Verschiedenstes von sich selbst ab. Zum einen ist das der Vater, dessen Verbitterung und Zorn immer mehr auch das naturgemäß nicht sonderlich harmonisch ausgeprägte kleinbäuerliche Familienleben vergiftet. Zum andern hält ihn Gustav Glück auf Trab, allerdings an äußerst kurzer Leine. Herr Glück erweist seinem schönen Namen, Gott sei’s geklagt, nur selektiv die Ehre, nämlich in erster Linie dort, wo es um ihn selbst geht. Ansonsten, das ist auch des jungen Schneiders vager und unbefriedigender Eindruck, spielt der Mann alle möglichen Spiele, die auf nichts anderem als sehr viel Geld und ebenso viel hirnloser Gier aufbauen. Eines davon hat mit seinem Vater und dem verbliebenen Baugrund hinter dem Hof zu tun; ein anderes offenbar mit dem Hamburger Strizzi droben im Aldoro. Genau dem soll Kajetan eine kleine Lektion erteilen, die dem Bauernbub einen schönen Batzen Geld einbringen wird. Viel mehr will er auch gar nicht wissen von den Umtrieben der Herrschaften. Man hätte das Brieflein wahrscheinlich auch auf einem anderen Weg überbringen können, aber Glück hat darauf bestanden, dass er, Kajetan Schneider, ein Einheimischer, dem Anwalt zeigt, wo sein wirklicher Platz ist. Um ein Haar hätte Schneider das Geld sausen lassen. Mit dem Petersen ist nicht gut Kirschen essen. Das hat sich erst kürzlich gezeigt, als Kajetan sich gerne wiederum als Skilehrer für Frau und Tochter etabliert hätte. Vielleicht muss man Wodka saufen können wie der Bischof Bastl, um an solche Beute heranzukommen und in diesen Kreisen zu bestehen. Jedenfalls hat der widerliche Schönling mehr Glück gehabt!