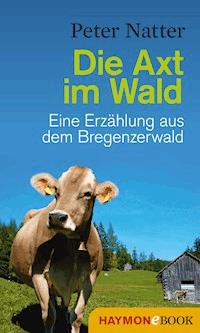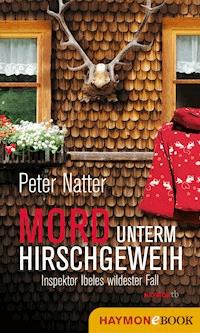
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ibele-Krimi
- Sprache: Deutsch
DIESMAL WIRD ES WILD: INSPEKTOR IBELE ERMITTELT IM MONTAFON. Schwarzer Tag im Silberberger Wald Es geht heiß her in Isidor Ibeles Revier: Im Silberberger Wald liegt eine Leiche - der alte Vonderleu, Bauer, Jäger und Sammler. Erlegt: durch einen Blattschuss. In seiner Hosentasche: 25.000 Euro. Währenddessen macht eine Tuberkuloseepidemie im Brunnenthal den Jägern dort zu schaffen - die Abschusspläne für das Rotwild, das die Krankheit verbreitet, erfordern brachiales Vorgehen. Außerdem gibt es da noch eine leidige Affäre um ein umstrittenes Kriegerdenkmal, das vielen ein Dorn im Auge ist und die Gemüter erhitzt. Mit Isidor Ibele und Peter Natter nach Vorarlberg Die Bewohner des idyllischen Tals stehen Ibele nur ungern Rede und Antwort. Dennoch tut der bodenständige Inspektor unbeirrt sein Bestes, sich zwischen frischen Gräbern hindurch der Wahrheit entgegenzutasten. Zu allem Übel muss er sich auch noch an einen neuen Chef gewöhnen. Für Nudelsuppe und Tafelspitz bei seinem Rösle und einen erlesenen Schluck Wein bleibt ihm zum Glück immer noch genügend Zeit. Als jedoch im Dorfgasthof ein brutal-scharfes Attentat auf ihn verübt wird und ein fatales Pilzgericht Menschenleben in Gefahr bringt, droht sogar dem Bregenzer Gourmet der Appetit zu vergehen ... ******************************************************************************** Peter Natter ist ein Meister der authentischen Darstellung von Ländle und Leuten und überzeugt mit sympathischen Figuren, trockenem Humor, großer sprachlicher Kunstfertigkeit und Krimi-Spannung pur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Natter
Mord unterm Hirschgeweih
Inspektor Ibeles wildester Fall
Peter Natter
Mord unterm Hirschgeweih
In großer Dankbarkeit meiner Mutter gewidmet
DER ERSTE: Leben?
DER ZWEITE: Vegetieren.
DER DRITTE: Krepieren.
Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame
Ich beschreibe da einen Typus, und das ist ein Typus, der viel Unglück anrichtet, nämlich einen Typus
mit so ’ner geraden Lebenslaufbahn. Das sind unvorstellbare Biografien.
Klaus Wagenbach
An welchem Punkt hört das Tier in uns auf, und an welchem Punkt fängt der Mensch in uns an?
Friedrich Nietzsche
Es gibt wenig, was unsichtbarer wäre als Denkmäler.
Wolfgang Herrndorf
I.
Erster Tag. Dienstag, 14. April 2015 am Heilandskogel oberhalb von Silberberg und St. Bartholomäi, zwei winzigen Dörfern, am engen Talgrund das eine, am steilen Berghang das andere
Leider aber hängt das Atmenkönnen nicht allein von der Luft ab.
Marcel Proust
Die Nacht ist klar und frostig und still. Eine leuchtende Mondsichel wandert über das Firmament. Nur der Wald ist tiefschwarz, der Wald, der sich über die steilen Hänge dem Grat zu ausbreitet, hinter dem er ins Radonatal abfällt. Im Süden zeichnet sich jeder einzelne der schneebedeckten Berggipfel wie Porzellan schimmernd vor dem Horizont ab. Eine schöne Nacht, wie gemacht für romantische Waldgänge. Weit drunten im Tal funkelt ein schmales Band von Lichtern entlang der Hauptstraße und der Bahnlinie. Im Dorf ist es fast vollständig dunkel, nur ein paar Straßenlaternen sind auszumachen. Ohne Rücksicht auf knackende Äste und raschelndes Laub, scheinbar ohne jede Angst vor möglichen Begegnungen, steigt ein Wanderer von kräftiger Gestalt vom Grat abwärts. Noch sieht er nicht, wer ihm von unten entgegenkommt. Er braucht es auch nicht zu sehen – er weiß es. So bewegen sich zu dieser nächtlichen Stunde, in der sich die Geister bereits wieder zurückgezogen haben, der neue Morgen aber noch fern ist, zwei Männer aus unterschiedlichen Richtungen auf ein vereinbartes Ziel zu. In zwei Stunden, um drei Uhr morgens, wollen sie vor einem zerfallenen Stadel auf einer größeren Lichtung mitten im Muttwald aufeinandertreffen. Schon am helllichten Tag möchte man dort lieber niemandem über den Weg laufen, den man nicht kennt.
Von unten, aus St. Bartholomäi, steigt der Zweite etwas kurzatmig auf. Wenn er auch nicht gerade das Geschäft seines Lebens wittert, eine gewisse verhängnisvolle Lüsternheit beseelt ihn dennoch. Die von lange unterdrücktem Zorn und tiefer Zerrissenheit kündenden Gesichtszüge verzerrt die Anstrengung zusätzlich. Ab und zu bleibt er stehen und wischt sich mit dem Ärmel der dicken Jacke den Schweiß von der Stirn. Eine bösartige Rachsucht drückt sich in derben, leise vor sich hingemurmelten Flüchen aus.
Der von oben Kommende, ein noch nicht Sechzigjähriger, erreicht die Hütte zuerst, eine knappe Stunde vor der vereinbarten Zeit. Er verstaut seinen Rucksack im Heu, nicht ohne ihm vorher ein schweres Jagdgewehr mit starkem Zielfernrohr zu entnehmen, das er sorgfältig zusammenbaut und lädt. Zuletzt schraubt er einen mächtigen Kolben an den Lauf, einen Schalldämpfer, der das Wild in Sicherheit wiegen soll. Im Schatten der Hütte sucht er sich einen Platz, von dem aus er den andern gut sehen kann, sobald der den Schutz des Waldes verlässt. Ein Stück weiter rechts stürzt der Rellsbach als tosender Wasserfall talwärts, den die schmelzenden Schneefelder in den Bergen mit eisigem Wasser speisen. Über Dutzende Meter stürzt die Flut senkrecht in die Tiefe, bevor sie sich in einem Kessel sammelt und von dort ihren Weg ins Tal nimmt. Das mächtige Rauschen schluckt jedes Geräusch, selbst ein Schuss wird darin mühelos untergehen. Er soll nur kommen und vorerst seinen Willen haben, der Blödmann. Soll er ruhig glauben, man gebe klein bei, man ziehe den Schwanz ein. Soll er sein Geld haben vorerst, seinen Judaslohn: Glück wird ihm der keines bringen. Es ist nicht die erste Schlinge, aus der der Wartende seinen Hals zu ziehen vorhat, abgerechnet wird bekanntlich am St. Kathrinentag, und der kommt womöglich früher, als so ein Schlaumeier glaubt.
Selbst wenn er eine Ahnung davon hätte, sich seit Minuten im Visier einer großkalibrigen Waffe zu bewegen, könnte das Vonderleus Unverwundbarkeitsfantasien, seiner wilden Entschlossenheit nichts anhaben. Als hätte er ganz ohne störendes Lindenblatt in Drachenblut gebadet, tritt er auf die Muttwald-Lichtung und geht nach einem ausgiebigen Rundumblick auf den alten Stadel zu, in dessen Schatten er einen Gewehrlauf blitzen sehen könnte, wenn nicht seine verdammte Überheblichkeit wäre. Nur der Griff seiner Faust schließt sich fester um sein altes, kampferprobtes Taschenmesser. Im Wasserfall bricht sich das Mondlicht. Sein Tosen übertönt die weiter halblaut gemurmelten Schimpftiraden des Bauern. Das Wasser skandiert einen ewig gleichen Rhythmus, der gleichwohl anzuschwellen scheint wie Bocksgesang. Jedes andere Geräusch schluckt der feuchte Wiesenboden. Als Vonderleu um die Ecke des hinfälligen Gebäudes späht, stehen sich die beiden zu allem entschlossenen Männer mit versteinerten Mienen Aug’ in Auge gegenüber. Das heißt, Vonderleu blickt in einen Gewehrlauf, der sich ihm beinah in die Stirn rammt. Das war nicht abgemacht, du Lumpenhund!
»Lass doch den Blödsinn, du Depp, und gib den Zaster her!«, gibt sich Vonderleu kaltblütig und schiebt den Gewehrlauf zur Seite.
»Eigentlich sollte ich dich einfach abknallen, du Hundling, statt dir Geld zu geben«, kontert der andere.
»Erstens ist es eh nicht deines und zweitens weißt du genau, dass du ohne mich nie an deinen Maharadschaschatzersatz kommst.« Es ist eine heikle Gratwanderung, die Vonderleu in Angriff nimmt, denn sein Gegenüber ist schwer zu taxieren. Dass der Kerl schon lange nichts mehr zu verlieren hat, macht die Sache nicht einfacher. Als er sich anschickt, in seinem Rucksack herumzukramen, schließt sich Vonderleus Faust noch fester um den Griff des Messers. Doch der finstere Geselle befördert ein fest verschnürtes Bündel Banknoten zutage.
»An was soll ich nicht kommen? Was redest denn für einen Quatsch daher! Lass mich nur in Frieden mit dem Maharadscha-Zeug. Der Besenböck liegt mir schon genug in den Ohren damit. Weil’s der nötig hat. Ihr könnt mir bald alle den Buckel runterrutschen! Nimm das Geld und hau ab!«
»Wie viel ist es?«
»Wie viel soll es sein? 25.000, wie abgemacht. Du kannst von Glück reden, wenn ich es mir nicht noch schnell anders überlege! Ich weiß nämlich nicht, warum du dir das nicht selbst geholt hast.«
»Natürlich weißt du es: Weil der Besenböck so schon misstrauisch genug ist und mir der Schweizer Almöhi, der Andermatt, immer mehr auf die Pelle rückt. Ich brauche dem seine Rindviecher, sonst ist der Sommer gelaufen. So, und jetzt gib endlich Ruhe! Wir reden nächste Woche weiter, ruf mich an!«
Nichts als einen langen Blick erntet Vonderleu für seine Erklärung; einen Blick, der zwischen hündischer Unterwürfigkeit und viehischer Grausamkeit wechselt. Wie ein feuriger Stab bohrt er sich in Vonderleus Hirn und geht ihm beim Abstieg ins Tal nicht mehr aus dem Sinn.
Der andere bleibt unbeweglich sitzen. Erst als die Nacht langsam zu Ende geht, macht er sich auf den Weg. Er führt ihn ebenfalls abwärts, dem Dorf zu.
Der bitterkalte Morgen verspricht einen weiteren strahlend schönen Vorfrühlingstag. Mehr und mehr geht die Farbe des Himmels im Osten von dunklem Blau in ein strahlendes Violett über. Adolf Gottlieb Vonderleus Armbanduhr zeigt halb sechs. Der Mann, der sich nach einer schlaflosen Nacht noch um einiges älter fühlt, als ihm lieb ist, liegt unter einer mächtigen Tanne am Waldrand und starrt in Richtung St. Bartholomäi. Weit unten, im Tal der Ill, rattert der erste Frühzug der Regionalbahn mit Pendlern und Schülern der Bezirkshauptstadt zu. Das grässliche Quietschen ist trotz der riesigen Entfernung zu hören. Niemand soll sich wundern, wenn einer die Nerven wegschmeißt, der neben den Gleisen wohnt und über Jahre hinweg von diesem Lärm frühmorgens aus dem Schlaf gerissen wird. Irgendwann schreibt er dann der Bahn ein böses E-Mail, richtet wüste Drohungen an die Behörden, stellt sein Auto quer über die Schienen und wird dafür vor dem Landesgericht zur Rechenschaft gezogen. So ungerecht ist die Welt! In den paar Häusern um die Kirche rührt sich nur, was sich um diese Stunde unbedingt rühren muss. In den Küchen der Bauernhöfe, in den Ställen und im Pfarrhof brennt Licht, einzelne Autos fahren talwärts.
Seit einer Stunde gestattet sich Vonderleu keine Bewegung. Weil das gibt es eigentlich nicht, dass der Appenzeller Schlawiner nicht auftaucht! Aber warten kann er, der Vonderleu. Schließlich wird ihm die Zeit doch zu lang, er holt ein Stück fetten Speck aus dem neben ihm liegenden Rucksack, säbelt mit dem Sackmesser dicke Scheiben herunter und kaut bedächtig darauf herum, saugt das würzige Fleisch mit den breiten Fetträndern aus wie alten Kautabak. Zum x-ten Mal fährt seine Rechte in die tiefe Hosentasche der Knickerbocker und befingert ein dickes Bündel Geldscheine. Alles da. Gut, dass der Inder so brav gezahlt hat. Wenn es mit dem anderen auch so glatt läuft, könnte Vonderleus Plan spätestens im Sommer, zum Alpauftrieb, aufgehen. Er soll endlich kommen, der Wichtigtuer! Noch einer, dem er endgültig den Meister zeigen wird. So wie dem lächerlichen Radonataler, dem Affenschädel, der vorhin geglaubt hat, mit ihm Katz und Maus spielen zu müssen. Vor einem Gewehr hat er sich sein Lebtag noch nicht gefürchtet! Jetzt gilt es, den Appenzeller in die Knie zu zwingen, dann ist der Alpsommer unter Dach und Fach. Ein Vonderleu lässt sich von ein paar schwindsüchtigen Hirschen und Rindviechern nicht das Geschäft verderben, von wildgewordenen Jägern, Tierschützern oder gar Vegetariern noch weniger. Der Emmentalerfresser und Stumpenraucher wird seine Franken noch früh genug kriegen, Gottverstutz!
Aufgepasst: Dort droben, knapp hinter den beiden Jagdhütten, bewegt sich etwas. Das muss er sein. Warum zum Teufel kommt der Idiot von der Hütte her? Seine Trittspuren auf den letzten Schneeresten werden alles verraten. Geh weiter!, will Vonderleu ihm zurufen, als sich die längste Zeit nichts mehr tut. Traut er sich nicht, der feige Hund? Am liebsten wäre dem Appenzeller nämlich gewesen, man hätte ihm das Geld auf sein Schweizer Konto überwiesen. Ja sicher, am besten übers Netbanking mit IBAN und BIC und all dem neumodischen Quatsch. Da hat Vonderleu ihn schön ausgelacht! Ausgerechnet übers Internet wird er seine Geschäfte erledigen, damit die halbe Welt erfährt, wie der größte Alpbesitzer im Brunnenthal sich sein Vieh sichert und sein Scherflein ins Trockene bringt, während rundum alle absaufen! Ganz so bescheuert, wie alle Welt glaubt, seit sein Stall leer ist, ist er bei Weitem nicht. Diese Prämie muss sich der Herr Aktionär und Großbauer schon persönlich abholen, und sich dabei einiges anzuhören, wird ihm auch nicht erspart bleiben. Die halbe Nacht hindurch hat sich Vonderleu die Sätze zurechtgelegt. Jeder Winkeladvokat könnte stolz sein auf den hochgradig verklausulierten Vertrag, den er aufgesetzt hat in seinem alten Sturkopf, seit er sich mitten in der Nacht aus dem Bett geschlichen hat, in dem seine Frau Walpurga Philomena wahrscheinlich noch immer den Schlaf der Gerechten schläft. Adolf Gottlieb ist der Letzte, der ihn ihr nicht gönnt. Sie hat ihn verdient. Sie hätte sich überhaupt etwas Besseres verdient als diesen Mann, das spürt er immerhin. Doch es ist gekommen, wie es kommen musste. Hat ihn denn jemand gefragt? Und jetzt ist es sowieso zu spät. Die alten Geschichten sind passé, Schnee von gestern. Es schaut auch aus, als ob man sich abgefunden hätte damit. Die meisten wenigstens. Die anderen, ein paar unbelehrbare Hanswurste ... Adolf Gottlieb wird ihnen zeigen, wo Bartle den Most holt.
Oder hat Walpurga wieder einmal die Schlafende gespielt, wie so oft, wenn er spät nach Hause kommt, sie schlafend glaubt und am nächsten Morgen haargenau erfährt, wie spät es war und was er alles umgeworfen hat auf seinem unsicheren Gang ins Schlafzimmer?
Der leere Stall war es, der ihm den Weg gezeigt hat. Da haben sich all die Siebengscheiten endgültig selbst ins Knie geschossen. Wegen einer einzigen TBC-kranken Kuh haben sie ihm den ganzen Stall ausgeräumt. Ausgerechnet ihm, Adolf Gottlieb Vonderleu, 65 Jahre, im besten Alter für einen von seiner Statur und Veranlagung. Bauer, Alpbesitzer und Jäger. Seine schönen Kühe abtransportiert. Gekeult: Wenn er das Wort schon hört, steigt sein Puls ins Ungesunde. Der Stall bleibt verwaist, vorläufig. Nie ist er in den paar Wochen seither den Verdacht losgeworden, es habe dem einen oder andern Spaß gemacht, sein Vieh abtransportiert zu sehen. Lange wird er sich nicht hinhalten lassen von den Herren der Landwirtschaftskammer, auch von der Versicherung nicht. Vonderleu ist keiner, den diese Witzfiguren mit hohlen Phrasen abspeisen können. Wenn er an das dämliche Grinsen von diesem Breuss denkt, als die Lastwagen durchs Dorf gefahren sind! Der halb vertrottelte Straßenwärter, der hat es nötig, der Knallkopf. Kann der überhaupt bis drei zählen? Wie ein Maulwurf ist er ihm immer vorgekommen. Auch einer, der sich glücklich schätzen könnte, dass die Dinge sind, wie sie sind, und der stattdessen durch die Gegend hatscht wie das personifizierte Unglück. Vonderleu weiß gar nicht mehr, wie viele Messen er den alten Pfarrer Rüscher schon hat lesen lassen, als Dank für gutes Wetter, unfallfreie Alpsommer, zur Abwehr von Hagel und Trockenheit oder ähnlichem Stuss, den auf der ganzen Welt niemand glaubt. In Wirklichkeit geschah es erstens, um den Geistlichen für sich zu gewinnen, sitzt doch die Kirche in der Gegend auf den schönsten Alpflächen und Weiden, zweitens, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, das ihn noch manchmal plagt wegen der zugegeben etwas delikaten Brautabwerbung damals. Gut, dass dieses Motiv nur die Walpurga kennt, außer demjenigen natürlich, dem er das Rösslein ausgespannt hat, diese prachtvolle Stute, noch dazu aus bestem Stall!
Stille rundum. Vom Dorf herauf läutet es den Tag ein, sechs Uhr. War das ein Tier vorher, eines der dem Abschuss geweihten Rehe oder ein schon jetzt aus der Winterruhe erwachter Dachs? Kein Wunder bei dem Winter, der bis weit hinauf so schneearm wie selten einer war, und bei dem Frühling, der um Wochen zu früh ins Land gezogen ist. Die Kirchenglocken läuten zur Schülermesse, es ist sieben Uhr. Großer Andrang seitens der Jugend herrscht nicht, nur die übliche Handvoll alter Weiblein humpelt daher. Vonderleu wartet.
Ja, natürlich, der leere Stall wurmt ihn gewaltig. Nicht so sehr der Kühe wegen. Er wird neue kaufen, bessere, wird die Milchleistung hochjagen mit Kraftfutter, holländischem, der Andermatt besorgt es günstig. Rentabel ist es trotzdem nicht, aber zum einen gibt es nicht umsonst die Bergbauernzuschüsse aus Brüssel, zum anderen geht es eh nur darum, die Statistik zu dominieren, den Dörflern die Prämien wegzuschnappen, denn ihre kaum verhohlene Schadenfreude zwickt ihn gewaltig. Dafür hat er sie nicht all die Jahre großzügig teilhaben lassen an seinem Hab und Gut, an seinen Beziehungen, seiner Gutmütigkeit. Sie sollen nur aufpassen. Ein Vonderleu weiß genau, wer seine Weideflächen falsch vermessen hat, um sich schöne Eurosummen an EU-Subventionen zu erschwindeln. So dumm, dass er sich nicht noch dümmer stellen kann als die Vollkoffer im Dorf, ist er nicht. Auch dem Landesrat wird es nichts nützen, hierzulande das Milchmädchen und in Wien drunten den wilden Mann zu spielen oder umgekehrt, wie man’s grad braucht, sollte er die kommende Landtagswahl überleben. Vonderleu hat, besser als ihm und manch anderen lieb ist, im Kopf, wer welche Förderungen kassiert hat. Wozu sitzt er denn seit Jahrzehnten im Gemeindevorstand? Etwa weil er sich engagieren möchte für die nette Dorfgemeinschaft? Sicher nicht. Dafür gibt’s die Weiber und ein paar Memmen wie den Haberer von der Tochter, den roten Toni, oder den deutschen Geldsack vom Heilandskogel droben. Der eigene Bub, der Norbert, wenn er auch sonst nicht viel taugt, wird ihm jetzt einmal von großem Nutzen sein. Dafür hat er neben seinen Frauengeschichten genug Zeit, und es ist doch praktisch, wenn man immer wieder Konkurrenten aus dem Weg räumen kann, indem man ihre halbkriminellen Praktiken an der richtigen Stelle anzeigt oder sie im Geheimen bluten lässt. Wie zur Bestätigung knistert leise das Geldbündel in Vonderleus Hosensack. Dass der Norbert mit dem Großvater unter einer Decke steckt, muss man in Kauf nehmen. So richtig ernst nimmt den Alten eh niemand mehr, seit sein wirres Sinnen und Trachten immer mehr in die Zeit zurückfällt, als auch hier im Tal die braunen Banditen in den Gemeindestuben und die roten Fahnen an den geschindelten Fassaden den Ton angegeben haben.
Gleich Viertel nach sieben. Schön langsam wird Vonderleu ungeduldig. Fünf Uhr war ausgemacht. Austreten sollte er auch einmal. Ein paar Schritte gehen wäre nicht schlecht. Hier oben rührt sich weit und breit nichts, drunten im Dorf geht der Betrieb langsam los. Die Pendler machen sich auf den Weg in den Walgau, die Schüler sammeln sich an den Bushaltestellen. Auch den Enkel, Norberts Sohn, kann Vonderleu mit dem Fernglas erkennen. Von dem erwartet er sich gar nichts, was sein Werk fortsetzen könnte. Schon, als er seinen Namen zum ersten Mal gehört hat, wurde Adolf Gottlieb Vonderleu klar, dass die Sache gelaufen war: Kevin Sven Goetz. Daraus wird nie im Leben ein Landwirt, ein Älpler, ein Jäger. Wenn der Schnösel mit dem Gymnasium fertig ist, nächstes Jahr vielleicht, wird er an der FH Multimedia-Design studieren oder auf die Angewandte gehen, hat er verkündet. Vergiss es!
Vonderleu lässt das Fernglas sinken und konzentriert sich aufs Pinkeln. Auch das war schon einfacher. Dafür rascheln bei jeder Bewegung die Fünfhunderternoten. Musik in seinen Ohren! Etwas starr von der Kälte, die langsam, aber sicher durch das dicke Lodenzeug dringt, schickt sich Vonderleu gleich darauf wieder an, eine halbwegs bequeme Position auf seinem Lager einzunehmen. Da hört er einen lauten Knall, einen Gewehrschuss. Ganz nah muss das sein, zuckt es durch sein Hirn. Gleichzeitig brennt es zwischen den Schulterblättern wie Feuer. Der Bauer sackt vornüber, röchelt, greift sich ans Herz, verdreht die Augen – und ist von nun an tot.
II.
14. April 2015, 06:50 Uhr oberhalb von St. Bartholomäi, eine recht opulente Jagdhütte
Aber wer weiß schon, woher kommt, was man in seinem Kopf hat.
Arthur C. Danto
Eigentlich wollte der junge Vonderleu, der kleine oder auch der dicke Vonderleu, das Weinfass, wie er im Dorf aus zweierlei Grund genannt wird, in der warmen und gemütlichen Hütte sitzend nach Wölfen Ausschau halten und sie fotografieren, um auch einmal in die Zeitung zu kommen, um berühmt zu werden. Seine aktuelle Geliebte, die Mizzi, Kellnerin im Bergblick, schläft derweilen noch selig. Besser für den Späher wäre es gewesen, er hätte der Mizzi sein Augenmerk geschenkt. Schließlich sind die Schlafenden seit eh und je ein ergiebiger Quell intimster Offenbarungen, unverstellter Wahrheit und erquickender Betrachtung. Außer denen vielleicht, die in aller Öffentlichkeit mit offenem Mund sabbernd vor sich hinschnarchen. Aber für derartige zwischenmenschliche Feinheiten ist Vonderleus Charakter nicht geschaffen. Nebst Kaffee und Schnaps, denen er zur Erweckung der Lebensgeister fleißig zuspricht, steht ihm wie gesagt nach Wölfen der Sinn. War doch kürzlich zu vernehmen, dass sie womöglich wieder Rudel bilden in den Wäldern des Landes. Dabei könnte es sich allerdings um eine Art von Bildung handeln, die nicht in den Wirkungsbereich der geneigten Schul- und Sportlandesrätin fällt; selbst dann nicht, wenn Meister Isegrim sein Revier auf die neu erbauten Sprungschanzen drüben auf der anderen Talseite ausweitet, von denen sich die Dame nicht weniger als den endgültigen Aufschwung der Jugend und kräftig auf sie selbst abstrahlenden, allerdings noch fernen olympischen Ruhm zu erwarten scheint. Zu beißen und zu reißen wird der Räuber dort nicht viel finden, denn was zu holen war, haben sich ein paar findige Unternehmer bereits gesichert. Wie sein Vater weiß auch der junge Vonderleu nur allzu gut um die Geschichten vom gewinnträchtigen Umgang mit den wertlosen, verrotteten Böden! Ein paar ganz raffinierte Raffer haben neue Wege gefunden, den längst eingestellten Silberabbau im Tal wiederzubeleben, indem sie Schottergruben in wahre Goldgruben umgewandelt haben. Wenn schon nicht eine neue Art von Rudel oder gar Bildung am Werk war, so sicher eine Art gieriger, hungriger Wölfe. Oder doch eher Haie?
Hoppla, was knallt denn da durch den Morgendunst? Bestimmt kein Wolf, sondern ein Schuss, eigenartig gedämpft zwar, aber ganz klar ein Schuss! Noch dazu definitiv keiner aus einem von seinen eigenen im Wandschrank versorgten, gut geölten und stets feuerbereiten Jagdgewehren, so viel ist sicher. Eher ist er von oben, vom Wald her gekommen. Wem mag er gegolten haben? Es wird viel geschossen derzeit, auf fast alles, was sich bewegt, seit sich die Jägerschaft auf Kriegspfad gegen das Rotwild befindet.
So trocken jedoch war das Frühjahr auch wieder nicht, dass dieser Schuss viel Staub aufgewirbelt hätte. Umso mehr, als die Bahn des Geschosses in bester Blattschussmanier mitten in Adolf Vonderleus Herz geendet hat. In der Jagdhütte, in der der Verblichene seinen Geschäftspartner vermutet hatte, sorgt der Knall immerhin für das Erwachen der Maid.
»Was ist denn da los? Hast du grad geschossen, Berti?«, erkundigt sie sich schlaftrunken bei ihrem von seinem Stuhl aufgesprungenen und die Tür entriegelnden Kavalier.
»Geh, red keinen Blödsinn, Mizzi, womit denn? Einer von den verrückten Jägern war es wahrscheinlich, einer von den ganz wichtigen, die auf Schalldämpfer umgestellt haben. Es würd mich interessieren, was der da schießt vor unserer Hütte!« Die Frage nach dem Womit ist angesichts des am Fensterbrett lehnenden Jagdgewehrs und der im offenen Wandschrank versorgten Waffen eher rhetorischer Natur. Nur ist die Mizzi zumindest im Augenblick nicht wach genug, um kompliziertere Zusammenhänge zu durchschauen, einfache schon eher:
»Wahrscheinlich hat er einen tollwütigen Hirsch erlegt, oder? Denen geht’s doch jetzt an den Kragen, stimmt’s? Gibt’s eigentlich wirklich Wölfe bei uns, Berti? Und krieg ich auch einen Kaffee?« Ein bisschen viel Fragerei auf einmal für den so Angeredeten, der aus dem geöffneten Fenster talwärts stiert.
»Keine Tollwut, Mizzi, TBC haben die Hirsche, wie oft muss ich dir das noch sagen? Tollwut haben die Füchse. He, was ist das? Himmelhargazak nochmal, da liegt jemand am Waldrand. Los Mizzi, steh auf und zieh dir endlich was Ordentliches an. Deinen Kaffee kannst dir selber holen. Ich geh nachschauen.«
Je näher der junge Vonderleu der liegenden Gestalt kommt, desto mulmiger wird ihm. Er hätte die Schnapsflasche mitnehmen sollen. Schneller, als ihm lieb ist, hat er die knapp hundert Meter auf dem schmalen Steig zurückgelegt, dann gibt es keinen Zweifel mehr: Es ist der Vater, der da im Gras liegt. Hat der Schuss vorhin tatsächlich ihm gegolten? Ja, hat er. Ein großer roter Fleck auf dem grauen Lodenjanker ist die Bestätigung. Norbert Vonderleu schaut sich zögerlich um. Weit und breit ist nichts zu sehen von einem Schützen. Ohne den Toten auch nur zu berühren, rennt er zurück in die Hütte, wortlos greift er zum Telefon. Ohne Mizzi eines Blickes zu würdigen oder auf ihre Fragen zu antworten, drückt er ein paar Tasten und trommelt in größter Verstörung mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Der Vater ist tot, Bürgermeister, erschossen, heroben bei der Jagdhütte. Ja, jetzt, vor zwei Minuten. Was soll ich tun?«
Stille, dann ein paar Sätze, die den Anrufer noch mehr aus der Fassung bringen.
»Nein, ich weiß nicht, wer es war, du Trottel! Was? Ich? Spinnst du komplett, Konrad? Sag mir lieber, was ich tun soll!« Die Anweisungen, die er erhält, sind kurz und deutlich. »Raus jetzt aus dem Bett, Mizzi! Der Vater ist tot. Wir müssen weg!«
»Was, der Vater ist tot? Welcher Vater? Deiner? Hast ihn erschossen oder was? Warum denn?«
»Fang du jetzt auch noch an mit dem Quatsch, Heilanderwelt! Wofür haltet ihr mich denn alle? Mach um Himmels willen lieber vorwärts, statt so einen Stuss zu verzapfen! In einer Minute sind wir weg, bevor die Gendarmen da sind!« Hektisch beginnt er, in der winzigen Hütte immer wieder mit der sich anziehenden Mizzi zusammenstoßend, die Fensterläden zu schließen, lässt dann nervös davon ab und räumt notdürftig auf, die Unordnung dabei eher noch vermehrend. Vor allem die Gewehre verstaut er sorgfältig. Die Kaffeetassen verschwinden in der winzigen Spüle. Mit dem Haushalt hat er es nicht, der Macho. Er schaut gerne der Schwester und der Mutter beim Putzen und Aufräumen zu, aber für ihn ist das nichts. Dann läuft er schon Richtung Dorf, die stolpernde Mizzi an der Hand hinter sich herschleifend, blick- und wortlos an der Leiche des Vaters vorbei. Nur Mizzi stößt einen spitzen Schrei aus, der in etwas wie einem meckernden Kichern verebbt, was ihr seitens des Galans ein beherztes »Renn, du Kuh!« einträgt.
III.
14. April 2015, 07:15 Uhr am Heilandskogel, ein gemütliches Chalet, leicht großkotzig, über dem Eingang ein gigantisches Elchgeweih