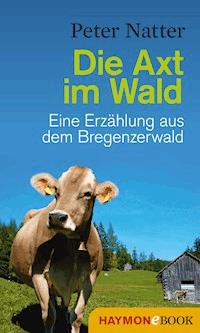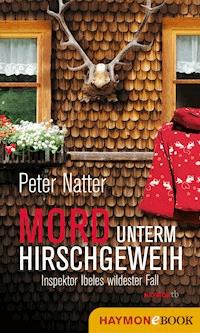Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ibele-Krimi
- Sprache: Deutsch
Brauchtumspflege ist gut und recht - oder auch nicht. Inspektor Ibele hat da seine Vorbehalte; vor allem, wenn Tote zu beklagen sind, dort, wo sie eindeutig nicht hingehören. Eine schöne Witwe macht's dem Inspektor nicht einfacher, etliche gefälschte Testamente und ein toter Baumeister stiften weitere Unruhe. Die Spuren führen tief in verschneite Wälder, aber auch in vornehme Dornbirner Fabrikantenvillen. Wie kaltblütig kann ein Heißsporn sein? Peter Natter ist ein Meister der authentischen Darstellung von Ländle und Leuten und überzeugt mit sympathischen Figuren, trockenem Humor, großer sprachlicher Kunstfertigkeit und Krimi-Spannung pur. ***************** Kriminalfälle mit Inspektor Ibele • Die Axt im Wald • Ibeles Feuer • In Grund und Boden • Die Tote im Cellokasten • Mord unterm Hirschgeweih ***************** "ein kurzweiliger und lebhafter Ausflug nach Vorarlberg" Die Presse, Duygu Özkan "ordentliche regionale Kost mit einem guten Schuss Humor" Tiroler Tageszeitung, Christian Windner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Natter
Ibeles Feuer
Eine Geschichte vom Erben
Diese Geschichte widme ich Reiner Speck, dem großen Proustianer und Förderer der deutschsprachigen Proust-Rezeption. Ihm verdanke ich wesentliche Erfahrungen tout autour de Proust, nicht zuletzt als Leser meiner selbst.
Mihi ipsi scripsi.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Das Bewußtsein zu brennen bedeutet schon Abkühlung.
Gaston Bachelard
Personen und Handlung der folgenden Geschichte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen oder Begebenheiten ist rein zufällig.
Hexenwahn und Feuerzauber
Funkensonntag, 13. März 2011
Danach, wenn es erloschen ist, Wenn der Hügel kalt ist, / Kommen die Gaffer.
Jean Tortel
Lange Zeit ist immer alles gut gegangen. Kaum wird im November mit einem Mords-Trari-Trara der Fasching eingeläutet, machen sich die Männer an die Arbeit. Monate hindurch sammeln die Mitglieder der Funkenzunft brennbares Material: Holzpaletten, Harrasse, Kisten, ausrangierte Christbäume, Abrissholz. Sie stapeln es sorgsam in einem Schuppen auf dem Bauhof des Funkenmeisters. Seit Tagen beschäftigen sie sich damit, den Krempel zu ordnen, herzurichten, zu vervollständigen, letzte Fuhren Brennholz heranzukarren und mit Hilfe von Lkw-Kränen und Traktoren den turmartigen Funken aufzubauen. In der letzten Nacht vor dem Abbrennen wachen sie, angetrieben von reichlich Schnaps und Bier, über den Scheiterhaufen, während auf der Wiese daneben ein kleiner Jahrmarkt aus provisorischen Buden, primitiven Tischen und Bänken errichtet wird. Seit wenigen Minuten endlich tanzen ein paar auserwählte Oberzünftler mit langen, brennenden Fackeln um das Brandwerk herum. Es sind selbstverständlich lauter Männer, wackere Kerle, das Beste, was das Oberdorf zu bieten hat, die Crème de la Crème von Zunft, Freiwilliger Feuerwehr, Faschingsgilde, Bürgermusik und Pfarrgemeinde.
Der sogenannte Kieskurvenfunken im Dornbirner Oberdorf ist einer der bekanntesten im Land. Das verdankt er nicht zuletzt seiner exponierten Lage auf einer Anhöhe über der Stadt. Von fast überall im Tal ist er bestens zu sehen. Selbst im Schweizerischen jenseits des Rheins hat er viele Bewunderer. Somit ist er natürlich immer mittendrin im jährlichen Wettbewerb um den allerhöchsten Scheiterhaufen, um die schreckenerregendste und am spektakulärsten explodierende Funkenhexe. Dass der Festrummel rund um das makabre Schauspiel Jahr für Jahr größer werden muss, versteht sich von selbst. Leider ist der Platz zwischen der Straße und den steilen Hängen allzu begrenzt, sonst wüsste man schon, wie man mit dem alten Brauch die Kassen ordentlich zum Klingeln bringen könnte!
Ganz oben auf dem Scheiterhaufen thront wie jedes Jahr die lebensgroße Funkenhexe. Sie stellt nach alter Überlieferung den Winter dar. Ihn gilt es heute, am ersten Sonntag der Fastenzeit, auszutreiben. Warum der Winter eine Hexe sein muss, ist auch den Oberbrauchtümlern nicht wirklich bewusst. Aber wenn es nur laut und besoffen genug zugeht, erspart man sich das Nachdenken, das ist die Hauptsache. Was die nach allen Regeln der Kunst hergerichtete Hexe für die Männer, die grölend um das gut fünfzehn Meter hohe, kunstvoll aufgeschichtete Brandwerk herumwirbeln, außer dem Winter noch verkörpert, sei hier nicht unser Thema. Das traurige Kapitel der mittelalterlichen und neuzeitlichen Hexenverbrennungen ist zwar längst abgeschlossen, allerdings nur in den Theorien der Historiker. Hier und heute wirkt noch vieles und lebt vieles wieder auf, das eigentlich schon längst überwunden geglaubt war! Es ist nämlich eine große Unaufrichtigkeit um das Gerede vom Zeitgemäßen und Modernen. Handelt es sich doch bei seiner Beschwörung meist um nichts anderes als Faulheit im Geiste. So lebt in mancherlei auf das Billigste aktualisierter Gestalt lediglich uralter Aberglaube fort!
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit treten die auserwählten Zunftmitglieder mit den brennenden Fackeln an den mächtigen Holzstoß heran und entzünden ihn unter den martialischen Klängen der Blasmusikkapelle. Morgen früh werden sie wieder brav in Büros und Werkstätten ihren mehr oder weniger biederen Dienst antreten. Hier heroben jedoch sind sie die großen Herren: mit ihren eigenen Ritualen, ihrer eigenen Ordnung, ihren eigenen Gesetzen. Gierig springt das Feuer von den Fackeln auf den strohdürren Funken über. Für wenige Augenblicke setzt sich im enger und enger um den Funken gezogenen Ring der vielen Schaulustigen so etwas wie Ehrfurcht oder Andacht durch. Bald aber zerreißt eine Reihe von Ahs und Ohs die kurze Stille. Das Geschrei vor Angst und Entsetzen plärrender Kinder macht sich breit. Schon wenige Sekunden später prasseln die Flammen meterhoch zum Himmel. Riesige Funkenbälle zerstieben in alle Richtungen. Das trockene Zeug brennt lichterloh. Wildes Gebrülle und übermütige, an die Hexe adressierte Rufe begleiten das Knistern und Knallen des gespenstischen Feuers. »Herunter mit der Hexe!«, »Brenn, du Luder!«, »Dass dich der Teufel hol’!« und ähnliches dringt aus bestens geölten Kehlen. Die vom Alkohol diktierten Parolen geben ganz nebenbei so manchen Hinweis darauf, wes Ungeistes Kind die Menge noch immer ist, immer war und immer sein wird.
Rund um den flackernden Holzstoß nimmt das Volksfest seinen Lauf. Bier, Schnaps und Glühwein werden ausgeschenkt. Zunehmend übermütige Verkäuferinnen reichen Becher, Gebäck und Bratwürste über die Tische. Nicht minder ausgelassen und närrisch nimmt das Publikum das eine so gierig und lüstern wie das andere in Augenschein. Das kalte trockene Wetter gibt den Blick frei bis weit hinunter ins Rheintal. Überall in den Dörfern leuchten zur Stunde die Funken auf: Schwarzach, Wolfurt, Hohenems, Lustenau, Hard. In manchen Gemeinden sind es gleich mehrere. Jeder hat seinen Winter auszutreiben. Jeder hat seine eigene Dunkelheit, die er nur allzu gerne mit ein wenig Feuerzauber und Fusel vertreiben möchte. Mit reichlich Alkohol und einer kurzlebigen Ekstase lässt sich das Vergessen wahrhaft preiswert erkaufen. Es herrscht eine Stimmung, wie sie kein anderes Fest im Jahreskreis aufweist. Ob es nun in den Köpfen präsent ist heute Abend oder nicht: Die letzten echten Hexenverbrennungen sind hierzulande noch nicht so lange her. Vieles von der Grausamkeit, Barbarei und Obszönität, von der Gewalttätigkeit der historischen Hexenverfolgung schwingt mit.
Unaufhaltsam treibt das Fest dem makabren Höhepunkt zu. Die Flammen züngeln orangerot in den schwarzen Nachthimmel und lecken bereits an den Röcken der Hexe. Glutbälle fahren wie Kometen fauchend aus dem Funken. Das Prasseln übertönt alles Lärmen und die Schlagermusik aus den riesigen Lautsprechern. Keine zehn Minuten sind vergangen seit dem Anzünden. Gebannt verfolgen die Zuschauer das Spektakel. Im Moment geht es hier um nichts anderes als dieses Feuer, dessen Kraft und Furor die Menschen völlig verzaubern. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ist das so. Da geschieht, in der allgemeinen Ausgelassenheit und Faszination zuerst von niemandem bemerkt, das Unfassbare. In einer kaum wahrnehmbaren Bewegung beginnt sich der glühende Feuerturm langsam zu neigen. Womit erst recht keiner gerechnet hat: Er neigt sich der Bergseite zu. Dorthin, wo Jung und Alt besonders dicht um ihn gedrängt stehen. Dann plötzlich geht es rasend schnell. Mitten in die panisch aufschreienden und chaotisch kreuz und quer auseinanderstiebenden Menschen hinein birst der Funken. Sich aufbäumend, qualmend, fauchend und Feuer speiend bricht er in sich zusammen, als wär’s ein tödlich getroffenes Ungeheuer. Es ist ein Wunder, dass es keine Toten und nicht einmal nennenswert Verletzte gibt.
Keine Toten, außer einem.
Die Hexe wird in hohem Bogen von ihrem Juche herabgeschleudert. Mit einem eigenartig dumpfen Knall kommt sie auf der asphaltierten Straße zu liegen. Ihre versengten Kleider rauchen, der spitze Hut liegt ein paar Meter weiter und beginnt eben zu brennen. Gleich wird sie in die Luft gehen. Sofort sind die ersten Zünftler zur Stelle. Die Hexe muss ja gerettet und – wie es der Brauch verlangt – am kommenden Sonntag feierlich beerdigt werden. Diesen Spaß will man sich ob des damit einhergehenden Festes nicht entgehen lassen. Als die Männer mit nassen Tüchern auf die glimmende Hexe einschlagen und sie packen, um sie wegzuschleifen, geht ihre grölende Geschäftigkeit blitzschnell in schieres Grauen über.
»Hände weg!«, schreit Funkenmeister Häfele, der dem Hexenkopf am nächsten steht, außer sich und verscheucht seine Kumpane mit Tritten und Hieben. So hysterisch hat ihn noch niemand gesehen.
Es ist sein fünfundzwanzigster Funken, der erste, der nicht hält und die zweite Hexe, die nicht wie es sich gehört in den Flammen verbrennt. »Hände weg, ihr Vollidioten!«, brüllt er wie ein auf den Tod gereizter Stier in den unbeschreiblichen Tumult hinein, »und ein Telefon her, aber dalli-dalli! Ein Telefon, verflucht nochmal!«
Help! I need somebody
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,
Flamme bin ich sicherlich.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Rosalia, genannt Rösle, Inspektor Isidor Ibeles Ehefrau, betritt stolz lächelnd, empfangen von bewundernden Ausrufen, das behagliche Esszimmer. Vor sich her trägt sie eine große silberne Platte. Darauf häuft sich goldgelbes Backwerk: die Funkenküchle. Das ist der traditionelle jährliche Funkensonntagabendschmaus im Haus Ibele. Genauer: sein krönender Abschluss nach einem reichhaltigen, aus Gerstensuppe, Schweinsbraten, Kesselfleisch, Knödeln und Sauerkraut bestehenden Mahl. Die private, familiäre Funkenfeier, selbstverständlich ohne Hexe, hat eine lange Tradition in der Familie Ibele. Tief ist sie im bäuerlichen Milieu mit seinem naturnahen und an den Jahreszeiten orientierten, gleichwohl aber der Aufklärung verpflichteten Denken verwurzelt. Folglich hat man mit Hexen, Scheiterhaufen und ähnlichem Brimborium nichts am Hut, noch weniger mit einem längst überholten, in seiner Einseitigkeit meist gröblichst vereinfachenden Frauenbild. So versteht sich Rosalias Kochleidenschaft, das sei ihren gestrengen Kritikerinnen ins Stammbuch geschrieben, nicht als Indiz einer biederen Hausfrauenexistenz, wie man bei oberflächlicher Betrachtung vermuten möchte. Rösles Leidenschaft ist vielmehr ein Hinweis auf ihr über viele Generationen hinweg quasi säkularisiertes, intellektualisiertes Dasein. Harmonisch werden Geist, Sinne und Seele zur Einheit gebracht. Genuss und Kunst, Arbeit und Spiel sind eines. In dem Moment, da die ersten Gäste nach dem begehrten Gebäck greifen, ertönt ein Folgetonhorn, scheinbar genau unter dem großen, massivhölzernen Tisch. Was ist das? Ein auf der Strecke gebliebener Faschingsscherz? Nein, es ist das Mobiltelefon des Hausherrn. Kaum ist der Inspektor mit dem Apparat diskret in sein Arbeitskabinett ausgewichen, brandet das Gespräch der kleinen Gesellschaft erneut auf. Unbekümmert macht man sich über die Küchlein her.
Wenige Minuten später ist Ibele wieder zurück. Er trägt jetzt nicht mehr seine gestrickte Hausjacke, sondern ein recht modisches knappes Mäntelchen, die Füße stecken in auf Hochglanz polierten Schuhen, in der Hand hält er seine karierte englische Schirmmütze.
»Gottverdammte Funkerei!«, knurrt er als Antwort auf das vielstimmige »Hoppla!«, »Hoi!« und »Was ist passiert?« in die Runde und schickt noch ein kräftiges »Heilandzack« hinterher. Letzteres trägt ihm einen tadelnden Blick seiner Frau ein. Hat sie ihm doch als Fastenübung eine Fluchabstinenz auferlegt. Denn das Fluchen ist bekanntlich eine Schwäche von Inspektor Isidor Ibele. Allerdings, auch das weiß man, es ist kein Indiz schlechter Laune, da gibt es anderes. Achselzuckend und knapp informiert er die Tischgesellschaft:
»Ich muss gleich ausrücken, in Dornbirn hat’s offenbar ein ärgeres Malheur gegeben.« Er angelt sich zwei, drei heiße Funkenküchlein von der Platte und balanciert sie in der freien Hand. Innig küsst er seine Frau, was die alte Hutterer-Freundin mit einem scheelen Blick auf ihren kümmerlichen Gatten zur Kenntnis nimmt. Ibele winkt den Gästen bedauernd zu und ist weg.
Durch die noch junge, frostige und somit, wie es in der Sprache der Wetterredaktionen heißt: »für die Jahreszeit viel zu kalte« Nacht fährt Ibele dem gut zehn Kilometer entfernten Dornbirn zu. Der Inspektor ist ein betulicher Autofahrer, ein echter Gleiter, kein Vollgastyp, nicht einmal wenn’s pressiert, was jetzt aber eh nicht der Fall ist. Tot ist tot, wenigstens für ziemlich lange Zeit. Der kürzeste Weg ist selten Ibeles Ziel. Geschwindigkeit ist für ihn ein absolut relativer Begriff und sicher nichts, was irgendwie einen eigenständigen Wert verkörpern könnte. Nur ein Mal kam er nicht drum herum, das Gaspedal voll durchzudrücken. Ein einziges Mal, vor bald fünfunddreißig Jahren im voll besetzten VW-Variant. Da hat er den 45 Pferdestärken die Sporen gegeben, als gälte es das Leben. Galt es auch. Aber das ist eindeutig eine andere Geschichte.
In Dornbirn-Süd verlässt Isidor die Autobahn und fährt dann direkt auf das Oberdorf zu. Was sich an dieser Stelle weitaus eindringlicher in sein Denken und Empfinden drängt als das ominöse Funkenunglück, ist die Hintere Achmühle. Das ist eine heute noch – die Betonung liegt allerdings auf dem noch – überwiegend bäuerliche Straße im Dornbirner Hatlerdorf. Dort hat er als kleiner Bub, wenn seine Eltern ihre obligaten Ferienreisen absolvierten, einige Jahre hindurch unvergessliche Urlaubswochen verbracht. Der kleine Sommerfrischler war dann jeweils bei einer älteren Schwester seiner Mutter, der verwitweten Hilda, zu Gast. Dort hat er weit mehr für seine Entwicklung und sein Leben mitbekommen als später in vielen Schul- und Lehrjahren. Mehr Erfahrung und mehr Wissen, mehr Ahnung und mehr Achtung, vor allem mehr, viel mehr Liebe. Da steht schon das Haus der Tante. Ein altes, großes Rheintal-Bauernhaus mit schönem Garten, Gemüsebeeten, Quitten- und Zwetschkenbäumen. Ein stolzes Haus, auch wenn es sich in Ibeles Erinnerung noch weitaus prächtiger darstellt. Stolz war auch die Tante, so stolz und schön wie weichherzig und – wer weiß? – einsam … Nicht einmal Ibele kann so langsam fahren, dass ihn nicht im Handumdrehen die Gegenwart einholen würde. Zum Beispiel in Gestalt der neu errichteten Wohnanlagen links und rechts der Straße. Sie bedecken jene Felder, auf denen der kleine Urlauber als tapferer Indianer mit Pfeil, Bogen und Steckenpferd auf Kriegspfad gegangen ist. Die Gegenwart zeigt sich auch im grellen Feuerschein des Achmühler Funkens, den Ibele soeben passiert. Hier nimmt alles seinen vorgesehenen Lauf. Die Hexe brennt lichterloh, gleich wird sie explodieren und in tausend Stücke zerrissen durch die Luft sausen. Das den Festplatz zahlreich belebende Volk johlt und säuft, säuft und johlt. Es hat seinen Spaß. Eigenartiger Spaß, denkt sich Ibele mit einer deutlichen Spur von Missmut. Bevor er ins Grübeln kommt, nimmt der Inspektor bereits die ersten paar Kehren hinauf zur Kieskurve. Eine seltsame Prozession begegnet ihm. Es muss sich um die abziehenden Funkenbesucher handeln. Geknickte, zerknirschte, frustierte Gestalten. Die Frauen tragen schlafende Kinder auf dem Arm. Die Männer, soweit sie nicht ebenfalls mit Kindern oder Bierkisten beladen sind, diskutieren aufgeregt und gestikulieren ratlos. Eine Autokolonne schiebt sich im Schritttempo der Stadt zu.
Wenige Minuten später ist Ibele am Ziel, steht vor einem qualmenden Haufen, einem wirren Durcheinander von verkohltem Gebälk inmitten einer gespenstischen Leere. Erhellt wird das ganze lediglich vom zunehmenden Mond am sternklaren Nachthimmel und von den kreisenden Blaulichtern der Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge. Der Geruch von verschüttetem Bier, Bratfett und verbranntem, nassem Holz liegt in der Luft. Verlassene Verkaufsstände, umgeworfene Tische und Bänke. Ein Szenario wie in einem schlechten Katastrophenfilm. Es stinkt gewaltig zum Himmel. Ibele schickt einen langen Blick hinunter ins Tal, wo allenthalben die großen Feuer lodern. Eine Gauloise soll seine Wahrnehmung schärfen. Fetzen von Blasmusik dringen aus der Stadt herauf. Ein Stadtpolizist begrüßt den Inspektor höflich, erstattet knapp Bericht und weist auf Rettungskräfte und Spurensicherung. Dann winkt er einen Mann herbei und stellt ihn als Wolfram Häfele vor. Seines Zeichens Funken- und Baumeister, ein Ur-Dornbirner. Ein Süoßlar wie aus dem Bilderbuch, mit aufwendig gezwirbeltem Schnurrbart, bekleidet mit Zipfelkappe und einem modisch aufgepeppten Jägerdress. Es ist eine auf den ersten Blick imponierende Erscheinung, aber von auffälliger Blassheit des Gesichts und fahrig in den Bewegungen. Was hat den so aus der Fassung gebracht? Ungefragt beginnt er auf Ibele einzureden.
»Heiliger Florian! Das gibt’s normal nicht, Herr Inspektor! Das war noch nie da, noch gar nie!« Der große kräftige Mann jammert haltlos vor sich hin. Wüsste Ibele nicht vom Alarmanruf der Dornbirner Kollegen her, worum es geht, der da wäre wohl kaum imstande, es ihm zu erklären!
»Also der Reihe nach, guter Mann. Wo ist das corpus delicti?« Ibele versucht Ruhe in das aufgewühlte Gemüt zu bringen. Mit zittriger Hand weist der Funkenmeister ein paar Meter auf der Straße bergwärts. Über Glutnester hinweg und um schwelende Balken herum erreicht Ibele den Leichnam. Der Tote, der einzige Tote des mißglückten Funkensonntags, befindet sich mitten auf der Bödelestraße. Mit signalrot leuchtender Farbe sind auf dem Asphalt die Umrisse des mit verrenkten Gliedmaßen bäuchlings liegenden Leichnams nachgezeichnet. Was den Funkenmeister so nachhaltig verwirrt, ist schnell erzählt. Der Tote ist niemand anderer als die Funkenhexe! Die Funkenhexe aber ist ein Mensch, ein Mann aus Fleisch und Blut! Das Fleisch ist leicht angeröstet und das Blut verkocht. Offenbar ein mittelgroßer, eher schmächtiger Mann, in mehrere lange, zerschlissene Röcke und ein buntes Gemisch von Blusen, Jacken und weiten Umhängen gekleidet. Auf dem Kopf sitzt schief eine rußige blonde Perücke, an den Füßen trägt er ein Paar spitze Stiefeletten. Alles miteinander mausetot.
Die Kollegen von der Spurensicherung können sich über Arbeit nicht beklagen. Sie wissen kaum, wo sie anfangen, und noch weniger, wo sie aufhören sollen. Eine hagere, hoch aufgeschossene Gestalt, es ist der diensthabende Notarzt, schleicht sich von hinten an Ibele heran und bellt ihm ungefragt seinen launigen Kommentar ins Genick. Man scheint eher redselig zu sein hier in Dornbirn, bei den Braschlarn.
»Herr Inspektor«, legt er in einem melodiösen Singsang los, »ich sage Ihnen eins: Der Mann da ist so tot, toter geht’s nicht. Der ist tot und bleibt tot. Mein Gott, ist der tot! Do gang i glei wiid’r huam!« Ibele fährt herum und mustert die drahtige Figur. »Gestatten, ich bin der Doktor Bertolino. Ich habe leider Dienst heute Abend. Das blöde Funkenzeug ergibt doch nie etwas Gescheites, das sage ich Ihnen!«
Unter Ibeles wortlos-kritischer Musterung bedient sich der Arzt, eine kleine Verbeugung andeutend, einer etwas sachlicheren Ausdrucksweise:
»Der Tote da dürfte unter anderem erwürgt worden sein. Aber nicht mit den Händen, eher mit einer riesigen Zange! Und zwar schon vor mindestens einem, eher vor zwei Tagen! Schauen Sie sich einmal seine Augen an! Zudem, was mir mehr als spanisch vorkommt, es fehlen ihm an jeder Hand zwei Finger. Das schaut wie abgebissen aus, wenn ich das so sagen darf, Herr Inspektor.« Statt einer Antwort runzelt Ibele die Stirn, nimmt seine englische Mütze ab und streicht sich mit der Hand ein paar Mal über die Glatze. Den Mund verzieht er unwillkürlich zu einer kleinen Schnute, die Nachdenklichkeit, Erstaunen und Ratlosigkeit signalisiert. Der Rest der Gauloise landet in dem, was einmal der Funken war.
»Wer ist der Tote?«, fragt Ibele in die rasch größer gewordene Runde der ihn umringenden Männer. Frauen sind am ganzen Brand- und wohl auch Mordschauplatz bis auf die letzten verschreckt zwischen ihren Verkaufsständen herumhuschenden Marketenderinnen keine mehr zu sehen.
»Es ist der Wilfried Bäcker«, »Ein Frühpensionist«, »Ein Privatier«, »Gelegenheitsarbeiter und fleißiger Pippler«, »Vor Jahrzehnten einmal war er jemand!«, »Herz- und magenleidend«. Ein vielstimmiger Chor ertönt hohl zu Ibeles Linken aus dem Dunkel. Und von der anderen Seite: »Ein möblierter Herr drunten im Oberdorf«, »Ein gutmütiger Kerl«, »Der tut keinem was«. Die Worte torkeln unsicher auf den Inspektor zu. Zumindest was das Trinken angeht, scheinen die Informanten Eingeweihte zu sein.
»Was hat der da heroben verloren?«, will Ibele wissen. Bei der Nennung des Namens Bäcker hat ihn eine flüchtige Erinnerung gestreift. Fürs Erste bleibt ihm jedoch keine Zeit, länger dabei zu verweilen. So verblasst und erlischt sie und sinkt zurück in die Tiefe, aus der sie emporgekommen ist.
»Er hat uns ab und zu bei leichteren Arbeiten geholfen, für eine Jause und ein paar Gläser Most und Schnaps.«
Ibele winkt einen der Stadtpolizisten zu sich, der sich als Mäser Tone vorstellt. Gemeinsam nehmen sie die Namen und Personalien einer Handvoll Männer auf, die angeben, über den Toten aussagen zu können.
»Jetzt halt doch endlich das Maul und sei wenigstens einmal still, Zumtobel, du lästiger Mensch! Du kommst dann morgen dran!«, fährt Mäser unwirsch einen schwer Betrunkenen an, der ununterbrochen zusammenhangslose Kommentare vor sich hinlallt und sich nach vorne drängt. Allesamt werden die Männer für morgen früh ins Bregenzer Kommando bestellt. »Nüchtern«, wie Ibele mit gespielter Drohgebärde anfügt. »Zumindest nicht völlig besoffen«, fügt Dr. Bertolino so ungefragt wie überflüssig hinzu, als wäre er in seiner Praxis. Ganz geheuer ist der Witz hier und jetzt aber nicht einmal ihm selbst. Der Funkenmeister liegt derweilen im Rotkreuzauto auf einer Bahre. Eine Beruhigungsspritze sollte ihn bald wieder halbwegs auf die Beine bringen. Sein Auftritt ist ihm heute gründlich vermasselt worden. Wie gründlich, das wissen nur ein paar Eingeweihte. Ibele wundert sich sehr über diese menschliche, männliche Funkenhexe, aber er kapituliert nicht vor der Vielzahl der Fragen, die sich hier stellen. Dennoch verlässt er so schnell wie möglich den Ort der in blutigen Ernst übergegangenen, ach so lustigen Hexenverbrennung.
Für die Fahrt nach Hause nimmt er wieder den Weg durch die Hintere Achmühle, noch einmal vorbei am Haus der vor Jahren verstorbenen Tante. Der Achmühler Funken ist mittlerweile fast zur Gänze abgebrannt. Vor der Gastwirtschaft des Max Danner herrscht ein großes Gedränge. Schaulustige erschweren die Durchfahrt. Dichte Menschentrauben kleben an den Getränke- und Imbissbuden. Unsäglicher Lärm dringt zum Glück etwas abgeschwächt durch die geschlossenen Autofenster. Das Haus der Tante liegt bis auf die matt erleuchteten kleinen Stubenfenster im Dunkel. In diesem Haus, das geht Ibele jetzt mit bildhafter und greifbarer Deutlichkeit durch den Kopf, hat zur Zeit von Isidors Sommerfrischen auch so einer gewohnt, wie es der Tote vom Oberdorf gewesen zu sein scheint. Ein Gescheiterter; nach dem Krieg ein gefeierter Fußballtormann beim alten FC Dornbirn, als der noch weit vom heutigen Profibetrieb und noch viel weiter vom Konkurs entfernt war. Irgendwann ist wohl etwas schiefgelaufen und der Ferdl, ein einfacher Fliesenleger, ein Plätteler, ist in seine eigene Welt aus Resignation, Ressentiment und Alkohol abgedriftet. Den kleinen Buben, der Ibele vor 45 Jahren war, hat er dennoch und gerade damit mächtig beeindruckt. Auch durch die unvermutete Nonchalance, mit der er der stolzen, schönen Hilda in für den kleinen Isidor schwer zuordenbaren Auseinandersetzungen Paroli geboten hat; war Ferdl doch trotz seines sozialen Abstiegs in einem subtil delikaten Verhältnis mit der Tante verbunden. So hat er, der einfache Zimmer- und Kostherr, mit stillem, gewaltlosem Widerstand seine Schrullen und anspruchslosen Extravaganzen tapfer gegen den ansonsten energischen, ja unbeugsamen Willen der Witwe durchgesetzt. Etwa wenn er abends in der geräumigen Küche am wachstuchbezogenen Tisch saß, hinter ihm an der Wand das berühmte Angelusgebet in einer vergilbten Reproduktion.