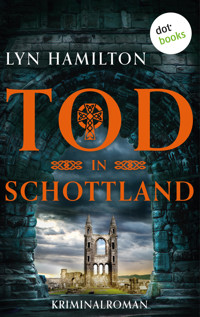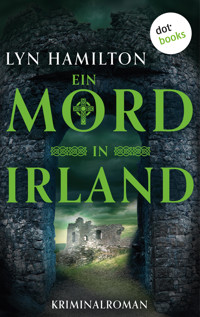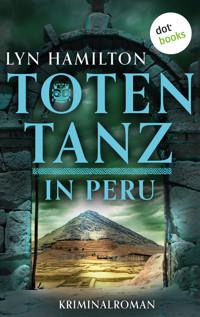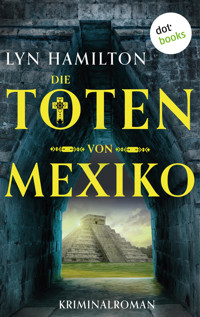
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein uraltes Geheimnis fordert Opfer: Der fesselnde Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« von Lyn Hamilton jetzt als eBook bei dotbooks. Manches Wissen hat einen hohen Preis … Erleichtert darüber, Kanada und ihrem Exmann für eine Weile den Rücken kehren zu können, reist Kunsthändlerin Lara McClintoch nach Mexiko: Hier soll sie einem befreundeten Museumsdirektor helfen, ein verschollenes Kleinod der Maya zu finden. Doch bei ihrer Ankunft in der Kleinstadt Mérida ist Dr. Castillo spurlos verschwunden. Als sie kurz darauf seine Leiche in einem Hinterzimmer des Museums findet, ist Lara erschüttert. Eigentlich sollte sie sofort ins nächste Flugzeug nach Hause steigen – aber spielt sie damit nicht jenen in die Hände, die ihren Freund ermordet haben? Fest entschlossen, den Schatz zu retten, wagt sich Lara tief hinab in ein Tunnelsystem der alten Mayas, das mehr als ein tödliches Geheimnis birgt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« von Lyn Hamilton ist der erste Band der Lara-McClintoch-Reihe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Manches Wissen hat einen hohen Preis … Erleichtert darüber, Kanada und ihrem Exmann für eine Weile den Rücken kehren zu können, reist Kunsthändlerin Lara McClintoch nach Mexiko: Hier soll sie einem befreundeten Museumsdirektor helfen, ein verschollenes Kleinod der Maya zu finden. Doch bei ihrer Ankunft in der Kleinstadt Mérida ist Dr. Castillo spurlos verschwunden. Als sie kurz darauf seine Leiche in einem Hinterzimmer des Museums findet, ist Lara erschüttert. Eigentlich sollte sie sofort ins nächste Flugzeug nach Hause steigen – aber spielt sie damit nicht jenen in die Hände, die ihren Freund ermordet haben? Fest entschlossen, den Schatz zu retten, wagt sich Lara tief hinab in ein Tunnelsystem der alten Mayas, das mehr als ein tödliches Geheimnis birgt …
Über die Autorin:
Lyn Hamilton (1944-2009) wuchs in Etobicoke, Toronto auf und studierte Anthropologie, Psychologie und Englisch an der University of Toronto, wobei sie 1967 in Englisch abschloss. Sie war in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und bildete sich in Mythologie und Anthropologie weiter. Ein Urlaub in Yucatán veranlasste sie dazu, ihren ersten Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« zu schreiben.
Lyn Hamilton veröffentlichte bei dotbooks bereits »Todesfurcht auf Malta«, »Totentanz in Peru«, »Todesklage in Italien«, »Ein Mord in Irland« und »Tod in Schottland«.
Die Website der Autorin: www.lynhamiltonmysteries.com/
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Xibalba Murders« bei The Berkley Publishing Group, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Die letzten Tage von Mérida« bei Ullstein und 2007 unter dem Titel »Der Fluch der Maya« bei Weltbild.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Lyn Hamilton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Hikiray, IR Stone, Dennis Diatel, MiuKaty
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-242-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Toten von Mexiko« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lyn Hamilton
Die Toten von Mexiko
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Wolfgang Neuhaus
dotbooks.
Für meine Eltern
PROLOG
Man nennt mich Rauchender Frosch, nach einem der größten Krieger in der Geschichte meines Volkes, dem Eroberer von Uaxactün.
Ich bin kein Krieger. Ich bin bloß ein Schreiber, und zwischen der Zeit, in der ich lebe, und den Zeiten jenes großen Eroberers liegen viele, viele Wanderungen der Venus über die Sonnenscheibe.
Aber vielleicht ist es passend, daß ich diesen Namen trage. Denn mein Namensvetter Rauchender Frosch, der gewaltige Kriegsherr, machte seine Eroberungen während der ruhmreichsten Epoche meines Volkes, während ich vermutlich das Ende dieses großen Zeitalters erleben werde.
Die Männer mit den hellen Bärten, die über das große Wasser kamen, sind keine Götter, wie wir anfangs glaubten. Statt dessen sind sie Sendboten der Herren von Xibalba, der Fürsten des Todes.
Bald werden sie uns unterworfen haben.
Nicht mit Waffen, und auch nicht durch ihre schrecklichen Krankheiten, sondern indem sie unsere Worte vernichten, unsere Geschichte und unsere Götter und sie durch die ihren ersetzen.
Ich habe gesehen, wie sie unsere kulché zerschmetterten, die Abbilder unserer Gottheiten. Und es ist erst vier Nächte her, daß ich aus meinem großen Kanu beobachtet habe, wie ein rotes Leuchten den Himmel über der Insel der Göttin Ix Chel erhellte – das Glühen eines Scheiterhaufens, auf dem die Fremden unsere heiligen Texte verbrannten.
Doch das Uralte Wort ist ewig. Ich trage es bei mir, auch wenn es meinen Tod bedeutet, sollte man mich damit finden.
Ich werde zu den heiligen Flüssen der Itzá reisen, sogar in den Schlund von Xibalba, und das Uralte Wort werde ich dort verbergen.
Sollte ich diese Zeiten überleben, werde ich es zurückholen und mein Volk an die Lehren erinnern, die diese Schrift verbreitet.
Sollte dies nicht geschehen, werde ich dafür beten, daß unsere Worte in einer besseren Zeit gefunden werden, auf daß sie wieder über das Land erschallen und es durch ihre Macht erbeben lassen.
KAPITEL 1:IMIX
Viele Leute haben mich gefragt – und der nächste wird wohl ein mexikanischer Richter oder Staatsanwalt sein –, weshalb ich Tausende von Kilometern geflogen bin, um jemandem, den ich gar nicht so gut kannte, dabei zu helfen, ein kleines pelziges Wesen mit langen Ohren, rosiger Nase und literarischen Ambitionen zu suchen.
Eine gezieltere Frage würde lauten, weshalb ich meine Suche fortführte, ohne mich von rätselhaften Todesfällen aufhalten zu lassen.
Eigentlich ist mein Exmann Clive an der ganzen Sache schuld. Exgatten sind bequeme Sündenböcke für fast alles. Und es lag nun mal an Clive, daß ich so viel Zeit hatte.
Der wahre Grund ist natürlich sehr viel komplizierter. Rückblickend glaube ich, es lag daran, daß ich der Meinung war, ich hätte nichts mehr zu verlieren; denn ich hatte zuvor schon alles verloren, was ich für wichtig hielt: ein Geschäft, das ich über mehrere Jahre hinweg aufgebaut, und eine unglückliche Ehe, an die ich mich geklammert hatte.
Deshalb trat ich diese Reise an – eine spirituelle Reise in die Finsternis und zu Menschen, die mit den Fürsten des Todes zu tun hatten, wie ich erfahren sollte.
Am Beginn dieser Reise stand ein Anruf von Dr. Hernan Castillo Rivas, eines gelehrten Herrn, der sich für die uralten Zivilisationen Mexikos begeisterte. Sein Enthusiasmus und sein Wissen erweckten in mir ein unauslöschliches Interesse für diesen Teil der Erde. Dr. Castillo war leitender Direktor eines privaten Museums in Mérida, Mexiko, gewesen, das auf die archäologischen Hinterlassenschaften der Maya spezialisiert war. Nach seiner Pensionierung wurde Hernan Castillo der mexikanische Agent meines Geschäfts – meines ehemaligen Geschäfts, sollte ich besser sagen: ein Antiquitätenladen. Ich kaufte und verkaufte Stücke aus aller Welt, wirklich wundervolle Dinge.
»Lara«, begann Dr. Castillo, »ich habe von der Familie Ortiz gehört, daß Sie sich an der Universität eingehend mit einem Fachgebiet beschäftigen, das mich sehr interessiert.« Die Ortiz waren alte Freunde von mir; sie hatten mich auch mit Dr. Castillo bekannt gemacht – oder Don Hernan, wie ich ihn gern nannte.
»Ich habe einen hoffentlich interessanten Vorschlag für Sie«, fuhr er fort. »Wenn ich mich nicht irre, beginnen bald die Semesterferien, und dann haben Sie viel Zeit zur freien Verfügung. Ich möchte gern, daß Sie nach Mexiko kommen und mir bei einem Projekt helfen, an dem ich gerade arbeite. Ich brauche einen Partner. Zurzeit kann ich Ihnen noch nicht mehr darüber sagen, aber ich kann Ihnen versichern, daß es … wie sagt man bei euch in Amerika? … genau auf Ihrer Wellenlänge liegt. Es wird Sie interessieren. Ach, was sage ich. Es wird Sie begeistern!«
Ich lachte. »Das müssen Sie mir schon eine bißchen genauer erklären.«
»Es handelt sich um eine Sache, die man nicht am Telefon besprechen sollte«, erwiderte Don Hernan. »Es wäre zu… riskant.«
Als ich nichts entgegnete, rückte er schließlich doch ein bißchen mit der Sprache heraus. Wahrscheinlich befürchtete er, daß ich auf seine vagen Andeutungen hin nicht nach Mexiko kommen würde.
»Also gut. Da Sie die Geschichte der Maya studieren, werde ich Ihnen einen Hinweis geben. Wir suchen, was das Kaninchen schreibt.«
Bei dieser mehr als rätselhaften Bemerkung beließ er es.
Es war ein lächerlicher Vorschlag, also machte ich mich natürlich auf die Reise.
Wie ich schon sagte: Zeit genug hatte ich. Einige Monate zuvor war ich in eine Phase erzwungener Untätigkeit geraten, worauf ich beschlossen hatte, wieder die Universität zu besuchen, um das Studium der Maya fortzuführen, einer alten mittelamerikanischen Kultur, die ihren Höhepunkt, die klassische Zeit, zwischen dem vierten und zehnten nachchristlichen Jahrhundert erlebte, und zwar in den Gebieten des heutigen Guatemala, Belize, Honduras und der mexikanischen Halbinsel Yucatán.
Zuvor war ich einer von zwei Besitzern des erwähnten Antiquitätenladens gewesen – der andere Besitzer war mein Mann, Clive Swain. Es war ein sehr gut gehendes Geschäft mit Namen ›McClintoch und Swain‹ in Yorkville, einem vornehmen Stadtviertel Torontos.
Meiner Meinung nach konnte Clives Arbeitsmoral mit dem Begriff ›katastrophal‹ noch am freundlichsten umschrieben werden. Doch als unsere Ehe im Sterben lag, entwickelte er unerklärlicherweise eine ausgesprochene Begeisterung für unser Geschäft.
Der Preis für meine Freiheit war die Hälfte des Verkaufserlöses für McClintoch und Swain sowie die Ermahnung meiner Anwältin, mindestes ein Jahr lang die Finger von diesem Geschäft zu lassen – und von jedem anderen.
»Falls Sie sofort einen neuen Laden eröffnen, Lara«, hatte sie mich gewarnt, »wird Clive noch mehr Geld verlangen. Er versucht, Ihnen alles wegzunehmen, was Sie haben.«
Dieses eine Jahr ohne Einkünfte konnte ich mir bequem leisten. Die Hälfte des Verkaufserlöses machte mich zwar nicht zur reichen Frau, doch mit ein bißchen Bedacht konnte ich ein Jahr gut überstehen. Aber es stieß mir sauer auf, Clive die Hälfte des Geldes zu überlassen, wo er doch viel weniger als die Hälfte der Arbeit geleistet hatte, und ich litt noch immer unter der bitteren Schärfe unserer Trennung und dem peinlichen Eingeständnis vor mir selbst, mich in Clive geirrt zu haben.
Mein einziger Trost begegnete mir in Gestalt der Frau, an die ich das Geschäft verkauft hatte, Sarah Greenhalgh. Sie schien den Laden genauso zu lieben, wie ich ihn geliebt hatte.
Ich versuchte, eine Zeitlang ein Leben in Muße zu führen, doch je weniger ich zu tun hatte, um so mehr Zeit blieb mir, über meine Situation nachzugrübeln. Dann kam mir die Idee, wieder zur Uni zu gehen. Doch ich mußte die Feststellung machen, daß das akademische Leben – so interessant es sein mochte – seinen angestrebten Zweck nicht erfüllte, meine Gedanken von dem finanziellen und gefühlsmäßigen Ruin abzulenken, den ich erlitten hatte. Ich muß gestehen, daß Don Hernans Anruf für mich so etwas wie eine Erleichterung war. Schon wenige Minuten nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, rief ich im Reisebüro an und buchte ein Ticket nach Mérida.
Es war an dem Tag, der bei den Maya ›Imix‹ geheißen hatte – der Tag des Erdengottes –, als ich die Tür meines kleinen viktorianischen Häuschens verschloß und die Schlüssel meinem Nachbarn Alex Stewart zur Aufbewahrung gab, der mir versprach, sich um mein Haus und meine getigerte Katze zu kümmern, die auf den Namen Diesel hörte. Diesel war die offizielle ›Ladenkatze‹ gewesen und im Grunde das einzig Wertvolle – jedenfalls in meinen Augen –, das ich nach zwölf Jahren Arbeit vorweisen konnte.
Die Reise führte mich zuerst nach Miami, dann weiter nach Mérida. Ich hatte den Flug nach Mérida zuvor schon jedes Jahr drei- oder viermal aus geschäftlichen Gründen unternommen, aber auch deshalb, weil ich diesen Ort aus vielen Gründen liebte. Diesmal ertappte ich mich dabei, wie ich aus dem Fenster des Flugzeugs nach irgendwelchen Spuren Ausschau hielt, die das gewaltige Reich hinterlassen hatte, das die spanischen Konquistadoren entdeckten, als sie diesen Teil der Neuen Welt zum erstenmal betreten hatten. Ich nehme an, es lag an meinen Studien.
Wie sehr mußten diese frühen Besucher gestaunt haben, als sie Städte erblickten, die größer waren als sämtliche Metropolen in Spanien oder sonstwo in Europa. Es gab bereits riesige Maya-Städte, als Paris noch ein schmutziges Kuhdorf war. Heute sind diese Städte größtenteils verschwunden. Lediglich grüne Hügel, die sich aus dem Teppich der Urwälder erheben, künden von ihrer einstigen Existenz.
Doch gerade weil ich von meinem Aussichtsplatz am Flugzeugfenster nur wenige sichtbare Überreste der Maya-Kultur entdeckte, konnte ich um so mehr die phantasievolle Weitsicht dieses Volkes bewundern. Die Maya betrachteten die Erde als Imix, ein Seerosen-Ungeheuer, eine Art Reptilienwesen – manchmal eine Schildkröte, doch meist ein gewaltiges Krokodil, das in einem riesigen Teich liegt und die Erde auf seinem gekrümmten Rücken trägt.
Unter dem Leib der Kreatur befindet sich Xibalba, die Unterwelt, der Ort der Furcht, dessen Atmosphäre das Wasser des Teiches ist, in dem Imix ruht, der Erdengott. Auf dem nächtlichen Abschnitt ihrer Reise muß die Sonne durch diese Wasserwelt, und indem sie Xibalba durchquert, verwandelt sie sich in den furchterregenden Jaguar-Gott. Über der Erde ringelt sich die doppelköpfige Himmelsschlange, deren Schuppenmuster die Zeichen der Himmelskörper sind.
Wenn man aus 7000 Metern Höhe in die Tiefe blickt, kann man sich leicht vorstellen, wie das Seerosen-Ungeheuer in den Gewässern des Golfs von Mexiko ruht und wie der Körper der Himmelsschlange sich von einem Horizont zum anderen wölbt. In gewisser Weise war ich enttäuscht, als das Flugzeug die Urwälder hinter sich ließ, in denen sich einst die Welt der Maya befunden hatte, und mit dem Landeanflug auf Mérida begann.
Ich stieg rasch aus der Maschine und kam ohne Schwierigkeiten durch den Zoll. Da ich hier alles schon von meinen Einkaufsreisen kannte, bahnte ich mir schnell einen Weg durch die dichten Gruppen der Straßenverkäufer und Marktschreier, die einem schlichtweg alles versprachen, von billigen Unterkünften bis hin zu Vergnügungen jeder Art. Ich war froh, als ich Isabella Ortiz entdeckte, die auf mich wartete. Offenbar war Isabella von Mexiko City hierher geflogen, nachdem sie von meinen Reiseplänen erfahren hatte.
Ich war seit fünfundzwanzig Jahren mit Isa befreundet, seit mein Vater, der bei den Vereinten Nationen gearbeitet hatte, nach Mexiko entsandt worden war. Meine Eltern und ich verbrachten zwei Jahre in Mexiko. Damals lernte ich die Ortiz und ihre Tochter Isabella kennen. Isa und ich – damals beide im Teenageralter – wurden die besten Freundinnen.
Isa hat in Mexiko City ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut: Sie produziert und verkauft die klassischen Frauenkleider aus ihrer Heimat Yucatán, die bestickten huipil, in moderner Machart. Ihre wunderschönen Kleider treffen genau den Geschmack der mexikanischen Frauen, und inzwischen zieren sowohl Isas Gesicht als auch ihre Modelle regelmäßig die Titel- und Innenseiten von Haute-Couture-Zeitschriften. Isa hat einen neuen Lebensgefährten, Jean Pierre, der für eine französische Bank in Mexiko arbeitet und überdies als Isas inoffizieller Finanzberater fungiert.
»Bienvenidos, Lara. Herzlich willkommen.« Isa lächelte, umarmte mich und reichte mir einen Strauß Paradiesvogelblumen. »Wir alle freuen uns sehr, daß du wieder zu Besuch gekommen bist.«
Ich ließ meinen häßlichen Matchbeutel auf die Rückbank ihres Mercedes-Cabrios fallen – Isas Geschäfte liefen offenbar prächtig –, und wir fuhren zu dem Hotel, das den Ortiz gehört, die Casa de las Buganvillas, wörtlich übersetzt ›Das Haus der Bougainvillea‹. Das Hotel liegt an einer stillen Seitenstraße des Paseo de Montejo. Ich wohne stets in der Casa, wenn ich Mérida besuche.
Wir stiegen die gewundene Steintreppe hinauf, die mit farbenprächtigen Fliesen in Blau und Weiß verkleidet ist; dann ging es durch handgeschnitzte Holztüren in eine kühle, dunkle Eingangshalle mit Kuppeldach; der Boden ist mit Terrakotta-Fliesen ausgelegt, die Wände sind kunstvoll im Kolonialstil verputzt. Die Eingangshalle und die Flure werden von großen gußeisernen Kandelabern mit Lampenschirmen aus mundgeblasenem Glas beleuchtet, und die Holzdecken sind mit traditionellen Mustern handbemalt.
Das Hotel ist das alte Herrenhaus der Familie Ortiz – ein Haus, das viel zu groß ist, als daß es praktisch sein könnte. Da Isas Vater, Santiago Ortiz Menendez, der im Dienst des diplomatischen Korps von Mexiko gestanden hat, oft auf langen Reisen war, hatte seine Frau, Francesca, vor Jahren damit begonnen, zeitweilig Zimmer zu vermieten, um die Casa dann nach und nach zu dem wunderschönen Hotel mit Restaurant auszubauen, das es heute ist.
Doch es gibt noch immer Erinnerungen an stillere Zeiten. Zum Beispiel den Empfangsschalter – ein riesiger, alter, geschnitzter Schreibtisch, der einst von den Ahnen der Ortiz auf einem spanischen Segler über den Atlantik gebracht worden war. An diesem Schreibtisch saß nun Santiago Ortiz Menendez und lächelte, als er mich sah. Von einer schwächenden Muskelerkrankung geplagt, die zunehmend schlimmer wird, war er frühzeitig aus dem diplomatischen Dienst ausgeschieden. Nun saß er im Rollstuhl, leitete trotz seiner Behinderung aber das Hotel.
Ich beugte mich vor und küßte Santiago auf europäische Art auf beide Wangen. Die vielen Jahre im diplomatischen Dienst hatten Spuren bei ihm hinterlassen, zu denen eine gewisse steife Förmlichkeit gehörte, wenn er sich mit jemandem unterhielt – seine beiden kleinen Enkelkinder eingeschlossen.
»Wir fühlen uns sehr geehrt, dich wieder bei uns zu haben«, sagte er würdevoll, »und wir freuen uns darauf, zu erfahren, wie es deiner Familie geht und wie es mit deiner Arbeit aussieht. Aber du hast gewiß einen langen Tag hinter dir und möchtest dich erst ein wenig ausruhen und dich frisch machen. Dann werden wir dich und Don Hernan im Speisesaal fürstlich bewirten. Das Essen wird gegen neun Uhr serviert. Don Hernan hat schon den Tisch für euch bestellt. Meine Familie und ich würden uns sehr darüber freuen, wenn du dich anschließend in unseren Privatzimmern auf einen späten Kaffee zu uns setzt. Meine Frau kann es jetzt schon kaum erwarten, dich zu sehen und Neuigkeiten über deine Eltern zu erfahren.«
Er reichte mir die Zimmerschlüssel. Zu meiner Freude war es mein Lieblingszimmer, das am Ende des Flurs im ersten Stock lag und einen Blick auf den parkähnlichen Hinterhof gewährte. Ein junger Mann, den ich nie zuvor im Hotel gesehen hatte, nahm meinen Matchbeutel und führte mich die steinerne Treppe hinauf in den ersten Stock. Vermutlich gehörte der junge Mann zu den entfernten Verwandten der Ortiz, von denen viele ihre ersten Schritte in die Berufswelt taten, indem sie hier im Hotel aushalfen.
Nachdem die Zimmertür sich hinter mir geschlossen hatte, ging ich zum Fenster, öffnete die Läden und blickte auf den Hinterhof hinunter, in dessen Mitte sich ein kleiner Teich befindet, über den die Terrakottastatue einer Maya-Gottheit wacht. Selbst im verblassenden Licht des frühen Abends konnte ich die herrlichen lila Bougainvilleen sehen, nach denen das Hotel benannt war. Die Blumen rankten sich die weiß verputzten Mauern des Hinterhofs hinauf.
Auf einer Seite des Hofes erblickte ich das Dach der Veranda: verblichenes Eichenspalier, von Säulen aus heimischem Canterastein gestützt. Die Tische im Speisesaal, den ich von hier aus einsehen konnte, waren schon für die cena gedeckt, das Abendessen. Norberto, der ältere Sohn der Ortiz, überzeugte sich bereits davon, daß alles seine Richtigkeit hatte, obwohl das Abendessen, den spanischen Gebräuchen entsprechend, ziemlich spät serviert wurde, erst in zwei oder drei Stunden.
Mit dem Flugzeug zu reisen oder an Flughäfen zu warten ist sicherlich eine der größten Strapazen, deren man sich unterziehen kann. Wie dem auch sei – jetzt, da ich wußte, daß bis zum Abendessen noch einige Stunden vergehen würden, legte ich mich aufs Bett und spürte, wie die Müdigkeit mich tatsächlich übermannte.
Doch bevor ich in Schlaf fiel, glaubte ich ein Streitgespräch zu hören, das zwei oder drei Männer unten im Hof führten, unter meinem Fenster. Sie redeten in einer Sprache, die ich nicht verstand. Es war weder Englisch noch Spanisch. Möglicherweise war es eine der vielen Mayasprachen. Es hörte sich nach einem ziemlich heftigen Streit an, aber ich hatte keine Ahnung, worum es ging.
Ich schreckte aus dem Schlaf, als das Telefon neben dem Bett klingelte. Der Anrufer war Dr. Castillo. Er sagte mir, er sei verhindert und könne leider nicht kommen, um mit mir zu Abend zu essen. Er müsse die Stadt verlassen, erklärte er, und wisse nicht, ob er früh genug zurück sei, um pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Er würde sich nach seiner Rückkehr aber sofort melden, um sich mit mir zu verabreden.
»Ich bedaure, unser Treffen heute abend verschieben zu müssen, amiga«, sagte er, »aber ich versichere Ihnen, daß meine Fahrt sich für uns beide lohnen wird. Und Sie verbringen ja ohnehin einen angenehmen Abend mit der Familie Ortiz. Lassen Sie mich nur soviel sagen: Die Sache wird jetzt erst richtig interessant!«
Damit legte er auf.
Ich ging unter die Dusche und versuchte, die Müdigkeit zu verscheuchen und einen klaren Kopf zu bekommen. Mein nachmittägliches Nickerchen war nicht gerade geruhsam gewesen. Der Gedanke, daß ich allein zu Abend essen mußte, bedrückte mich, und ich ärgerte mich darüber, daß ich alles hatte stehen und liegen lassen und Tausende von Meilen geflogen war, um ein mysteriöses schreibendes Kaninchen zu suchen, was immer Don Hernan damit gemeint hatte.
Ich packte meine Sachen aus. Wenn man mit einer erfolgreichen Modeschöpferin befreundet ist, besteht einer der Nachteile darin, daß man hin und wieder an die Unzulänglichkeiten der eigenen Garderobe erinnert wird. Zum damaligen Zeitpunkt beschränkte meine Kleidung sich im wesentlichen auf schwarze und khakibraune Sachen aus Jeansstoff – meine Studentenuniform, wie ich es nenne. Mein Nachbar Alex sagt immer, ich würde mich kleiden, als wollte ich mir absichtlich die Männer von Leibe halten. Wahrscheinlich hat er recht. Für den heutigen Abend wählte ich eine Seidenbluse in gebrochenem Weiß und eine graue Gabardinehose. Das mußte genügen.
Als ich oben an der Treppe erschien, die hinunter zur Eingangshalle führte, sah ich Isa und ihren Vater. Sie waren in ein leises Gespräch vertieft; Isa hatte den Kopf verschwörerisch zu dem ihres Vaters vorgebeugt. Beide strahlten eine unbestimmbare Aura der Unruhe und Anspannung aus, doch als ich die Treppe hinunterstieg, unterbrachen sie ihr Gespräch. Isa lächelte mich an, aber es kam mir dennoch so vor, als würde mit meinen Freunden irgend etwas nicht stimmen.
Norberto führte mich über die von Kerzen erhellte Veranda in den Speisesaal an einen Tisch, von dem ich über den ganzen Hof schauen konnte. Diesen Tisch, erfuhr ich von Norberto, hatte Dr. Castillo für unser Abendessen reserviert, und er habe darum gebeten, mir eine Flasche Wein meiner Wahl bringen zu lassen, als kleine Entschädigung für seine Absage.
Ich ließ mir einen Calafi bringen, einen Wein von der mexikanischen Westküste. Als ich am Glas nippte, ließ ich den Blick in die Runde schweifen und betrachtete die anderen Gäste.
Heute saßen zumeist Mexikaner an den Tischen. Wahrscheinlich kamen viele von ihnen aus der Nachbarschaft; einige waren vermutlich Hotelgäste – wie Dr. Castillo, der ständig in der Casa wohnte, nachdem vor etwa zwei Jahren seine fünfundvierzigjährige Frau gestorben war.
Bei Touristen aus dem Norden ist das Hotel zwar nicht sonderlich bekannt, doch in Mérida hat es einen beinahe legendären Ruf. Während Doña Francescas Ahnen Maya waren, ist ihr Mann, Don Santiago, spanischer Abstammung. Beide sind liebenswürdige und kultivierte Gastgeber, was vermutlich am aristokratischen Elternhaus Don Santiagos liegt, oder an den vielen Jahren, die er im diplomatischen Dienst verbracht hat.
Doña Francesca ist eine ausgezeichnete Köchin, was für Mexiko insofern ungewöhnlich ist, als viele mexikanische Frauen aus reichem Hause das Kochen gar nicht erst lernen, ja entsetzt darüber wären, müßten sie in einer Küche hantieren.
Doña Francesca verbindet bei ihren zu Recht berühmten Gerichten die Traditionen der spanischen Küche mit den kulinarischen Künsten der Maya. Eine ihrer Spezialitäten heißt pescado borracho, wörtlich ›betrunkener Fisch‹; ein anderes ihrer Spezialgerichte trägt den Namen faisan en pipian verde de Yucatán – ›Fasan in grüner Sauce à la Yucatán‹. Diese Köstlichkeiten ziehen nicht nur Hotelgäste an, sondern locken Leute aus der ganzen Gegend ins Restaurant.
An diesem Abend stand der Fasan auf der Speisekarte, was sich offensichtlich herumgesprochen hatte, denn die Veranda und der Speisesaal füllten sich rasch.
Die Dauergäste waren leicht zu erkennen. Es handelte sich zumeist um ältere Leute, wie Dr. Castillo, die ihre Tische im Speisesaal als ihr persönliches Eigentum betrachteten. Jeder wurde bei seiner Ankunft mit Namen begrüßt, und die Gäste begrüßten auch einander, als sie an ihre Tische geführt wurden, die auf eine Weise gedeckt waren, daß sie ihren ganz persönlichen Bedürfnissen und Wünschen entsprachen. Auf einigen dieser Tische stand eine bereits entkorkte Flasche Wein.
Einer der Dauergäste, eine alte Dame, sah besonders interessant aus. Sie saß allein am Tisch neben dem meinen. Die Frau war nach meiner Schätzung Mitte Achtzig und nach ihrem würdevollen, vornehmen Auftreten zu schließen eindeutig das Produkt einer versunkenen Epoche, in der man noch mehr Wert auf Etikette gelegt hatte als heutzutage. Höchstwahrscheinlich war diese Frau Witwe, denn sie war ganz in Schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mantilla über dem weißen Haar.
Ihre Augen, die sich hin und wieder auf mich richteten, waren von einem intensiven Blau – ungewöhnlich für diesen Teil der Welt und für das Alter der Frau –, und auf den Tisch neben ihr hatte sie sorgfältig einen schwarzen Fächer aus Seide und ein Paar schwarze Spitzenhandschuhe gelegt. Sie kam mir wie die personifizierte Kultiviertheit vor, doch unter dem liebenswürdigen Äußeren konnte ich einen eisernen Willen spüren. Ich bemerkte, daß die Bedienungshilfen im Speisesaal besonders auf der Hut waren, wenn sie der alten Frau servierten. Offensichtlich stellte sie höchste Ansprüche. Leider saß die alte Dame zu nahe bei mir, als daß ich Norberto hätte fragen können, wer sie war.
Von der alten Frau und mir selbst abgesehen, wirkten nur zwei weitere Personen in dieser Umgebung fehl am Platze – zwei Männer an einem Tisch in der Ecke.
Beide waren ziemlich attraktiv, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Einer war Mexikaner, dunkelhäutig, Mitte Vierzig, mit ziemlich langem dunklem Haar und dunklen Augen. Was ihn aus den anderen Gästen heraushob, war sein Aufzug – schwarze Jeans und schwarzes T-Shirt, was ganz und gar nicht zur eleganten Umgebung des Speisesaals paßte.
Der andere Mann war in den Fünfzigern und gut gekleidet: graue Flanellhose, blauer, zweireihiger Blazer, weißes Hemd, burgunderfarbene Krawatte. Sein Haar war sorgfältig frisiert, von grauen Strähnen durchzogen und über den Ohren leicht gewellt.
Ich hatte den Eindruck, daß die beiden Männer mich ebenso eingehend-unauffällig musterten wie ich sie, doch nach einigen Minuten verließ der Dunkle den Speisesaal.
Ich beobachtete den Mann, der sitzen geblieben war, verstohlen über den Rand meines Weinglases hinweg; dann widmete ich mich eine Zeitlang dem Essen, versuchte, meine Gedanken zu ordnen und dem Fasan die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die er verdiente. Doch unweigerlich schaute ich wieder zu dem Mann hinüber, und diesmal erwiderte er meinen Blick und lächelte mich an, statt so zu tun, als würde er mich nur beiläufig mustern.
Kurz darauf verließ auch er den Speisesaal und machte einen kleinen Umweg an meinem Tisch vorbei. Er neigte ganz leicht den Kopf, als er an mir vorüberging, und lächelte erneut sein strahlendes Lächeln. Ich bedauerte, daß dieser attraktive Bursche den Speisesaal so rasch verließ.
Später am Abend saß ich am Tisch der Ortiz in Doña Francescas gekachelter Küche. Der größte Teil der Familie war versammelt: Isa mit ihrer Mutter und ihrem Vater, und Norberto mit seiner Frau Manuela. Es fehlten nur die beiden Enkelkinder, die inzwischen in den Betten lagen, und Alejandro, der jüngere Bruder von Isa und Norberto.
Als ich mich nach Alejandro erkundigte, bemerkte ich wieder die eigenartige Spannung, die mir schon am frühen Abend bei Isa und Don Santiago aufgefallen war. Alle schwiegen für einen Moment, bis Isa mir schließlich erklärte: »Wir bekommen Alejandro in letzter Zeit selten zu sehen. Er führt sein eigenes Leben und hat seine eigenen Freunde.«
»Ja, er geht seinen eigenen Weg«, pflichtete Norberto seiner Schwester bei, »und kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, die uns nichts angehen.«
Es war nicht zu überhören, daß die Familie dieses Thema damit als erledigt betrachtete. Allerdings muß ich zugeben, daß ich den Ortiz auch nicht allzu viel über meine Scheidung erzählte, was sie mir jedoch nicht übelzunehmen schienen, denn der Abend verlief recht angenehm, und ich ging spät zu Bett.
In dieser Nacht wurde ich von einem scheußlichen Traum geplagt – der erste in einer Reihe ständig wiederkehrender Alpträume, die noch folgen sollten. Ich schwebte durchs All und blickte auf die Erde hinunter, die sich in eine schlangenartige Kreatur verwandelte. Das gräßliche Wesen reckte sich zu mir empor, als ich darüber hinwegflog, und verschlang mich. Ich fiel durch eine schwarze Leere in die Tiefe und hörte wütende Stimmen in der Finsternis. In meinem Traum wußte ich, was geschah. Ich war in den Schlund Xibalbas gestürzt, und die Stimmen, die ich vernahm, gehörten den Fürsten der Unterwelt.
Obgleich ich zu ständig wiederkehrenden Träumen neige, brauche ich immer ziemlich lange, um mir darüber klarzuwerden, was mein Unterbewußtsein mir mitteilen will. Vor einigen Jahren hatte ich eine andere Aufeinanderfolge von Träumen, in denen ich stets in einem Türeingang stand, mein Reisegepäck vor mir auf dem Boden, und keine Ahnung hatte, wo ich war oder wohin ich wollte. Es brauchte sechs oder sieben Wiederholungen dieses Traumes, bis ich die Botschaft verstand, meine Siebensachen packte und Clive für immer verließ.
Heute weiß ich, daß ich dem Traum dieser Nacht – und denen, die noch folgten – mehr Beachtung hätte schenken sollen. Dann hätte ich im schlechtesten Fall einige dumme Entscheidungen vielleicht nicht getroffen. Und im besten Fall hätte der Tod mindestens eines Menschen abgewendet werden können.
KAPITEL 2:IK
Mérida mag seinen Ruf als Ciudad Bianca, als ›Weiße Stadt‹, verdient haben, als schönster und sauberster Ort in Mexiko. Für mich aber ist Mérida eine Stadt, deren Anfänge in Blut getaucht sind, was für viele spanische Kolonialstädte gilt. Selbst heute noch sind in Mérida die Spannungen zwischen den Indios und den einstigen Kolonialherren zu spüren – eine seltsame Unrast, die der Stadt eine gespannte Energie verleiht.
An Tag nach meiner Ankunft in Mérida trafen Isa und ich uns auf dem größten Platz der Stadt zum almuerzo, einem späten Frühstück. Wir setzten uns in ein Café am Plaza Grande, wie die Méridanos ihn nennen, ließen uns huevos rancheros schmecken und plauderten darüber, wie es uns ergangen war, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten.
Wir hatten gerade Platz genommen, als eine Gruppe müder Méridanos das Café verließ – Männer und Frauen, die von den Feiern der gestrigen Nacht übriggeblieben waren und nun endlich zu Bett gehen wollten. Mérida gehört zu jenen mexikanischen Städten, in denen man den Karneval todernst nimmt; wenngleich er nur in der Woche vor Beginn der Fastenzeit gefeiert wird, beginnen manche Méridanos schon sehr früh mit den Festivitäten.
Der Platz, an dem Isa und ich saßen, trägt den offiziellen Namen ›Plaza de la Independencia‹. Er ist das Herz Méridas und liegt an genau derselben Stelle, wo einst das Herz der riesigen Mayastadt Tiho geschlagen hatte. An einer Seite des Platzes steht die Kathedrale, die in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts aus den Steinblöcken niedergerissener Pyramiden Tihos errichtet wurde. An der Südseite des Platzes befindet sich die Casa de Montejo, die heute eine Bank beherbergt. Einst war sie der Palast von Francisco de Montejo, dem Gründer Méridas – und Zerstörer von Tiho. All jenen, die nicht wissen, was Sache ist, wird auf einem Relief an der Fassade des Palasts gezeigt, wie zwei Konquistadoren auf den Köpfen erschlagener Maya-Krieger stehen.
Auch auf Isa verfehlte der Anblick – Kirche, Palast und Rathaus auf dem Boden einer geschliffenen Maya-Metropole –, offensichtlich nicht seine Wirkung.
»Müßte ich den Charakter dieser Stadt beschreiben«, sagte sie gedankenversunken, »würde ich den Ausdruck schizophren benutzen.«
Womit sie vollkommen recht hatte.
»In eingeschränktem Maße sind Mérida und die gesamte Halbinsel Yucatán geographisch von Mexiko abgeschnitten«, fuhr Isa fort. »Deshalb hat sich hier die Möglichkeit zur Herausbildung eines unverwechselbaren Charakters geboten. Mérida, zum Beispiel, ist eine Kolonialstadt. Sieh dir nur die Gebäude um die Plaza herum an. Doch die Maya-Wurzeln sind noch überall, buchstäblich dicht unter der Oberfläche. Offen gesagt – eigentlich sind sie es, die diesem Ort seine ganz besondere Atmosphäre verleihen. Eine ziemlich erregende Mischung, nicht wahr? In gewisser Weise ist die mexikanische Kultur die einzige in ganz Amerika, bei der die Alte und die Neue Welt tatsächlich Zusammentreffen und verschmelzen. Manchmal sind beide Welten in einem empfindlichen Gleichgewicht, und manchmal nicht.« Sie lächelte. »So ähnlich wie in meiner Familie.«
Ich gestand Isa, daß ich am gestrigen Tag das Gefühl gehabt hatte, mit den Ortiz stimme irgend etwas nicht; daß es offenbar Spannungen gäbe. Und ich erzählte ihr von dem Streitgespräch, das ich kurz vor dem Einschlafen unter dem Fenster meines Hotelzimmers gehört hatte.
»Ich bin ziemlich sicher, eine Mayasprache gehört zu haben«, sagte ich. »Möglicherweise yukatekisch. Aber vielleicht habe ich mir die ganze Sache auch nur eingebildet.«
Für einen Moment wirkte Isa besorgt. »Ich kann dir nichts über diesen Streit sagen«, meinte sie schließlich. »Ich habe nichts gehört. Wahrscheinlich hast du’s dir wirklich nur eingebildet. Und was meine Familie betrifft – vielleicht ist mein Vergleich mit Mérida sehr treffend. Alejandro hat seine Maya-Herkunft entdeckt. Wiederentdeckt, genauer gesagt. Deshalb die Spannungen in meiner Familie. Alejandro beschuldigt Mutter, unser Erbe an die Spanier zu verkaufen. Indem sie unseren Vater geheiratet hat, will er damit wohl sagen.« Wieder lächelte sie. »Na ja, jeder Heranwachsende durchlebt Zeiten, in denen er die Eltern aufs Korn nimmt, habe ich recht? Aber bei Alejandro sieht die Sache etwas anders aus. Offenbar ist er an der Uni mit einer Gruppe junger Leute in Kontakt gekommen, die meinen Eltern und mir alles andere als sympathisch sind. Wenn Alejandro sich mal dazu herabläßt, mit uns zu sprechen, redet er nur über den Kampf gegen die Ungerechtigkeit – mit einem Beiklang, bei dem alle Eltern es mit der Angst zu tun bekämen. Aber ich bin sicher, Alejandros Gerede über Rebellion ist nichts weiter als jugendliches, pseudo-intellektuelles Imponiergehabe, wie bei vielen Universitätsstudenten. Andererseits haben die Indigenas tatsächlich sehr unter der spanischen Eroberung gelitten, und der Wunsch nach Aufstand, nach Rache schlummert oft dicht unter der Oberfläche. Erinnerst du dich an die Aufstände in Chiapas? Ist noch gar nicht so lange her.«
Ja, ich konnte mich erinnern. Damals war ich sogar dort gewesen, auf einer Einkaufsreise. Die Aufstände waren am Neujahrstag aufgeflammt und hatten bis weit in den Januar hinein angedauert.
»Ich weiß es noch sehr gut«, sagte ich. »Es steckte eine Organisation dahinter, die sich zapatistische Befreiungsarmee nannte. Sie hatten alles so eingefädelt, daß die Unruhen genau an dem Tag losbrachen, als das nordamerikanische Freihandelsabkommen in Kraft trat.«
»Stimmt. Damals munkelte man, die Zapatistas wären zehn Jahre lang im Dschungel militärisch ausgebildet worden, bevor sie am Neujahrstag zuschlugen«, erklärte Isa. »Aber das waren natürlich nur Gerüchte. Es dürfte unmöglich sein, eine solche Sache zehn Jahre lang vorzubereiten und dabei völlige Geheimhaltung zu wahren. Doch als es dann geschah, traf es die Regierung völlig unvorbereitet. Seit der Revolution hatte man so etwas in Mexiko nicht mehr erlebt. Die ganze Sache war ziemlich schnell wieder vorbei, doch seitdem sind immer wieder Unruhen aufgeflammt. Manchmal setzen die Regierung und die Zapatistas sich an einen Tisch und verhandeln; dann wieder gibt es lange Zeit keine Verständigung zwischen beiden Parteien. Die Möglichkeit eines plötzlichen Gewaltausbruchs ist jederzeit gegeben.
Wie dem auch sei – die Probleme in unserer Familie spiegeln in gewisser Weise die Spannungen in unserer Gesellschaft wider«, fuhr Isa fort. »Alejandro redet viel über Ausbeutung und Unrecht und macht Andeutungen, daß es eine Revolution geben wird. Mutter ist natürlich entsetzt über seine Äußerungen. Schließlich ist Alejandro immer noch ihr kleiner Junge. Mutter hat ihn ziemlich spät bekommen, wie du weißt. Ich war weit über Zwanzig, als Alejandro geboren wurde. Eine Zeitlang habe ich ihn als kleinen Bruder betrachtet, ein süßes Baby, aber ich muß zugeben, daß ich mich nie wirklich um ihn gekümmert habe. Der Altersunterschied zwischen uns beiden war einfach zu groß. Und heute? Heute ärgere ich mich über Alejandro, auch wenn ich in vielen Dingen mit ihm übereinstimme.
Aber er verachtet mich, weil ich in den Vereinigten Staaten studiert habe, wie viele Kinder aus wohlhabenden Familien in dieser Stadt. Er selbst hat beschlossen, hier in Mérida zu studieren – und dafür bewundere ich ihn. Aber ich habe es ihm nie gesagt. Damit würde ich bloß Öl in die Flammen gießen.«
»Ich bin sicher, dein Bruder wird seine rebellische Phase früher oder später überwinden«, erwiderte ich. »Als ich zur Uni ging, kam meine Mutter mir wie der konservativste Mensch auf der Welt vor. Heute weiß ich, daß sie in Wahrheit ihrer Zeit voraus war. Sie ging ihren eigenen Weg. Sie ließ sich nicht von den ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln vorschreiben, was eine Frau zu tun und zu lassen hat.«
»Ich hoffe, du hast recht, was Alejandro betrifft«, erwiderte Isa. »Ich hoffe es sehr.«
Kurz darauf verabschiedeten wir uns. Isa machte sich auf den Weg zu der kleinen Näherei, in der die von ihr entworfenen Kleider hergestellt wurden, während ich zum Museum schlenderte – dem Museo Emilio Garcia, nach seinem Gründer benannt, einem reichen Philanthropen aus Mérida. Das museo war in einem einstigen Kloster untergebracht, nur wenige Querstraßen von der Plaza Grande entfernt.
Ich glaube, ich hatte darauf gehofft, Dr. Castillo Rivas zu begegnen, der im museo ein Büro hatte. Santiago Ortiz hatte mir gesagt, Don Hernan sei in der letzten Nacht nicht auf sein Zimmer im Hotel zurückgekehrt; doch so etwas käme des öfteren vor, und niemand mache sich groß Gedanken darüber. Ich wußte, daß Don Hernan häufig auf irgendeiner heißen Spur war, die zu diesem oder jenem archäologischen Schatz führte. Immer wenn das der Fall war, neigte Don Hernan zur Vergeßlichkeit, was von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. Ich hatte seine Eigenarten und seine Besessenheit stets als Zeichen seines Genies betrachtet – Don Hernan, der zerstreute Professor. Wenn ich mich recht entsinne, hatte seine Frau es weniger liebenswert ausgedrückt.
Ich schlich am PROHIBIDO-ENTRAR-Schild an der Tür zum Aufenthaltsraum der Museumsangestellten vorbei, stieg bis in die oberste Etage hinauf und ging zu Don Hernans kleinem Büro. Es war dunkel darin, und die Tür war abgeschlossen.
Ich beschloß, den Versuch zu unternehmen, jenes Rätsel zu lösen, das er mir am Telefon aufgegeben hatte – die Sache mit dem schreibenden Kaninchen. Ich hielt das Ganze für ein bißchen kindisch, doch Don Hernan und ich hatten so manchen wundervollen gemeinsamen Tag mit der Suche nach Antiquitäten für mein Geschäft verbracht, und ich war fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, um ihm vielleicht helfen zu können.
Zuerst brachte ich das Rätsel mit dem Tzolkin in Verbindung, dem Kalender der Maya, über den Don Hernan mich vieles gelehrt hatte. Von ihm wußte ich, daß die Maya zwei Kalender kannten, die eine wesentliche Grundlage ihrer Religion darstellten. Der Jahreskalender war in 18 Monate zu je zwanzig Tagen eingeteilt; hinzu kamen fünf Tage, um die Gesamtzahl von 365 Tagen zu erreichen. Bedeutender jedoch war der zweite, ›rituelle‹ Kalender, der 260 Tage umfaßte und in zwanzig Wochen zu je dreizehn Tagen eingeteilt war. Jede der ›Dreizehn-Tage-Wochen‹ begann mit der Zahl 1, verbunden mit einem der zwanzig verschiedenen Tagesnamen. Somit ist jeder Tag durch eine Zahl und einen Namen gekennzeichnet 1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal und so weiter. Dies hatte eine große religiöse Bedeutung. Menschen, selbst Herrscher, wurden nach dem Tag benannt, an dem sie geboren wurden. So gab es den König 2 Wind, 5 Eidechse oder 18 Kaninchen. Weil es im Kalender mehr Namen als Zahlen gab, wurde dem vierzehnten Namen wieder die Zahl 1 zugeordnet. Bei dreizehn Zahlen und zwanzig Namen kommt man auf die genannten 260 Tage des rituellen Kalenders, bevor der ursprüngliche Tag und die Zahl, in meinem Beispiel also 1 Imix, wieder erscheinen.
Bei einem meiner früheren Besuche – es war schon eine ganze Weile her – saß ich spätabends bei einer Tasse starkem mexikanischem Kaffee im Speisesaal der Casa de las Buganvillas, während Don Hernan mir dies alles erklärte.
»Um die Maya verstehen zu können, müssen Sie ihr Zeitverständnis begreifen«, hatte er zu mir gesagt. »Wie wir hatten auch die Maya Methoden entwickelt, den Zeitablauf einzuteilen, und ein entsprechendes System entworfen. Wie wir gaben auch die Maya den verschiedenen Tagen Namen, doch im Unterschied zu uns ordneten sie jedem Tag ein Tageszeichen zu. Die meisten von uns wissen nichts mehr über die Ursprünge unserer Tagesnamen – der Donnerstag, zum Beispiel, leitet sich von ›Thors Tag‹ ab, nach dem nordischen Donnergott. Die meisten Maya dagegen kennen diese historischen Wurzeln noch heute. In ihrer Vorstellungswelt wird alles, auch das persönliche Schicksal, vom Zeichen des jeweiligen Tages beeinflußt, von der Zahl des Tages und dem Zeichen des haab – wir würden es Monatszeichen nennen –, und schließlich vom Charakter des Zeichens für den jeweiligen Quadranten, für die vier Götter standen, die durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet waren: rot für den Osten, schwarz für den Westen, weiß für den Norden und gelb für den Süden. Jeder dieser Götter, Kawils genannt, beherrscht einen Quadranten von achthundertneunzehn Tagen.«
»Dann war es so ähnlich wie bei uns, nicht wahr?« entgegnete ich. »Auch wir bringen ja astrologische Zeichen mit bestimmten menschlichen Eigenschaften in Verbindung. Und auch wir versuchen, bestimmte Ereignisse vorherzusagen, indem wir den Lauf der Sonne, des Mondes und der Planeten durch die Tierkreiszeichen deuten. Man weiß sogar von einigen amerikanischen Präsidenten, daß sie an die Astrologie glaubten. Und Verbindungen zwischen Zahlen und Tagesnamen kennen wir ebenfalls. Denken Sie nur an Freitag, den Dreizehnten.«
»Stimmt. Aber wie Sie noch sehen werden, ist das System der Maya sehr viel komplizierter, und es bewegt sich über riesige Zeitspannen in die Zukunft und die Vergangenheit. Während wir große Zeitläufe in Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten messen, haben die Maya die Zeit in katuns gemessen, in Zyklen von zwanzig Jahren, und in baktuns – zwanzig mal zwanzig Jahre –, also Zyklen von vierhundert Jahren. Und während unsere größte gebräuchliche Zeiteinheit das Millenium ist, das Jahrtausend, sind diese Einheiten bei den Maya sehr viel größer. Beispielsweise kennen sie das calabtun, einen Zeitabschnitt, der einhundertsechzigtausend Jahren entspricht. Und sie messen die Zeit von der Entstehung des gegenwärtigen Kosmos an. Nach ihrer Auffassung leben wir nämlich im vierten Kosmos, der geschaffen wurde.
Bei einigen Mayatempeln gibt es in Stein gehauene Zahlen und Datumsangaben, die in der Zeit viel weiter zurückreichen als bis zum Urknall, der Entstehung des Universums, wie unsere Physiker es kennen. Außerdem sagen diese Maya-Inschriften Ereignisse voraus, die viele Jahrtausende in der Zukunft liegen. Was ich Ihnen damit zu sagen versuche – für die Maya ist die Vergangenheit immer noch bei uns. Sie ist immer noch lebendig.«
Während ich nun an dieses Gespräch zurückdachte, schlenderte ich durch das museo und versuchte, eine Verbindung zu dem Rätsel zu finden. Der heutige Tag war Ik, der Tag des Windes, des Atems und Lebens. Was hatte das mit einem Kaninchen zu tun? Nichts. Im Geiste ging ich die anderen zwanzig Tagesnamen durch. Beim Tag Lamat – von heute an gerechnet in sechs Tagen – gab es gewisse Verbindungen mit einem Kaninchen und dem Mond oder dem Planeten Venus, doch falls irgendein unmittelbarer Zusammenhang bestand, konnte ich ihn nicht entdecken.
Möglicherweise, überlegte ich, ist es ein Wortspiel; vielleicht eine Übersetzung ins Spanische. Aber mir fiel nichts ein.
Weil die Antwort, wie ich glaubte, irgendwo im Museum zu finden war, verbrachte ich einen großen Teil des Nachmittags damit, über die Flure zu schlendern und mir die Ausstellungsstücke auf der Suche nach einem Maya-Kaninchen anzuschauen. Vergeblich.
Ich hatte mich gerade über Artefakte gebeugt, die man aus einer heiligen Cenote geborgen hatte – einem natürlichen Brunnen, die oft als Opferstätten benutzt wurden –, als ich plötzlich eine Stimme hinter mir hörte.
»Sagen Sie, sind meine Blicke den Ihren nicht quer durch einen Speisesaal begegnet?« fragte die sehr britische Stimme.
Ich drehte mich um. Es war der Mann, den ich am Abend zuvor am Tisch im Hotel gesehen hatte – und er sah tatsächlich gut aus, wie ich hinzufügen möchte. Hinter ihm stand sein dunkelhäutiger Freund.
»Mrs. McClintoch, wenn ich nicht irre«, sagte er und streckte die Hand aus.
»Sie kommen im Augenblick ziemlich ungelegen«, erwiderte ich.
»Das tut mir leid. Mein Name ist Jonathan Hamelin. Das ist mein Partner, Lucas May. Ich konnte Norberto Ortiz davon überzeugen, daß Sie eine Schulfreundin von mir waren, die ich wiedererkannt habe. Mein Trinkgeld war großzügig genug, daß er mir sogar Ihren Namen verraten hat.« Er lächelte. »Da wir uns offenbar häufig an den gleichen Orten aufhalten – dürfen Mr. May und ich uns erlauben, Sie zu einem Drink einzuladen? Ein Glas Wein? Oder eine Tasse Kaffee? Wir könnten einen kleinen Spaziergang machen, wenn Sie möchten. Ich kenne eine wunderschöne Bar am Paseo de Monte jo.«
Er strahlte eine solche Aura gelassener Zuversicht aus, daß ich mich geschlagen gab. Die beiden Männer führten mich aus dem Museum und geleiteten mich ein paar Seitenstraßen in Richtung paseo, einer von Bäumen gesäumten Prunkstraße sehr europäischen Zuschnitts, die von den Méridanos – ein bißchen optimistisch – als ›ihre‹ Champs-Elysees bezeichnet wird. Um die Jahrhundertwende gab es eine Zeit, da viele Spanier im Sisal-Handel ein Vermögen machten und Mérida zu den reichsten Städten der Welt zählte. Und der paseo war das Herzstück dieser Stadt, in der die Häuser – eher schon Paläste – der Reichen standen, in Blau, Rosa, Lederbraun und Pfirsich, mit schmiedeeisernen Toren und kunstvoll behauenen Simsen, die eher dem Pariser Stil nachempfunden waren als dem amerikanischen, eher Belle Époque als Kolonialstil.
Die Villen gibt es immer noch, doch die meisten alten Bewohner sind fortgezogen, weil der Unterhalt angesichts schrumpfender Familienvermögen zu teuer wurde. Einige Häuser sind liebevoll restauriert und beherbergen nun Banken und andere Unternehmen, die es sich leisten können; andere alte Villen jedoch verfallen – einige mit Würde, andere in hoffnungsloser Tristesse.
Wir betraten eines dieser alten Häuser. Es gehörte zu jenen, die sorgfältig restauriert worden waren und wieder ihren alten Glanz besaßen. In diesem Fall war das Haus zur Eingangshalle des Hotels Montserrat umgebaut worden, in dem sich auch die Bar und das Restaurant befanden. Gleich hinter der alten Villa ragte ein Stuck- und Glasturm auf, der architektonisch halbwegs mit dem alten Bauwerk harmonierte und in dem sich die Gästezimmer befanden. Wir gingen zur Bar, einem riesigen Raum im vorderen Teil des Eingangsbereichs. Offensichtlich war Jonathan Hamelin in der Bar gut bekannt, denn binnen weniger Augenblicke wurden wir zu einem Tisch mit wunderschönem Blick auf den paseo geführt.
Jonathan schien sich in dieser Umgebung sehr wohl zu fühlen. Selbst in der eher sportlichen Kleidung, die er heute trug, sah er sehr elegant aus. Sein Partner dagegen war fast genauso gekleidet wie am gestrigen Abend, nur daß er heute eine schwarze Jacke trug. Wieder wirkte er ziemlich fehl am Platz.
Die Bar hieß Ek Balam, der Schwarze Jaguar. Maya-Motive beherrschten das Dekor. An einer Seite des Raumes standen zwei schummrig beleuchtete Schaukästen aus Glas, in denen präkolumbianische Ausgrabungsstücke ausgestellt wurden; jedenfalls hatte es auf diese Entfernung den Anschein.
Aber damit erschöpfte sich auch schon jeder Bezug zu dieser Stadt und dem Land. Die Bar des Ek Balam war viel zu groß, als daß sie gemütlich hätte sein können, und das Dekor war in blassen, gedämpften Farbtönen gehalten, denen die strahlende Leuchtkraft der Tropen fehlte. Keine Mariachi- oder Nuevo-Flamenco-Klänge attackierten die empfindsamen Ohren der Gäste; statt dessen spielte ein Streichquartett Salonmusik von Ravel und Haydn, Copland und Strauss.
Die Luft in der Bar war erfüllt von Zigarrenrauch und dem Geruch teuren Parfüms. Unverkennbar trafen sich hier die Reichen und Schönen von Mérida, um zu sehen und gesehen zu werden. Und die Person, der es offensichtlich am meisten darauf ankam, gesehen zu werden, saß an einem Tisch in einer schummrigen Ecke. Genauer gesagt: Er hielt dort hof.
Er war ein kleiner, etwa sechzig Jahre alter, dicklicher Mann, nicht besonders attraktiv, doch vom Geruch des Geldes umgeben und mit einer Aura persönlicher Anziehungskraft gesegnet, so daß er die Aufmerksamkeit fast aller anwesenden Frauen erregte – und den Neid sämtlicher Männer. Zwei der anderen Personen an seinem Tisch machten auf mich den Eindruck von Leibwächtern, nicht zuletzt deshalb, weil ihre Blicke ständig durch den Raum schweiften und ihre Fähigkeit, Konversation zu machen, gleich Null zu sein schien.
»Señor Diego Maria Gomez Arias«, sagte Jonathan, als er sah, in welche Richtung ich schaute.
»Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Er ist sehr reich. Ihm gehört das Hotel. Und er ist ein leidenschaftlicher Sammler.«
»Was sammelt er denn?«
»Alles, was schön ist.« Jonathan lächelte.
»Frauen eingeschlossen?« fragte ich und beobachtete wieder, wie die Blicke fast aller Damen in der Bar auf Señor Gomez Arias gerichtet waren.
»Frauen eingeschlossen«, erwiderte Jonathan.
»Gehören ihm auch die Artefakte in den Glaskästen?«
»Oh, ja. Ich vermute es jedenfalls stark.«
»Wären die Stücke im Museum nicht besser aufgehoben?«
»Schon möglich.« Er zuckte die Achseln.
»Gomez Arias … Ich glaube, ich habe seinen Namen tatsächlich schon mal gehört. Ist er ein Kunde von Hernan Castillo Rivas?«
»Das war er, soviel ich weiß. Mir ist zu Ohren gekommen, daß die beiden einen Streit hatten. Aber woher kennen Sie Don Hernan?« fragte Jonathan.
Ich erzählte ihm von McClintoch und Swain.
»Tja, McClintoch haben wir jetzt ja kennengelernt. Und wer ist Swain?«
»Mein Exgatte.«
»Oh.«
»Mit ›oh‹ ist ungefähr alles über meinen Verflossenen und unsere Ehe gesagt.«
Dann erzählte ich ihm vom Verkauf des Geschäfts und dem Anruf, der mich tags zuvor nach Mérida geführt hatte.
Das schien die Aufmerksamkeit beider Männer zu erregen. Sogar Lucas, der bis jetzt kaum ein Wort gesagt hatte, beugte sich erwartungsvoll vor.
»Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Lara«, sagte Jonathan. »Worum geht es?«