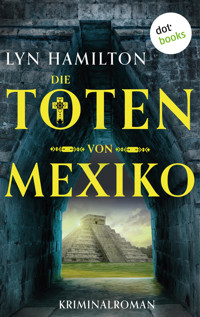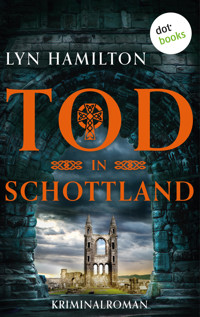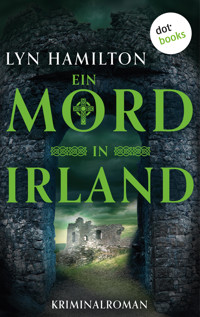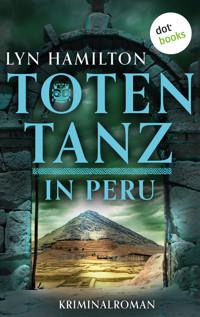
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Antiquitätenhändlerin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kann sie den Mörder fassen, bevor er sie ins Visier nimmt? Der packende Kriminalroman »Totentanz in Peru« von Lyn Hamilton als eBook bei dotbooks. Wenn ein scheinbar harmloses Artefakt ein gefährliches Geheimnis hat ... Lara McClintock ist hocherfreut, als sie ihrem Exmann bei einer Auktion eine Kiste mit Kunstgegenständen direkt unter der Nase wegschnappt – darunter auch eine Vase aus Peru. Doch sie bereut diesen Kauf schon bald, als in ihrem Laden Feuer gelegt wird … und die Polizei noch dazu die verkohlte Leiche eines Unbekannten aus den Trümmern zieht! Aber warum wurde nur die Vase gestohlen? Für die Polizei ist die Sache klar: Einer von Laras Mitarbeitern muss dahinterstecken – oder sie selbst ist die Täterin! Um ihre Unschuld zu beweisen, folgt Lara den Spuren des Diebes bis nach Peru – mitten hinein in ein Hornissennest aus Schwarzmarkthändlern und Grabräubern ... »Ein fesselnder Kriminalroman, voll von unterhaltsamen Charakteren und spannendem Wissen.« The Book Report Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der spannende Kriminalroman »Totentanz in Peru« von Lyn Hamilton ist der dritte Band der Lara-McClintoch-Reihe; alle Romane können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn ein scheinbar harmloses Artefakt ein gefährliches Geheimnis hat ... Lara McClintock ist hocherfreut, als sie ihrem Exmann bei einer Auktion eine Kiste mit Kunstgegenständen direkt unter der Nase wegschnappt – darunter auch eine Vase aus Peru. Doch sie bereut diesen Kauf schon bald, als in ihrem Laden Feuer gelegt wird … und die Polizei noch dazu die verkohlte Leiche eines Unbekannten aus den Trümmern zieht! Aber warum wurde nur die Vase gestohlen? Für die Polizei ist die Sache klar: Einer von Laras Mitarbeitern muss dahinterstecken – oder sie selbst ist die Täterin! Um ihre Unschuld zu beweisen, folgt Lara den Spuren des Diebes bis nach Peru – mitten hinein in ein Hornissennest aus Schwarzmarkthändlern und Grabräubern ...
»Ein fesselnder Kriminalroman, voll von unterhaltsamen Charakteren und spannendem Wissen.« The Book Report
Über die Autorin:
Lyn Hamilton (1944-2009) wuchs in Etobicoke, Toronto auf und studierte Anthropologie, Psychologie und Englisch an der University of Toronto. Obwohl sie hauptberuflich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war, galt ihre Leidenschaft der Mythologie und Anthropologie. Ein Urlaub in Yucatán inspirierte sie dazu, ihren ersten Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« zu schreiben.
Die Website der Autorin: http://www.lynhamiltonmysteries.com/
Bei dotbooks erscheinen von Lyn Hamilton folgende Krimis in ihrer Reihe um die Antiquitätenhändlerin Lara McClintock:
»Die Toten von Mexiko«
»Todesfurcht auf Malta«
»Totentanz in Peru«
»Ein Mord in Irland«
»Todesklage in Italien«
»Tod in Schottland«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »The Moche Warrior« bei Berkley Publishing Group, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Die Maske des Kriegers« bei Weltbild.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 by Lyn Hamilton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/SL-Photography, Eleni Mavrandoni, sunwart, Eroshka
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-244-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Totentanz in Peru« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lyn Hamilton
Totentanz in Peru
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Christa Hohendahl
dotbooks.
Für den Complejo de Moro von 1997
PROLOG
Der Große Krieger ist tot. Eine Zeit lang werden die Waffen ruhen, werden die Kämpfe der Männer zum Stillstand kommen. Eine Zeit lang werden die Priester die Prozessionen auf dem großen Vorplatz am Fuße der Huaca aussetzen, ebenso ihre Beschwörungen, und sie werden dem Fluss des heiligen Bluts in den Kelch Einhalt gebieten. Ruhen wird auch die Zurschaustellung der Gefangenen mit den Seilen um ihre Hälse und den auf den Rücken gebundenen Händen, ihrer Waffen beraubt, nackt, besiegt und gedemütigt. Andere Zeremonien werden stattfinden, andere Menschen werden nun ihre Knie vor dem Enthaupter beugen.
Der Große Krieger ist tot. Schon bereiten die Priester das Königsgrab vor und schaufeln unter der Huaca in die Tiefe. Die vigas, die Balken, die es bedecken sollen, werden ausgewählt; die Lehmziegel, mit denen es verkleidet wird – jeder Stein trägt das Zeichen seines Handwerkers – sind aus dem Landesinneren herangeschafft worden. Alles ist bereit. Nun ist es an der Zeit, dass wir diesen bedeutenden Mann für seine Reise rüsten.
Der Große Krieger ist tot. Wir sind verwundbar ohne ihn, ohne die Zauberformeln und Rituale, die uns beschützen. Ohne ihn kann das Wasser aus den Bergen seinen Lauf ändern, können die Ernten zu Staub zerfallen, die Fische aus dem Meer verschwinden. Wir müssen ihn mit einer prächtigen Feier auf den Weg schicken. Wir müssen bald den neuen Krieger wählen.
EIDECHSE
KAPITEL 1
»Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen«, donnerte der Mann mit erhobenen Armen, wobei seine Augen auf irgendeine ferne Vision gerichtet waren.
»Offenbarung des Johannes 12,12«, murmelte ich vor mich hin. Ich wusste Bescheid: In den letzten drei Tagen, seitdem der Verrückte aus der Nachbarschaft sich unmittelbar vor meinem Geschäft – Greenhalgh & McClintoch – ein kleines Rechteck auf dem Gehsteig abgesteckt hatte, um das Ende der Welt zu verkünden, hatte ich es unzählige Male gehört. Wenn er nicht die Bibel zitierte, trug er ohne Unterlass Shelleys Gedicht Ozymandias vor und beschwerte sich mit Inbrunst über den Teil, in dem Ozymandias den Allmächtigen auffordert, sein Menschenwerk anzusehen und zu verzweifeln. Ich war nicht sicher, was schlimmer war: Shelley oder die Offenbarung.
»Offenbarung 12,12«, dröhnte er, und ich konnte zumindest befriedigt feststellen, dass ich in meinen Kenntnissen über die apokalyptischen Texte rasche Fortschritte machte.
»Zuerst wird ein schreckliches Feuer kommen«, fuhr er fort, und seine Stimme nahm einen milderen Tonfall an, weil er versuchte, eine kleine Gruppe von Touristen in seinen Bann zu ziehen. Das derart bedrängte Quartett versuchte, sich vorsichtig an ihm vorbeizuschieben. Man konnte es ihnen kaum verübeln. Er wirkte schmutzig und ungepflegt und hatte die Augen eines Fanatikers. »Dann sah ich etwas, das einem gläsernen Meer glich und mit Feuer durchsetzt war«, sprach er weiter.
Wieder die Offenbarung, dachte ich.
»Offenbarung 15, Vers 2«, psalmodierte er. »Dann werden die Menschen sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod«, fügte er hinzu.
»Römerbrief 6, 23«, sagte ich. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Der Mann ging mir auf die Nerven, so kritikwürdig ich die Unfähigkeit der Gesellschaft, mitfühlend mit psychisch Kranken umzugehen, auch fand. Schließlich waren es meine Kunden, die er vertrieb. Es war Touristensaison, und die Leute mieden diesen Straßenabschnitt wie die Pest. Kein Wunder. Auch ich schlenderte gerade auf der anderen Straßenseite umher, in der Hoffnung, dass ihn etwas ablenken würde, damit ich rasch über die Straße und in den Laden laufen konnte, bevor er mich wahrnahm. Ich wusste bereits, was bei meinem Anblick kommen würde: das Buch Jesus Sirach.
»Kaum eine Bosheit ist wie Frauenbosheit!«, brüllte er, als er mich schließlich entdeckte. »Buch Jesus Sirach 25,19.«
Ich zuckte zusammen, eilte an ihm vorbei und lief die Stufen zum Geschäft hinauf.
»Es ist Ihre Schuld!«, schrie er, wobei er mit dem Finger auf mich zeigte und die Augen auf mich geheftet hielt. Ich ging rückwärts die letzten beiden Stufen hinauf und stürzte regelrecht hinein. Die Waagschalen neigten sich zugunsten von Percy Bysshe Shelley.
»Ist alles in Ordnung, Lara? Was ist nur mit diesem grässlichen Mann los?«, seufzte Sarah Greenhalgh, als ich durch die Tür geflogen kam.
»Ich würde sagen, er hat vergessen, seine Medikamente zu nehmen«, meinte Alex Stewart, ein Seemann im Ruhestand, der außerdem mein Nachbar und unsere unentbehrliche Aushilfe im Laden ist. »Vielleicht liegt es auch an der Jahrtausendwende«, fügte er hinzu. »Sie weckt offenbar eine Art primitiver Furcht in uns. Ihr braucht nur mal die Zeitungen anzuschauen! Auf der ganzen Welt machen sich die Menschen Gedanken um irgendwelche Zeichen am Himmel und solche Dinge. Lauter böse Omen, die scheinbar darauf hindeuten, dass uns eine Katastrophe bevorsteht, die alles Leben mit einem Schlag auslöscht.«
»Ich wünschte nur, er würde sich für seine Tiraden eine andere Stelle des Bürgersteigs suchen«, seufzte ich. »Er ist geschäftsschädigend! Trotzdem möchte ich nicht die Polizei rufen. Irgendwie kann er einem ja leidtun.«
Wenn ich heute daran zurückdenke, hatte der Mann jedoch in gewisser Weise recht, auch wenn er eindeutig geistesgestört war. Vielleicht nicht gerade, was die genaue Abfolge angeht. Der Mann in unserem Abstellraum war tot, ermordet, allerdings vor und nicht erst nach dem Feuer. Doch der Teufel – oder zumindest sein irdischer Handlanger – hatte also tatsächlich eine Zeit lang unter uns geweilt. Und – auch wenn es immer noch schmerzt, es zuzugeben – ich muss eine gewisse Verantwortung, eine Art von Schuld einräumen, denn alles, was geschah, war gewissermaßen auf meine Unfähigkeit zurückzuführen, mit einer heiklen persönlichen Situation umzugehen.
Die ganze verfahrene Geschichte begann, zumindest nach den Polizeiakten, damit, dass mein Geschäft verwüstet wurde und beinahe niederbrannte. Meiner Ansicht nach fing alles jedoch schon einige Monate vorher an, als Maud McKenzie überraschend von uns ging.
Maud war die Exzentrikerin von Yorkville, wo sich Greenhalgh & McClintoch befindet. Sie und ihr Ehemann Franklin waren die Besitzer eines seltsamen kleinen Ladens, in dem sie alles Mögliche verkauften: ein paar Antiquitäten, ein wenig Trödel, und der – Gott segne sie – den Namen Old Curiosity Shop trug. Maud und Frank wohnten über dem Geschäft. Sie waren da, so lange ich denken kann. Das Haus, in dem sich der Laden befand, hatte ursprünglich Mauds Familie gehört, und erst viele Jahre später, nachdem ihre Verwandten es verkauft hatten und fortgezogen waren, hatten Maud und Frank es sich leisten können, das alte Gebäude zurückzukaufen. Sie hatten schon hier gelebt, als Yorkville noch ein heruntergekommenes Viertel gewesen war. Sie hatten zugesehen, wie es in den Sechzigern zum kulturellen Zentrum wurde, als all diese großartigen Cafés und Folksänger dort waren, und hatten die Zeiten durchgestanden, in denen die Sechziger hässlich geworden waren und die Drogenszene sich hier angesiedelt hatte. Und als Yorkville seine Renaissance als vornehme Einkaufsgegend erlebte, machten sie genauso weiter wie vorher.
Sie hatten einen relativ lockeren Zusammenschluss von Händlern gegründet, eher eine Art Club zum geselligen Beisammensein als alles andere, dem zahlreiche von uns hiesigen Ladenbesitzern angehörten. Einmal pro Woche kamen wir in der Coffee Mill zusammen und nannten es unser Straßentreffen. Wir koordinierten unsere Weihnachtsdekorationen, richteten einen Fonds ein, um für das Viertel zu werben, kümmerten uns um Fälle von Vandalismus – die üblichen Dinge eben. Doch vor allem plauderten wir gern: darüber, wer gerade renovierte, wer sein Geschäft aufgab, wer eines eröffnete. Ein paar Jahre zuvor, als mein Mann Clive und ich uns gerade trennten und ich das Geschäft verkaufen musste, um ihn auszuzahlen, war auch dies sicher ein Gesprächsthema. Wir wachten über die Straße, als hinge unsere Existenz davon ab, was ja auch tatsächlich stimmte.
Wir waren eine feste kleine Gruppe und alle miteinander befreundet, zum Teil, weil wir in unterschiedlichen Branchen tätig und somit keine direkten Konkurrenten waren. Wir hatten einen Modedesigner, einen Buchhändler, einen Friseur, eine Bastelladenbesitzerin, mein Antiquitäten- und Designgeschäft und einen Wäscheladen. Neuankömmlinge wurden nicht unbedingt ausgeschlossen. Aber bevor jemand neu aufgenommen wurde, war ein einstimmiges Votum erforderlich, und wir entschieden uns nicht besonders oft für eine Abstimmung.
Als Frank starb, führte Maud das Geschäft allein weiter. Wir haben nie herausgefunden, wie sie es schaffte. Vielleicht lief der Laden besser, als jeder Einzelne von uns vermutete. Wenn man intensiv suchte, konnte man zweifellos wahre Schätze dort finden. Doch nach Franks Tod schien sich das Angebot nicht mehr großartig zu verändern.
Als Maud ein wenig, wie sie es nannte, »wackelig auf den Beinen« wurde, verlegten wir unser Kaffeekränzchen in ihre Wohnung, und jeder von uns brachte reihum eine Kanne Kaffee und ein paar Kekse mit. Eines Tages jedoch gingen meine Freundin Moira und ich hinüber, um nach ihr zu sehen, weil der Laden nicht pünktlich geöffnet hatte. Maud, die gelegentlich ihre kleinen »Anfälle« – so bezeichnete sie es – hatte, lag am Fuß der Treppe, die in ihre Wohnung im ersten Stock führte. Ein unglücklicher Sturz, schloss der Gerichtsmediziner. Das Genick war gebrochen, und der Schädel ebenso.
Ich denke, als Moira und ich sie dort liegen sahen, war uns beiden bewusst, dass unser Viertel nie mehr dasselbe sein würde.
Zu unserer großen Überraschung hatten Maud und Frank wesentlich mehr Geld besessen, als wir jemals vermutet hatten. Eine hübsche Summe, genau genommen etwas mehr als eine Million Dollar, und darin war der Verkauf des Gebäudes und des Mobiliars noch nicht eingerechnet. Ein Großteil des Geldes ging an diverse Wohltätigkeitsorganisationen, das alte Gebäude und den Hausrat bekam ein Neffe in Australien, von dessen Existenz wir nichts gewusst hatten, und zusätzlich gab es einen netten kleinen Fonds, der mit der Auflage eingerichtet worden war, dass unsere Kaffeekränzchen – wir waren alle einzeln genannt – einmal im Jahr zu einem Essen in einem Restaurant unserer Wahl zusammenkommen sollte, solange es uns möglich wäre.
In der folgenden Zeit drehten sich die Gespräche fast ausschließlich um Frank und Maud.
»Was meinst du, wo das ganze Geld herkam?«, überlegte ich laut, als Moira morgens auf einen Kaffee vorbeigekommen war, bevor wir unsere Geschäfte öffneten.
»Aus Kapitalanlagen«, vermutete Moira, Besitzerin des hiesigen Schönheitssalons. »Als ich irgendwann bei ihnen vorbeischaute«, fuhr sie fort und tippte dabei mit ihren perfekt manikürten Nägeln leise auf den Tisch, »arbeitete Maud gerade oben an ihrem Schreibtisch. Für mich sah es nach Wertpapieren aus.«
»Aber man muss erst mal Geld besitzen, bevor man es anlegen kann!«, erwiderte ich. »Wenn ich von meinen persönlichen Erfahrungen ausgehe, dann würde ich sagen, dass diese Läden sicher niemanden reich machen.«
»Vielleicht waren sie einfach besser als wir«, entgegnete Moira und schloss sich großzügig mit ein, obwohl sie eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist.
Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich recht gut an jenen Tag. Ich ließ den Blick durch mein Geschäft schweifen, das meiner Meinung nach ausgesprochen hübsch aussah, und dachte darüber nach, wie glücklich ich zum ersten Mal seit geraumer Zeit mit meinem Leben war, wie mein Universum sich zu meiner vollsten Zufriedenheit entfaltete. Der Laden warf regelmäßige, wenn auch nicht gerade überwältigende Einnahmen ab. Sarah und ich arbeiteten gut zusammen. Sie überließ mir die Kaufentscheidungen, weshalb ich vier ausgedehnte Einkaufsreisen pro Jahr in Teile der Erde, die ich liebte, unternehmen konnte, während sie, die geborene Buchführerin, das Geschäft sehr effizient verwaltete. Wir hatten eine ansehnliche Stammkundschaft aufgebaut, die uns in mageren Zeiten über Wasser hielt.
Was mein Privatleben betraf, hatte ich meiner Ansicht nach ein angenehmes Leben. Ich war nun schon seit etwa einem Jahr ohne Partner und musste feststellen, dass ich das Single-Dasein genoss, auch wenn ich öfter, als mir lieb war, an die frühere Liebe meines Lebens dachte – einen mexikanischen Archäologen namens Lucas May – und gelegentlich immer noch gegen die Versuchung ankämpfen musste, ihn anzurufen und zu bitten, zu mir zurückzukehren.
So oft ich konnte, traf ich mich mit Freunden wie Moira, und einmal in der Woche besuchte ich einen Abendkurs an der Universität von Toronto, meist etwas über antike Geschichte oder antike Sprachen, zum Teil, weil ich beruflich damit zu tun hatte, aber vor allem, weil ich mich dafür interessierte. Ich hatte bereits vor langer Zeit eingesehen, dass aus mir nie eine Wissenschaftlerin werden würde, aber mir gefiel es, mich in vielen Bereichen ein wenig auszukennen, und insbesondere, etwas über die Geschichte der Orte zu lernen, die ich besuchte, um meine Einkäufe zu tätigen.
Für ein junges maltesisches Paar, das in Kanada lebte, solange der Mann, Anthony Farrugia, Architektur studierte, war ich eine Art Ersatzelternteil geworden. Diese Aufgabe teilte ich mir mit einem Freund, Rob Luczka, einem Sergeant der Royal Canadian Mounted Police, der RCMP, den ich vor ein paar Jahren auf Malta kennengelernt hatte und mit dem ich in Verbindung geblieben war. Die jungen Farrugias wohnten in der Erdgeschosswohnung des Hauses, das Rob sich mit seiner Tochter Jennifer und seiner Lebensgefährtin Barbara teilte. Von Zeit zu Zeit schaute ich bei den Farrugias vorbei, etwa einmal im Monat rief ich bei Anthonys Mutter an, um Bericht zu erstatten, und wenn ich in der Stadt war, aß ich sonntags mit Anthony, seiner Frau Sophia sowie Rob und seinem Clan in ihrem Haus zu Abend. Mein Leben gestaltete sich ausgesprochen angenehm, auch wenn es nicht übermäßig aufregend war.
»Was meinst du also, was wird mit Mauds ganzem Kram geschehen?«, unterbrach Moira meine Gedanken.
»Der australische Neffe hat kein Interesse daran«, warf Alex ein. »Das Haus steht zum Verkauf, und das Mobiliar soll versteigert werden. Molesworth &Cox«, fügte er hinzu und nannte damit ein piekfeines Auktionshaus.
»Nun, wenn du das sagst, Alex, muss es ja stimmen«, sagte Moira lachend. »Ich weiß nicht, wie du es anstellst, aber du scheinst wirklich immer alles zu wissen.«
Nicht alles, wie sich herausstellte. Bald darauf hing ein »Zu verkaufen«-Schild an dem Gebäude, und das Haus wurde unmittelbar danach von einem Mann erworben, der einer der bedeutendsten Grundstücks- und Immobilienbesitzer der Gegend war. Kurz darauf wurde es für einen neuen Mieter instandgesetzt. Für wen genau, verriet der Eigentümer nicht. Er gab lediglich preis, dass der Mieter vornehm, gebildet und interessant sei, was uns nicht viel weiterhalf.
Wir waren alle der Ansicht, dass wir ebenfalls über diese Eigenschaften verfügten.
Ein großer Bauzaun verbarg die Renovierungsarbeiten vor unseren Blicken, so angestrengt wir auch versuchten hineinzuspähen. Nicht einmal Alex Stewart gelang es herauszufinden, wer der neue Mieter sein würde.
Eines Tages wurde der Zaun mit viel Aufhebens entfernt, und das Geschäft zeigte sich in all seiner Pracht. CLIVE SWAIN, RAUMAUSSTATTER, ANTIQUITÄTENHÄNDLER, stand auf dem Schild. Mein Exmann, diese Ratte, konkurrierte mit mir von der anderen Straßenseite aus!
Von diesem Moment an begann meine angenehme kleine Welt ins Wanken zu geraten.
»Du lieber Himmel, manche Männer sind wirklich schwer loszuwerden! Sie hängen an einem wie schmutzige Wäsche!«, rief Moira.
»Das ist so grauenhaft!«, jammerte ich. »Ich war es, die zuerst in der Branche arbeitete«, erklärte ich unnötigerweise, denn Moira wusste das nur zu gut. Aber ich musste es dennoch sagen. »Der einzige Grund, warum er in diesem Gewerbe Fuß fassen konnte, ist, dass ich bei unserer Heirat dumm genug war, ihm die Hälfte abzugeben. Und er war so ein Schuft und bestand bei unserer Trennung darauf, dass ich das Geschäft veräußerte, um ihm das Geld auszuzahlen. Dass ich mich mit Sarah wieder einkaufen konnte, war reines Glück. Und was macht er jetzt? Genau gegenüber!«
Moira zeigte sich verständnisvoll: »Er scheint es tatsächlich herauszuhaben, wie er Frauen dazu bringt, dass sie für ihn sorgen, nicht wahr? Zuerst du, die ihm jedoch auf die Schliche kommt und ihn vor die Tür setzt. Also lässt er sich mit dieser Neuen ein – wie heißt sie noch gleich? Celeste – die, sagen wir es klar heraus, ihm ein komplettes Geschäft finanziert. Ich glaube nicht, dass er eine große Bedrohung für dich darstellt, Schätzchen«, fuhr sie fort. Moira nannte jeden ›Schätzchen‹. »Schließlich hat er in seinem ganzen bisherigen Leben nicht einen einzigen Tag richtig gearbeitet, oder?«
Das stimmte. Clive war ein brillanter Innenausstatter, und eine Zeit lang waren wir ein gutes Team gewesen. Man musste jedoch kein Genie sein, um zu merken, dass er schon bald, nachdem wir geheiratet hatten und ich ihm den einen Anteil am Geschäft – die Hälfte – als Hochzeitsgeschenk überlassen hatte, dazu überging, an Hotelpools herumzuliegen und jungen Frauen in Bikinis schöne Augen zu machen, während ich mich mit einem gemieteten Jeep steile Bergstraßen hinaufkämpfte, um zu herausragenden Holzschnitzern zu gelangen, oder in irgendeiner heißen, stickigen Lagerhalle mit Zollagenten diskutierte.
Im Grunde hatte Moira recht. Clive arbeitete nicht gern. Aber er hatte wieder geheiratet, eine wohlhabende Frau namens Celeste, und sie besaß genügend Geld, um Leute zu engagieren, die die Arbeit für ihn erledigen konnten. Ich versuchte, das Ganze herunterzuspielen, und versicherte Sarah – die sich gefragt haben muss, was sie in ihrem früheren Leben verbrochen hatte, dass sie es verdiente, in diesen Streit hineingezogen zu werden –, dass Clive auf keinen Fall ein Problem darstellen würde.
In Wahrheit konnte er jedoch hart arbeiten, wenn er wollte, und bei unserem Scheidungsprozess war er ein grausamer Gegner gewesen. Ich betrachtete ihn durchaus als Bedrohung, aber es steckte noch mehr dahinter. Ich hatte ihn geliebt, wir waren zwölf Jahre lang verheiratet gewesen, und seinen Namen in eleganten Goldbuchstaben auf dem Schild auf der anderen Straßenseite zu sehen bedeutete eine stetige Erinnerung an etwas, das ich als persönliche Niederlage betrachtete – als wäre das Scheitern unserer Ehe und Clives Verhalten ausschließlich eine Folge meiner eigenen Unzulänglichkeit. Mir graute vor der unvermeidlichen ersten Begegnung mit ihm, und meine Angst machte mich wütend, sowohl auf Clive als auch auf mich selbst.
Ich versuchte, möglichst gute Miene zu machen, und nahm mir vor, genauso fortzufahren wie bisher und mich auf die kleinen und alltäglichen Dinge meines Lebens zu konzentrieren. Ich machte Pläne für meine nächste Reise nach Indonesien und Thailand und kümmerte mich um die letzte Sendung aus Mexiko. Was mein gesellschaftliches Leben anging, so gab es jeden Sonntag ein Abendessen in Robs Haus. Wie um diese Jahreszeit üblich, saßen Sophia, Jennifer und ich dann jedes Mal auf der Terrasse und sahen Rob und Anthony beim Grillen zu, während Barbara, eine flotte Blondine mit einem Pferdeschwanz und einem prachtvollen Körper und – sollte es so etwas jemals geben – überdies eine sichere Kandidatin für den Martha-Stewart-Preis für perfekte Haushaltsführung, exquisite kleine Vorspeisen sowie gemischte Blattsalate mit exotischen Zutaten herumreichte, die ich nicht einmal identifizieren konnte.
Darüber hinaus stand die Versteigerung von Mauds Besitztümern bei Molesworth & Cox an. Ich wollte daran teilnehmen, um zu sehen, ob ich einige von Mauds Sachen erwerben konnte, ein paar Gegenstände, die ich im Laden verkaufen könnte, und ein oder zwei persönliche Stücke zur Erinnerung an Maud und Frank. Ich hatte Alex gebeten, nach der Ankündigung der Auktion Ausschau zu halten.
Alex tat sogar noch etwas Besseres und besorgte mir eine Ausgabe des Katalogs. Eines Tages blätterte er ihn durch, als ich gerade dabei war, die Schaufensterauslage neu zu arrangieren, und es beharrlich vermied, zu Clives Laden auf der anderen Straßenseite hinüberzusehen.
»Aha, was haben wir denn da?«, hörte ich ihn murmeln. »Sieh mal hier, Lara. Ist es das, wofür ich es halte?«
Ich warf einen Blick auf den Katalog und lächelte. »Cape Cod«, sagte ich. »Gute Arbeit, Alex. Das hätte ich möglicherweise übersehen.«
»Wird Jean Yves nicht erfreut sein?«, erwiderte er. »Allein dafür solltest du auf jeden Fall hinfahren.«
Er sprach von einem Satz von sechs Wasserkelchen aus Pressglas mit Cape-Cod-Muster aus den 1880er-Jahren, die am selben Tag wie Mauds Habseligkeiten versteigert werden sollten. Bei dem fraglichen Jean Yves handelte es sich um Jean Yves Lassonde, einen französischen Schauspieler, der zehn Jahre zuvor nach Hollywood gegangen war, um einen Film zu drehen. Er war in Amerika geblieben, hatte eine Farm im Norden des Staates New York gekauft und war dort eingezogen. Ich hatte ihn vor mehreren Jahren kennengelernt, als Clive und ich noch das Geschäft zusammen betrieben und Jean Yves sich gerade wegen Dreharbeiten in der Stadt aufhielt.
Er war in den Laden hineinspaziert, der damals noch McClintoch & Swain hieß, und das Geschäft hatte ihm gefallen. Bei jenem ersten Besuch hatte er einen schönen alten Spiegel und einen antiken Schrank aus Teak erstanden, den ich in sein Farmhaus liefern ließ. Danach kam er jedes Mal, wenn er in der Stadt war, vorbei und kaufte nahezu immer etwas. Bei einer Gelegenheit hatte ich ihm einen sehr großen geschnitzten Eichen-Esstisch aus Mexiko verkauft, zusammen mit sechzehn dazu passenden Stühlen mit wunderbar gearbeiteten Rückenlehnen und schönen abgenutzten Ledersitzen.
Er hatte damals lachend gesagt, dass er gar nicht wisse, was er mit einem derart riesigen Tisch anfangen solle, da er nur fünf von den antiken Glaskelchen mit dem Muster, das er eben erst zu sammeln begonnen hatte – dem Cape-Cod-Muster –, hatte finden können. Auch wenn nordamerikanisches Pressglas nicht zu meinen Spezialgebieten gehört, hatte ich ein paar Nachforschungen zu dem Thema angestellt – weil er ein so guter Kunde und ein wirklich angenehmer Mensch war – und herausgefunden, dass die Formen für die Herstellung regelmäßig über die Grenze zwischen den USA und Kanada hin- und hergereicht wurden und dieses spezielle Muster möglicherweise eine Zeit lang in den Burlington Glass Works auf der kanadischen Seite hergestellt worden sein könnte.
Mit diesem Wissen gerüstet, hatte ich bei einem Nachlassverkauf außerhalb von Toronto einen Glaskelch gefunden und diesen bei einer Warenlieferung an ihn als kleines Geschenk des Hauses mitgeschickt. Wie erwartet war er begeistert gewesen. Er nahm das Glas als Geschenk an, bestand jedoch darauf, dass, falls ich noch weitere fände, er diese zu bezahlen beabsichtigte. Danach hatte ich noch zwei weitere Gläser aufgetrieben, und auf eines war er selbst gestoßen, sodass er nun insgesamt neun besaß. Es fehlten also noch sieben. Und hier in dem Katalog von Molesworth & Cox waren sechs. Jean Yves würde tatsächlich sehr erfreut sein.
Am Tag der Auktion war es heiß und schwül, und ich betrat die illustren, kühlen Räume gleichermaßen erleichtert wie erwartungsvoll. Ich kaufe nicht viel bei Auktionen: Die meisten Waren erwerbe ich direkt bei den Herstellern oder über meine Agenten und Sammler in den verschiedensten Teilen der Erde. Doch nichts gibt einem einen solchen Adrenalinstoß wie eine Auktion, und nichts vermag es, den Kampfgeist so zu wecken – bei den meisten Menschen zumindest.
Bei Molesworth & Cox fand man außer der Wettbewerbsstimmung auch noch ein wenig von der Klasse und der Erhabenheit der Alten Welt. Das alte britische Unternehmen, das vor fast hundertfünfzig Jahren gegründet worden war, als die Kostbarkeiten aus den fernen Einflussbereichen des Empires nach London strömten, präsentierte in seinen Räumen stolz die Wappen, die es als Hoflieferanten für Ihre Majestät, die Königin, und ein paar der niedereren Mitglieder des Königshauses auszeichneten. Die Firma hatte vor einigen Jahren nach Nordamerika expandiert und Auktionshäuser in New York, Dallas und Toronto eröffnet. Die Niederlassung in Toronto befand sich auf der King Street, nur ein oder zwei Häuserblöcke von den hoch aufragenden Bankgebäuden entfernt, in denen zahlreiche Gegenstände von Molesworth & Cox zu finden waren, die die Sitzungsräume jener modernen Kathedralen zierten, in denen vor allem der Mammon regiert.
Außen war das Geschäft so dezent gehalten, dass man es, wenn man keine genaue Wegbeschreibung besaß, leicht übersah. Lediglich eine bescheidene Bronzetafel neben einer auf schlichte Art eleganten Tür wies darauf hin, was sich im Inneren befand.
In den Räumlichkeiten sah es immer noch so aus wie zur Zeit des Britischen Empires. Die Atmosphäre wurde gewissenhaft gepflegt und entsprach der Vorstellung, die ich von einem britischen Club in Indien während der Raj-Periode, der Zeit der Kolonialherrschaft, hatte: unzählige Palmwedel; große Fenster, deren Läden das Sonnenlicht und die Hitze abhielten; glänzend poliertes Messing; dunkles Holz; abgenutzte Ledersessel; und starker, dunkler Tee – Assam möglicherweise –, der in durchscheinenden Porzellantassen auf einem mattierten Messingtablett serviert wurde, während der dezente Duft teurer Zigarren in der Luft hing.
Besucher mussten läuten, um eingelassen zu werden, und fanden sich im Innern sogleich in den Ausstellungsräumen wieder, von denen jeweils zwei auf beiden Seiten einer zentralen Halle lagen. Die Räume waren in einem tiefdunklen Grün gestrichen, und auf den Böden lagen Orientteppiche. Wie immer, wenn ich eine Auktion besuche, ließ ich meinen Blick rasch durch den Raum gleiten und schaute, ob es außer den speziellen Gegenständen, nach denen ich suchte, noch etwas anderes von Interesse gab. Sofort entdeckte ich Mauds Besitztümer und legte mich innerlich auf mehrere Bilderrahmen aus Sterlingsilber fest, die ich selbst behalten wollte, sowie auf drei Paare alter Messingkerzenleuchter für den Laden.
Die Wasserkelche befanden sich in dem zweiten Raum, und ich begutachtete sie so schnell wie möglich. Gegenstände aus Pressglas stellen heutzutage beliebte Sammelobjekte dar, und die Preise sind an einem Punkt angelangt, bei dem zwangsläufig Fälschungen im Umlauf sind. Ich hatte den Eindruck, dass sie authentisch waren, und ihre Echtheit wurde selbstverständlich durch ein Zertifikat von Molesworth & Cox bestätigt. Das Mindestgebot lag bei hundertfünfundsiebzig Dollar, was angemessen war. Jean Yves war bereit, etwa fünfzig Dollar pro Kelch zu zahlen, also blieb noch ein gewisser Spielraum.
Ich folgte meiner üblichen Strategie bei Auktionen und verbrachte so wenig Zeit wie möglich bei den Gegenständen, die ich wirklich haben wollte, um Desinteresse vorzutäuschen. Stattdessen betrachtete ich ausgiebig Dinge, die ich gar nicht ersteigern wollte, in diesem Fall ein Porzellanservice von Royal Doulton mit einem einwandfreien Herstellernachweis, das früher irgendeinem Herzog gehört hatte und angeblich extra anlässlich des Besuchs von keiner Geringeren als Königin Viktoria in seinem Schloss in Auftrag gegeben worden war. Ich weiß nicht, was ich mit dieser kleinen List zu erreichen glaube; ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hohe Gebote für irgendwelche Dinge abgibt, nur weil er beobachtet hat, dass ich sie mir angesehen habe. Vielleicht ist es nur ein Aberglaube.
Bei Molesworth & Cox ist es erforderlich, dass die Käufer sich registrieren lassen und ihre Zahlungsfähigkeit nachweisen, und sobald sie sich als dessen würdig erwiesen haben, erhalten sie eine Nummer und eine Tafel, auf der sie zu lesen ist. Bei M & C gibt es kein unziemliches Geschrei. Um ein Gebot zu machen, hebt man lediglich sein Schild und macht, falls nötig, ein Handzeichen bezüglich des Betrags, und zwar so kultiviert und würdevoll wie möglich.
Ich setzte mich beizeiten hin, wie gewöhnlich hinten in der Mitte, und beobachtete, wie andere vor mir ihre Plätze einnahmen. Die üblichen Verdächtigen waren anwesend – etwa ein Dutzend Händler, von denen mir ein oder zwei namentlich bekannt waren, die anderen nur vom Sehen. Ich war ein wenig enttäuscht, Sharon Steele zu entdecken. Sie ist eine Händlerin, die ein Antiquitätengeschäft auf der Queen Street West besitzt und sich auf altes Glas spezialisiert hat, und ich vermutete, dass auch sie an den Wasserkelchen interessiert sein würde. Darüber hinaus waren mehrere Yuppie-Paare da, einige arabische Geschäftsmänner und ein paar offensichtlich wohlhabende Chinesen. Außerdem sah ich Ernie, einen älteren Herrn, der bisher bei jeder Auktion gewesen war, an der ich in diesen Räumlichkeiten jemals teilgenommen hatte, und jemand anderen, den ich noch nie irgendetwas hatte kaufen sehen.
Ein Mann schien aus dem Rahmen zu fallen. Er war mir hier noch nie aufgefallen, auch wenn das nichts bedeuten musste. Vermutlich bemerkte ich ihn nur, weil er irgendwie fehl am Platz zu sein schien. Er war mittelgroß und von durchschnittlicher Statur, dunkelhäutig, sein Kragen und seine Ärmelaufschläge waren ein wenig abgenutzt, seine Schuhe etwas abgetragen, sein gräulich-grüner Anzug glänzte leicht – nichts, was an einem anderen Ort unpassend gewirkt hätte, aber hier vielleicht schon. Er wirkte nervös, möglicherweise sogar eher verstohlen. Er hatte die ganze Zeit über die Hände in den Hosentaschen, sein Blick jagte im Raum umher, und hin und wieder schoss seine Zunge blitzschnell aus dem Mund und verschwand sofort wieder. Da ich die schlechte Angewohnheit habe, fremden Leuten Spitznamen zu geben, nannte ich ihn Eidechse.
Eigentlich rechnete ich damit, dass Eidechse wieder verschwinden würde, sobald die Auktion begann, aber das tat er nicht. Vielmehr hatte er offensichtlich die Aufnahmekriterien erfüllt, da er eine Tafel mit der Nummer neun in der Hand hielt, und wählte einen Platz mehrere Reihen vor mir auf der rechten Seite.
Mauds Spiegel und die Kerzenhalter sollten an dritter und vierter Stelle versteigert werden und die Wasserkelche an zehnter. Bei den ersten Gegenständen wurde zügig geboten, doch bei Mauds Besitztümern hatte ich nur wenig Konkurrenz und bekam sowohl die Rahmen als auch die Kerzenleuchter zu einem meiner Ansicht nach angemessenen Preis. Anschließend lehnte ich mich zurück und wartete, bis die Gläser an der Reihe waren. Sharon Steele hatte noch kein Gebot abgegeben, weshalb ich vermutete, dass auch sie auf die Wasserkelche aus war. Ich wusste, dass sie eine konservative Bieterin war, weshalb ich davon ausging, dass ich eine realistische Chance hatte, die Dinge, die ich haben wollte, zu bekommen.
Sharon hatte die Nummer achtzehn, ich die dreiundzwanzig. Sobald die Kelche zur Versteigerung kamen und mit dem Mindestgebot einsetzten, boten mehrere Personen mit, doch als eine Summe von zweihundertdreißig Dollar erreicht wurde, waren nur noch Sharon und ich dabei. Der Auktionator schwankte zwischen uns beiden hin und her, bis wir bei dreihundert Dollar ankamen, Sharons Gebot. Das war Jean Yves Obergrenze, aber ich erhöhte dennoch auf dreihundertzehn Dollar, in der Hoffnung, dies wäre das Ende. Das war es jedoch nicht. Sharon war offenbar ebenfalls ganz versessen auf die Kelche. Inzwischen rechnete ich in Gedanken durch, wie viel Verlust ich bereit war zu akzeptieren. Jean Yves war ein guter, nein, ein bedeutender Kunde, und die Geschäfte liefen derzeit nicht schlecht. Doch Sarah und ich würden niemals reich werden, und, wie man so schön sagt, in einem guten Monat reichte es gerade so für die Miete.
Ein anderes Sprichwort sagt: Wer zögert, hat bereits verloren. Die Gebote waren nun bei vierhundert Dollar angelangt, und meine Nerven lagen ein paar Sekunden lang blank. Zu Sharons und auch zu meiner großen Überraschung erhöhte jemand, der weiter hinten saß, das Gebot auf vierhundertfünfzig Dollar, und der Auktionshammer senkte sich. »Verkauft an einunddreißig«, sagte der Auktionator.
Ich saß da und versuchte, mit meiner Enttäuschung fertig zu werden, als eine Stimme hinter mir ertönte, die ich nur zu gut kannte. »Ich glaube, Jean Yves wird sich über die Gläser freuen, meinst du nicht auch?«, fragte die Stimme liebenswürdig.
Clive. Ich wandte mich um und stellte fest, dass mein Exmann direkt hinter mir saß und ziemlich selbstzufrieden dreinblickte. Er war äußerst elegant gekleidet, ich schätzte, es war Armani – Moira hätte es gewusst –, und trug eine moderne kleine Brille mit Metallgestell zu einem teuer wirkenden Haarschnitt.
»Warum tust du das?«, zischte ich. Während ich sprach, strich er sich über den Schnurrbart, eine Geste, die ich einst, wie ich mir ins Gedächtnis rief, ungemein attraktiv gefunden hatte, die mich im Augenblick jedoch einfach nur in Rage brachte.
»Was meinst du?«, fragte er unschuldig. »Ich dachte, ich könnte sie für Jean Yves mitnehmen. Ich habe befürchtet, dass Sharon sie bekäme, daher bin ich eingesprungen.«
»Das hast du nicht für Jean Yves getan. Du hast es aus demselben Grund getan, weshalb du einen Laden gegenüber von meinem eröffnet hast«, flüsterte ich, obwohl ich mir durchaus bewusst war, dass die Leute in der Nähe uns beobachteten, aber ich war zu wütend, als dass mich das gestört hätte.
»Du hast es getan, um mich zu ärgern«, fuhr ich fort. »Aber warum? Ich habe dir die Hälfte der Summe gegeben, die der Verkauf des Ladens erbracht hat, und Celeste hat sicher genug Geld, um dir ein stilvolles Leben zu ermöglichen«, zischte ich.
»Aber es ging mir nie um Geld, mein Schatz. Ich brauchte einfach etwas, in dem ich meine Kreativität ausleben kann«, erwiderte er.
Na klar, dachte ich. »Ich bin nicht dein Schatz«, sprudelte es aus mir heraus, und ich erhob mich von meinem Stuhl und ging in Richtung Ausgang.
Während ich über die Beine mehrerer Leute kletterte, die zwischen mir und dem Gang saßen, sammelten sich in meinen Augen Tränen der Wut, aber ich war entschlossen, sie niemanden sehen zu lassen. Schon wurde der nächste Gegenstand versteigert. Als ich auf die Tür am Ende des Raumes zustolperte, bemerkte ich, dass jemand hinter einer Palme lauerte – anders kann man es nicht bezeichnen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was er dort machte. Er schien nicht über eine Nummer zu verfügen und wirkte sogar noch deplatzierter als Eidechse. Er war ganz in Schwarz gekleidet und verfolgte äußerst konzentriert den weiteren Verlauf der Versteigerung. Als ich an seinem Versteck vorbeikam, drehte er sich um, weil ich ihn durch mein Vorübergehen abgelenkt hatte, und sah mir einen Moment lang direkt in die Augen. Ich konnte es gerade noch vermeiden, laut aufzuschreien. Er hatte sehr dunkle und tief liegende Augen, und seine Handrücken waren mit ebenso dunklen Haaren bedeckt. Aus einem Grund, den ich nicht erklären kann, erinnerte er mich an einen Krebs, vielleicht wegen der Art, wie er die Arme vom Körper wegstreckte, beinahe wie Scheren – oder vielleicht auch an eine riesige schwarze Spinne, und eine giftige noch dazu. Er blickte mich ein oder zwei Sekunden lang an, dann wandte er sich wieder der Versteigerung zu.
Interessiert drehte ich mich ebenfalls um. Das Bieten entwickelte sich zu einem wahrhaften Kampf, und zwei Parteien stritten um irgendein Objekt, Nummer neun und Nummer einunddreißig: Clive und Eidechse.
Das Versteigerungsobjekt war eine Kiste mit kleinen Gegenständen, die nicht beim Zoll abgeholt worden und daher auf dem Auktionstisch gelandet war. Bei meiner kurzen Erkundungstour vor dem Beginn der Auktion hatte ich sie gesehen, sie aber nicht besonders beachtet. Und weil ich es nun so eilig gehabt hatte, aus dem Raum zu gelangen, hatte ich die Beschreibung des Auktionators nicht gehört. Ich erinnerte mich vage daran, dass sich in der Kiste eine Menge wertloses Zeug befand und möglicherweise auch ein paar reizvolle Dinge, allerdings nichts, was mich wirklich interessierte.
Doch ich wusste, welcher Gegenstand Clives Aufmerksamkeit erregt hatte: eine kleine geschnitzte Schnupftabakflasche aus Jade. Clive war ein leidenschaftlicher Sammler, und auf einer Skala von eins bis zehn würden Schnupftabakflaschen bei ihm eine neun Komma fünf erreichen. Er besaß eine beeindruckende Kollektion, die wir früher auf einer Platte unter unserem Glascouchtisch im Wohnzimmer ausgestellt hatten. Es war mir gelungen, ein paar schöne Exemplare als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zu erstehen, und er hatte sich jedes Mal sehr darüber gefreut.
Das Bieten wurde zunehmend hitziger, und die gebotene Summe wuchs rasch. Wenn Eidechse nicht gerade sein Schild hochhielt, warf er Clive verzweifelte Blicke zu. Der Preis stieg stetig an. Clive saß vorgebeugt auf seinem Stuhl, und Eidechse wischte sich den Schweiß von der Stirn; der Mann wollte die Kiste unbedingt haben. Aber es war offensichtlich, dass Clive über die nötigen finanziellen Mittel verfügte und Eidechse nicht.
Kurz bevor sich der Hammer nach Clives letztem Gebot senkte, beugte er sich zu einer hübschen jungen Frau vor, die neben ihm saß, und flüsterte ihr etwas zu. Er witterte bereits den Sieg und war davon überzeugt, dass er gewonnen hatte.
Und dann tat ich spontan dasselbe, was Clive mir angetan hatte. Ich hob meine Tafel, und bevor er begriff, was geschah, war ich stolze Besitzerin einer Kiste mit irgendwelchem alten Krempel, der durch mein Handeln plötzlich neunhundertneunzig Dollar wert war. Es war boshaft gewesen, um nicht zu sagen kindisch, leichtsinnig und sogar töricht.
Außerdem war es einer der schlimmsten Fehler, den ich je begangen habe.
KAPITEL 2
»Clive hat sie bekommen!«, kreischte Moira. »Das ist ja entsetzlich!«
Wir saßen kurz nach Ladenschluss in dem kleinen Büro im hinteren Teil des Geschäfts und betrachteten die jämmerliche Kiste, die ich erstanden hatte. Während wir das taten, sprang Diesel, ein orangefarbener Kater, der den offiziellen Titel »Ladenkater« trägt, auf den Tisch und steckte seine Nase in das Behältnis. Nachdem er eine Weile darin herumgeschnüffelt hatte, blickte er auf, warf mir einen verächtlichen Blick zu und stolzierte interessanteren und lohnenswerteren Dingen entgegen. »Es war bescheuert, ich weiß!«, rief ich dem kleinen Biest hinterher.
Mein Triumphgefühl darüber, dass ich Clive die Schnupftabakflasche weggeschnappt hatte, währte ausgesprochen kurz. Genau genommen nicht einmal bis vor die Tür des Gebäudes. Es dauerte nur so lange an, bis ich meine private Kreditkarte vorzeigte, um das ersteigerte Objekt zu bezahlen (schließlich konnte ich das Geschäft nicht mit dieser verrückten Ausgabe belasten). Die Abbuchung von tausend Dollar, neunhundertneunzig, um genau zu sein, brachte meinen Kreditrahmen gefährlich nah an seine Grenze, und ich schlich verzweifelt zum Laden zurück.
Etwa eine Stunde später erschien Moira. Ihre dunklen Haare hatten einen flotten, raffinierten neuen Schnitt, und sie trug einen langen, grauen Baumwollpullover und dazu passende Leggings. Sie sah wie üblich atemberaubend aus, und ich nahm an, dass sie noch eine Verabredung hatte. Moira behauptete jedoch, sie sei ohnehin in der Nähe gewesen und hätte sich spontan entschieden, hereinzuschauen. Ich hegte den Verdacht, dass Alex sie angerufen hatte, weil er meine düstere Stimmung bemerkt hatte, aber keiner von beiden sagte etwas darüber.
Nachdem wir die Kiste einige Minuten lang schweigend betrachtet hatten, sagte Moira: »Meiner Ansicht nach solltest du jemanden beauftragen, dieses Jade-Dingsda in eine Art Anhänger umzuarbeiten, den du dann jeden Tag um den Hals trägst. Jeden einzelnen Tag«, fügte sie hinzu, »während du vor Clives Laden auf und ab stolzierst.«
Ich musste lachen. »So ist es schon besser«, sagte sie. »Wir wollen mal sehen, was wir hier noch alles haben. Vielleicht ist etwas Kostbares dabei, und du kannst deinen Verlust wieder ausgleichen.«
»Das bezweifle ich«, entgegnete ich. »Wenn ein wertvolles Stück dabei gewesen wäre, hätten Molesworth & Cox es gefunden, herausgenommen und separat verkauft, meinst du nicht?«
»Man weiß nie«, beharrte Moira. »Lass uns mal schauen. Was meinst du, was du für die Schnupftabakflasche bekommen könntest?«
»Vier-, vielleicht auch fünfhundert. Höchstens«, antwortete ich.
»Na siehst du, dann hätten wir schon die Hälfte wieder drin«, sagte sie. »Nun fehlen nur noch etwa fünfhundert.«
Wir begannen, in der Kiste herumzukramen, deren Inhalt meiner Ansicht nach in keiner Weise an den Wert herankam, den ich gezahlt hatte – selbst wenn man für die Jadeflasche großzügige fünfhundert Dollar ansetzte. Moira suchte unbeirrt weiter.
»Ist das hier nicht putzig?«, meinte sie und zog einen kleinen Gegenstand aus der Kiste. Wir blickten ihn beide erstaunt an. Moira verwendete häufig Wörter wie ›putzig‹ und ›Dingsda‹, und manche Leute schlossen daraus fälschlicherweise, sie sei nicht besonders intelligent. In Wahrheit war sie auf Privatschulen erzogen worden und hatte ihre Schulausbildung in der Schweiz und mehrere Jahre lang in Cornell fortgesetzt, bevor sie ihrer snobistischen Familie eine lange Nase machte und die Schule abbrach, um Friseurin zu werden. Heute besitzt sie einen der elegantesten und erfolgreichsten Salons der Stadt. In den letzten ein oder zwei Jahren, seitdem ich den Laden wiederhatte, war sie eine wirklich gute Freundin geworden.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Es sieht aus wie ... eine Erdnuss. Eine silberne Erdnuss«, stellte Moira fest. Ich verdrehte die Augen, und wir schüttelten uns beide vor Lachen. Das kleine Ding sah tatsächlich genau wie eine Erdnuss aus, und es hatte auch ungefähr die richtige Größe. Ich legte es in meine Handfläche und prüfte das Gewicht.
»Ich glaube«, sagte ich nach einer Weile, »es ist sogar echtes Silber, und möglicherweise ist es alt. Die handwerkliche Ausführung ist hervorragend. Sie sieht so echt aus, dass man sich beinahe vorstellen kann, sie zu erbrechen und die zwei kleinen Nüsse darin zu finden. Und sieh mal hier«, fuhr ich fort und zeigte auf die beiden winzigen Löcher, die sich an den Enden befanden, »offenbar ist es als Perle gedacht.«
»Siehst du, was habe ich gesagt?«, erwiderte Moira. »Ein wirkliches Kleinod. Allerdings ist es schwer einschätzbar, ob es einen Markt für eine einzelne silberne Erdnuss gibt«, fügte sie hinzu, und wir lachten beide erneut. Ich war froh, dass ich das Ganze allmählich mit Humor sehen konnte.
»Zumindest ist sie nicht aus Plastik wie das hier«, fuhr Moira fort, während sie eine Perlenkette herauszog, auf die jemand in den Sechzigern sehr stolz gewesen wäre. Ich seufzte. »Oder so hässlich wie das hier«, fügte sie hinzu und zeigte mir eine besonders scheußliche Brosche.
»Kein Wunder, dass es nicht verzollt wurde«, stöhnte ich. »Die Kiste wäre die Anfahrt zur Abholung nicht wert gewesen!«, sagte ich, während ich einen hölzernen Kasten öffnete. Darin lag eine gebauchte Schale oder Vase, die sorgfältig in Stroh gebettet und etwa fünfzehn bis achtzehn Zentimeter hoch war. In die Innenseite des Gefäßes war – in kunstvollen Details – ein schlangenartiges Wesen gemalt, das sich um die Öffnung wand. Außen, unterhalb der Wölbung, war mit feinen Strichen eine fantastische Szene aufgemalt. Sie bestand aus prächtig gekleideten Figuren, von denen einige menschenähnlich zu sein schienen, andere jedoch Vogel- und Tierköpfe hatten, und zog sich rund um den Fuß.
»Wow. Das ist aber hübsch!«, rief Moira aus, als ich die Vase vorsichtig aus der schützenden Verpackung zog. »Was ist es denn? Es sieht sehr alt aus.«
»Das stimmt«, pflichtete ich ihr bei. »Allerdings ...« Ich drehte den Boden des Gefäßes zu ihr, sodass sie sehen konnte, dass dort die Worte hecho en Peru – hergestellt in Peru – in den Ton geritzt worden waren.
»Und dann ist da noch etwas«, fuhr ich fort und hielt eine kleine Karte hoch, die ich für sie übersetzte. »›Replikat einer präkolumbischen Vase‹«, las ich vor. »›Hergestellt in Campina Vieja, Peru‹ – ›Campina Vieja‹ bedeutet, wenn mein Spanisch mich nicht täuscht, ›alter kleiner Bauernhof‹. Das ist vermutlich der Name eines Städtchens.«
Sie lachte. »Wie gut, dass ich nicht in deiner Branche arbeite«, sagte sie. »Ich wäre wahrscheinlich auf das Ding hereingefallen.«
»Tja, das könnte fast jedem passieren«, entgegnete ich. »Das Problem bei Replikaten ist, dass sie, anders als Reproduktionen – die im Grunde genommen nur Nachbildungen sind –, exakt so aussehen wie das ursprüngliche Objekt: es werden dieselben Materialien verwendet, dieselbe Herstellungsmethode, es stimmt einfach alles. Wenn man ein Replikat anfertigt, wird manchmal sogar absichtlich ein Fehler eingebaut – damit es nicht für das Original gehalten wird, für den Fall, dass die Unterlagen, die das Werk als Replikat kennzeichnen, von dem betreffenden Objekt getrennt werden. Bei dem Stück hier ist es zum Beispiel möglich, dass eine der Linien der Zeichnung vom Original abweicht. Replikate sind meistens sehr teuer in der Herstellung, aber präkolumbische Arbeiten sind so wertvoll, dass es sich vermutlich auszahlt, eines anzufertigen. Und zumindest in diesem Fall ist es eindeutig als solches gekennzeichnet und nicht das Werk skrupelloser Menschen, die, sagen wir, an einem schlechten Gedächtnis leiden und vergessen, hecho en Peru in den Boden zu ritzen.«
»Und daher zahlen Touristen viel zu viel für einen Gegenstand, den sie für ein authentisches präkolumbisches Stück halten, und versuchen anschließend, ihn in ihrer schmutzigen Unterwäsche nach Hause zu schmuggeln, nehme ich an«, sagte Moira. »Wovon ist es deiner Meinung nach ein Replikat? Da Peru draufsteht: vielleicht von etwas von den Inka?«
»Ich bin nicht sicher. Wie du ja weißt, habe ich eine Zeit lang mittelamerikanische Geschichte studiert, insbesondere die Mayas, aber dieses Gefäß hier ähnelt keinem, das ich je gesehen habe. Der Umstand, dass es in Peru hergestellt wurde, könnte auf die Inkakultur hindeuten, aber ich kann es wirklich nicht sagen. Vielleicht werde ich bei Gelegenheit ein wenig recherchieren, nur so zum Spaß, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe.«
»Könntest du nicht Lucas um Rat fragen? Er müsste sich doch mit peruanischen Dingen auskennen, oder?«, fragte Moira, relativ zurückhaltend, wie ich fand. Sie hatte meinen einstigen Lebensgefährten Lucas immer gemocht und war der Meinung, dass er und ich uns wieder zusammentun sollten. Sie glaubte, ich hätte mich von ihm getrennt, dabei war er derjenige gewesen, der unsere Beziehung vor einem Jahr beendet hatte. Er könnte nicht gleichzeitig seine patriotische Pflicht Mexiko gegenüber erfüllen und unsere Beziehung aufrechterhalten, hatte er gesagt. In Moiras Augen war eine solche Aussage nicht ernst zu nehmen.
»Er ist Experte für die Mayas, Moira, und nicht für Peru. Und es ist vorbei, verstehst du?«
»Wie auch immer«, entgegnete Moira. Mit weniger als einer hundertprozentigen Versöhnung würde sie sich nicht zufriedengeben, schlussfolgerte ich. So ärgerlich dies gelegentlich auch sein mochte, in gewisser Hinsicht hatte es auch etwas Liebenswertes. »Also, was auch immer es ist, könntest du es in deinem Laden verkaufen?«, fuhr sie fort, während sie das Tongefäß hin- und herdrehte. »Zusammen mit der Art von Dingen, die du verkaufst, würde es nicht schlecht wirken, glaube ich. Du bietest doch gelegentlich präkolumbische Reproduktionen an, nicht wahr?«
»Das stimmt, und du hast recht«, räumte ich ein. »Die Vase würde tatsächlich sehr gut passen. Aber welchen Preis sollte ich dafür ansetzen? Glaubst du, dass ich fünfhundert dafür bekommen könnte?«
»Wahrscheinlich nicht«, erwiderte Moira. Ich zog eine Grimasse und blickte sie an. »Ich muss jetzt los«, sagte sie und erhob sich von ihrem Stuhl. »Eine Verabredung. Mit einem neuen Mann. Meinst du, diesmal ist es der Richtige?«
»Wahrscheinlich nicht«, äffte ich sie nach.
Sie lachte. »Komm doch mal bei mir im Salon vorbei. Bei deinem nächsten Besuch spendiere ich dir einen kostenlosen Haarschnitt. Und warte nicht zu lange«, sagte sie, während sie ihre Hand ausstreckte und eine lange Strähne vor meinen Augen herunterzog.
»Danke«, entgegnete ich. »Das ist sehr nett von dir.«
»Wozu hat man denn Freunde?«, erwiderte sie. »Du kannst mir dann Beistand leisten, wenn es mit diesem Typ wieder nicht klappt, wie üblich.«
»Es ist nicht so, dass es nicht klappt, sondern du lässt sie fallen, Moira«, sagte ich. »Aber ich werde für dich da sein.«
Als sie gegangen war, sah ich mir den Inhalt des Kartons noch einmal genauer an. Ganz unten auf dem Boden befand sich eine kleinere Version der Holzkiste, die die Vase enthalten hatte. Auch diese enthielt ein Kärtchen, das den darin liegenden Gegenstand als präkolumbisches Replikat auswies. Er war rund, hatte einen Durchmesser von etwa fünf bis sechs Zentimetern und war aus einem Material, das wie Gold aussah, und irgendeinem türkisfarbenen Stein. In der Mitte war die winzige Figur eines Mannes zu sehen, der einen aufwendigen Kopfschmuck trug und eine Art Zepter in der Hand hielt, außerdem einen Gegenstand, der offenbar einen Schild darstellte. Das Zepter konnte man sogar von seiner kleinen goldenen Hand entfernen, und um seinen Hals lag eine Kette aus Perlen, die alle individuell gefertigt waren. Der Rand der runden Scheibe wurde von winzig kleinen Goldkugeln gesäumt. Auf der Rückseite befand sich ein ziemlich dicker Stift. Diesmal glaubte ich zu wissen, um was es sich handelte: ein einzelnes Stück von einem Paar Ohrringe – Ohrpflöcke werden sie zuweilen genannt –, wie sie von den präkolumbischen Völkern Mexikos, Mittelamerikas und vermutlich auch Südamerikas getragen wurden. Die handwerkliche Verarbeitung, selbst für ein Replikat, war wirklich recht außergewöhnlich. Ich nahm mir fest vor, demnächst ein paar Nachforschungen darüber anzustellen, wickelte das Objekt wieder in ein Tuch ein und legte es behutsam in die Schreibtischschublade.
Die Vase würde sich verkaufen lassen, beschloss ich. Ich überlegte, einen Preis von hundertfünfzig Dollar dafür anzusetzen – die Zeichnung war exquisit, und manch einer würde das Gefäß sicher als ungewöhnliches Dekorationsobjekt schätzen. Ich fand einen guten Platz auf einem Beistelltisch, wo es von allen Seiten gesehen werden konnte und die beste Wirkung erzielte, und lehnte die Karte, mit meiner handschriftlichen Übersetzung versehen, dagegen. Die Erdnuss wollte ich behalten, ich würde sie säubern und auf eine meiner dünnen Silberketten aufziehen, um sie als Erinnerung an mein impulsives Verhalten um den Hals zu tragen. Ich überlegte, dass ich sie vielleicht tragen sollte, wenn ich das nächste Mal eine Auktion besuche. Positiver betrachtet würde sie ein interessantes Schmuckstück abgeben, das wenigstens Anlass zu Gesprächen böte.
Und das Schnupftabakfläschchen? Darüber musste ich mir noch Gedanken machen.
Als ich den Karton zur Seite stellte, streifte mein Blick ein Blatt Papier, das zwischen dem Verpackungsmaterial und einer Kartonseite steckte. Ich zog es vorsichtig heraus und stellte fest, dass es sich um einen Brief handelte, der von einem gewissen Edmund Edwards, dem Besitzer eines Geschäfts, das Ancient Ways hieß und sich in New York befand, an eine Galerie in Toronto geschrieben worden war, von der ich noch nie gehört hatte – auch wenn das nichts zu bedeuten hatte. Toronto ist eine große Stadt. Die Galerie hieß Smythson Gallery, und der Besitzer war dem Brief zufolge jemand mit Namen A. J. Smythson. Das Schreiben war insgesamt sehr förmlich, wie es bei einer Galerie nicht anders zu erwarten war, die Niederlassungen in London, Tokio, Bonn und Paris hatte, wie der Briefkopf einen diskret wissen ließ. Mr Edwards begrüßte Mr Smythson und schrieb, dass er hoffe, die Waren seien wohlbehalten angekommen und er dürfe auch in Zukunft seine Dienste anbieten, da noch viele weitere Objekte verfügbar seien. Das Datum des Briefes lag gut zwei Jahre zurück. Aus einer Laune heraus suchte ich die Smythson Gallery im Telefonbuch, aber dort war sie nicht aufgeführt, ebenso wenig wie ein A. J. Smythson, auch wenn mir der Name und seine ungewöhnliche Schreibweise irgendwie bekannt vorkamen. Vielleicht war die Galerie inzwischen geschlossen worden, was erklären würde, warum die Sendung nie beim Zoll abgeholt worden war. In jedem Fall, so entschied ich, war es wirklich nicht mein Problem, weshalb ich den Brief in den Papierkorb warf.
In den nächsten Tagen kehrten wir im Großen und Ganzen zur Normalität zurück, abgesehen von zwei Ereignissen. Zum einen ging die Alarmanlage dazu über, mitten in der Nacht ohne erkennbaren Grund anzuspringen. In zwei Nächten, und in einer davon zweimal, musste ich mir eine Jeans und ein Sweatshirt überziehen und in den Laden fahren, um mit der Polizei zu sprechen. In keinem dieser Fälle gab es einen Hinweis auf irgendetwas Ungewöhnliches. In der anderen Nacht ging der Alarm nur einmal los, aber diesmal sagte mir der Polizist, man würde mir eine Rechnung für seine Dienste schicken, da es mit diesen Fehlalarmen nun wirklich zu viel wurde. Ich ließ die Sicherheitsfirma kommen, um die Anlage zu überprüfen, doch sie sagten, sie wäre in Ordnung.
Die andere Sache, die diese Woche von einer normalen unterschied, war, dass ich jede freie Minute damit verbrachte, mir abscheuliche Dinge auszumalen, die ich Clive antun könnte. Sie reichten von der Idee, mir einen Hammer zu schnappen und seine geliebte kleine Jadeflasche vor seinen Augen zu zertrümmern, über die Möglichkeit, ein oder zwei große Steine in seine elegante Schaufensterauslage zu werfen, bis dahin, seinen Armani-Anzug mit Farbe zu besprühen. Natürlich setzte ich keine dieser Ideen in die Tat um. Nun gut, eine schon: Ich rief die Polizei an und ließ seinen nagelneuen BMW abschleppen, den er beharrlich im Halteverbot abstellte. Besonders befriedigend war es, ihn bei seinem vergeblichen Versuch, sein Auto noch einzuholen, die Straße entlangrennen zu sehen. Wie tief man sinken kann, wenn es um einen Exmann geht, ist wirklich erstaunlich.
Das Problem an diesem kleinen Sieg war natürlich, dass er den Konflikt eskalieren ließ, wenngleich ich meine Tat damals für einen Meisterstreich hielt. Clive hatte mir die Glaskelche weggeschnappt und ich ihm seine Schnupftabakflasche. Bis zu diesem Punkt war der Kampf mehr oder weniger unentschieden. Aber ich konnte es einfach nicht darauf beruhen lassen, ich war immer noch sehr wütend. Im tiefsten Herzen wusste ich selbstverständlich, dass es in unserer Beziehung offenbar noch etwas zu klären gab, obwohl mehrere Jahre und eine neue Liebe vorübergezogen waren. Man braucht keinen Psychiater, um das herauszufinden. Dennoch machte ich weiter, so kleinlich es auch sein mochte. Und obwohl ich nur zu gut wusste, wie unreif Clive war, war mir dennoch klar, dass er sich denken konnte, wer das Abschleppen seines Wagens veranlasst hatte, und einen Weg finden würde, Vergeltung zu üben.
Ich brauchte nicht lange zu warten.
Wenige Tage nach dem Vorfall mit dem Auto kam Clive in den Laden marschiert. »Ich komme nur, um meinen Nachbarn Hallo zu sagen«, begann er. »Es sieht schön aus hier, Lara. Und das muss deine neue Geschäftspartnerin sein, Sarah, nicht wahr?«, sagte er in seinem charmantesten Tonfall.