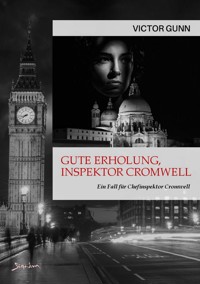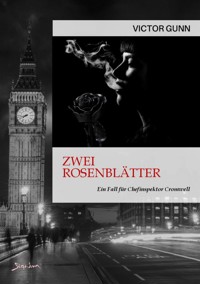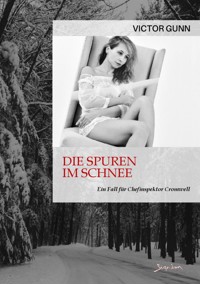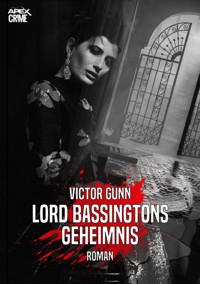6,99 €
Mehr erfahren.
Die Bewohner des englischen Städtchens Westonbury werden von einem skrupellosen Erpresser terrorisiert. Oberst Graham will dem »Lauscher an der Wand« das Handwerk legen. Doch man kommt ihm zuvor: Chefinspektor Cromwell von Scotland Yard kann nur noch feststellen, dass Graham mit Totenglocken - den Blüten des Roten Fingerhuts - vergiftet wurde...
Der Roman Die Totenglocken von Victor Gunn (eigentlich Edwy Searles Brooks; * 11. November 1889 in London; † 2. Dezember 1965) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1958 (unter dem Titel Roter Fingerhut).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Victor Gunn
Die Totenglocken
Roman
Apex Crime, Band 119
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE TOTENGLOCKEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Die Bewohner des englischen Städtchens Westonbury werden von einem skrupellosen Erpresser terrorisiert. Oberst Graham will dem »Lauscher an der Wand« das Handwerk legen. Doch man kommt ihm zuvor: Chefinspektor Cromwell von Scotland Yard kann nur noch feststellen, dass Graham mit Totenglocken - den Blüten des Roten Fingerhuts - vergiftet wurde...
Der Roman Die Totenglocken von Victor Gunn (eigentlich Edwy Searles Brooks; * 11. November 1889 in London; † 2. Dezember 1965) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1958 (unter dem Titel Roter Fingerhut).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DIE TOTENGLOCKEN
Erstes Kapitel
Der Polizei-Inspektor von Westonbury, Oberst a. D. Roderick Graham, trug ein düsteres Geheimnis mit sich herum. Das war besonders gefährlich für ihn, weil seine Gesundheit nach einem halben Menschenalter, das der Oberst in Indien verbracht hatte, sehr angegriffen war.
Der Oberst saß allein im Esszimmer seines Hauses Chakrata Lodge, das auf einem Hügel lag, von dem man auf Westonbury hinabsehen konnte, und aß hastig sein Abendbrot. Er aß so unaufmerksam, dass er kaum wusste, was er verzehrte. Die Uhr auf dem Kamin verkündete die Zeit: dreiviertel neun. Er beendete sein einsames Mahl und trug den benutzten Teller in die Küche, wo er ihn auf ein Gestell unter dem Abwaschtisch stellte. Er tat das automatisch, denn er war ein ziemlich pedantischer Mensch und konnte den Anblick herumliegender schmutziger Sachen nicht vertragen.
Als er wieder ins Esszimmer zurückkehrte, schob er die Schüssel mit Kompott und Vanillesoße, die seine Frau für ihn bereitgestellt hatte, beiseite, weil er keinerlei Appetit mehr hatte. Er trug sie dann zusammen mit dem noch unbenutzten Teller auf das Büfett. Das Tischtuch, das nur ein Ende des Tisches bedeckte, wurde nur gefaltet und in die Schublade der Anrichte gelegt. Jetzt holte der Oberst ein großes silbernes Tablett und stellte es mitten auf den Tisch. Auf dem Tablett waren zwei gutgefüllte Karaffen mit Whisky, zwei Flaschen Sodawasser, ein Wasserkrug und ein Dutzend Gläser, denn er erwartete gegen neun Uhr Besuch.
Ein Blick zum Kamin zeigte ihm, dass das Feuer am Verlöschen war. Er brachte es mit dem Feuerhaken wieder zum Aufflammen und legte ein paar Schaufeln Kohle auf die Glut. Der Frühlingsabend war kühl, und er wollte es seinen Gästen gern gemütlich machen.
Die Stühle standen schon um den Tisch herum - ein Stuhl an jedem Ende und drei weitere an jeder Seite des Tisches.
Das Gesicht des Polizeidirektors war ernst, als er sich an den Kamin stellte und seine Pfeife stopfte. Er war ein hochgewachsener Mann von sechzig Jahren mit einem schneeweißen Schnurrbart und dünnem, eisengrauem Haar. Seine für gewöhnlich gesunde Gesichtsfarbe zeigte jetzt eine unnatürliche Röte. Leute, die ihn vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen hatten, wären von der Veränderung seines Aussehens betroffen gewesen. Noch vor einem Jahr war er ein zufriedener, vergnügter Mensch gewesen; jetzt sah er verhärmt und erschöpft aus, und tiefe Falten zerfurchten sein Gesicht.
Die Standuhr in der Halle schlug feierlich neun; mit hellem Klingeln begleitete sie die Uhr auf dem Kaminsims. Gleichzeitig hörte Graham, wie ein Auto auf dem Kies der Auffahrt bremste. Er riss sich zusammen, als ob er sich für eine unangenehme Aufgabe wappnen wollte, und ging zur Haustür, als es läutete.
Der Mann, der seinen chromglänzenden, schweren Wagen auf der anderen Seite der Auffahrt geparkt hatte, zog seine buschigen Augenbrauen hoch, während er die Stufen zum Portal heraufstieg.
»Hallo, Graham! Was soll denn das heißen?«, fragte er verwundert. »Sie öffnen selbst die Tür? Damit verwöhnen Sie doch nur die Dienstboten, und sie sind, weiß Gott, heutzutage sowieso schon lässig genug...«
»Millie hat heute ihren freien Abend«, unterbrach ihn der Polizeidirektor ungeduldig. »Kommen Sie nur herein, Lacey. Ich bin ganz allein, denn meine Frau und meine Tochter sind zum Essen zu Freunden nach Seven Oaks gefahren.«
Sir Christopher Lacey, Herr auf Schloss Westonbury, war über den Hinweis seines Gastgebers auf Millie einigermaßen verwundert. War es möglich, dass die Grahams nur einen einzigen Dienstboten hatten? Er kam zu dem Schluss, dass sie noch weitere haben müssten, mindestens eine Reinmachefrau für das Haus und einen Mann für den Garten; aber diese Leute kamen wohl nur tagsüber und wohnten nicht im Haus.
»Ein scheußlicher Anblick!«, rief Sir Christopher angeekelt.
Ehe der überraschte Graham ihn fragen konnte, was er mit seiner Bemerkung meinte, wies Sir Lacey mit der Hand in das Tal hinab, wo die blitzenden Lichter der Stadt sich aus der samtigen Dunkelheit abhoben. Ein Gebäude strahlte besonders hell vom anderen Ende der Stadt herüber.
»Sparrows scheußliche Fabrik!«, sagte der Baron angewidert. »Bei Tag ist sie eine Verschandelung der Landschaft, und bei Nacht ist sie noch schlimmer, weil man sie dann gar nicht mehr übersehen kann. Warum, zum Teufel, muss der Mann alle diese protzigen Lampen anzünden? Warum kann er nicht wie andere seinen Betrieb zu einer vernünftigen Zeit schließen?«
Sir Christophers Vater und Großvater hatten - wie schon seine Vorfahren während der letzten paar hundert Jahre - im Ort die stolze Stellung des Grundherrn gehabt. Jetzt war er nicht mehr der erste Mann der Grafschaft; aber wenn auch die Zeiten sich geändert hatten, Sir Christopher hatte sich nicht mit ihnen gewandelt. Man hörte ihm an, dass er in Eton und Oxford erzogen worden war, und in seinem ganzen Benehmen waren sein Stolz und sein aristokratisches Selbstbewusstsein zu spüren. Er war noch einer der wenigen Aristokraten der alten Schule, die auf jede Art von Beruf und technischem Können mit Verachtung herabsahen.
Er liebte Westonbury, und es schmerzte ihn tief, dass noch zu seinen Lebzeiten - er war fünfundfünfzig - die Stadt ihren einst berühmten malerischen Charme verloren hatte. Neue Verwaltungsgebäude, neue Schulen, neue Wohnblocks und - was das Schlimmste war - neue Fabriken waren wie Giftpilze in der Stadt selbst und besonders am Stadtrand aufgeschossen.
»Man kann den Fortschritt nicht aufhalten, Lacey«, meinte der Oberst, als er auf die Verschandelung blickte. »Sparrow muss sehr gute Geschäfte machen, sonst würde er nicht eine Nachtschicht einlegen. Mir persönlich sind die vielen Lichter übrigens sympathisch, und ich würde Sparrows Fabrik auch nicht als Verschandelung bezeichnen. Sie ist schließlich ganz modern, gut angelegt und macht der Stadt nur Ehre.«
»Ach, was!«, murmelte Sir Christopher.
Er folgte dem Oberst ins Haus, als ein zweiter Wagen sich näherte. Graham führte seinen Gast ins Esszimmer.
»Was, zum Teufel, soll das bedeuten, Graham?«, fragte Sir Christopher, als er die Whiskykaraffen und die vielen Gläser auf dem Tisch sah. »Als Sie mich anläuteten, sagten Sie etwas von einer dringenden Konferenz. Wie viele Menschen erwarten Sie denn, um Gottes willen? Dabei haben Sie womöglich noch gar nicht zu Abend gegessen.«
Der Gedanke schien ihm geradezu Entsetzen einzuflößen. Aber Graham konnte ihm versichern, dass er sein Essen, das ihm seine Frau auf einer Wärmplatte zurechtgestellt hatte, bereits verzehrt habe.
»Mein Gott! Aufgewärmtes Essen!«, murmelte Sir Christopher noch viel entsetzter als zuvor.
Der Neuankömmling, den Graham einließ, war der Arzt Dr. Howard Small, ein untersetzter, vergnügter Mann in den Fünfzigern. Er war bei seinen Patienten äußerst beliebt, obwohl er im Ruf stand, es als Mediziner manchmal an der erforderlichen Gewissenhaftigkeit mangeln zu lassen. Er war, schon seit er die Praxis von seinem Vater übernommen hatte, der Hausarzt der Grahams. Er war schon bei Jacqueline Grahams Geburt zugegen gewesen und wurde mehr als Freund der Familie denn als Arzt betrachtet. Er hatte die Modernisierung von Westonbury durchaus begrüßt, denn obwohl mit der Vergrößerung der Stadt eine ganze Anzahl junger Ärzte sich hier niedergelassen hatte, war seine eigene Praxis ebenfalls gewachsen. Anders als Sir Christopher, beobachtete er daher mit Befriedigung, wie sich Westonbury aus einer verschlafenen Kleinstadt zu immer größerer Bedeutung entwickelte. Ihm gefielen die vielen Neubauten und die Fabriken, die überall am Rande der Stadt errichtet worden waren.
»Was gibt es denn hier Geheimnisvolles, Roddy?«, fragte er vergnügt, als er dem Oberst die Hand schüttelte und ihm prüfend ins Gesicht sah. »Hm... Ihr Aussehen gefällt mir gar nicht - viel zu rot im Gesicht. Haben Sie etwa meine Warnung in den Wind geschlagen und Portwein getrunken?«
»Ich habe schon ein ganzes Jahr lang keinen Portwein mehr angerührt«, erwiderte Graham gutmütig. »Aber warum, zum Teufel, müssen Sie immer den Arzt hervorkehren? Sehen Sie mich doch nicht an, als ob Sie mich im nächsten Augenblick auffordern wollten, Ihnen die Zunge herauszustrecken. Ich bin vollkommen in Ordnung!«
»Nein, viel zu rot im Gesicht«, wiederholte Small kopfschüttelnd. »Aber vielleicht sind Sie jetzt erregt. Um was handelt es sich denn bei dieser Konferenz? - Guten Abend, Lacey.« Er schüttelte Sir Christopher die Hand. »Ich wusste gar nicht, dass Sie auch hier sind.«
Sein Ton hatte jede Herzlichkeit verloren. Er hatte nichts für Lacey übrig und gab sich keinerlei Mühe, seine Abneigung zu verbergen. So schwiegen denn die beiden Männer, als der Polizeidirektor das Zimmer verließ, um die Tür aufs Neue zu öffnen.
Die Auffahrt sah jetzt wie ein Parkplatz aus, denn gleichzeitig waren drei Besucher angekommen. Geläutet hatte allerdings nur Oberinspektor John Parry von der Polizei in Westonbury, ein hochgewachsener, gutaussehender Mann von fünfundvierzig Jahren, mit militärisch straffer Haltung. Die anderen, die ihre Wagen jetzt am Rand der Auffahrt parkten, waren Pastor Horace Nettlefold, der Schriftsteller Reginald Paige und der große, vierschrötige Fabrikant William Sparrow.
»Ich habe eigentlich gar keine Zeit für so etwas übrig, Oberst - stecke bis über den Hals in Arbeit -, aber da Sie ja Polizeidirektor sind, dachte ich, dass es doch geraten ist, nicht unfolgsam zu sein, wie?«, scherzte der Fabrikant. Seine dröhnende Stimme entsprach ganz seiner mächtigen Erscheinung. »Worum handelt es sich denn?
»Da ist ja auch unser Seelenhirt, wie? Sie werden uns doch nicht etwa hergerufen haben, um an unsere Mildtätigkeit für den Kirchenfonds zu appellieren, wie?«
»Wohl kaum«, meinte Pastor Nettlefold ärgerlich. »Ich habe jedenfalls keine Ahnung, warum der Oberst uns hierhergebeten hat. Aber wir werden es wohl bald hören.«
Sparrow konnte nicht antworten, da Graham ihm jetzt Paige vorstellte, den er noch nicht kennengelernt hatte - und auch gar nicht kennenzulernen wünschte, denn der Schriftsteller war ihm auf den ersten Blick höchst unsympathisch.
Sir Christopher Lacey äußerte einen nur halb unterdrückten Protest, als Graham die Neuankömmlinge ins Esszimmer führte und der Baron dabei Sparrow, den Fabrikbesitzer, erkannte. Er hatte nicht erwartet, sich mit ihm an einen Tisch setzen zu müssen - und mit Parry, der in Uniform erschienen war. Er, Sir Christopher Lacey, an einem Tisch mit einem Polizisten in Uniform!
»Was soll das Graham?«, fragte er scharf. »Ich weiß, Sie sind Polizeidirektor, aber sollten Sie Ihre Berufsgeschäfte nicht lieber in Ihrem Amt erledigen? - Guten Abend, Parry. Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu sehen.«
Der Oberinspektor musste lachen.
»Ich tappe genauso im Dunkeln wie Sie, Sir«, erwiderte er. »Aber der Oberst wird uns schon alles klarmachen. Ich zweifele nicht daran, dass er gute Gründe hatte, uns zu dieser Konferenz zusammenzurufen.«
»Ich erwarte noch einen Gast, meine Herren. Wenn er jedoch nicht bald kommt, möchte ich ohne ihn beginnen«, sagte Graham unruhig. »Ich würde das allerdings bedauern, denn ich hatte den Wunsch, eine repräsentative Auswahl der prominentesten Bürger von Westonbury hierzuhaben. - Ach, das muss wohl Braun sein!«
Er ging zur Tür und kehrte mit einem weißhaarigen älteren Herrn zurück, der eine dicke, randlose Brille trug. Professor Rudolf Braun war ein deutscher Wissenschaftler, von dem die ganze Stadt wusste, dass er sich mit elektronischen Experimenten befasste.
»Was ist denn?«, fragte der Neuankömmling und blickte die Versammelten mit seinen kurzsichtigen Augen an. »Sie sagten mir ja gar nicht, dass Sie so viele Leute geladen haben, Oberst.«
»Meine Gründe werden Sie noch erfahren, Professor«, antwortete der Oberst. »Setzen Sie sich bitte hierher!« Er wies auf einen leeren Stuhl. »Ich werde Ihnen sofort alles erklären. Inzwischen bedienen Sie sich bitte mit dem Whisky.«
Die Gäste gehorchten gern; in den nächsten Augenblicken war außer dem Klirren von Gläsern, dem Knistern des Feuers und dem missbilligenden Brummen von Sir Christopher nichts zu hören. Der Gesichtsausdruck des Barons zeigte, dass er es bedauerte, gekommen zu sein. Wenn diese Leute hier eine repräsentative Versammlung prominenter Bürger vorstellen sollten, so sagten seine Blicke, dann war Westonbury nicht mehr zu helfen!
Der Oberst hatte seine Gäste so platziert, dass er selbst am Kopf des Tisches, Oberinspektor Parry ihm gegenüber am Ende und von den anderen sechs Gästen je drei an einer Seite saßen. Es herrschte eine unbehagliche Stimmung, denn es lag eine gewisse Spannung in der Luft, eine Vorahnung, dass Graham eine peinliche Enthüllung zu machen habe.
»Nun, meine Herren, ich will nicht wie die Katze um den heißen Brei herumgehen«, begann der Oberst plötzlich, nachdem er einen Schluck Whisky getrunken hatte. »Als Polizeidirektor von Westonbury hielt ich es für meine Pflicht, Sie - sieben prominente Bürger der Stadt - zusammenzurufen, um mit Ihnen einen Übelstand zu besprechen, der sich während der letzten acht oder neun Monate wie eine schleichende Krankheit in unserer Stadt verbreitet hat. Ich habe absichtlich meine Frau und meine Tochter für den Abend zu Freunden geschickt, damit wir das Haus ganz für uns allein haben. Unsere Köchin, der einzige Dienstbote, der im Hause schläft, hat heute ihren freien Abend.«
Keiner der Anwesenden beachtete seine letzten Sätze, denn alle waren viel zu sehr mit den Worten beschäftigt, mit denen er seine Ausführungen begonnen hatte. Dabei sah niemand überrascht oder verwundert drein, nur die Spannung hatte sich verstärkt. Das zeigte sich darin, dass sieben Augenpaare wie gebannt auf den Sprecher blickten. Oberinspektor Parry räusperte sich.
»Ich ahnte schon, dass Sie uns zusammengerufen haben, um über dieses Thema zu sprechen, Sir. Aber ich bin nicht sicher, ob Ihre Handlungsweise auch wirklich der Sache dient«, meinte er ernst. »Darum möchte ich Sie dringend bitten, es sich nochmals sorgfältig zu überlegen, bevor...«
»Schon gut, Parry. Ich weiß genau, was ich tue«, unterbrach ihn der Polizeidirektor. »Ich glaube nämlich, dass der Zeitpunkt zu einem sofortigen und drastischen Eingreifen gekommen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir dem bösen Fluch, der allzu lange einen Schatten auf unser Leben warf, ein Ende machen. Einige in diesem Zimmer - vielleicht alle - haben unter ihm zu leiden gehabt.«
»Verdammter Unsinn!«, schnaufte Sir Christopher.
»Verzeihung, ich verstehe Sie nicht ganz.« Professor Braun sah Graham verwundert an. »Sie sprachen von leiden...«
»Sie verstehen mich ausgezeichnet, Braun«, fiel ihm der Polizeidirektor ins Wort. »Um Gottes willen, benehmen wir uns doch nicht so scheinheilig! Ich meine diesen üblen Schurken, der seit nahezu einem Jahr von uns Geld erpresst. Gott allein weiß, wieviel Geld dieser Vampir uns schon abgezapft hat, zusammen müssen diese Summen sicherlich ein kleines Vermögen ergeben. Wir, die hier zusammen sind, stellen nur einen Bruchteil der Opfer dar. Dutzende prominenter Bürger von Westonbury mussten zahlen - schwer zahlen -, um das Schweigen dieses unbekannten Verbrechers zu erkaufen. Meine Herren, ich spreche von anonymen Briefen, die aus Westonbury, einst der Wohnsitz fleißiger, glücklicher Menschen, eine Stätte des Schreckens gemacht haben, in der ein Nachbar den andern verstohlen mit Furcht und Argwohn beobachtet. Allzulange sind wir über all das schweigend hinweggegangen. Niemand hat es gewagt, selbst mit seinen engsten Freunden über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube aber, dass nun die Zeit gekommen ist, um frei und offen diese Dinge zu besprechen, und darum habe ich Sie, meine Herren, in meiner Eigenschaft als Polizeidirektor hier zusammengerufen.«
Auf seine Worte folgte ein langes Schweigen. Keiner der Anwesenden war gewillt, sich zu äußern; jeder wartete darauf, dass der andere das Wort ergriff. Das Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit stieg wie die Quecksilbersäule in einem Thermometer an.
Sicher hatten verschiedene der Anwesenden wirklich anonyme Erpresserbriefe erhalten - und es war ebenso sicher, dass sie schwer an den Verbrecher gezahlt hatten, der die Erpressungskampagne führte. Trotzdem trafen die Worte des Obersten jeden der anwesenden Herren wie ein Schlag. Die kühne, offene Erwähnung des heiklen Themas hatte sie völlig überrascht. Graham wartete gespannt auf ihre Reaktion; sein Gesicht war ungesund gerötet, seine Augen leuchteten unnatürlich hell.
»Sie haben mir nichts zu sagen, meine Herren?« Unvermutet, fast ärgerlich, brach er das Schweigen. »Wie steht es mit Ihnen, Parry? Sie sind doch der Beamte, dem der Fall der anonymen Briefe übertragen wurde! Was konnten Sie herausfinden?«
Parry sah peinlich berührt aus. »Hier ist wohl kaum der Ort, und es ist wohl kaum der Augenblick...«
»Ich behaupte aber, es ist der rechte Ort - und ganz bestimmt der rechte Augenblick!«, herrschte ihn der Direktor an. »Ich wiederhole nochmals, Oberinspektor: Was haben Sie herausgefunden?«
»Nichts«, gab Parry zu und zuckte hilflos die Achseln. »Es ist mir ein Rätsel... Wie kann die Polizei handeln, Sir, wenn kein einziges Opfer zu uns kommt und uns informiert?« Sein Blick wanderte von einer Seite des Tisches zur anderen. »Sehen Sie, meine Herren, hier handelt es sich gar nicht um anonyme Briefe üblicher Art. Es sind vielmehr Briefe einer Art, mit der sich die Polizei bisher nicht zu beschäftigen hatte. Vielleicht haben einige von Ihnen solche Briefe erhalten. Ich weiß es nicht; sollte es der Fall sein, so haben Sie mir nichts davon gesagt. Ich kann verstehen, dass der Oberst uns hier zusammenruft...« Er brach ab und schluckte; er hatte wohl den Faden verloren. »Gewöhnlich enthalten anonyme Briefe schmutzige Beschimpfungen und obszöne Anklagen. Sie bezwecken im Allgemeinen nur, den Ruf des Opfers zu beflecken oder gar zu ruinieren. In den meisten Fällen ist der Schreiber eine neurotische, unbefriedigte Frau - ein scheinbar harmloser und unbescholtener Bürger, den niemand einer solchen Schmutzerei für fähig halten würde. Aber die Geißel von Westonbury hat einen gänzlich anderen, einen viel teuflischeren Charakter. Wir haben, weiß Gott, nur wenig Material, aber einiges wissen wir doch. Wir wissen nämlich, dass diese Briefe keine Beschimpfungen, keine Obszönitäten, keine Verleumdungen enthalten...«
»Dafür enthält jeder Brief eine Forderung nach Geld - nach viel Geld!«, fiel ihm der Polizeidirektor ins Wort. »Jeder dieser Briefe zeigt, -dass der Schreiber genaueste Kenntnis eines Vergehens oder einer Unklugheit erlangen konnte, die der Empfänger des Briefes begangen hat. Für die Geheimhaltung hat das Opfer nun zu zahlen. Es muss zahlen - sonst wird alles enthüllt. Wir haben bis jetzt keinen Beweis, dass auch nur ein einziger der Empfänger die Zahlung verweigert hat. Denn das Entscheidende bei diesen gemeinen Forderungen ist ja, dass die Tatsachen, die der Erpresserbrief enthält, stimmen. Wer von uns hat noch nie eine Torheit oder eine Unklugheit begangen, die uns gesellschaftlich ruinieren würde, falls sie allgemein bekanntwerden sollte? Wir Bürger von Westonbury sind stolz - wir möchten, dass unsere Mitbürger gut von uns denken. Muss ich Sie daran erinnern, dass in den letzten drei Monaten zwei Mitbürger, die allgemein als ehrliche und anständige Menschen galten, Selbstmord begangen haben? Es waren normale, wohlhabende, zufriedene Männer, von denen niemand vermutet hatte, dass sie Grund zu einer solchen Tat haben könnten. Dennoch müssen sie ein Motiv gehabt haben, sich das Leben zu nehmen - und wir wissen, was sie zu ihrer Tat trieb. Ein anderer - ich will seinen Namen nicht nennen - flüchtete, finanziell und gesundheitlich ruiniert, auf den Kontinent.«
»Aber was hat das alles eigentlich mit uns zu tun?«, fragte William Sparrow.
Seine Stimme schallte drohend durch den Raum, als er jetzt aufstand. Nun wirkte er sogar noch mächtiger als er war, denn sein vierschrötiger Körper mit den gewaltigen Schultern war vor Zorn gespannt. Fast furchtsam blickten die anderen Anwesenden zu ihm hinüber. Sein blondes Haar war zerzaust, weil er sich mit seinen dicken Fingern hindurchgefahren war, und seine breite Nase, an der eine tiefe Narbe entlanglief, zuckte.
»Wenn Sie sich noch etwas gedulden wollten, Sparrow...«, begann der Oberst.
»Der Teufel soll alle Geduld holen!«, brüllte der Fabrikant. »Sie haben mich unter falschen Vorspiegelungen hierhergelockt! Ich weiß von diesen verdammten anonymen Briefen gar nichts! Ich habe auch keinem Erpresser Geld gezahlt! Meine Vergangenheit liegt offen vor aller Augen!«
Er setzte sich. Ein betretenes Schweigen folgte. Gerade die Heftigkeit seiner Worte und sein aufflammender Zorn hatten den Fabrikanten verraten. Sein Leugnen war viel zu entrüstet gewesen, um überzeugend zu wirken. Einer der Anwesenden betrachtete ihn mit äußerster Abneigung. Es war Sir Christopher Lacey, der seinem Gastgeber zürnte, weil er ihn gezwungen hatte, mit diesem lauten, pöbelhaften Emporkömmling an einem Tisch zu sitzen.
»Ich bedauere, dass Sie die Ruhe verloren haben, Mr. Sparrow«, sagte der Polizeidirektor, beugte sich vor und verschränkte seine schweißnassen Hände. »Wenn Sie zu Ende sind, werde ich mit meiner Darstellung fortfahren.«
»Einen Augenblick...!« Die dünne, heisere Stimme, die diese Worte sprach, war die von Reginald Paige. Seine Worte klangen quäkend und doch irgendwie geziert. »Ich weiß nicht recht, Graham, ob ich Mr.... äh... Sparrow - nicht zustimmen sollte. Auch ich möchte gegen Ihre voreilige Annahme protestieren, dass wir alle hier Opfer von Erpressungen geworden sind.«
»Ich habe nicht behauptet, dass alle es geworden sind, Mr. Paige. Ich sagte einige!«
»Aber Ihren Worten war zu entnehmen, dass Sie alle meinten. Dagegen muss ich Protest einlegen!« Der Schriftsteller erhob sich. Seine schlaksige Gestalt war, wie immer, nach vorn gebeugt. Er nahm seine Hornbrille ab und fuhr sich mit der Hand durch sein langes, dunkles Haar, Das höhnische Grinsen, das in lebenslanger Gewohnheit auf seinem Gesicht lag, verstärkte noch die Ironie seines Tones. »Ich glaube, es ist wohl am besten, wenn ich mich entferne, solange ich noch imstande bin, meinen Ärger zu zügeln.«
»Jawohl! Und das gilt für mich auch!«, brüllte Sparrow.
Oberst Graham sah leidend aus. Er machte sogar den Eindruck, als ob er große Schmerzen auszustehen habe. Dr. Small betrachtete ihn mit Unruhe, denn Grahams Gesicht trug nicht den Ausdruck seelischen Leidens; es spiegelte vielmehr unerträgliche physische Schmerzen wider - Schmerzen, die nur Krankheitssymptome sein konnten. Der Arzt beobachtete, wie er sich gewaltsam zusammenriss und krampfhaft die Fäuste ballte; aber bald schien der Schmerz nachzulassen und die Verkrampfung vorüberzugehen.
»Ich bedaure, meine Herren, dass Sie sich in so eindeutiger Weise verraten haben«, sagte Graham kühl, und sein verächtlicher Blick glitt von Sparrow zu Paige. »Denn nun steht es ja zweifelsfrei fest, dass Sie anonyme Briefe erhalten haben. Ebenso ist uns allen wohl klar, dass Sie zahlten - schwer zahlten. Wozu leugnen Sie also? Sie müssen doch von diesen verbrecherischen Briefen genauso betroffen sein wie alle übrigen - und vor dem gleichen Rätsel stehen. Denn die höllische Schlauheit dieses Schuftes zeigt sich doch in der Tatsache, dass er in ganz unerklärlicher Weise in der Lage war, sich richtige Informationen zu beschaffen. Wäre es nicht angezeigt, meine Herren, dass wir einmal offen miteinander sprächen?«
Er ließ seine Augen um den Tisch wandern, blickte jeden der Anwesenden kurz an. Small bemerkte mit Erleichterung, dass der Ausdruck des Schmerzes aus seinem Gesicht verschwunden war, obgleich es noch immer unnatürlich gerötet aussah.
»Wir alle haben unsere Geheimnisse«, fuhr der Oberst tiefernst fort. »Selbst der Beste von uns hat vielleicht irgendwann einmal etwas getan, das unklug, hässlich oder vielleicht sogar strafbar war und das er ängstlich geheim hält.« Sein Blick blieb einen Augenblick auf dem Gesicht des verstörten Geistlichen haften. »Bei solchen Geheimnissen mag es sich um nebensächliche Kleinigkeiten, kann es sich aber auch um gefährliche Dinge handeln. Der Übeltäter, der diese Erpresserbriefe schreibt, weiß jedoch von ihnen. Er kennt unsere Geheimnisse. Aber wie konnte er zu solchen Kenntnissen gelangen?«
»Ich glaube«, meinte der Pfarrer sanft, »dass Sie auch jetzt wieder unbewiesene Behauptungen aussprechen.«
»Nein, Sir!«, fuhr der Polizeidirektor auf. »Das tue ich keineswegs. Ich stelle einfach Tatsachen fest! Ich will Ihnen ein Beispiel von dem geben, was ich meine: Ein Mann, wohlangesehen in Westonbury, glücklich verheiratet, ist töricht genug, mit einer Frau ein Wochenende in Brighton zu verbringen - zu einer Zeit, wo er sich angeblich geschäftlich in London aufhält. Bald nach seiner Rückkehr bekommt er eins dieser anonymen Schreiben. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist also sein Seitensprung dem Erpresser bekanntgeworden. Was soll er tun? Entweder wird seine Ehe zerstört, oder er hat eine große Summe zu zahlen. Er zahlt.«
»Die Diskussion solcher angenommener Fälle bringt uns doch nicht weiter, Graham«, warf Dr. Small ungeduldig ein. »Sie sind heute Abend gar nicht Sie selbst. Als Ihr Arzt möchte ich Ihnen vorschlagen...«
»Ich brauche Ihren medizinischen Rat nicht!«, herrschte ihn der Oberst an. »Ich werde das aussprechen, was zu sagen ich mir vorgenommen habe. Nehmen Sie einen andern Fall - nennen Sie ihn meinetwegen wieder hypothetisch. Ein Mann von bestem Ruf, Stadtrat in Westonbury, hat eine private Besprechung mit dem Inhaber einer Baufirma, der sich um ein großes Bauprojekt - sagen wir um die Bebauung eines größeren Terrains oder um einen Straßenbau - bewirbt. Die beiden kommen überein, dass der Stadtrat eine prozentuale Beteiligung erhält, falls der Baufirma der Auftrag erteilt wird. Obgleich ihre Unterredung unter vier Augen, hinter verschlossenen Türen stattfand, obgleich die beiden Herren die einzigen sind, die von diesem Abkommen wissen, erhalten sie bald darauf jeder einen anonymen Brief. Auch der Erpresser weiß von dem Abkommen - wie, bleibt ein Rätsel. Und so geht es weiter. Schon seit Monaten. Auch jetzt noch.«
Grahams Worte waren so feierlich und mit solchem Nachdruck gesprochen, dass ihn seine Zuhörer schweigend anhörten.
»Einige der Herren, die hier um diesen Tisch sitzen, haben die Forderungen des Erpressers erfüllt«, fuhr der Polizeidirektor fort. »Das soll nicht etwa heißen, dass sie sich eines Verbrechens oder eines Vergehens schuldig gemacht haben. Es gibt ja auch andere Geheimnisse, die wir gern für uns behalten...«
»Aber wirklich, Oberst, da muss auch ich Protest einlegen!«, fiel ihm Pastor Nettlefold ins Wort. »Warum haben Sie mich zu dieser Konferenz zugezogen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mir keine unerlaubte Handlung zuschulden kommen lassen.«
»Verdammt noch mal - ich auch nicht!«, schrie Sir Christopher Lacey. »Sie nehmen sich wirklich zu viel heraus, Graham! Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich gehe fort.«
»Noch nicht!« Wieder erhob sich der Polizeidirektor, in den Augen ein hartes Leuchten. »Ich habe noch etwas zu sagen - und werde mich von Ihnen nicht daran hindern lassen.« Sein Gesicht war jetzt fleckig und verzerrt; in kleinen Bächen rann ihm der Schweiß über die Wangen. Eine Hand hielt er auf den Magen gepresst, als ob er einen furchtbaren Schmerz unterdrücken wolle. Plötzlich musste er laut aufstoßen. »Mein Gott - ich bitte um Entschuldigung, meine Herren.« Er hielt sich die Hand vor den Mund und nahm sie erst wieder weg, als er sicher war, dass ein solcher Verstoß gegen die guten Sitten ihm nicht noch einmal unterlaufen könne. »Es wird Sie vielleicht interessieren, zu erfahren, dass ich Sie, meine Herren, ausgewählt habe, weil jeder einzelne von Ihnen ein prominenter Bürger von Westonbury ist. Sie sind alle wohlhabend, wenn auch vielleicht nicht geradezu reich, und es sind die wohlhabenden Bürger unserer Stadt, die zu leiden hatten. Wieviel haben Sie, meine Herren, also diesem Erpresser gezahlt? Und in welcher Form haben Sie die Zahlung geleistet? Dieser Schuft hat seine Opfer so eingeschüchtert, dass es uns bisher unmöglich war, einen Anhaltspunkt zu finden.« Er starrte über den Tisch hinweg auf Parry. »Das stimmt doch, Oberinspektor? Keine Ausflüchte - ich verlange von Ihnen eine klare Antwort.«
Der Polizeibeamte sah aus, als ob ihm höchst unbehaglich zumute wäre. »Gewiss, Sir«, gab er zögernd zu. »Wir wissen zwar von diesen Erpressungen, aber man vertuscht sie allgemein, und die Opfer sind nicht gewillt, uns Informationen zu geben. Das ist es ja gerade, was unsere Arbeit so erschwert. Trotzdem bedaure ich, dass Sie es für notwendig hielten, die Herren hier in so ungewöhnlicher Weise zusammenzurufen...«
»Dafür habe ich meine guten Gründe, Parry«, fiel ihm Oberst Graham ins Wort. Seine Stimme hob sich, als er jetzt aufstand. Aber er schwankte und musste sich am Tisch festhalten. »Ich habe sogar einen außerordentlich guten Grund, die Herren hierher in mein Haus zu rufen. Die Person des Erpressers ist mir nämlich jetzt bekannt, und ich beabsichtige, Ihnen noch heute den Namen dieses Verbrechers zu nennen.«
Sieben Augenpaare hefteten sich starr auf den Sprecher.
»Die fragliche Person«, fügte der Polizeidirektor mit Nachdruck hinzu, »sitzt gegenwärtig unter uns - hier an diesem Tisch!«
Zweites Kapitel
Wenn sich vor dem Haus eine Explosion ereignet hätte, die Wirkung hätte kaum verheerender sein können als die von Oberst Grahams Worten. Zunächst blieben die sieben Männer am Tisch wie erstarrt in gedrücktem Schweigen sitzen. Dann hörte man schweres Atmen, es entstanden eine Verwirrung und schließlich ein allgemeiner Aufruhr.
Der erste, der, nachdem er aufgesprungen war, seine Meinung zum Ausdruck brachte, war Dr. Howard Small. Furcht und Erregung hatten die Krähenfüße um seine Augen vertieft, und sein Gesicht war totenblass.
»Nehmen Sie sich in acht, Graham!«, rief er heiser. »Wenn Sie auch Polizeidirektor sind, so dürfen auch Sie doch so etwas nicht behaupten, ohne es zu beweisen. Sie sind krank. Um Gottes willen, überlegen Sie es sich gut, bevor Sie etwas aussprechen, was Sie später zu bereuen haben werden!«
Er verließ seinen Platz und ging zum Kopfende des Tisches, wo der Oberst in merkwürdig verkrampfter Haltung stehengeblieben war. Grahams Gesicht war wie von furchtbaren Schmerzen verzogen.
»Aber mir fehlt doch nichts, Howard!«, stieß er mit größter Anstrengung hervor. »Bitte lassen Sie mich in Ruhe! Ich weiß ganz genau, was ich sage...«
»Sie sind mehr als krank, Graham - Sie sind sogar verrückt!«, fiel ihm Sir Christopher Lacey ins Wort, der ebenso blass und erschüttert aussah wie der Arzt. »Wie können Sie es wagen, sich hier vor uns hinzustellen und zu behaupten, dass einer von uns der Erpresser ist? Ich muss Sie warnen - großer Gott, was ist denn das?«
Verwundert drehte er sich um. Der krachende Laut, der ihn unterbrochen hatte, war aber nur dadurch verursacht worden, dass Brauns Stuhl umfiel, als der Gelehrte erregt aufgesprungen war.
»Hören Sie auf!«, rief der für gewöhnlich so sanfte kleine Mann, der jetzt schwer atmete. »Das ist gefährlich! Sie sind doch leidend - das sieht man Ihnen ja an! Und Sie wissen nicht, was Sie sagen!«
»Ich weiß ganz genau, was ich sage!«, erwiderte der Polizeidirektor, der sich nur mit Mühe zwingen konnte, ruhig zu sprechen - obwohl allen um ihn herum klar sein musste, dass er große Schmerzen hatte. »Ich habe mir alles sehr wohl überlegt. Ich habe meine Worte genau erwogen, bevor ich Sie, meine Herren, zu dieser Konferenz gebeten habe.« Seine Stimme klang jetzt schwach, und man sah, dass das Sprechen ihn Anstrengung kostete. Auch seine Aussprache war unklar geworden, und zwischen den Worten musste er häufig schlucken. »Ich habe jede mögliche Vorsichtsmaßregel ergriffen. Wir sind ganz allein im Haus - meine Familie und das Dienstmädchen sind fort. Was also in diesem Zimmer gesagt wird, kann nur von unseren Ohren gehört werden.«
»Ja, gewiss doch, lieber Freund, das verstehen wir ja«, versuchte ihn der Arzt zu begütigen. Er warf den anderen Anwesenden gleichzeitig einen warnenden Blick zu. »Trotzdem sollten Sie sich jetzt erst einmal für einen Augenblick Ruhe gönnen.«
»Gehen Sie weg!«, stieß der Oberst hervor. Wieder musste er seine Hand auf den Magen pressen, und ein neuer Krampf verzerrte sein blasses Gesicht. »Der Mann, der diese Erpressungen...«
»Verzeihen Sie, Sir, aber es ist meine Pflicht als Polizeibeamter, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie sich der Tragweite Ihrer Worte bewusst sein müssen«, unterbrach ihn Oberinspektor Parry mit ernster Miene. »Ich muss Ihnen raten, es sich nochmals zu überlegen, ehe Sie hier vor uns einen Namen aussprechen! Mein Gott, muss ich Sie wirklich erst darauf aufmerksam machen, dass Sie eine Verleumdungsklage zu gewärtigen haben, wenn Sie das, was Sie behaupten, nicht einwandfrei beweisen können?«
Oberst Graham sah plötzlich wieder ruhig und gefasst aus. Offenbar hatte er jetzt keine Schmerzen mehr. Er richtete sich auf, und seine Schultern strafften sich, aber merkwürdigerweise machte er trotzdem einen nervösen und zögernden Eindruck.
»Gewiss, Parry«, meinte er unsicher. »Das ist mir klar. Sie haben auch recht, mich zu warnen.« Er ergriff mit zitternder Hand sein Glas und stürzte den Whisky hinunter. »Ah - jetzt ist es besser. Ich bedauere, meine Herren, Ihnen ein solch unwürdiges Schauspiel geboten zu haben. - Schon recht, Howard, es geht schon wieder. Ich verstehe gar nicht, was über mich kam.«
Aber plötzlich krümmte sich sein ganzer Körper zusammen, und aus seinem Mund drang ein furchtbares Stöhnen. Seine Hand griff nach der Tischkante, konnte aber keinen Halt finden, und er stürzte zu Boden. Dort blieb er verkrümmt liegen; er begann sich heftig zu erbrechen. Dr. Small stürzte zu ihm und kniete neben ihm nieder. Schon nach einem Moment des Zögerns stand der Arzt wieder auf.
»Es ist ein sehr schwerer Anfall«, sagte er hastig. »Wir müssen ihn hinauf in sein Zimmer tragen. Er ist schwer krank.«
»Ist es ein Herzanfall?«, erkundigte sich Sir Christophen
»Vielleicht etwas noch Schlimmeres«, antwortete Small und schüttelte den Kopf. »Dabei habe ich ihn doch erst vor zehn Minuten gewarnt - Sie haben es gehört. Aber er wollte ja keinen Rat annehmen. Ich ahnte, dass ein Anfall unmittelbar bevorstand. Das schlimme ist nur, sein Herz ist nicht allzu kräftig...« Er brach ab, da ein Stöhnen ihn unterbrach. »Mein Gott, will mir denn niemand helfen?«
»Ich, Doktor!«, rief der Oberinspektor und trat vor. »Und Sie, Mr. Sparrow, doch auch! Nehmen Sie seine Füße!«
Es war eine Erlösung für alle Anwesenden, dass die lastende Starre durch aktives Handeln beendet werden konnte. Parry fasste die Schultern des Obersten und Sparrow seine Füße, und so trugen sie den Ohnmächtigen in sein Schlafzimmer hinauf. Dr. Small und Sir Christopher Lacey folgten ihnen; der Rest der Gäste blieb im Zimmer zurück.
Wenige Minuten später kamen Sir Christopher Lacey und William Sparrow wieder ins Esszimmer. Beide sahen recht erschüttert aus.
»Der arme Kerl!«, sagte der Baron, als Antwort auf die fragenden Blicke. »Wenigstens hat er momentan keine Schmerzen, denn er ist ohne Besinnung. Aber sein Atem geht so röchelnd. Was mag nur los sein?«
»Übermäßige Aufregung, wenn Sie mich fragen«, meinte Paige. »Er hat sich diese verrückten Ideen in den Kopf gesetzt, sich dabei in höchste Aufregung hineingesteigert, und dem ist sein Herz eben nicht gewachsen gewesen. Sie haben ja gehört, was der Doktor von seinem Herzen sagte.«
»Es war aber kein Herzanfall«, brummte Sparrow, zog eine Pfeife aus der Tasche und begann sie zu stopfen. »Ich kann das beurteilen, denn mein Vater litt an Herzanfällen. Das sieht mir eher nach Gift aus.«
»Gift...!«, wiederholten die Anwesenden erschrocken.
»Nun, Sie haben es doch selbst gesehen, verdammt noch mal«, sagte der Fabrikant. »Zwei- oder dreimal packte ihn ein Krampf, bevor der letzte Anfall kam. Scheußlich - ich möchte fortgehen, aber ich glaube, man sollte besser doch noch bleiben.«
Das Wort Gift übte auf alle eine lähmende Wirkung aus. Sie schwiegen, gingen ruhelos im Zimmer auf und ab und warfen einander verstohlene Blicke zu. Keiner der Herren konnte vergessen, welche Enthüllung der Oberst ihnen gerade hatte machen wollen, eine Enthüllung, an die ihn nur sein Anfall gehindert hatte.
Wen von den Anwesenden hatte der Oberst nennen wollen?
Gewiss, fürs erste hatte sein rätselhafter Anfall ihm die Lippen versiegelt, aber das bedeutete ja nur einen Aufschub. Sobald er sich erholt hatte, würde er den Namen des Erpressers bekanntgeben.
Mit einer Mischung von Erleichterung und Bestürzung sahen die fünf Männer durch die offene Tür des Esszimmers, wie Dr. Small die Treppe herunterkam und zum Telefon in der Halle ging. Sie hörten, wie er das Krankenhaus von Westonbury anrief und dringend die sofortige Übersendung einer Magenpumpe, zusammen mit Brechmitteln, und eine Krankenschwester forderte. Als er das Gespräch beendet hatte und die Treppe wieder hinaufsteigen wollte, blieb er am Fuß noch zögernd stehen.
»Möchte nicht einer der Herren Mrs. Graham benachrichtigen und sie bitten, sofort nach Hause zu kommen?«, fragte er. »Der Zustand des Obersten ist sehr ernst...«
»Sie meinen - er liegt im Sterben?«, unterbrach ihn Sir Christopher ängstlich.
»Ich weiß es nicht - noch nicht«, erwiderte der Arzt. »Ich werde natürlich tun, was ich kann, aber es ist ein sehr böser Anfall«, murmelte er, halb zu sich selbst. »Ich weiß gar nicht, was ihn ausgelöst haben kann.«
»Wie können wir seine Frau erreichen?«, fragte Lacey. »Wo ist sie denn?«
Der Arzt griff sich an den Kopf. »Ach, verdammt... wie unangenehm... er hat uns ja nur gesagt, dass sie bei Freunden in Seven Oaks ist; damit können wir nicht viel anfangen.«
»Könnte man nicht die Polizei in Seven Oaks anläuten und sie auffordern, Mrs. Graham ausfindig zu machen?« schlug Paige vor. »Ich verstehe zwar nicht viel von so etwas, aber es muss doch einen Weg geben...«
»Das möchte ich nicht«, unterbrach ihn Dr. Small. »Ich möchte der armen Frau nicht einen solchen Schrecken einjagen. Und Jackie! Sie betet ihren Vater an! Ich hoffe ja, dass wir ihn noch durchbringen können, wenn wir rechtzeitig die richtigen Mittel anwenden. Aber ich muss zu meinem Patienten - bitte veranlassen Sie, was Sie für das beste halten.«
Er eilte die Treppen hinauf, aber die Zurückbleibenden unternahmen gar nichts. Sie rauchten nur und tranken große Mengen Whisky. Die Unterhaltung beschränkte sich auf gelegentliche Bemerkungen, dass es zu spät sein könnte, wenn die Leute vom Krankenhaus nicht bald kämen.
Aber bereits zehn Minuten nach dem Anruf von Dr. Small fuhr ein Krankenwagen die Auffahrt herauf, dem ein junger Arzt in Begleitung einer älteren Krankenschwester entstieg. Sie gingen sofort zu dem Kranken hinauf, während Oberinspektor Parry sich den Herren im Speisezimmer wieder zugesellte.
»Sie wollten mich dort oben nicht mehr haben«, meinte er und zündete sich eine Zigarette an. »Scheußliche Geschichte! Ich hoffe nur, dass sie den alten Herrn durchbringen.«
»Meinen Sie, dass sie es schaffen werden?«, fragte Braun eifrig. »Glauben Sie, dass er sich wieder erholen wird?«
»Ja, heraus mit der Sprache, Oberinspektor!«, rief Sparrow.
Parry ließ seine Blicke prüfend von einem zum anderen wandern. Selten hatte er aufs höchste erregte Menschen gesehen, die sich so krampfhaft bemühten, jede Nervosität zu verbergen.
»Ich bin kein Arzt, Mr. Sparrow«, antwortete er dann und zuckte die Achseln. »Ich weiß nur, dass der Oberst einen bösen Anfall gehabt hat. Was für einen? Da weiß ich ebenso wenig wie Sie.«
»Mr. Sparrow deutete an...«, begann Paige.