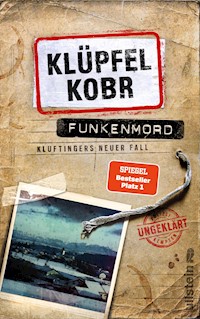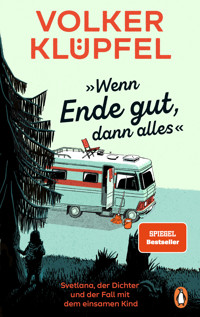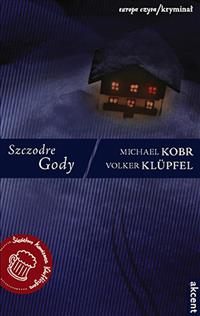10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charmante Dilettanten: Monsieur Lipaires Gauner-Truppe träumt vom großen Coup an der Côte d'Azur - doch irgendwas geht immer schief Ein Rätsel, das zum Familienschatz einer südfranzösischen Adelsdynastie führt, versteckt im Kanallabyrinth der malerischen Küstenstadt Port Grimaud? Das klingt zu formidable, um wahr zu sein. Gelegenheitsgauner Guillaume Lipaire sieht endlich seine Chance, schnell an viel Geld zu kommen. Er versammelt ein ungewöhnliches Team um sich, das ihm dabei helfen soll, das Rätsel zu lösen: Wassertaxifahrer Karim, Eisverkäuferin Jacqueline, Ex-Fremdenlegionär Paul, Delphine, die den örtlichen Handyladen betreibt, und die 84-jährige Lebedame Lizzy. Zusammen sind sie die Unverbesserlichen von der Côte d'Azur. Dumm nur, dass keiner von ihnen weiß, wie man einen großen Coup aufzieht und ihnen die Adeligen langsam, aber sicher auf die Schliche kommen. Ein turbulentes Katz-und-Maus-Spiel durch den pittoresken Urlaubsort beginnt, bei dem eine Katastrophe die nächste jagt. "Volker Klüpfel und Michael Kobr ist mit Die Unverbesserlichen eine äußerst sympathische Kriminalkomödie gelungen, ein perfekter Einstieg in eine neue Reihe, die komplett anders ist als die Allgäu-Krimis. Leichter Retro-Charme unter der Sonne Südfrankreichs - genau das richtige für graue Novembertage." Maren Ahring, NDR Kultur "Wie immer bei Klüpfel und Kobr sind auch die eigenwilligen Nebenfiguren mit viel Liebe fürs Detail gezeichnet, sie verleihen der amüsanten, mit Schwung und Witz erzählten Gaunerkomödie erst die richtige Würze." Sabine Reithmaier, Süddeutsche Zeitung Nach dem Allgäu mit Kommissar Kluftinger entführt uns das Bestsellerduo Klüpfel & Kobr an die traumhaft schöne Côte d'Azur. Das Lesevergnügen in Frankreich geht weiter: Band 1: Die Unverbesserlichen. Der große Coup des Monsieur Lipaire, November 2022 Band 2 : Die Unverbesserlichen. Die Revanche des Monsieur Lipaire, Mai 2023
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Unverbesserlichen – Der große Coup des Monsieur Lipaire
Die Autoren
Altusried hat einen prominenten Sohn: Kommissar Kluftinger. Volker Klüpfel, Jahrgang 1971, kommt wenigstens aus dem gleichen Ort. Nach dem Abitur zog es ihn in die weite Welt – nach Franken: In Bamberg studierte er Politikwissenschaft und Geschichte. Danach arbeitete er bei einer Zeitung in den USA und stellte beim Bayerischen Rundfunk fest, dass ihm doch eher das Schreiben liegt. Seine letzte Station vor dem Dasein als Schriftsteller war die Feuilletonredaktion der Augsburger Allgemeinen. Die knappe Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie, mit der er im Allgäu lebt. Sollte noch etwas Zeit übrig sein, treibt er Sport, fotografiert und spielt Theater. Auf der gleichen Bühne wie Kommissar Kluftinger.
Michael Kobr, geboren 1973 in Kempten im Allgäu, studierte in Erlangen ziemlich viele Fächer, aber nur zwei bis zum Schluss: Germanistik und Romanistik. Nach dem Staatsexamen arbeitete er als Realschullehrer. Momentan aber hat er schweren Herzens dem Klassenzimmer den Rücken gekehrt – die Schüler werden’s ihm danken –, um sich dem Schreiben, den ausgedehnten Lesetouren und natürlich seiner Familie widmen zu können. Kobr wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Unterallgäu – und in einem kleinen Häuschen mitten in den Bergen, wo die Kobrs im Winter häufig auf der Skipiste, im Sommer auf Rad- und Bergtouren unterwegs sind. Wenn nicht gerade mal wieder eine gemeinsame Reise ansteht ...
Das Buch
Hausmeister und Gelegenheitsgauner GUILLAUME LIPAIRE vermietet illegal Ferienhäuser seiner Kunden, ohne dass diese davon wissen. Doch plötzlich findet er in einem der Häuser einen Toten, einen Mann, der offenbar eine große Summe Geld erwartete.LIPAIRE ist überzeugt, dass eine alteingesessene Adelsfamilie dahintersteckt und dass es um ein Rätsel geht, dessen Lösung ihn zu einem reichen Mann machen könnte. Zusammen mit ein paar Freunden, die sich in Port Grimaud mit Gaunereien über Wasser halten, versucht er, den Adeligen zuvorzukommen. Ein witzig-turbulentes Wettrennen beginnt.
Volker Klüpfel und Michael Kobr
Die Unverbesserlichen – Der große Coup des Monsieur Lipaire
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotive ©: GettyImages / Ietty17; FinePic®, MünchenAutorenbilder: © Hans ScherhauferE-Book powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-2802-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autoren / Das Buch
Titelseite
Impressum
#1: Guillaume Lipaire
#2: Karim Petitbon
Hart am Wind
Ein stummer Passagier
Familienbande
Transportprobleme
Piraten
Schlüsselgewalt
Die Sache mit dem Handy
#3 Delphine Berté
Eine helfende Hand
Angebot und Nachfrage
Ein seltsamer Anruf
Der Groschen fällt
Ein Freund, ein guter Freund
#4 Paul Quenot
Unter fremden Segeln
Besuch im Morgengrauen
Der Schatz der Sierra Madre
Mysteriöse Begegnungen
Wenn die Toten sprechen
Helfende Hände
Bureau de Tabac
#5 Jacqueline Venturino
Im Schatten der Brücke
Bootspartie
Stille Post
#6 Lizzy Schindler
Botschaften
Der Feldherr
Leinen los
Undichte Stellen
Der verlorene Sohn
Ein Jahrmarkt in Azur
Das Misstrauensvotum
Schwanensee
Unerwarteter Besuch
Der geheimnisvolle Fantômas
Aus den Augen, aus dem Sinn
Ich sehe was, was du nicht siehst
Mit leeren Händen
Unerwartete Hilfe
Andere Saiten
Nächtliche Geschäfte
Il est cinq heures, Grimaud s’éveille
Nachtwache
Sightseeing mit Hindernissen
Hilfe in der Not
Einer für alle
Gefälligkeiten
Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann
Zwei Éclairs
Schiffeversenken
Es wird ernst
Das Ziel vor Augen
Epilog: Auf die Freundschaft
Nachwort
Glossar
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
#1: Guillaume Lipaire
#1: Guillaume Lipaire
Wasser. Nichts als Wasser! Trotz der vielen Jahre, die Guillaume Lipaire bereits hier in Port Grimaud verbracht hatte, versetzte ihn der Anblick noch immer in Staunen. Während er mit seinem Morgenzigarillo im Café Fringale saß und es genoss, dass er zu dieser frühen Stunde schon kurze Hosen und Poloshirt tragen konnte, glitt sein Blick wie von selbst immer wieder auf die Wellen, die die Kaimauern umspielten. Wo hätte er auch sonst hinschauen sollen? Schließlich war das ganze Städtchen so gebaut, dass man, egal, wo man sich befand, vor allem eins sehen konnte: Wasser. Selbst wenn man etwas abseits vom Zentrum wohnte, hatte man aus jedem Reihenhäuschen, jedem Appartement einen unverbaubaren Blick darauf. Wenn nicht auf die Kanäle, dann auf den Sandstrand, das glamouröse Saint-Tropez am schräg gegenüberliegenden Ufer und das fast immer azurblaue Meer. Port Grimaud kam Guillaume Lipaire manchmal weniger wie eine Stadt vor, die man ins Wasser gebaut hatte, sondern eher wie Wasser, in das ein bisschen Stadt gestreut worden war.
Aber genau das war es, was die Leute im Sommer in Scharen anlockte und dafür sorgte, dass es selbst im Winter niemals so leer war wie in anderen Ferienorten am Mittelmeer: ein Flair, das es eben nur hier gab. Wo die Masten der großen Jachten die bunten Häuschen oft um mehrere Meter überragten und sich die Segel auf der Oberfläche der Kanäle spiegelten. Und das alles im sanften, tröstlichen Licht der Côte d’Azur. Dieses besondere Flair war auch der Grund, weshalb er einst hier gestrandet war. Gestrandet – wie passend das Wort doch war. Dieses Blau … der strahlende Himmel … das sanft plätschernde …
»… Wasser, Ihr Croissant und natürlich der Kaffee, Monsieur.«
Lipaire drückte seinen Zigarillo aus und blickte auf das Tablett, das der garçon auf dem Tischchen vor ihm abstellte. Ein buttrig glänzendes Hörnchen, das obligatorische Glas Leitungswasser und eine henkellose Tasse voll mit bronzefarbenem Kaffee. Kein Cappuccino, wie ihn die ganze Welt trank. Nein, hier wurde café au lait serviert. Was für Lipaire jedoch auch nichts anderes war als zu wenig Kaffee mit zu viel Milch. Er hatte andere Vorlieben. »Michel, hast du dich da nicht vertan?«
Der Ober sah ihn fragend an, folgte dann seinem Blick und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Pardon, Monsieur Lipaire, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist.« Er griff sich das Tablett und flüsterte: »Das ist für die beiden dort.« Dabei deutete er mit dem Kopf auf ein Pärchen am Nebentisch und rollte mit den Augen. Guillaume Lipaire betrachtete ihre Aufmachung: Trekkingsandalen, eine lederne Gürteltasche und grelle Funktionshemden.
Er zuckte mit den Achseln und blickte wieder auf den Kanal, wo Karim, der Wassertaxifahrer, gerade zu seiner ersten Tour aufbrach. Er hatte nur wenige Fahrgäste in seinem Elektroboot und winkte Lipaire fröhlich zu. Das idyllische Bild wurde jedoch gestört vom schrillen Piepsen des Müllwagens, der rückwärts die schmale Brücke zur kleinen Insel im Kanal passierte.
»Geht das nicht ein bisschen schneller, putain!«, schimpfte ein Mann, dem es nicht gelang, an dem Fahrzeug vorbeizukommen.
»Guten Morgen, Abbé!«, rief Lipaire und spielte mit einem der Zuckertütchen, die auf dem Tisch herumstanden. Der Pfarrer des Ortes war ein recht spezielles Exemplar seiner Zunft, doch wer ihn kannte, wusste seine Diskretion und Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen zu schätzen. »Haben Sie es eilig?«
»Bonjour, Guillaume!«, schrie der Priester zu ihm herüber. »Und wie. Ich habe einen Termin beim Bischof, und ausgerechnet heute hat der Wecker gestreikt. Wir haben … ich habe heillos verschlafen.«
»Jetzt aber: wie immer.« Michel, der Kellner, stellte Lipaire einen neuen Teller hin, diesmal nur mit einem Stück Baguette und etwas Butter, dazu eine schöne Tasse schwarzer Kaffee. Ohne Sahnehaube, Milchschaum oder sonstiges Chichi. Lächelnd zog Lipaire eine kleine Dose getrüffelter Leberpaté aus seiner Hosentasche und strich sich etwas davon auf sein Baguette. Genussvoll biss er ein Stück ab. So konnte der Tag beginnen.
Nachdem sich in seinem Magen diese angenehme Fülle ausgebreitet hatte, die ihn bis zum Abendessen tragen würde, stand Lipaire auf und winkte dem Kellner. »Schreib’s bitte an, Michel, ja?« Das Anschreiben hatte er hier eingeführt, eine Reminiszenz an seine alte Heimat. Es hatte etwas gedauert, bis die Einheimischen das Prinzip verinnerlicht hatten, aber inzwischen fanden sie es genauso gut wie er.
»Der Chef lässt fragen, wann Sie denn Ihre Liste mal begleichen wollen«, rief Michel ihm nach. Lipaire sah dem jungen Mann an, wie unangenehm es ihm war, ihn so direkt darauf ansprechen zu müssen. Die Touristen vom Nebentisch reckten die Köpfe. Sie hofften offenbar auf eine Auseinandersetzung, eine erste kleine Attraktion an diesem Urlaubstag, der womöglich noch den Besuch der Burgruine von Grimaud oder des berühmten Jachthafens von Saint-Tropez beinhaltete. Doch den Gefallen würde Lipaire ihnen nicht tun. Dafür war das Leben zu kurz und das Wetter viel zu schön. Lächelnd erwiderte er: »Richte ihm doch bitte aus: Die Saison geht ja erst richtig los, dann laufen auch meine Geschäfte wieder ordentlich an.« Er wandte sich bereits zum Gehen, da schob er nach: »Ach ja, und für das Schäferstündchen mit seiner neuen Freundin im romantischen Fischerhäuschen hab ich sowieso noch was gut bei ihm.« Dann hob er die Hand zum Gruß und schlenderte pfeifend davon.
»Je t’aime, was für ein wundervolles Lied!«
»Bonjour, Madame«, grüßte Lipaire die alte Dame, die sich ächzend bückte, um die Hinterlassenschaften ihres schwarzen Pudels mit einer Tüte einzusammeln. »Wenn man sein Leben liebt, kann ja nur alles gut werden, nicht wahr?«
Die Dame nickte eifrig, während sie ein wenig ungelenk ihr Beutelchen zuband. »Ja, das Leben und die Menschen zu lieben, das war immer mein Motto. Und Brigittes auch.«
Jetzt war er baff. »Ach, Sie kennen die Bardot?«
»Natürlich. Sie und auch Jane Birkin, die das Lied nach ihr mit dem guten Serge Gainsbourg gesungen hat. Aber Brigitte ist eine Frau, die man nicht so leicht vergisst.«
»Ganz wie Sie, wenn ich mir diesen Kommentar erlauben darf.«
Die alte Dame winkte mit gespielter Bescheidenheit ab. Da erhob sich ein greiser Mann mit Stock von einer Bank und trippelte auf Lipaire zu. Als er nahe genug bei ihm stand, zischte er: »Lass die Hände von ihr, sie gehört mir.«
»Ach, halt doch die Klappe«, fauchte die alte Dame. »Ich gehöre niemandem, und dir schon gar nicht.«
Guillaume nickte und trat den Rückzug an. Inzwischen war es lebhafter geworden. Jener kurze Moment am Morgen, wenn das Städtchen langsam zum Leben erwachte, die Händler ihre Vorräte auffüllten und die Menschen zu ihren Arbeitsplätzen eilten, die Touristen aber noch nicht auf der Suche nach Zerstreuung durch die Gassen irrten, neigte sich bereits seinem Ende zu.
Er schlenderte über den gekiesten, von Platanen bestandenen Marktplatz, auf dem schon die Boulekugeln aufgereiht bereitlagen. Die Spieler, ein paar ältere Herren mit Schiebermützen, saßen abseits auf einem Mäuerchen und rauchten filterlose Zigaretten. »Habt ihr heute Dienst?«, wollte Lipaire wissen.
»Frühschicht geht gleich los. Bis drei«, erwiderte einer von ihnen, ein Dicker mit mächtigem Schnurrbart. »Heute ist Bettenwechsel drüben in der Anlage, da müssen wir für Provence-Atmosphäre sorgen. Aber es dauert noch, bis die Neuen hier sind. Und du wirst ja auch zu tun haben mit deinen Vermietungen, n’est-ce pas?« Dabei zwinkerte ihm der Mann verschwörerisch zu.
Lipaire nickte. Ja, er musste sich langsam beeilen. Er wünschte ihnen einen schönen Tag, eilte über die Brücke und wollte bereits auf die Place des Artisans abbiegen, da rief ihm die junge Eisverkäuferin zu: »Eine Portion unserer … Spezialsorte, Monsieur?«
»Dazu könnte nicht einmal ein Sonnenschein wie Sie mich zu dieser Stunde überreden.« Er wusste, was mit Spezialsorte gemeint war und dass man diese eher rauchte denn in einer Waffel genoss. Für ihn jedoch war das schon lange nichts mehr, er verließ sich ganz auf Wein und seine ohnehin meist tadellose Laune, wenn es darum ging, sich einen entspannten Tag zu machen. Die Aussicht, gleich mit einem Glas eiskalten Rosé in den Arbeitstag zu starten, ließ ihn seinen Schritt beschleunigen. Vor der Bäckerei jedoch hielt er inne. Auf dem schmalen Weg kam ihm ein Mann mit einer Schubkarre voller Gartengeräte entgegen. Lipaires Stimmung trübte sich sofort, als er den kahl rasierten Schädel unter dem Strohhut erkannte. Er bog ab, denn wenn es jemanden gab, dem er nicht begegnen wollte, dann war es dieser Mann. Er hatte in seiner Vergangenheit schon genug Schaden angerichtet. Doch sich in dieser kleinen Stadt aus dem Weg zu gehen war schwierig, man musste dafür den einen oder anderen Umweg in Kauf nehmen. Immerhin konnte er so auch vermeiden, an dem Haus vorbeizukommen, das einmal ihm gehört hatte. Ihm und seiner damaligen Frau Hilde. In einer anderen, besseren Zeit. In der er dachte, ihr den großen Traum vom Häuschen am Meer zu erfüllen sei so etwas wie die ultimative Liebeserklärung. Aber auch die hatte nicht verhindert, dass letztlich alles den Bach runterging. Wie dumm er doch gewesen war.
Nachdem er die nächste Brücke überquert hatte, hielt Lipaire erneut inne und rief dem jungen Mann, der mit einer Angel in der Hand am Kai stand, zu: »Das ist hier verboten, wussten Sie das gar nicht? Dafür gibt’s saftige Strafen, wenn Sie erwischt werden. Die police nationale kennt da kein Pardon.«
Eingeschüchtert rollte der Mann die Schnur wieder ein. »Das wusste ich nicht«, erklärte er.
Ein Holländer, vermutete Lipaire. »Wird Ihnen nichts nützen. Ist schon zu spät.«
Unschlüssig blickte ihn der Angler an.
»Sie können das Bußgeld gleich bei mir bezahlen, wenn Sie wollen.«
»Ach, sind Sie dafür zuständig?«
»Ja. Ehrenamtlich, sozusagen.«
»Wie viel kostet das?«
Lipaire dachte kurz nach. »Sechzig.«
Der andere bekam große Augen. »So viel hab ich gar nicht dabei.«
Achselzuckend gab Lipaire ihm zu verstehen, dass man da nichts machen könne.
»Reichen vierzig nicht auch?«
Mit einem gönnerhaften Nicken streckte er seine Hand nach den zwei blauen Scheinen aus, die ihm der Holländer hinhielt.
»Ausnahmsweise. Falls Sie keine Quittung benötigen.«
Der andere schüttelte energisch den Kopf. Mit ein paar hektisch geflüsterten Entschuldigungen packte er seinen Angelkram zusammen und trollte sich. Lipaire sah ihm nach und zündete sich noch einen Zigarillo an. Er schlenderte weiter und hätte beinahe den Gruß der Frau überhört, die am Bootsanleger in der Rue de l’Octogone stand, einen halb vollen Eimer mit Fischen neben sich. Sofort richtete er seinen drahtigen Oberkörper ein bisschen mehr auf und fuhr sich durch seine grauen Locken. »Bonjour, Lucie!«
»Na, Guillaume, was gibt’s Neues?«, fragte sie und warf ihre Angel aus.
»Stell dir vor, ich musste schon wieder einen Touristen verscheuchen, der hier geangelt hat.«
Die Mittfünfzigerin schüttelte den Kopf. »Die denken wohl, Verbote gelten für sie nicht, was?«
»Werden immer dreister. Ach übrigens, ich hab das Geld dabei, das ich dir noch schulde.« Er reichte ihr die Scheine, die er eben vom Holländer bekommen hatte.
»Oh, danke. Komm doch mal wieder zum Essen vorbei.«
Er warf einen skeptischen Blick in den Kübel. »Sind die denn schon wieder … gut?«
»Du meinst, wegen dem ausgelaufenen Öl von dem Boot neulich?«
Er nickte.
»Also, das war so wenig, das merkt wirklich nur ein Gourmet wie du. Aber warte halt noch eine Woche, bis du wieder ins Restaurant kommst.«
»Mach ich, bis dann, meine Liebe! Und guten Fang noch.« Er warf ihr eine Kusshand zu, was sie mit einem Lächeln und geröteten Wangen quittierte. Guillaume registrierte das mit Genugtuung. Er war eben noch immer ein Hingucker, keiner trug die Shorts und die Polohemden so nonchalant wie er. Zufrieden steuerte er auf den gemauerten Durchgang zwischen zwei Häusern zu. Dort, in einer Nische, in die auch im Hochsommer nie die Sonne schien, war eine unscheinbare Tür eingelassen, neben der ein Schild hing: gardien stand darauf, daneben prangte der stilisierte grün-blaue Fisch, das Wahrzeichen von Port Grimaud. Kein Name, nur eine Funktion: gardien. Das war er, Guillaume Lipaire, streng genommen Wilhelm Liebherr, aber diesen Namen benutzte er schon lange nicht mehr. Stolzer Wächter über zahlreiche Ferienhäuser und Wohnungen im Städtchen, hochoffiziell beauftragt und bezahlt von der Eigentümergemeinschaft.
Er schloss auf und schaltete die Neonröhre an. Weil die Dienstwohnung außer der Tür nur über ein winziges Fenster verfügte, war es darin immer recht dunkel. Aber dafür auch stets angenehm kühl, sagte sich Lipaire, holte sich die Flasche Rosé aus dem Kühlschrank, goss den Inhalt in das nächstbeste leere Senfglas und prostete seinem Ebenbild im Spiegel zu, der im winzigen Flur hing, der wiederum nahtlos in die Küchenzeile überging. Er sah immer noch geradezu unverschämt gut aus, urteilte er zufrieden. Vielleicht so gut wie noch nie in seinem Leben. Es gab Menschen, die verglichen ihn gar mit Alain Delon. Obwohl der schon weit über achtzig war und er erst Mitte sechzig, protestierte Lipaire nie dagegen, denn er wusste, dass dies eines der größten Komplimente war, das ihm Franzosen machen konnten. Natürlich war eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden: Wie der Filmstar war auch er schlank, hatte ein weiches, aber, wie er fand, ausdrucksstarkes Gesicht mit einer markanten Nase, und seine Haare waren immer noch so dicht wie in seiner Jugend. Lächelnd strich er sich die silbergrauen Locken zurück, ließ sich in einen der drei Plastikstühle fallen und legte die Füße auf den Tisch, den er auf ein Viertel seiner ursprünglichen Größe zurechtgesägt hatte. Sonst hätte er nicht in die Küche gepasst, die kleiner war als in vielen Wohnmobilen drüben auf den Campingplätzen. Doch es machte ihm nichts aus, dass hier alles eng und spartanisch war. Nicht mehr, jedenfalls. Als er vor vielen Jahren mit seiner Frau und den Kindern regelmäßig in den Sommerferien hierherkam, war das noch anders gewesen. Die Träume waren groß gewesen, das Haus auch. Selbst als seine Apotheken in die Insolvenz schlitterten, hatte er noch von Dolce Vita in Port Grimaud geträumt. Nur er und Hilde, die Sonne und das Meer. Die Kinder brauchten ihre Eltern längst nicht mehr. Doch dann kam alles anders, und von seinen Träumen war nicht mehr viel übrig geblieben. Auch wenn er die Trennung von seiner Frau inzwischen verarbeitet hatte – dass seine Kinder den Kontakt zu ihm abgebrochen hatten, war nur zu ertragen, indem er den Schmerz darüber ganz tief begrub. Er wusste noch nicht einmal, ob sie inzwischen selbst Kinder hatten. Nur auf eine Weise schaffte er es, seine Zuversicht zu behalten: indem er sich verbot, zurückzuschauen, zu lamentieren.
Er blickte auf das Nagelbrett mit den vielen Schlüsseln an der Wand. In den dazugehörigen Häusern konnte er ein und aus gehen, wie es ihm gefiel. Als gardien war er der Schlüsselmeister, kannte die Wohnungen manchmal besser als die Besitzer selbst, wusste, welchen Wein sie in ihren Vorratsschränken lagerten, welche Bücher sie lasen, wer ihnen schrieb, und manchmal – wenn er es für nötig erachtete – auch, was in den Briefen stand. Er kannte die Orte, wo die privatesten Fotos versteckt waren, wusste, bei wem es stets sauber und aufgeräumt, bei wem chaotisch und schmutzig war. Das musste er wissen, es war sein Beruf. Dennoch war er stolz darauf, dass er sich nie etwas notierte. Es war alles in seinem Kopf.
Lipaire schaltete eben den Fernseher an, da klopfte es. Vor der Tür stand Frau Krause, die deutsche Schreckschraube aus Haus Nummer 46. Dauernd lag sie ihm mit irgendwelchen Lappalien in den Ohren. Obwohl sie dieselbe Muttersprache hatten, sprach er Französisch mit ihr. Ihr Gartentürchen quietsche immer noch, beschwerte sie sich, zudem fehle ein Riegel, er habe doch versprochen, sich darum zu kümmern. »Oui Madame, pardon … bien sûr, Madame … tout de suite, Madame«, antwortete er stoisch auf ihr Gezeter. Immer, wenn sie besonders laut schimpfte, zuckte er entschuldigend mit den Achseln, als verstehe er nicht, was sie sagte. Worauf sie etwas in hanebüchenem Französisch zusammenstotterte, das übersetzt in etwa so viel bedeutete wie: »Mein Garten singt in der Tür.«
Doch all das beschleunigte Lipaires Puls nicht. Er nahm sich vor, den Ärger demnächst mit der teuersten Flasche Château Lafite hinunterzuspülen, den die Krauses in ihrem Küchenschrank lagerten – in einer Menge, die sie nie und nimmer überblickten. Es würde ihm Freude und Genugtuung zugleich sein, damit auf das deutsche Ehepaar anzustoßen, wenn es in wenigen Wochen wieder nach Hause zurückkehrte.
Das Telefon klingelte. Lipaire entschuldigte sich bei Frau Krause, versprach wortreich, sich vor allen anderen Punkten auf seiner Liste zuerst ihres Problems anzunehmen, machte ihr überschwängliche Komplimente über ihre Frisur und ihre Beine, was sie sich gern gefallen und ihren Zorn sichtlich verrauchen ließ. Schließlich drückte er mit einem in die Luft gehauchten Kuss die Tür zu und nahm den Hörer ab. Eine flüsternde Stimme am anderen Ende sagte etwas, das er nicht verstand. »Können Sie etwas lauter reden?« Er schaltete den Fernseher stumm und hörte angestrengt zu. Jetzt erkannte er die Frau. »Ah, Bernadette, Sie sind es.«
»Hören Sie, Monsieur Lipaire: Familie Vicomte kommt morgen«, sagte sie, noch immer flüsternd.
»Sicher?«
»Sicher. Das Boot liegt schon im Hafen von Marseille zur Abfahrt bereit.«
»Wie viele?«
»Alle.«
»Alle?«
»Ja.«
Das war ungewöhnlich, schon ewig waren nicht mehr alle Familienmitglieder der Vicomtes gleichzeitig da gewesen. »Herzlichen Dank, liebe Bernadette. Es ist immer ein Genuss, Ihre melodische Stimme zu hören.«
»Jaja. Wie sieht es mit meiner Bezahlung aus? Es steht noch immer ein längerer Urlaub aus.«
Seufzend blickte Lipaire auf das Brett mit den Schlüsseln. »Zurzeit bin ich ziemlich ausgebucht. Leider. Aber es kann sich ja immer spontan etwas ergeben.«
»Schon gut. Ich wollte nur sichergehen, dass Sie es nicht vergessen.«
»Auf keinen Fall, seien Sie beruhigt.« Dann legte er auf. »Merde!«, zischte er. Er hatte sich auf einen ereignislosen Tag gefreut, jetzt aber musste er ihn damit verbringen, die Spuren seiner letzten inoffiziellen Vermietung zu beseitigen, bevor die eigentlichen Besitzer des Hauses kamen, das noch dazu das mit Abstand größte in ganz Port Grimaud war. Da musste er sich ranhalten. Aber so war das eben in seinem Geschäftsfeld. Er nahm den Hörer wieder zur Hand und wählte eine Nummer. Schon nach dem ersten Klingeln wurde abgehoben. »Karim?«
»Was gibt’s?«
»Arbeit.«
»War mir fast klar, dass du nicht anrufst, um mir einen schönen Tag zu wünschen.«
»Wann kannst du kommen?«
»Ich hab den ganzen Tag Rundfahrten und danach noch ein paar Privataufträge. Gegen acht?«
»Gut, bis dann«, sagte Lipaire schnell und nannte ihm die Adresse, zu der er kommen sollte. »Es gibt noch einiges zu tun bis dahin. Ach ja, wenn du an der Vierunddreißig vorbeikommst, schau bitte vom Wasser aus, ob die tatsächlich einen Hund dabeihaben. Wenn ja, stelle ich denen das noch extra in Rechnung. Schönen Tag!«
Guillaume Lipaire schnappte sich einen der Schlüssel und schlenderte zu dem sonnenbeschienenen Fischerhaus an der Place du Quatorze Juin, einem seiner liebsten Objekte. Der Begriff Fischerhaus – maison de pêcheur – war ein wenig irreführend. Es handelte sich nicht um eine geduckte, sturmumtoste Natursteinkate auf irgendeiner Klippe, sondern um ein dreistöckiges, farbig gestrichenes Reihenhaus mit dem hier obligatorischen Bootsliegeplatz davor. Denn auch wenn Port Grimaud wirkte, als sei es ein über Jahrhunderte gewachsenes provenzalisches Dorf: Der Ort war erst Mitte der Sechzigerjahre auf dem Reißbrett entstanden.
Lipaire zog das hölzerne Gartentor auf und betrat den schmalen Vorgarten mit den blühenden Oleanderbüschen. Das Anwesen gehörte einer reizenden Familie aus dem Elsass mit einem besonderen Händchen für Inneneinrichtung und einem herrlichen Oldtimer von Citroën. Nachdem er die Post aus dem Briefkasten entnommen hatte, schraubte er den Riegel des Gartentürchens mit dem Vorsatz ab, ihn demnächst bei den Krauses zu montieren, und öffnete die große Glastür zur Terrasse, an die der Bootssteg grenzte. Alles in Ordnung. Zufrieden, seinen Pflichten als gardien so gewissenhaft nachgekommen zu sein, holte er sich aus dem Kühlschrank eine angebrochene Flasche Elsässer Riesling, machte es sich auf dem Liegestuhl auf der Terrasse bequem, ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen und schlief ein.
#2: Karim Petitbon
Zum dritten Mal innerhalb einer Minute warf Karim Petitbon einen Blick auf das zerkratzte Display seines Smartphones. Das Ergebnis blieb immer dasselbe: Er würde es nicht rechtzeitig schaffen. Es war bereits kurz vor acht, und egal, wie kräftig er den Hebel seines Wassertaxis auch nach vorn drückte – mehr als die paar Knoten, die er machte, waren mit dem schwachbrüstigen Elektroboot einfach nicht drin. Eigentlich hätte er die Fahrt gerne genossen, denn in der Dämmerung durch die Kanäle zu schippern gehörte zu den schönsten Privilegien, die ihm sein Job bot. Wenn der Himmel sich in ein fast kitschiges Rosa verfärbte, die Hitze des Tages einer erfrischenden Brise wich und die Schiffe von ihren Ausflügen auf dem Meer zurückkamen.
Vor allem von den großen Segeljachten konnte er nicht genug bekommen, er kannte alle Details, ihre Namen, ihre Länge, wusste, wie tief ihre Kiele gingen. Dennoch verspürte er keinen Neid auf die Besitzer, denn er war sich sicher, dass er selbst einmal einen großen voilier sein Eigen nennen würde. Irgendwann würde er nicht mehr diese coches d’eau im Auftrag der Verwaltung durch die Kanäle lenken. Irgendwann würde er nichts tun als segeln, würde Regatten gewinnen mit einer atemberaubenden Rennjacht.
Dabei gab es keinen plausiblen Grund für eine solche Annahme: Er kam aus ärmlichen Verhältnissen, und seit sein Vater vor ein paar Jahren überraschend gestorben war, schlugen seine Mutter und er sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Doch es gab da jemanden, der ihn gelehrt hatte, seine Träume mit Konsequenz zu verfolgen, anstatt sie aufzugeben. Dieser Jemand war Guillaume Lipaire, und er hatte wirklich »mit Konsequenz« gesagt. Das war eines seiner Lieblingswörter – genau wie »Disziplin« und »Pünktlichkeit«. An der mangelte es Karim leider ein wenig, wie ihm ein erneuter Blick auf die Uhrzeit auf seinem Handy zeigte.
Dabei bemühte er sich wirklich, denn er wollte seinen väterlichen Freund nicht enttäuschen, auch wenn der es einem mit seinen deutschen Tugenden nicht immer leicht machte, diesem Anspruch zu genügen. Aber er hatte sich um Karim gekümmert, als der eine Vaterfigur brauchte, und daraus war eine Freundschaft geworden, auch wenn sie rund vierzig Jahre trennten. Eine Freundschaft – und eine lukrative Geschäftsbeziehung. Ständig hatte Lipaire irgendwelche Aufträge für ihn, kleine Erledigungen, deren Entlohnung Karim stets eisern beiseitelegte. Jedenfalls den Teil davon, mit dem er nicht seine Mutter unterstützte. Genau deswegen war er so nervös, als ihm klar wurde, dass er wieder zu spät kommen würde, was einen Vortrag Lipaires zur Folge haben würde, der ihm …
»Mein Guter, sagen Sie mir: Was habe ich heute im Ort verpasst?«
Karim Petitbon zuckte zusammen, als die Stimme seines Fahrgastes ihn aus seinen Gedanken riss. Er hatte die alte Dame in seiner Eile ganz vergessen. Doch nun drehte er sich um und lächelte die Frau an, die da mit ihrem struppigen, schwarzen Pudel auf der Bank des Wassertaxis saß. Irgendwie hatte er einen Draht zu Lizzy Schindler, auch wenn sie mit weit über achtzig fast viermal so alt war wie er. Karim mochte ihren Akzent. Irgendjemand hatte ihm erzählt, sie komme ursprünglich aus Österreich. Sogar ihren Hund Louis Quatorze, der mittlerweile unter noch schlimmeren Hüftproblemen als sein Frauchen litt, hatte er irgendwie ins Herz geschlossen.
In seinen Augen war sie eine echte Dame mit Stil und Größe. Viele im Ort sahen das anders und lästerten unverhohlen über sie, wenn sie mit ihren abgetragenen Glitzerklamotten vorbeiflanierte, bemüht, alle in dem Glauben zu lassen, sie führe noch immer das Leben einer Grande Dame an der Côte d’Azur.
»Nein, Madame Lizzy, alles ruhig«, antwortete er. »Na ja, bei den van Mools in der Neununddreißig hing heute der Haussegen schief, weil der Mann sich zu wenig für die neue Katze interessiert und lieber mit dem Boot rausfährt, was seine Frau hasst, seitdem sie so schnell seekrank wird. Und bei Ihnen?«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, hör mir auf, Karim! Saint-Tropez ist nicht mehr das, was es war. Lauter Tagestouristen, kaum mehr Einheimische und vor allem kaum mehr Leute mit Stil, wenn du weißt, was ich meine. Heute muss man sogar schon bei Dior anstehen. Dabei kaufen die doch nichts, sie wollen nur … schauen.« Sie verzog das Gesicht bei dem letzten Wort und schwenkte ein Tütchen der Designermarke vor seinem Gesicht.
Karim nickte lächelnd. Die abgewetzte Dior-Tüte trug Lizzy Schindler schon seit Monaten mit sich herum. Samt Louis fuhr die alte Dame immer wieder hinüber in den mondänen Nachbarort, wo sie sich dann auf eine Bank am Hafen setzte und die Leute beobachtete, um nach ihrer Rückkehr den Bewohnern von Port Grimaud von einem ausschweifenden Jetset-Tag vorzuschwärmen. Karim hatte sie einmal in Saint-Tropez gesehen, allein an einem leeren Baguette mümmelnd. Das Bild hatte ihm einen Stich ins Herz versetzt. »Wir sind da, Madame Lizzy«, verkündete er, machte das Boot an der Anlegestelle am Marktplatz fest und reichte ihr die Hand zum Aussteigen. Obwohl er es furchtbar eilig hatte, nahm er sich Zeit für sie.
»Danke, Karim, du weißt, was sich gehört.« Damit ging sie von Bord.
»Selbstverständlich, Madame«, antwortete er und hievte den altersschwachen Pudel an Land. »Erholen Sie sich gut von Ihrem anstrengenden Tag.«
Lizzy Schindler winkte ihm gönnerhaft und setzte sich schlurfend in Bewegung, wobei sie den störrischen Hund unter lauten »Louiiiiiis«-Rufen hinter sich herzog.
Sofort verfiel Karim in hektische Betriebsamkeit, denn es war bereits eine Minute vor acht, und auch wenn er keinen weiten Weg bis zum Haus in der Rue de l’Île Longue hatte: Er hätte schon einen Helikopter gebraucht, um es noch rechtzeitig zu schaffen.
Nach ein paar Minuten hatte er sein Ziel erreicht und drehte vor dem Anlegesteg an der breiten Terrasse bei. Sie gehörte nicht zu irgendeinem Haus, sondern zum Anwesen der Vicomtes. Es stach aus der Reihe der kleinen, niedrigen Fischerhäuschen heraus. Einst hatte es dem Architekten gehört, der die Stadt entworfen hatte. Und der hatte sich etwas Besonderes gegönnt: nicht weniger als das mit Abstand größte und außergewöhnlichste Anwesen weit und breit. Im Gegensatz zu den anderen wirkte es modern, war dominiert von einem rechteckigen Turm samt Fahnenmast und lag auf einer Art Halbinsel, vor der sich mehrere Kanäle zu einem kleinen Hafenbecken formierten. Das Gelände besaß einen weitläufigen Garten mit Palmen und einer ausladenden Schirmpinie sowie gleich mehrere Anlegestege für Boote, die im Moment jedoch alle unbenutzt waren. Das Beste aber, fand Karim, war die Bootsgarage, in die man vom Kanal aus einfahren konnte, um direkt ins Haus zu gelangen. So etwas gab es nur einmal in Port Grimaud, auch wenn die Einfahrt für sein Wassertaxi ein wenig zu eng war. Er musste vorn an einem der Liegeplätze festmachen.
Als er das Boot vertäute, tauchte über ihm ein Schatten auf. Karim musste sich ein Grinsen verkneifen, als Guillaume Lipaire vorwurfsvoll auf seine Armbanduhr tippte.
»Junge, Junge! Schon mal geschaut, wie spät es ist?«
Karim zog die Schultern hoch. »Würd ich ja, aber bei dem bisschen, was du mir zahlst, kann ich mir einfach noch keine Rolex leisten.«
»Sparen liegt dir wohl nicht?«
»Nicht so wie dir.« Karim Petitbon zog sein Handy heraus und kontrollierte die Uhrzeit: sechs Minuten nach acht. »Oje, du hast recht, in der Zeit hättest du ja locker noch zwei Flaschen geborgten Wein zischen können.«
»Eineinhalb. Schön, dass du’s einsiehst. Nächstes Mal bitte pünktlich, ja?«
»Jawoll, sofort, schnell, schnell.« Karim salutierte zackig und lachte. Guillaume konnte seine deutsche Herkunft beim besten Willen nicht verleugnen, sosehr er sich auch bemühte, für einen Franzosen gehalten zu werden. Doch seine überzogene Pünktlichkeit verriet ihn immer wieder.
Der Junge schwang sich auf den hölzernen Steg, wo er mit Guillaume abklatschte. Der stand offensichtlich unter Strom. »Also, pass auf: Die Pflegerin vom alten Vicomte hat mich heute früh angerufen. Sie kommen schon morgen an.«
»Verstehe. Wer denn alles?«
»Alle, Karim, alle!«
»Oh, das hatten wir ja schon lange nicht mehr, oder?«
»Du sagst es. Das Haus war bis letzte Woche vermietet, und ich bin noch nicht zur Endreinigung gekommen. Wir müssen uns sputen, hörst du, Junge?«
»Geht klar, auch wenn wir bei dem riesigen Kasten eine Weile beschäftigt sein werden. Aber vielleicht ist ja ein Expresszuschlag drin?« Weil von Lipaire keine Antwort kam, fragte Karim: »Hast du schon angefangen?«
Sein Gegenüber schüttelte den Kopf und deutete auf die Zigarre in seiner rechten Hand. »Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.«
»Bin ich also eigentlich zu früh, hm?«
Sie warteten, bis er fertig geraucht hatte, durchschritten den Garten bis zum gepflasterten Bereich, der direkt ans Haus grenzte, dann schloss Guillaume Lipaire die Terrassentür auf. »Nimm dir am besten erst mal die oberen Räume vor.«
Mehr musste er nicht sagen, sie waren ein eingespieltes Team, und die Aufgabe war immer die gleiche: Alles, was nicht ins Haus gehörte, wurde entfernt, damit nichts mehr auf eine Vermietung hinwies, wenn die tatsächlichen Eigentümer zurückkamen.
»Staubsaugen müsste man vielleicht noch.«
Karim nickte und ließ seinen Blick durch die offene Wohnhalle wandern. Hier, auf der untersten Ebene, standen einige Ledersessel und zwei Sofas um einen niedrigen Couchtisch herum. An der Stirnseite befand sich ein offener Kamin. Man sah den Möbeln an, dass sie aus den Siebzigerjahren stammten, dennoch war alles gepflegt und wirkte ziemlich teuer. An den Wohnbereich schloss sich eine offene Küche samt Tresen mit ledernen Barhockern an, die deutlich neuer als der Rest des Inventars aussahen. Der Essbereich war um drei Stufen erhöht, und Karim fragte sich, wozu man dort eine weitere Feuerstelle brauchte. In der Mitte stand ein mächtiger ovaler Esstisch mit antiken Holzstühlen. Aus dem Wohnzimmer führte eine offene Treppe in die obere Etage, wo sie in eine Art Galerie mit hölzernem Geländer mündete. Dort lagen die Schlafräume der Familie. Es war, zumindest für die beengten Verhältnisse in dieser Stadt, fast ein Schloss, wie Karim auch heute wieder beeindruckt feststellte.
»Träumst du gerade, oder brauchst du noch irgendwas?« Lipaire riss ihn aus seinen Gedanken.
»Ich frage mich nur gerade, was du in der Zwischenzeit machst.«
»Mein Lieber, ich trage die Verantwortung für die Zwischenvermietungen, das ist Bürde genug.«
Das war natürlich übertrieben, das wusste Karim, auch wenn Lipaire immer behauptete, es erfordere »umfangreiche Koordination, um das volle Potenzial der Häuser auszuschöpfen«. Schließlich tue es denen nicht gut, wenn sie dauernd leer standen. Außerdem hatte sich offenbar noch nie jemand bei ihm beschwert.
»Also dann: Die Aufgaben sind verteilt, jeder geht an seine Arbeit.« Damit ließ Lipaire sich in einen der Korbsessel fallen und betrachtete mit glänzenden Augen die gläserne Vitrine mit den wertvollsten Weinen der Familie, während sich Karim seufzend den Staubsauger aus der Abstellkammer holte und nach oben ging.
Keine fünf Minuten später kehrte er ins Erdgeschoss zurück, wo Lipaire eben eine edel aussehende Flasche mit billigem Rotwein aus einem TetraPak auffüllte.
»Werden sie das nicht merken?«
»Bisher ist es immer gut gegangen. Es ist ja keiner von den ganz edlen aus dem Glastresor gewesen.« Er zeigte grinsend auf den Weinschrein, wie er ihn immer nannte. Karim wollte schon wieder nach oben, da drehte er sich noch einmal um. »Beinahe hätt ich’s vergessen: Du hast doch vorher gemeint, es soll alles raus, was nicht reingehört.«
»Ja, natürlich.«
»Wirklich alles?«
Lipaire seufzte. »Na komm! Du machst das doch nicht zum ersten Mal.«
»Der Typ auch?«
»Welcher Typ denn?«
»Der da liegt.«
»Wo?«
»Na oben. Soll der auch weg, oder kann der bleiben?«
Guillaume Lipaire sah ihn verständnislos an, dann folgte er ihm in die erste Etage.
»Merde«, zischte Lipaire.
Karim nickte und musterte beunruhigt seinen Freund, dessen gut gebräuntes Gesicht auf einmal ganz blass wirkte. Eine Weile standen sie nur da und schauten auf den Mann, der in einem der Schlafzimmer ausgestreckt auf dem Boden lag und an die Decke zu starren schien. Wobei er kein einziges Mal blinzelte. Er trug einen ziemlich zerknitterten, hellen Sommeranzug und ausgetretene Segelschuhe.
»Ist der tot?«, flüsterte Karim.
»Sieht so aus, irgendwie.«
»Merde.«
»Ist er schon kalt? Oder … starr?«
»Denkst du etwa, ich habe ihn angefasst?«, kiekste Karim und schüttelte so heftig den Kopf, dass seine schwarzen Haare in alle Richtungen flogen. »Vielleicht atmet er noch«, sagte er schließlich.
»Sieht für mich nicht so aus.«
Wieder schwiegen sie eine Weile und horchten in die Stille, ob der Mann vor ihnen irgendein Geräusch von sich gab.
»Man müsste mal den Puls fühlen«, schlug Lipaire vor.
»Ich sicher nicht.«
»Ganz ruhig. Es handelt sich nur um einen Verblichenen, keinen Untoten.« Der Junge wich einen Schritt zurück, als Lipaire auf den Mann zuging und ihn mit dem Fuß in die Seite stupste. »Tatsächlich schon ein bisschen steif in den Gliedern.«
Karim spürte, wie sein Puls sich beschleunigte. »Warst du nicht früher Arzt?«
»Nein, Apotheker.«
»Kannst du ihn dann nicht …?«
Jetzt kniete sich Lipaire zu dem leblosen Körper und kontrollierte den Puls. »Mit Wiederbelebung kommen wir bei ihm nicht mehr weit«, konstatierte er und kratzte sich am Kopf. »Ich hatte das noch nie. In keinem der Häuser.«
»Ist das einer von denen, an die du vermietet hast?«
»Nein, die sind schon letzte Woche abgereist. Dann würde der nicht mehr so frisch aussehen.«
Karim spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg. »Ob den jemand abgemurkst hat?«
»Hm, könnte sein.« Lipaire sah sich den Toten genauer an. »Ich bin da aber kein Experte. Bin ja nicht von der Polizei.«
»Sollten wir die nicht rufen?«
Lipaire tippte sich an die Stirn. »Und was erklären wir denen? Dass ich als gardien mein Gehalt aufbessere, indem ich ohne Wissen der Besitzer deren Ferienhäuschen untervermiete? Und du mich dabei tatkräftig unterstützt?«
»Na ja, das vielleicht nicht, aber wir könnten uns ja eine Geschichte überlegen, die …«
»Karim!«, zischte Lipaire. »Wenn rauskommt, was wir hier treiben, muss ich in ein noch kleineres Zimmer ziehen – und zwar im Knast. Und du kannst von Glück reden, wenn sie dich in der Pariser banlieue als Drogenkurier brauchen können, klar?«
»Können wir ihn dann nicht einfach hierlassen? Ich meine, wir haben ja nichts zu tun mit der Sache.«
»Dann fliegt doch trotzdem alles auf, wenn hier erst mal die Polizei rumschnüffelt.«
Petitbon schluckte. Wo Guillaume recht hatte, hatte er recht. Man konnte sich normalerweise auf seine Lebenserfahrung verlassen.
»Aber wenn den Typen hier wirklich jemand gekillt hat? Dann sind die vielleicht bald auch hinter uns her, Wilhelm.«
Lipaire musterte den Toten noch einmal. »Nein, sieh doch nur, wie friedlich er aussieht, Karl.«
»Ich heiße Karim.«
»Und ich Guillaume.«
Darüber konnte man streiten, aber dafür war gerade nicht der richtige Moment, fand Petitbon.
»Komm schon, wir müssen ihn wegbringen.«
»Aber das ist illegal.«
»Genau wie alles andere, was wir hier so machen.«
Wieder ein Punkt, in dem er dem Deutschen nur schwer widersprechen konnte. »Und wohin bringen wir ihn? In eines der anderen Häuser in deinem gardien-Bezirk?«
»Zu riskant. Früher oder später muss er da wieder weg.«
Karim überlegte eine Weile und verkündete: »Wir lösen ihn in Salzsäure auf.«
»Du schaust zu viele Krimis.« Nachdenklich blickte Lipaire aus dem Fenster. »Natürlich, das ist es«, entfuhr es ihm plötzlich heiser.
»Was denn jetzt? Verbrennen?«
»Nein, besser.«
»In feine Scheibchen schneiden und an die Fische verfüttern? Vielleicht können wir uns beim Metzger so eine Maschine ausleihen, die …«
»Jetzt überleg doch mal, Karim. Wo sind wir denn hier, hm?«
»In Port Grimaud natürlich.«
»Exactement. Und wo würde man einen Toten wohl an einem solchen Ort verstecken?«
»In einer Eisdiele?«
»Im Wasser!«
»Wasser, klar«, gab der Junge zurück und schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Wollte ich auch gerade vorschlagen.«
Eine halbe Stunde später hatten sie nicht nur im Expressverfahren die Endreinigung des Hauses durchgeführt und sämtliche Spuren ihres Besuches beseitigt, sondern auch den Toten fein säuberlich in eine Plane von Karims Boot eingeschlagen, das Päckchen notdürftig verschnürt, ins Erdgeschoss verfrachtet und von der Terrasse auf eine der Bänke im Wassertaxi gehievt. Zum Glück war es mittlerweile stockfinster und auf dem Kanal kaum Verkehr. Nur hier und da saßen ein paar Leute im Kerzenschein auf den Terrassen und nahmen einen Schlummertrunk.
»In was für einer friedlichen Gegend wir doch leben, findest du nicht auch?«, schwärmte Lipaire und machte das Tau vom Anlegesteg los – als auf einmal das Blubbern eines Schnellboots zu hören war. Keine zehn Sekunden später tauchte es in ihrem Blickfeld auf.
»Oh nein«, zischte Karim.
»Schnell, runter von der Bank mit ihm«, flüsterte Lipaire, und der Junge beförderte den stillen Fahrgast mit einem raschen Fußtritt zu Boden.
Das andere Boot drosselte den Motor, und Karim blickte nervös zu seinem Freund, der jedoch im gleichen Moment erleichtert ausatmete. »Nur Polizei«, sagte er und winkte der zerknitterten Gestalt am Steuerrad zu. Karim tat es ihm gleich, die Gestalt deutete einen Salut an, der Motor röhrte wieder auf, und der Polizist verschwand so schnell, wie er gekommen war.
»Da haben wir noch mal Glück gehabt«, sagte Petitbon, als das Städtchen nur noch eine Lichterkette am Horizont war und sie die Mitte der ausgedehnten Bucht erreicht hatten, deren Eckpunkte die Orte Sainte-Maxime, Saint-Tropez und Port Grimaud bildeten. »Dass du ihm auch noch gewinkt hast, obwohl wir eine Leiche dabeihaben! Ich hab mir beinahe in die … du weißt schon.«
»Gelernt ist gelernt.«
»Und wenn er irgendetwas gewittert hat?«
»Der? Sicher nicht, ist ja beileibe nicht die hellste Lampe im Leuchtturm.«
Karim grinste. Das stimmte natürlich, jedes Kind hier kannte Marcel Durand, den alle nur commissaire Marcel nannten. »Trotzdem. Was, wenn er unseren Mitfahrer schon sucht?«
»Ach was, als ich eben am Fringale vorbeikam, saß er mit zwei blonden Touristinnen da und hat seine Dienstwaffe bestaunen lassen. Mach dir mal keine Gedanken. Und jetzt: raus mit dem blinden Passagier.«
Karim stoppte den Motor. »Hier?«
Lipaire zuckte mit den Achseln. »Warum nicht? Spricht was dagegen?«
»Keine Ahnung.«
»Siehst du!«
Guillaume Lipaire packte das Bündel an einer Seite und hob es ein Stück an. Petitbon kam ihm zögernd zu Hilfe. Was um alles in der Welt tat er nur? War es nicht eine völlig andere Nummer, einen Toten verschwinden zu lassen, als seinem Freund hin und wieder bei seinen Vermietungen zur Hand zu gehen und das Taxiboot für Privataufträge und Freizeitfahrten zu nutzen? Vor ihnen in der Plane lag ein Mann, über dessen Ableben sie rein gar nichts wussten. Den sie noch dazu nicht einmal selbst um die Ecke gebracht hatten. Ob sie nicht doch besser die Polizei …?
»Hast du vor, mir zu helfen, oder soll ich mir an dem Brocken endgültig den Rücken versauen?«
Karim wischte seine Zweifel beiseite und packte das Paket an der anderen Seite, wobei ein Handy herausrutschte. Als sie bis drei gezählt hatten, platschte der Körper ins Wasser neben dem Boot. Der Junge bückte sich schnell, ließ das Smartphone in seine Hosentasche gleiten und sah dem Leichnam nach. Karim hatte in seiner Kindheit sämtliche Lucky-Luke-Hefte verschlungen und beschloss, in alter Westernmanier kurz Einkehr zu halten, um ein paar Worte zu sprechen, während der namenlose Verblichene in die ewigen Jagdgründe einging. Doch die störrische Leiche durchkreuzte seine Pläne: Sie dachte offensichtlich nicht daran unterzugehen. Stattdessen dümpelte sie im Wasser herum und trieb zurück zum Boot. Stirnrunzelnd sahen sich Petitbon und Lipaire an.
»So ein Querulant.«
»Ein was?«, fragte Karim.
»Ein sturer Hund.«
»Wieso geht der nicht unter? In Filmen funktioniert das doch auch.« Er raufte sich die schwarzen Haare. »Wir können ihn nicht einfach treiben lassen, sonst liegt er morgen früh am Strand oder landet im Netz vom alten Olivier.« Damit zeigte er auf das Fischerboot, das in der Ferne gerade an ihnen vorbeiknatterte.
»Und meine Plane noch dazu!«
»Vielleicht müssten wir ihm nur einen kleinen Schubs geben, und er überlegt es sich anders. Hast du irgendwas Langes dabei? Ein Ruder vielleicht?«
Karim ging zum Bug und holte den Bootshaken, der an einer langen hölzernen Stange befestigt war. Damit konnte man sich im Notfall an einen Steg oder ein anderes Boot heranziehen – oder eine Leiche unter Wasser drücken, wenn es nötig war. Er reichte das Teil an Lipaire weiter und nahm sich selbst eines der Paddel, die unter den Sitzbänken verstaut waren. Mit vereinten Kräften drückten und schlugen sie nun auf das Paket ein, was lediglich dafür sorgte, dass sie beide klitschnass wurden.
»Olivier für Karim, bitte kommen«, schepperte es da auf einmal aus dem Funkgerät.
»Da geh ich besser mal hin«, erklärte der Junge, hastete zu seinem Cockpit und antwortete: »Karim hört?«
»Ist euch der Saft ausgegangen, oder warum müsst ihr rudern?«, kam als Antwort aus dem Gerät. Karims Kehle wurde trocken. »Bin gerade an euch vorbei, braucht ihr Hilfe? Sind die Akkus leer?«
»Ich … nein, wir … machen nur eine Sicherheitsprüfung. Sind jetzt Vorschrift, diese … Nachtübungen.«
»Wird alles immer komplizierter«, schimpfte Olivier und beendete das Gespräch mit einem gebrummten »Over«.
»Wir müssen ihn beschweren«, beschloss Lipaire. »Haben wir irgendetwas an Bord, was dazu taugt?«
»Nur meine Batterien«, antwortete Karim. »Aber die können wir schlecht hier mit ihm im Golf versenken. Wobei … ich hätte da eine andere Idee: Nathalie.«
»Deine Mutter?«
»Die heißt Naima, das solltest du langsam wissen.«
»Ach, stimmt.«
»Nathalie heißt das Wrack, das auf dem Meeresgrund seit Jahren vor sich hinrostet. Wenn ich das richtig sehe, befinden wir uns ziemlich genau darüber.«
»Jetzt verstehe ich …«
Petitbon zog sich bis auf die Boxershorts aus, schnappte sich eine wasserdichte Taschenlampe, begab sich zum Toten ins Wasser und schlang ein weiteres Seil mehrmals um ihn, bis er aussah wie ein überdimensionierter Rollbraten. Dann holte er tief Luft und tauchte die knapp zehn Meter zu dem gesunkenen Schiff hinunter, die Leiche hinter sich im Schlepptau. Unten knotete er das Seil an einem Teil der alten Reling fest, dann kehrte er wieder an die Oberfläche zurück.
»Du hast ja ’ne Lunge wie ein Thunfisch«, empfing ihn Lipaire.
»Fische haben keine Lungen.« Keuchend hievte er sich zurück an Bord.
»Jaja, du kleiner Schlaumeier. Dann eben wie ein Wal. Und du hast ihn sicher vertäut, da unten?«
»Mit meinem besten Seemannsknoten.« Und dem einzigen, den er richtig beherrschte, fügte er in Gedanken hinzu, aber das ging Lipaire nichts an. Genauso wie das Handy des Toten, das er in seiner Hose spürte, als er sich die Klamotten wieder anzog. Sein Freund würde es ihm sonst abknöpfen, aber er wollte es lieber schnell zu Geld machen.
»Dann können wir ja unseren langen Arbeitstag beruhigt mit einem kühlen Gläschen Wein im Café Fringale beenden. Du bist mein Gast. Haben wir doch prima hinbekommen: Das Haus ist makellos, unser Freund schlummert am Meeresgrund – die Vicomtes können also getrost kommen.«
Hart am Wind
»He, Yves, pass auf, das Kleid ist nagelneu und war noch nicht auf Instagram.«
Marie blickte zu ihrer Tochter Isabelle, die mit einem Glas Lillet Rosé an Deck stand. Mit der anderen Hand hielt sie ihr Mobiltelefon weit von sich gestreckt, um eines der Fotos zu schießen, mit denen sie ihre täglich wachsende Follower-Schar begeisterte. Marie vermutete, dass ihr Neffe Yves das Boot deshalb so ruckartig manövrierte, damit sich der Inhalt des Glases auf das neue Kleid seiner Cousine ergießen würde. Schon lange hatte sie den Verdacht, dass er Isabelle ihren Erfolg in den sozialen Medien neidete. Nicht, dass er in diesem Bereich sonderlich aktiv gewesen wäre, aber Aufmerksamkeit, die jemand anderem als ihm zuteilwurde, bereitete ihm schlechte Laune. Das war schon immer so gewesen. Bei der Beerdigung seines Vaters, Maries älterem Bruder Antoine, hatte er vor allem deshalb so laut geschluchzt, weil niemand Notiz von ihm genommen hatte, dachte sie manchmal.
Seufzend rückte Marie den ausladenden Strohhut zurecht, den eine Windböe ihr beinahe vom Kopf geweht hätte. Dann ließ sie ihren Blick mit einem spöttischen Lächeln über das Deck der hölzernen Jacht gleiten. Das hier hätte ein Familienausflug sein können, der jedem Glamour-Magazin zur Ehre gereicht hätte. Sie selbst vorn am Bug, ihr in der Mittagssonne leuchtendes Kleid gebläht von der erfrischenden Brise, ein Stück weiter Isabelle in ihrem knappen Kleidchen, der stets ein wenig zu elegant gekleidete Yves am Steuerrad und in der Mitte der Fixstern, um den diese Ego-Planeten kreisten: ihr Vater, der Patriarch Chevalier Vicomte, in strahlend weißem Sommeranzug mit Panamahut. Der Rollstuhl, in dem er saß und für den extra eine Haltevorrichtung auf dem Boot angebracht worden war, wirkte wie ein Thron. Marie bewunderte ihn dafür, dass er selbst in diesem fortgeschrittenen Stadium körperlichen Verfalls noch so eine Grandezza ausstrahlte. Sie hoffte, dass ihr das Schicksal dereinst ähnlich gewogen sein würde. Nur auf Bernadette, die Pflegerin in ihrer weißen Dienstkleidung, die mit puppenhaft starrem Lächeln hinter ihrem Vater stand, immer darauf wartend, dass er einen Wunsch äußerte, könnte sie gut verzichten.
Für Marie Yolante Vicomte, Chevaliers älteste Tochter, seit Antoines Tod seine Stammhalterin, war der Stolz, den ihr Vater ausstrahlte, Ziel und Auftrag zugleich. Und der Maßstab, an dem sie ihr Leben auszurichten hatte. Nein, korrigierte sie sich. Nicht nur sie selbst. Sie alle. Da fiel ihr Blick auf Henri, der eben die steile Treppe aus der Kabine der Comtesse heraufkam, wie die Jacht hieß. So hatte Papa ihre Mutter immer genannt. In seinen abgewetzten Shorts und dem halb heraushängenden Hemd wirkte Henri eher wie einer ihrer Angestellten. Doch auch er war ein Sohn des Patriarchen. Er setzte sich halb auf die Reling und blickte rauchend auf das türkisblaue Meer. Es schien ihn nicht zu stören, dass der Qualm zu seinem Vater hinüberzog, der schon mehrmals ostentativ gehustet hatte. Marie hatte alle Mühe, sich eine Bemerkung zu verkneifen. Denn darauf wartete Henri nur, da war sie sich sicher. Er ließ keine Gelegenheit aus, ihr und allen anderen zu zeigen, wie egal ihm die Familie war. Dabei glaubte sie ihm kein Wort. Für sie war es nur Ausdruck seiner Frustration. Darüber, dass er, obwohl ein Jahr älter als Marie, ganz unten in der Rangfolge stand. Denn obgleich Chevalier sein Vater war, hatte er eine andere Mutter – eine in jeder Beziehung gewöhnliche Frau. Eine Tatsache, die sich beim Anblick von Maries Halbbruder nicht verleugnen ließ.
Die nächste ruppig gesegelte Wende brachte auch Marie kurz aus dem Gleichgewicht. »Yves, bitte, jetzt streng dich doch ein kleines bisschen an.« Sie verstand nicht, warum er die Segel nicht einholte, schließlich verfügte das Boot über einen Motor, mit dem es deutlich leichter zu navigieren war. Aber Yves musste eben immer und überall beweisen, was er alles konnte.
»Jetzt hart am Wind bleiben«, rief ihr Vater kehlig über das Deck. Sie wusste nicht, was das in diesem Moment bedeuten sollte, ob es überhaupt etwas bedeutete. Wahrscheinlich war es nur ein Satz, der gerade durch sein Gehirn gefegt war, das immer eigenartiger funktionierte, mal völlig klar, messerscharf und blitzgescheit, mal träge und ganz weit weg. So oder so: Sie liebte diesen sechsundachtzigjährigen Mann. Bedingungslos. Und wenn er sie, wie vor ein paar Tagen, zusammenrief, um in Marseille ihre Jacht zu besteigen und in ihr gemeinsames Sommerhaus nach Port Grimaud zu segeln, dann kamen sie alle. Fast alle zumindest. Sie war Realistin genug, zu wissen, dass ihm die anderen nicht aus der gleichen Zuneigung heraus folgten wie sie selbst, sondern dass ihre Gefolgschaft andere Gründe hatte. Furcht vor seinem Zorn etwa, vor seiner Unberechenbarkeit. Immer stand die unausgesprochene Drohung im Raum, dass er jeden jederzeit aus seinem Testament streichen könne.
Marie wischte diesen Gedanken beiseite und versuchte, den Törn zumindest ein wenig zu genießen. Es war lange her, dass sie gemeinsam gesegelt waren. Seit dem Tod ihrer Mutter kam es nur noch selten zu solchen Ausflügen.
»Magst du auch ein Gläschen, Schwesterherz? Hilft, das alles hier zu ertragen.« Henri hielt ein Glas und eine Flasche hoch.
Marie schüttelte den Kopf und ging zu ihrem Vater. »Ist dir kalt, Papa?«, fragte sie, auch wenn es fast dreißig Grad waren. Dabei blickte sie vorwurfsvoll die Pflegerin an, als hätte sie die Frage eigentlich stellen müssen.
Chevalier Vicomte griff nach ihrer Hand.
Sie umschloss sie, fühlte seine papierne Haut, die zerbrechlichen Glieder.
»Nein, mein Engel«, hauchte er. Sie blickten eine Weile aufs Meer, den Hafen von Saint-Tropez, den sie eben passierten, bis schließlich die Silhouette von Port Grimaud auftauchte.
»Wo ist eigentlich Clément?«
»Hm?« Marie hatte genau verstanden, aber sie brauchte noch ein paar Sekunden Zeit für die Antwort.
»Warum ist Clément nicht gekommen, Marie Yolante?«, wiederholte ihr Vater.
Sie wusste noch immer nicht, was sie antworten sollte, also schwieg sie.
»Mein Lieblingsbruder ist vorgestern verschwunden«, rief stattdessen ihre Tochter. »Mal wieder. Niemand weiß, wo er sich rumtreibt. Mal wieder.«
»Isabelle!« Marie warf ihr einen eisigen Blick zu, und die junge Frau verstummte.
»Habt ihr schon in den einschlägigen Schwulenklubs nachgefragt?«, mischte sich Henri ein.
»Hör auf damit«, zischte Marie mit schneidender Stimme.
Er hob abwehrend die Hände. »Schon gut, Schwesterherz.« Dann leerte er sein Glas und goss sofort nach.
Halbschwester, hätte sie gerne erwidert, aber sie wusste, dass ihr Vater das missbilligt hätte. Er hatte eine Schwäche für diesen verkrachten Autor. Vielleicht war es auch nur die Erinnerung an das Flittchen, das sich von ihm hatte vögeln lassen, um diesen Bastard in die Welt zu setzen.
»Lass das, Idiot«, hörte sie da Isabelles schrille Stimme. Henri hatte ihr seinen Kopf auf die Schulter gelegt und grinste dümmlich in ihre Handykamera. Angewidert verzog ihre Tochter das Gesicht und schob ihn zur Seite. »Du stinkst nach Alkohol, Onkel.«
»Isabelle, Ausdruck!«, mahnte Marie.
»Entschuldige: Halbonkel.«
»Lass mich doch auch auf ein Foto mit drauf«, insistierte Henri mit schwerem Zungenschlag.
»Spinnst du? Ich hab einen Ruf zu verlieren.« Sie drückte ihn endgültig weg und wollte noch etwas hinzufügen, da rief Yves: »Wir laufen ein. Haltung bitte, wie es sich für die Vicomtes gehört.«
Das war eigentlich Chevaliers Text, und Marie wusste, dass Yves ihn damit auf den Arm nehmen wollte, doch da ihr Vater nicht reagierte, ließ sie es unkommentiert.
»Lasst uns den Paparazzi ein tolles Bild liefern«, schob Yves nach.
Zu gerne würde er ein Foto von sich in den Hochglanzmagazinen finden, das wussten alle. Doch die nahmen von den Vicomtes schon lange keine Notiz mehr, da halfen all seine Regatten und wohlkalkulierten Eskapaden nichts.
Als sie die Hafeneinfahrt von Port Grimaud passierten und an den ersten Häusern entlangglitten, standen sie stumm an der Reling, das Mahagoni der imposanten Jacht in der Sonne glänzend. Auch wenn sie zu dieser Mittagsstunde kaum Menschen sah, so glaubte Marie doch wahrzunehmen, wie sich die Köpfe der Bewohner in ihren Häusern drehten, wie ihnen aus den Fenstern die Blicke zuflogen. Blicke, die zu sagen schienen: Die Vicomtes sind wieder da. Sie genoss diesen Augenblick und hätte gerne gewinkt, doch sie unterdrückte den Impuls und setzte stattdessen eine gelangweilte Miene auf. Obwohl es in ihrem Inneren brodelte, weil sie den Nachhall der alten Größe ihrer traditionsreichen Familie spürte.
Dann knirschte es lautstark, und die Comtesse kam abrupt zum Stehen. Beinahe hätte Marie das Gleichgewicht verloren und sich unsanft auf die Planken gelegt. Yves war der schlechteste Skipper, den man sich vorstellen konnte! Isabelle saß mit offenem Mund auf ihrem Hosenboden, das Kleid nun doch getränkt vom Lillet. Henri brach in schallendes Gelächter aus, während Marie sorgenvoll zu ihrem Vater im Rollstuhl blickte, der sich jedoch keinen Millimeter bewegt hatte.
»Scheiße, geht’s eigentlich noch mit eurem Protzkahn?«, zeterte eine Frauenstimme vom Wasser.
Sie blickten über die Reling. Ein Pärchen in einem dieser unsäglichen Elektroboote, die sich die Touristen für teures Geld ausliehen, um damit eine Runde durch die Kanäle zu dümpeln, entfernte sich gerade lauthals schimpfend. Marie bemerkte eine Schramme im Mahagoni der Comtesse.
»Mann, Yves, manchmal muss selbst ein Vicomte von seinem hohen Ross runtersteigen und ausweichen«, sagte Henri und wischte sich mit einem Taschentuch über die dunklen Flecken auf seinen Shorts, die der Cognac bei der Kollision hinterlassen hatte.
»Wollte ich ja. Aber das Ruder ist irgendwie verklemmt. Der Kahn lässt sich kaum noch steuern.«
»Das sagst du doch auch immer, wenn du deine Gegner bei den Regatten rammst.«
»Aber diesmal stimmt es.«
Ein sonores Hupen unterbrach ihr Streitgespräch. Alle drehten sich zum Heck und blickten auf ein rostiges Schiff mit ausladendem Baggerarm direkt hinter ihnen. Damit wurden die Kanäle regelmäßig vom Schlamm befreit.
»Was man sich heutzutage alles bieten lassen muss«, schimpfte Isabelle.
Da meldete sich die knarzende Stimme ihres Großvaters: »Das wird sich bald erledigt haben.«
Mit Müh und Not erreichten sie schließlich einen der Anlegestege ihres Hauses. Der Turm überragte die anderen Häuser um ein Geschoss und fiel mit seinen klaren, modernen Linien ziemlich aus dem Rahmen. Etwas Besonderes eben, für eine besondere Familie. Als Yves die Comtesse unter Quietschen und Knarzen an den Kai manövrierte, hatten sie endlich die volle Aufmerksamkeit der Menschen der benachbarten Häuser.
Henri schüttelte den Kopf. »Mon Dieu, Yves, es reicht, glaubst du, der Kratzer von eben fühlt sich einsam?«
»Das Ruder klemmt, wie oft soll ich es noch sagen?«
Jetzt mischte sich Marie ein. »Dann reparier es gefälligst so schnell wie möglich. So können wir unmöglich noch einmal auslaufen. Was sollen die Leute denken?«
»Reparieren? Ich?«
»Weißt du jemand anderen?«
»Ich glaube schon.« Yves holte sein Mobiltelefon heraus und wählte eine Nummer. Während er sprach, gingen die anderen durch den Garten ins Haus. Marie liebte es, von der Seeseite aus hier anzukommen und durch die Terrassentür direkt in den repräsentativen Wohn- und Essbereich der Familienvilla zu gelangen.
»Ist es nicht schön, wieder hier zu sein, Papa?« Sie strich ihrem Vater zärtlich über die Wange, als die Pflegerin den Rollstuhl im Wohnzimmer abstellte.
Als Antwort gab er nur ein Brummen von sich und deutete auf die große Vitrine mit den edelsten Weinflaschen, die sie besaßen. Sie stand mitten im Raum und trennte den Essbereich vom ein paar Stufen darunter liegenden Salon ab, in dem die Couch und die originalen, cognacfarbenen Designersessel aus der Entstehungszeit des Hauses standen.
»Bringen Sie meinem Vater ein Glas Wasser, Bernadette«, wandte sich Marie an die Frau. »Wir ziehen uns inzwischen kurz zurück und machen uns frisch.« Wie auf Stichwort beeilten sich alle, in ihre privaten Zimmer in den oberen Etagen zu kommen. Dort kam Marie Henri entgegen. Er hatte es so eilig, dass er fast in sie hineingerannt wäre. »Was ist denn mit dir los?«, fragte sie.
»Ich … muss …«
»Ist dir schlecht?« Sie roch seinen Cognac-Atem.
Er nickte nur und stürmte in eines der Bäder.
Sie blickte ihm nach. Schon in diesen wenigen Stunden hatte er ihr wieder klar vor Augen geführt, dass er nicht hierhergehörte. Nicht in dieses Haus. Nicht in diese Familie.
Marie war froh, als sie die Tür hinter sich zuziehen konnte und endlich allein war. Sie ließ sich aufs Bett fallen. So viel Zeit hatte sie schon lange nicht mehr mit der Familie verbracht. Und nach der Überfahrt von Marseille hierher wusste sie auch wieder, weshalb. Sie bedauerte, dass es so war. Dennoch hatte auch sie für die Anreise mit der Jacht plädiert. Sie waren schließlich nicht irgendwer, stahlen sich nicht durch die Hintertür.
Es klopfte. Marie setzte sich auf und rief ein »Herein«, worauf Isabelle ins Zimmer trat.
»Wann kommt dieser Barral?«
»In einer Stunde.«
Ihre Tochter blies hörbar die Luft aus. »Erst? Und was sollen wir so lange machen?«
»Was du machst, weiß ich nicht, vermutlich wieder etwas mit deinem Telefon, aber ich …« Sie wurde vom Türgong unterbrochen.
Die Miene ihrer Tochter hellte sich auf. »Oh, es scheint, wir haben Glück.«
Marie folgte ihr die offene Treppe hinunter und öffnete die Haustür. Vor ihr stand ein junger Mann mit dunklem Teint und schwarzem Haar. Sie hatte ihn schon einmal gesehen. Irgendein Bediensteter der Gemeinde. Wie war noch sein Name gewesen?
»Petitbon, endlich!« Yves tauchte hinter ihr auf. »Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen.«
»Aber Sie haben mich doch gerade erst angerufen.«
»Keine Ausreden. Kümmere dich um die Comtesse. Irgendwas ist mit dem Ruder.«
Karim deutete eine Verbeugung an. »Sofort, Monsieur.«
Er wollte eintreten, da stoppte ihn Yves mitten in der Bewegung: »Was soll das werden?«
»Ich wollte zum Boot.«
»Durchs Haus? Bist du betrunken? Du gehst außen herum.«
»Verzeihung, Monsieur.«
»Hör auf, dich immer zu entschuldigen. Und, Karim?«
Der junge Mann drehte sich noch einmal um. »Ich will diesmal keine Abdrücke von deinen ausgelatschten Tretern auf den Planken sehen, klar?«
»Natürlich. Versprochen, Monsieur Yves. Ich werde die Comtesse behandeln, als sei sie meine Mutter.«
Yves blickte die Umstehenden an und grinste schief. Dann zuckte er mit den Achseln und ging ins Haus.