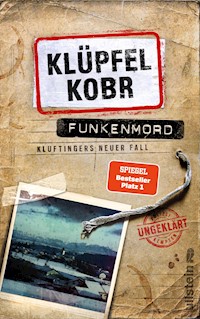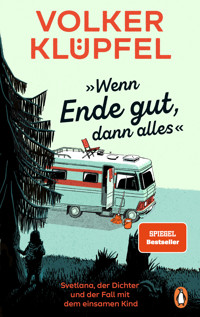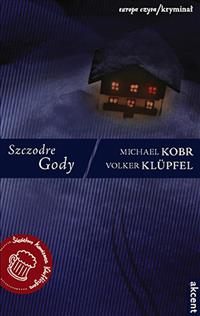9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kommissar Kluftinger kratzt den Lack von der Allgäu-Idylle: der zweite Fall für den grantigen Ermittler mit Kultfaktor Ein Ritualmord im beschaulichen Allgäuer Wald? Unerhört! Kommissar Kluftinger nimmt das fast persönlich – und taucht in seinem zweiten spannenden Fall tief in die Vergangenheit ein. Wenn es im Heimatkrimi-Genre jemals einen echten Sympathieträger gegeben hat, ist es sicher nicht Kommissar Kluftinger. Das Allgäuer Urgestein ist misstrauisch gegen jede Neuerung, meistens schlecht gelaunt und überdies auch noch unheimlich pedantisch. Doch wenn Klufti eines kann, dann knifflige Mordfälle lösen. Eine Leiche in einem Waldstück gibt der Polizei düstere Rätsel auf. Eine drapierte Krähe auf dem Toten sieht verdächtig nach Ritualmord aus. Kluftinger übernimmt die Ermittlungen und verstrickt sich zunehmend in einer Geschichte, die weit in die abgrundtief dunkle Vergangenheit des Allgäus hinabreicht. »Mystisch, spannend, witzig. Wieder ein großer Krimi.« – Augsburger Allgemeine Mit ihrer Regionalkrimireihe um Kommissar Kluftinger stürmen die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr seit Jahren die Bestsellerlisten. Wenn ihre kantige Hauptfigur ermittelt, folgen ihr Millionen Leser mit angehaltenem Atem und so manchem lauten Lacher. Machen Sie Krimi-Urlaub im Allgäu – und lernen Sie Kempten von seiner mörderischen Seite kennen! Beste Unterhaltung mit Humor und Spannung – dafür stehen bisher zwölf Kommissar-Kluftinger-Bücher. Blicken Sie hinter die Kulissen der Idylle, die man von Postkarten und aus Reiseprospekten kennt, und entdecken Sie Ihren neuen Lieblingskommissar von der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95058-9 Januar 2017 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2006 Erstausgabe: Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen 2004 Umschlagkonzeption: semper smile, München Umschlaggestaltung: Cornelia Niere Umschlagabbildungen (Collage): L’aura Colan / Getty Images und picture-alliance / dpa Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Prolog
Als er an diesem kühlen Herbstmorgen die Haustüre öffnete und nach draußen trat, blieb er für einen Augenblick auf der Schwelle stehen. Wie ein ausgewaschenes Leintuch spannte sich der Nebel über die Felder, eine Decke, die die Erde noch nicht dem Tag preisgeben wollte. Er legte den Kopf in den Nacken und blickte in den dämmrigen, von grauen Wolkenfetzen übersäten Himmel. Durch die Nase sog er die frische Morgenluft in seine Lungen, streckte sich und entblößte seine verfaulten Zähne. Dann knöpfte er den obersten Knopf seiner groben Filzjacke zu, zog sich seinen speckigen, zerschlissenen Hut tief ins Gesicht, griff sich die Axt, die in einem Baumstumpf gleich neben der Eingangstüre steckte, und stapfte los.
Es war kalt, aber er ging schnell, und schon bald hatten sich kleine Schweißtropfen auf der Stirn des stämmigen, breitschultrigen Mannes gebildet. Er hatte seinen Blick starr auf den Boden gerichtet, beobachtete, wie sich die Nebelschwaden teilten, wenn er sie mit seinen Stiefeln durchschritt, wie sie kleine Wirbel bildeten, die um seine Knöchel tanzten. Er mochte den Nebel.
Er hatte sich noch keine zweihundert Schritte vom Haus entfernt, da blieb er stehen. Er dachte, er hätte ein Geräusch gehört, aber jetzt, als er stand, war es absolut still um ihn herum. Die wenigen Geräusche, mit denen die Natur zu solch früher Stunde ihr Erwachen ankündigte, wurden vom Nebel beinahe gänzlich verschluckt. Er sah an seinem Haus vorbei auf den Hang. Dort war kein Nebel mehr. Als sein Blick auf den großen, gelblich-weißen Tuffstein fiel, verzogen sich seine Lippen zu einem spöttischen Grinsen. »Nicht mit mir«, flüsterte er leise. Da könnten sie ihm noch so oft mit dem Tod drohen. Er hatte keine Angst. Dann setzte er sich wieder in Bewegung.
Nur das Schmatzen seiner Schuhe, die bei jedem Schritt ein wenig in den schlammigen, vom Dunst aufgeweichten Boden einsanken, begleitete ihn. Als er den Waldrand erreicht hatte, blickte er sich noch einmal um. Irgendetwas war heute anders. Er konnte es nicht erklären, denn alles schien wie immer. Wie gestern und vorgestern. Und den Tag davor. Alle Tage davor. Doch so plötzlich, wie das Gefühl gekommen war, verschwand es auch wieder. Er machte einen Schritt nach vorn und die Dunkelheit des Waldes verschluckte ihn.
Er hatte wie immer Mühe, sich den Weg durch das dämmrige Dickicht zu bahnen. Seine Augen waren nicht mehr die besten. Als ob es etwas nützen würde, rieb er mit seinen schmutzigen, rissigen Fingern über seine Lider. Dann sah er vor sich die Lichtung. Er beschleunigte seinen Schritt etwas. Schnell fand er den Baum, den er tags zuvor mit einem Kreuz markiert hatte. Er blieb stehen, zog die Jacke aus und breitete sie neben sich auf dem Boden aus. Dann löste er den Knoten seines Halstuchs und legte es auf die Jacke.
So machte er es immer.
Anschließend schnappte er sich die Axt mit beiden Händen, holte weit aus und schlug zu. Er war ein kräftiger Mann und schon beim ersten Hieb drang die Schneide tief ins Holz der Tanne. Die Rinde splitterte mit solcher Wucht, dass er kurzzeitig die Augen schließen musste. Er holte erneut aus. Die Axt pfiff durch die Luft, und noch bevor sie den Stamm traf, hörte er hinter sich ein Knacken. Als habe jemand im Gehen einen Zweig zertreten. Dann wurden die Geräusche vom Krachen der Axt übertönt, die nun, etwas schräger angesetzt, einen dicken Keil aus dem Baumstamm heraushieb.
Er ließ die Axt stecken und drehte sich um. Normalerweise hätte er dem Ganzen keine Aufmerksamkeit geschenkt, denn der Wald kannte viele Geräusche und nur Menschen, die nicht dauernd hier zu tun hatten, fanden sie unheimlich. Aber heute war es anders. Wieder meldete sich dieses merkwürdige Gefühl. Als er sich umdrehte, meinte er, einen Schatten hinter dem Stamm einer Fichte zu erkennen. Doch er hatte keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, denn ihr Stamm kam mit rasender Geschwindigkeit auf ihn zu. Er machte nicht einmal mehr einen Schritt zur Seite. Sein Mund öffnete sich, aber er kam nicht mehr dazu, zu schreien. Das letzte, was er in seinem Leben sah, war das Splittern der Rinde, als der Baum seinen Schädel spaltete.
Man schrieb das Jahr des Herrn 1657.
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod,
Er mäht das Korn, wenn’s Gott gebot;
Schon wetzt er die Sense,
Daß schneidend sie glänze,
Bald wird er dich schneiden,
Du mußt es nur leiden;
Mußt in den Erntekranz hinein,
Hüte dich schöns Blümelein!
»Mei, schau, Erika, jetzt hab ich auch magische Kräfte«, sagte Kluftinger spöttisch zu seiner Frau, als er die Türe ihres Hauses in Altusried aufschloss. »Ich steck den Schlüssel ins Schloss und – Abrakadabra schwuppdiwupp – ist die Türe auf!« Er drehte sich zu ihr, blickte sich in beide Richtungen um, neigte seinen Kopf und flüsterte verschwörerisch: »Das kommt von der Kraft des Illerwassers.«
Seine Frau seufzte. »Ja, ja. Mach du dich ruhig über mich lustig. Macht mir nix aus. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, ist mir rechtschaffen egal.«
Erika Kluftinger ließ sich von den Spötteleien ihres Mannes nicht die Laune verderben: Immerhin hatte sich der Kemptener Kriminalkommissar einen Bonus erwirtschaftet, weil er – freilich nachdem sie einige Überzeugungsarbeit geleistet hatte – mitten unter der Woche einen Tag frei genommen hatte, um mit ihr zum Einkaufen nach Immenstadt zu fahren. Dort konnte man das nach Erikas Überzeugung viel gemütlicher als in Kempten, wo es – erst recht jetzt, nachdem das große neue Einkaufszentrum gebaut worden war – ziemlich hektisch zuging. Positiv schlug sich auf seinem Bonus-Konto außerdem die Tatsache nieder, dass er sich recht kooperativ gezeigt hatte, als es darum gegangen war, drei neue Hosen – darunter sogar zwei Jeans –, mehrere Hemden, zwei Pullover und eine wetterfeste Übergangsjacke zu kaufen.
Und was Erika nicht minder froh machte, war, dass auch sie einige Kleidungsstücke gefunden hatte, die, so versicherte sie glaubhaft, absolute Schnäppchen waren, was nun wiederum ihn sehr froh machte.
Anschließend hatte sie die Idee gehabt, noch beim so genannten »Ort der Kraft« am Illerwehr bei Martinszell vorbeizufahren. Ihren Ehemann dazu zu überreden, war für sie ein Akt der Kraft gewesen, aber schließlich hatte er eingewilligt. Dass sie es tatsächlich geschafft hatte, erfüllte sie zu einem Drittel mit Freude, zum anderen Drittel mit dem sicheren Gefühl, ihren Gatten ganz gut dorthin lenken zu können, wo sie ihn haben wollte, und zum letzten Drittel mit blanker Verwunderung.
Denn er rühmte immer seine – beruflich bedingte – Rationalität und hielt ihr gerne lange Vorträge darüber, dass die Donnerstags-Horoskope in der Zeitung, die sie für besonders zutreffend hielt, auch nicht besser waren als der ganze andere »Astrologie-Schmarrn«.Vielleicht lag seine Nüchternheit daran, dass er als Kripo-Kommissar beruflich damit beschäftigt war, Rätsel zu entschlüsseln und nur an das zu glauben, was er sah.
Der »Ort der Kraft« war für Kluftinger also ein rotes Tuch und das nicht erst, seit die Medien das Thema vor einigen Jahren entdeckt hatten. Laufend war damals über Menschen berichtet worden, die zu dem kleinen Wehr am Fluss pilgerten, weil dort am Wasser angeblich ein besonderes Kraftfeld bestehe, das Kranke heilen und auch sonst für Entspannung und mehr Lebenskraft sorgen würde. Er hatte als Kind oft an der Iller gespielt, weniger Schnupfen als andere Kinder hatte er deswegen aber nicht gehabt. Kluftinger tat solche »Spintisierereien« in Diskussionen gerne mit der lapidaren Feststellung ab, dass er Heilung entweder in bewährten Hausmitteln oder gleich in Penicillin finde, Entspannung beim Bergsteigen oder gleich vor dem Fernseher suche und Lebenskraft ihm vor allem seine geliebten Kässpatzen mit Zwiebeln oder gleich der abendliche halbe Liter Bier aus seinem Steingutkrug verleihe.
Aber nun hatte er sich extra für seine Frau frei genommen, was kostete es ihn da schon, noch an diesem Kraftort vorbeizufahren? Außerdem boten sich dort zahlreiche Gelegenheiten, sie mit ihrem »Geistermist« aufzuziehen.
Erika schob ihn durch die Haustür in den Flur und lehnte ihre beiden Einkaufstüten an das alte Nussbaumbüffet, das bei Kluftingers einfach »Gangschrank« hieß und Platz für allerlei Zettel, das Telefon und sonstige »wichtige Dinge« bot und somit das organisatorische Zentrum ihres Haushalts bildete. Mit dem Zwetschgendatschi, den sie auf dem Heimweg gekauft hatten, ging Erika in die Küche und stellte das Päckchen neben die Kaffeemaschine.
»Jetzt gibt’s dann einen Kaffee, ich zieh bloß noch schnell die Jacke aus«, rief sie ihrem Mann zu, der an der Garderobe stand und seine Hausschuhe anzog, hölzerne Clogs mit Kuhfellkappen.
»Soll ich Sahne schlagen?«, fragte Erika, obwohl sie die Antwort ihres Mannes bereits wusste, der sagen würde, ein Zwetschgendatschi ohne Sahne sei wie Kässpatzen ohne Zwiebeln.
»Ja freilich. Ein Zwetschgendatschi ohne Sahne ist ja wie ein Kraftort ohne Kraft.«
»Du wirst schon noch merken, dass da was dran ist«, sagte sie und hielt die Kaffeekanne in die Spüle. Doch als sie das Wasser aufdrehte, tat sich nichts. Der Hahn gab lediglich ein dumpfes Röcheln und Gurgeln von sich. »Du, da geht kein Wasser!«, rief Erika.
»Was? Gibt’s doch gar nicht. Schau doch mal im Bad.«
»Schau du doch mal, bitte.«
Kluftinger stand seufzend auf, schlurfte mit seinen Holzpantinen zum Badezimmer, öffnete die Tür und trat ein. Er war noch keine zwei Schritte gelaufen, da spürte er, wie es ihm die Beine wegzog. Er klammerte sich an die Klinke, um nicht hinzufallen. Als er wieder sicher stand, sah er den Grund für sein Manöver: Der ovale, eigentlich beige Baumwollteppich hatte eine bräunliche Farbe angenommen, eine leere Shampooflasche, die Kluftinger am Morgen neben den Abfalleimer gestellt hatte, trieb neben der ganz und gar mit Wasser bedeckten Waage.
»Kreuzkruzifix!«, schrie Kluftinger, als er sich des Ausmaßes der kleinen Katastrophe bewusst wurde. Ihm war ganz schlecht. Diese Sauerei! Unter dem Waschbecken hatten sich bereits einige Fliesen abgelöst, aus der Wand dahinter plätscherte noch immer Wasser auf den Boden. Das Bad, für das sie eigentlich eine Fußbodenheizung vorgesehen hatten, die aber wegen Kluftingers Furcht vor einem Bruch der Heizungsrohre nie eingebaut worden war, war gegenüber den anderen Räumen etwa fünf Zentimeter abgesenkt. Das dadurch entstandene Bassin war komplett mit Wasser voll gelaufen.
Wie gelähmt starrte Kluftinger auf den überschwemmten Boden. Dann drehte er sich hastig um und stürzte an der Küchentür vorbei in den Keller. Wieder rutschte er beinahe aus, diesmal auf den dunkelgrünen Fliesen der Treppe.
»Kruzifix, im Bad … « war die einzige Information, die er seiner Frau im Vorbeieilen zukommen ließ.
Erika eilte zum Badezimmer. Nachdem ihr Mann den Haupthahn zugedreht hatte, gesellte er sich zu ihr. Wortlos standen sie an der Tür und blickten hinein. Wenigstens plätscherte kein Wasser mehr, vor ihnen lag ein stiller, beschaulicher See. Kluftinger hatte vorsichtshalber auch den Hauptschalter im Sicherungskasten umgelegt, schließlich standen Waschmaschine und Trockner bei ihnen im Bad, nicht im Keller, wo, wie Kluftinger fand, Hochwassergefahr immer gegeben war.
»Das darf doch nicht wahr sein«, sagte Erika schließlich mit jammervoller Stimme und lehnte sich an die Schulter ihres Mannes, der aus dem Keller bereits zwei Eimer und ein Kehrblech mitgebracht hatte. Er tätschelte Erika kurz den Kopf und bückte sich dann, um Schuhe und Socken auszuziehen und sich die Hose hochzukrempeln.
»Jetzt wird erst mal das Wasser aufgeputzt, dann schau ma weiter«, sagte er mit fester Stimme. Er ächzte leicht, als er in die Knie ging, die erste Schaufel durchs Wasser gleiten ließ und die Flüssigkeit, die sich in der Kehrschaufel gesammelt hatte, in den Eimer schüttete. Erika folgte ihm ein wenig zögerlich und trat mit den Hausschuhen in ihren hausgemachten Badesee.
Kluftinger schüttete gerade den ersten Eimer grau-bräunlichen Wassers in die Toilette, als er ein leises Klingeln hörte, das aus seiner Windjacke kam. Als er keine Anstalten machte, darauf zu reagieren, sagte seine Frau auffordernd: »Dein Handy … «
»Da werd ich jetzt grad rangehen, ja wahrscheinlich! Das wird schon wieder aufhören.« Kluftinger bückte sich wieder und begann, den zweiten Eimer mit Wasser zu füllen. Aber das Telefon hörte nicht auf und trällerte weiterhin Toccata und Fuge in d-Moll von Bach. Kluftinger selbst hätte gar nicht gewusst, dass der eigentlich ganz ansprechende Klingelton vom berühmten Barockkomponisten stammte, aber Dr. Martin Langhammer, der Altusrieder Arzt, dessen Frau mit Erika befreundet war und den er wegen seiner Wichtigtuerei stets nur als »Zwangsbekanntschaft« bezeichnete, hatte den Kommissar einmal darauf hingewiesen.
»Ja Herrschaftszeiten!« Schimpfend schob sich Kluftinger an seiner Frau vorbei und ging, um mit seinen nassen Füßen möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, auf Zehenspitzen zur Garderobe, zog umständlich das Telefon heraus und blaffte ein missmutiges »Ja, was gibt’s denn?« ins Handy.
Mehr hörte seine Frau nicht von ihm. Nur »Ja um Gottes Willen« und dann einige gebrummte »mhm« deuteten darauf hin, dass sich am anderen Ende der Leitung noch ein Gesprächspartner befand. Mit einem »Bin sofort da« beendete er das Gespräch.
Sichtlich betroffen zog er sich seine Strümpfe wieder an und schlüpfte in die Schuhe. Seine Frau, die ihn die ganze Zeit aus dem Türrahmen des Badezimmers beobachtet hatte, fragte ihn nicht, wohin er wolle. Sie sagte nur: »Was Schlimmes?«
Kluftinger erhob sich, ging langsam zum Bad und antwortete angespannt: »Ich muss unbedingt weg.« Dann drehte er sich um und ging. Nach ein paar Schritten wandte er sich noch einmal um: »Tut mir Leid, dass ich dich mit dem … «, er ließ seine Hand unbestimmt in der Luft kreisen, » … allen allein lassen muss. Glaub mir, es geht nicht anders.«
Erika spürte, dass es ernst war.
***
Die Fahrt nach Rappenscheuchen dauerte nur etwa zehn Minuten, aber Kluftinger kam die Zeit länger vor. Sein schlechtes Gewissen plagte ihn. Nicht nur, weil er seine Frau in dieser prekären Lage allein gelassen hatte, sondern vor allem, weil er regelrecht erleichtert war, dass er sich mit dieser Situation jetzt nicht mehr herumschlagen musste.
Sein schlechtes Gewissen sollte ihn jedoch nicht lange beschäftigen. Als er die letzten Kurven vor dem kleinen Weiler Zollhaus zwischen Krugzell und Kempten nahm, sah er schon von weitem die Polizeiwagen rechts oberhalb der Straße. Blaulichter zuckten hektisch, ein Krankenwagen stand mit geöffneten Türen in der Einfahrt des ersten Bauernhofes auf dem kleinen Hügel, mindestens ein Dutzend Polizisten lief geschäftig zwischen den Autos umher. Neben den uniformierten Beamten schien auch die Spurensicherung bereits vor Ort zu sein. Als Kluftinger seinen Blick wieder auf die Straße richtete, erschrak er. Mit aller Kraft stieg er aufs Bremspedal und stemmte seine Arme gegen das Lenkrad. Die Reifen quietschten, als das Auto schlagartig an Geschwindigkeit verlor. Die vor ihm fahrenden Autos bewegten sich nur noch im Schritttempo. Offenbar waren die Fahrer sehr interessiert an dem, was oberhalb der Straße vor sich ging.
Die Zornesröte stieg Kluftinger ins Gesicht. Wütend hämmerte er mit der Faust auf die Hupe. Wenn es etwas gab, was er hasste, waren es Gaffer. Sein Vordermann deutete ihm mit einigen Handbewegungen an, was er von seinem Gehupe hielt, beschleunigte dann aber seine Fahrt wieder. Wenn Kluftinger Zeit gehabt hätte, hätte er ihn gerne für die eben begangene Beleidigung zur Kasse gebeten.
Auf der Höhe der großen Gewächshäuser, bei denen er sich immer fragte, ob man für die dort kultivierten Pflanzen keinen besseren Platz hatte finden können als direkt neben einer viel befahrenen Straße, bog der Kommissar rechts ab.
Er zog die Brauen nach oben bei dem Gedanken, dass er Rappenscheuchen, an dem er ungezählte Male auf dem Weg nach Kempten vorbei gefahren war, nun auf diese Weise kennen lernen würde. Der etwas beleibte, grauhaarige Polizist, der an der Abzweigung dafür sorgte, dass sich keine Unbefugten mehr nach oben verirrten, winkte den Kommissar durch. Sie kannten sich von vielen gemeinsamen Dienstjahren und so nahm Kluftinger es ihm auch nicht übel, als er ihm ein »Das war aber ganz schön knapp grad!« durchs offene Fenster zurief. Obwohl die Ortschaft, die eigentlich nur eine Ansammlung weniger Höfe war, erst etwa hundertfünfzig Meter oberhalb der Abzweigung begann, dort, wo die Straße nach links in die hügelige Landschaft bog, musste Kluftinger seinen Wagen schon nach wenigen Metern abstellen. Bis hier unten standen die Polizeiautos.
Wortlos, nur mit einem Kopfnicken als Gruß, schob sich der Kommissar zwischen den Fahrzeugen an den Beamten vorbei. Er versuchte, leise zu schnaufen, denn er wollte nicht, dass die Kollegen merkten, dass ihm schon dieser kleine Aufstieg zu schaffen machte. Obwohl er sich seit Jahren zu keiner Diät durchringen konnte, wollte er nicht als unsportlich oder gar dick gelten.
Eine vertraute Stimme riss ihn aus seinen Gedanken.
»So, haben wir dich bei der Kneippkur erwischt?«, fragte Maier, der ihn von oben hatte kommen sehen und ihm entgegengelaufen kam.
Kluftinger verstand nicht. Erst als er Maiers Blick an seinen Beinen entlang nach unten wandern sah, war ihm klar, was sein Kollege meinte. Er hatte seine Hose umgeschlagen, damit sie beim Abschöpfen des häuslichen Hochwassers, dem er gerade entkommen war, nicht nass wurde. Das Wasser hatte sich aber doch einige Zentimeter nach oben gesogen, wie er jetzt bemerkte. Kluftinger ging in die Hocke, um das Beinkleid wieder auf die gesellschaftlich erwünschte Länge zu bringen.
Von unten blickte er Maier an und fragte, dessen Scherz ignorierend: »Was gibt’s denn?«
Er horchte den Worten nach und fand auf einmal, dass sie irgendwie deplatziert klangen. So fragte er auch zu Hause, wenn er sich nach dem Essen erkundigte.
Maier blickte seinen Chef von oben herab an. Er blähte erst die Backen auf und stieß dann hörbar die Luft aus, bevor er ihm antwortete. Sein Grinsen war verschwunden; der hagere Mann mit dem gezimmerten Scheitel wirkte nun noch blasser als sonst. Kluftingers Magen krampfte sich zusammen. Er merkte, dass es ernst war. Schnell stand er auf. Zu schnell, denn es wurde ihm kurzzeitig schwarz vor Augen. Seine Knie drohten nachzugeben, und um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, hielt er sich an Maier fest. Als er sich wieder im Griff hatte, ließ er seinen Kollegen schleunigst wieder los.
»Also … ?«, hakte er ungeduldig nach und ging weiter zwischen den Polizeiwagen in Richtung der Menschentraube, die sich auf dem Hof versammelt hatte.
»Ganz ehrlich, du kennst mich. Ich neige doch nicht zu Übertreibungen … «
Kluftinger fand, dass jetzt nicht der passende Zeitpunkt war, um Charakterfragen zu diskutieren. Deswegen antwortete er Maier mit einem gelogenen »Nein«.
»Genau. Aber das, also wirklich … da ist sogar mir schlecht geworden.«
Kluftinger prüfte misstrauisch das Gesicht seines Kollegen. Er war sich nicht sicher, was er mit dem »sogar mir« hatte andeuten wollen. Vielleicht überinterpretierte er die Äußerung auch. Kluftinger bog jetzt in den Hof ein. Das Bauernhaus und die Ställe lagen links von ihm, nach rechts öffnete sich der Hof auf eine Wiese, an die sich ein kleines Waldstück anschloss.
Nur noch einen kleinen Hügel musste er erklimmen, dann war er bei der Menschenansammlung angelangt. In der Mitte erkannte er die blaue Baseballkappe von Georg Böhm, dem Pathologen. Und sah, wie sie wieder verschwand. Offenbar hatte sich der Arzt gebückt, zur Leiche, die der Kommissar dort vermutete.
»Liegt sie da?«, fragte er. Als er keine Antwort bekam, blickte er sich um. Maier war nicht mehr zu sehen. Kluftinger hatte gar nicht gemerkt, dass er am Zaun stehen geblieben war. Er sprach etwas in sein Diktiergerät.
Kluftinger ging noch ein paar Schritte, dann machte er mit einem Räuspern die Beamten auf sich aufmerksam. Als sie sich umwandten, erschrak er. Ihre Gesichter waren blass, einige atmeten schwer. Sie gingen auseinander, so dass in der Mitte eine Gasse frei wurde. Kluftinger sah jetzt, dass vor ihnen am Boden eine leblose Gestalt auf dem Rücken lag. Die Beine steckten in grauen Flanellhosen, die über und über mit Dreck besudelt waren. Der Blick auf den Oberkörper war ihm noch von Georg Böhm versperrt, der sich über den Toten gebeugt hatte. Als er merkte, dass die Umstehenden zurückwichen, wandte er den Kopf. Die blauen Augen unter der Baseballkappe wirkten trüb. Er stand auf und klopfte dem Kommissar im Vorbeigehen kraftlos auf die Schulter. Der Blick, der ihn traf, war voller Mitleid. Das verwirrte den Kommissar, doch er hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Sein Blickfeld war nun frei. Und was er sah, raubte ihm für einen Moment den Atem.
Er presste die Zähne zusammen und blickte starr auf das Bild, das sich ihm bot. Vor ihm lag ein Mann, nur mit einer Hose, Strümpfen und einem ehemals weißen, jetzt ziemlich verdreckten Hemd bekleidet. Sein Kragen war von verkrustetem Blut dunkelrot, fast schwarz gefärbt. Eine tiefe, klaffende Wunde zog sich quer über den Hals des Mannes. Auf der Stirn klebte ebenfalls eingetrocknetes Blut. Doch das war es nicht, was den Kommissar und offenbar auch die anderen Kollegen so aus der Fassung brachte. Auf der Brust des Mannes lag, mit ausgebreiteten Flügeln, ein toter, pechschwarzer Vogel.
Kluftinger wollte schlucken, doch sein Mund war zu trocken. Er wartete darauf, dass ihm schlecht wurde, doch selbst dafür war er zu geschockt. Ihm war sofort klar, dass ihn diese Geschichte noch lange in Atem halten würde. Sie alle.
Er drehte sich um. Die anderen waren ein paar Schritte zurückgewichen. Er blickte in fragende Gesichter. Es schien ihm, als erwarteten sie, dass er irgendetwas sagte. Etwas, das die Situation weniger bedrückend erscheinen lassen würde. Aber ihm fiel nichts ein. Er drehte sich wieder zur Leiche. Schloss kurz die Augen. Zum einen, um die Fassung wieder zu gewinnen. Zum anderen, um endlich seinen Verstand arbeiten zu lassen. Das würde ihm auch helfen, das grausige Bild in den Hintergrund zu drängen. Aber er fand nichts, wo er hätte einhaken können. Die Todesursache schien offensichtlich: die aufgeschnittene Kehle, das viele Blut, das … Er stockte: Er hatte einen Punkt gefunden, an dem er ansetzen konnte. Er öffnete die Augen. »Das Blut … «, sagte er leise zu sich selbst.
»Respekt. Wir haben wesentlich länger gebraucht, um uns von dem Anblick zu erholen.«
Der Kommissar zuckte zusammen, als er die Worte dicht neben seinem Ohr vernahm. Georg Böhm, der Pathologe, war unbemerkt neben ihn getreten. Er nahm seine Baseballkappe ab, fuhr sich mit der Hand durch sein dichtes, dunkelbraunes Haar und zeigte mit der Kappe in Richtung der Leiche.
»Wir meinen doch beide dasselbe, oder?«, fragte er.
»Das Blut. Wo ist das Blut?«, antwortete Kluftinger mit Blick auf den Toten.
Böhm schnalzte anerkennend mit der Zunge. »Abgesehen von dem, womit sich sein Kragen voll gesogen hat, haben wir nichts gefunden.«
Kluftinger sah ihn entgeistert an.
»Keinen Tropfen«, schob Böhm nach.
Der Kommissar musterte den jungen Arzt. In seinen verwaschenen Jeans, seinen weißen Turnschuhen und der abgewetzten Cordjacke wirkte er irgendwie deplatziert. Ein Grund mehr, ihn sympathisch zu finden, dachte er.
»Er ist also nicht hier ermordet worden«, folgerte er. Er überlegte kurz und fragte dann: »Gibt es irgendwelche Spuren? Von einem Wagen oder so? Irgendwie muss er ja hergekommen sein.«
»Ist jetzt zwar nicht mein Metier, aber so viel ich weiß, hat man nichts gefunden.« Böhm hatte die Hände in den hinteren Hosentaschen vergraben und deutete mit dem Kopf auf die Leiche. »Willst du ihn dir nicht mal genauer anschauen? Ich würde ihn dann gern mitnehmen … «
Kluftinger nickte. Er würde sowieso nicht darum herum kommen, also konnte er es genauso gut schnell hinter sich bringen. Seine Knie knackten, als er rechts von dem Toten in die Hocke ging. Mordopfer waren nichts allzu Ungewöhnliches für ihn, aber auch nicht tägliches Brot für einen Kriminaler im in dieser Hinsicht wirklich recht ruhigen Allgäu. Der Anblick einer Leiche brachte ihn jedenfalls immer aufs Neue aus der Ruhe. Das hier war außerdem anders als alles, was er bislang gesehen hatte. Er kämpfte eine Weile mit sich, dann gestand er es sich ein: Es war unheimlich. Der tote Vogel verlieh der Szenerie eine gespenstische Stimmung. Dazu kam, dass es ein zwar trockener, aber dunstiger Herbsttag war. Die trübe Atmosphäre mit den zaghaften Nebelschlieren, die langsam aus dem Boden krochen, ließen alles noch düsterer erscheinen.
Kluftingers Blick wanderte das verschmutzte Hemd des Mannes weiter nach oben. Die rechte Hand ruhte auf einem viereckigen Blech, das offenbar einem großen Stein als Abdeckung diente. Sein Hemd sah aus, als hätte ihn jemand durch den Dreck gezogen. Die Spuren hätten allerdings auch von einem Kampf stammen können. Der Kommissar erhoffte sich von der Obduktion Aufschluss über diese Frage. Eine Antwort allerdings würde sie nicht geben können: Was sollte der Vogel, eine Krähe, auf der Brust des Opfers? Jemand hatte ihn dort sorgfaltig drapiert: mit gespreizten Flügeln, den Kopf zur Seite gedreht. Was hatte das zu bedeuten? Kluftinger schüttelte den Kopf. Ihn beschlich das ungute Gefühl, dass das hier eine Nummer zu groß für ihn war.
Er betrachtete nun die Halswunde. Ein sauberer Schnitt war das. Und ziemlich tief. Jemand musste ein scharfes Messer zur Hand gehabt haben. Das Gesicht des Mannes wies einige Schürfwunden auf, auf der Stirn hatte er eine kleine Platzwunde und in den schütteren, dunklen Haaren klebte Dreck. Weitere Einzelheiten konnte er nicht erkennen, denn der Kopf der Leiche war von ihm abgewandt. Er näherte sich mit seiner Hand dem Gesicht, um den Kopf herumzudrehen, machte aber mitten in der Bewegung halt. Er wollte den Mann nicht anfassen. Er hätte das bei keiner Leiche machen wollen. Und bei dieser hier schon gar nicht.
Er blickte sich Hilfe suchend um. Böhm stand ein paar Schritte hinter ihm. Er verstand und nickte dem Kommissar zu. Als er sich auf der anderen Seite der Leiche ebenfalls hingehockt hatte, griff er ans Kinn des Toten. Mit einem »Nicht erschrecken« drehte er das Gesicht des Mannes nach oben.
Es nützte nichts, der Kommissar erschrak trotzdem. Das heißt: Eigentlich krampfte sich sein Magen so stark zusammen, dass er Mühe hatte, seinen Inhalt nicht Preis zu geben. Das rechte Auge des Toten war nicht mehr vorhanden. Jedenfalls war das, was davon übrig war, als Auge kaum mehr zu identifizieren. Kluftinger wandte sich ab. Er stand auf und ging schnell ein paar Schritte in Richtung der Bäume. Er tat so, als würde er den Tatort inspizieren, aber er war sich sicher, dass er niemandem etwas vormachen konnte. Direkt hinter den Bäumen fiel das Gelände stark ab, genau wie er es vermutet hatte. Er lehnte sich an einen Baum und atmete tief durch. Nach wenigen Atemzügen glaubte er, sich wieder im Griff zu haben.
»Kannst ihn mitnehmen«, sagte er zu Böhm. Als er sah, wie die Beamten den Vogel von der Brust des Toten hoben und ihn in einen durchsichtigen Plastiksack steckten, stellten sich seine Nackenhaare auf. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hätte er jetzt gern wieder eine Zigarette geraucht.
Er sah sich um. Erst langsam machte der Anblick des Toten den weiteren Eindrücken des Fundorts Platz. Kluftinger suchte nach seinen Kollegen. Maier stand noch immer verloren in der Hofeinfahrt. Strobl hatte er noch nicht entdeckt. Aber auf den wollte er jetzt auf gar keinen Fall verzichten. Er ließ seinen Blick so lange über das Gelände wandern, bis er seinen strohblonden Haarschopf sah. Er stand an der Ecke des Bauernhauses und war in ein Gespräch mit einem bärtigen Mann in Arbeitshose und Gummistiefeln vertieft. Kluftinger winkte, um auf sich aufmerksam zu machen, doch Strobl bemerkte ihn nicht. Stattdessen fühlte sich Maier von seinem Winken angesprochen und ging zögernd auf den Kommissar zu. Dabei huschte sein Blick immer wieder in Richtung der Leiche, die gerade von vier Beamten auf eine Trage gehoben wurde. Kluftinger seufzte und setzte sich ebenfalls in Bewegung, allerdings in Richtung Strobl.
Als er an der Leiche vorbeikam, drehte sich sein Kopf wie ferngesteuert in Richtung des Toten. Der Kopf des Mannes lag nun so, dass seine Halswunde noch weiter auseinander klaffte. Kluftinger wandte sich mit Grausen wieder ab. Doch das Bild vor seinen Augen blieb. Der Kommissar stoppte. Er konnte es sich nicht erklären, aber die Einzelheiten fielen ihm oft erst auf, wenn er den Blick schon abgewandt hatte. Als würde sein inneres Auge viel schärfer sehen. Auch jetzt war es so: Etwas lag in der Wunde.
Er machte kehrt. »Halt, wartet, noch nicht«, rief er den Kollegen zu, die gerade den Reißverschluss des dunklen Plastiksacks zuziehen wollten, in den sie den Toten gelegt hatten. Er beugte sich über den Toten und neigte seinen Kopf hin und her. Er war so konzentriert, dass er gar nicht darüber nachdachte, was er da eigentlich tat. Ohne den Vogel hatte der Anblick des Toten außerdem etwas von seinem Schrecken verloren. Verdutzt sahen ihn die Beamten an. Böhm, der bereits auf dem Weg zum Wagen gewesen war, hatte die Szene mitbekommen und machte kehrt.
»Suchst du was Bestimmtes?«, fragte er.
»Ich weiß nicht. Irgendwas ist da, schau doch mal.«
»Wo? Ich seh nichts!«
Kluftinger zeigte mit dem Finger auf eine Stelle am Hals. Dabei drehte er den Kopf angewidert etwas zur Seite. Jetzt sah Böhm es auch.
Er pfiff anerkennend. »Du musst ja Adleraugen haben.«
Er streifte sich einen Gummihandschuh über und näherte sich der Wunde. Kluftinger ging zwei Schritte zurück und beobachtete, wie Böhm ein pfenniggroßes, weißes Stück Plastik hervorzog. Er stand auf, betrachtete es von allen Seiten und hielt es dann ratlos Kluftinger unter die Nase, was diesen veranlasste, noch weiter zurückzuweichen.
»Was meinst du … ?«
Kluftinger runzelte die Stirn. »Sieht aus wie ein Stück … Papier … vielleicht auch Folie oder so.«
Böhm zuckte mit den Achseln. »Ich schau mir das mal an.«
Mit diesen Worten steckte er seinen Fund in eine Plastiktüte und ließ einen skeptisch dreinblickenden Kommissar zurück.
***
Als Kluftinger bei seinem Kollegen Strobl ankam, stand dieser noch immer bei dem bärtigen Mann. Der saß kreidebleich auf der Bank neben der Eingangstür zum Wohnhaus. Seinen Kopf hatte er in die Hände gestützt, seinen Blick starr auf den Boden gerichtet. Strobl schien etwas ratlos, was er mit ihm anfangen sollte.
Kluftinger fasste ihn an der Schulter und zog ihn ein paar Meter zur Seite.
»Wer ist das?«, fragte er.
»Der Bauer. Er hat ihn gefunden. Scheint ziemlich durch den Wind zu sein. Ich hab versucht mit ihm zu reden, aber bis jetzt ist nicht viel dabei rausgekommen.«
»Ich versuch’s mal.«
Kluftinger ließ sich ebenfalls auf der Bank nieder. Er betrachtete ihn von der Seite. Die Latzhose des Mannes, der vielleicht ein paar Jahre älter als er selbst, also knappe sechzig, sein musste, steckte in dunkelgrünen Stiefeln. Ein grobes, schmutziges Hemd mit Stehkragen schaute darunter hervor, die Ärmel waren hochgekrempelt. Auf seinem Kopf saß ein viel zu kleiner Cordhut. Er sah fast ein bisschen lächerlich aus, wäre da nicht sein Gesicht gewesen. Es war gezeichnet vom Schock. Die Furchen, die sich über die lederne Haut zogen, wurden durch die Blässe des Gesichtes noch betont.
»Einen schönen Hof haben Sie da«, sagte Kluftinger.
Langsam drehte der Mann seinen Kopf in Richtung des Kommissars. Er musterte ihn lange. Kluftinger hielt seinem Blick stand. »Hat schon meinem Großvatter g’hört«, sagte der Bauer leise. »Einer der ersten Höf, die hier g’standen sind.«
»Wie viel Hektar sind’s denn?«
Der Mann überlegte. Sein Gesicht nahm wieder etwas Farbe an. »So dreiundzwanzig, wenn man den kleinen Wald mitzählt.«
Der Kommissar nickte anerkennend. »Kluftinger.« Er streckte ihm die Hand hin.
»Gassner, Albert«, antwortete der.
Kluftinger lächelte. Er hatte nie verstanden, warum die Allgäuer ihren Nachnamen so gerne vor den Vornamen setzten.
Sein Gegenüber nahm an, das Lächeln habe ihm gegolten und verzog ebenfalls das Gesicht. Wie ein Lächeln sah das zwar nicht aus, aber Kluftinger wusste, wie es gemeint war. Der Mann stand unter Schock, das konnte er auch ohne Arzt diagnostizieren. Wenn er erst einmal etwas Ruhe hätte, würden die Ausläufer der Schockwellen auch ihn erreichen, fürchtete er.
»Haben Sie ihn gefunden?«
Die Miene des Mannes verdunkelte sich wieder. »Ja.« Er machte eine lange Pause, dann sagte er: »Sowas hab ich noch nie gesehen. Und ich hab schon viel gesehen.«
»Kennen Sie ihn?«
»Nein. Der war noch nie da.«
»Wie haben Sie ihn denn gefunden?«
»Also, des hat sich so zugetragen«, fuhr er, als er bemerkte, dass Strobl seinen Schreibblock gezückt hatte, in umständlichem Deutsch und dem ihm sichtlich schwer fallenden Bemühen fort, möglichst nach der Schrift zu reden. »Ich war gerade unterwegs zum Mähen da heroben.« Er streckte seine Hand aus und zeigte mit dem Finger auf die Stelle, an der der Tote gelegen hatte.
»Als ich hinkam, lag er dort.« Er sah bei seinen Worten nicht Kluftinger, sondern Strobl an. Deswegen gab der Kommissar seinem Kollegen ein Zeichen, sich zu entfernen. Er wollte mit dem Mann allein reden, die geballte Anwesenheit der Obrigkeit machte ihn offenbar nervös. Strobl verstand und wandte sich mit einem Nicken ab.
»Also, Sie wollten zum Mähen … «, nahm Kluftinger den Faden wieder auf.
Etwas entspannter fuhr Gassner fort: »Jawoll. Ich hab mir gleich gedacht, als ich aus dem Stall rauskommen bin, dass da irgendwas liegt. Ich bin heut den ganzen Tag im Haus und im Stall g’wesen, sonst hätt ich ihn ja schon früher g’sehen.«
»Woher wissen Sie denn, dass er schon früher da gelegen hat?«, unterbrach ihn Kluftinger.
Der Bauer sah ihn mit großen Augen an. »Also … ich … des hab ich mir halt gedacht. Weil den bei Tag doch niemand da umbracht hätt. Des hätten mir doch g’hört. Oder g’sehen. Es kommen zwar nicht viel Leut da vorbei, aber die Straße ist ja auch gleich da unten, oder?«
Es klang, als wollte sich Gassner verteidigen. Kluftinger kannte dieses Phänomen: Selbst der unschuldigste Mensch konnte bei einem polizeilichen Verhör ein schlechtes Gewissen bekommen. Er legte dem Mann deswegen beruhigend seine Hand auf die Schulter. »Schon gut, ich wollt’s ja nur wissen. Alles, was Sie gehört oder gesehen haben, kann für uns wichtig sein. Der Mann scheint wirklich schon länger tot zu sein, die Ärzte meinen, seit letzter Nacht. Für uns wäre halt wichtig zu wissen, wann und wie er hierher gekommen ist.«
»Ach so.« Gassner schien erleichtert. »Ich hab schon gedacht … Ja, also mei Frau und ich, mir haben nix g’hört, in der Nacht. Aber wie g’sagt: Als ich dann naus bin zum Mähen, da hab ich ihn glei g’sehen, wie er auf’m Denkstein g’legen ist.«
»Was für ein Stein?«
»Denkstein, haben wir immer g’sagt. Weil der steht hier schon lang, ich glaub, schon bevor mein Opa den Hof baut hat. ›Denkt’s dran, dass hier mal eine Burg war, Buben‹, hat er immer g’sagt zu uns. Und deswegen haben wir immer Denkstein g’sagt.«
Kluftinger sah noch einmal zu der Stelle hinüber. Sie war etwas erhöht und unter den Bäumen lagen vereinzelt, aber doch so, dass noch eine rudimentäre Linie erkennbar war, große Steine. Er konnte sich gut vorstellen, dass hier einmal eine Burg gestanden hatte. Es hatte früher hier viele solcher Bauwerke gegeben, sein Heimatdorf Altusried führte sogar eine Ruine im Wappen.
Damit war nun auch die Frage geklärt, was der große Stein zu bedeuten hatte, der ihm vorher aufgefallen war.
»Ich habe jetzt erst mal keine Frage mehr an Sie. Aber es kann natürlich sein, dass wir noch mal kommen oder Sie zu uns kommen müssen. Falls Ihnen also noch was einfällt, melden Sie sich.« Der Kommissar wusste nicht, wie oft er dieses Sprüchlein schon aufgesagt hatte.
»Jetzt kümmern Sie sich wieder um Ihre Frau.«
Gassner blickte nach links. Seine Frau saß mit einer geblümten Kittelschürze über einem dunkelblauen Kleid in der offenen Tür eines Krankenwagens und redete mit einer Sanitäterin in weißen Hosen und orangefarbener Weste. Das heißt: Eigentlich redete sie nicht, sie schluchzte ununterbrochen in ein Taschentuch, das sie sich vors Gesicht presste. Gassner sah zu Kluftinger, zuckte mit den Achseln und stand auf.
***
Etwa eine Dreiviertelstunde später saßen Maier, Strobl und Hefele im Büro ihres Chefs. Keiner sagte ein Wort. Alle standen noch unter dem Eindruck des grausigen Fundes. Was Kluftinger hier gesehen hatte, würde ihm für einige Zeit den Appetit rauben, da war er sicher. Im Moment jedenfalls konnte er sich nicht vorstellen, überhaupt jemals wieder einen Bissen hinunterzubringen.
Eine Frage lag in der Luft, doch keiner wollte sie stellen.
Sandra Henske, Kluftingers hübsche, wenn auch manchmal etwas zu grell geschminkte Sekretärin, steckte den Kopf zur Tür herein. Sie wollte fragen, ob sie einen Kaffee machen sollte, schwieg aber ebenfalls, als sie die gedrückte Stimmung bemerkte. Die gebürtige Dresdnerin wusste zwar noch keine Details über den Fall, war aber darüber informiert worden, dass eine Leiche gefunden worden war. Der »Bürosonnenschein«, wie Kluftinger sie einmal genannt hatte, hätte gerne mehr Details erfahren. Sie liebte spektakuläre Fälle im Kommissariat, denn dann lief das Telefon heiß, die Presse rief an, es rührte sich was. Im Moment traute sie sich aber nicht, die Stille mit einer Frage nach Einzelheiten zu durchbrechen. »So schlimm?«, fragte sie deswegen verständnisvoll in Kluftingers Richtung.
»Schlimmer, Fräulein Henske, glauben Sie mir. Viel schlimmer«, antwortete er mit leiser Stimme.
Als sie die Tür wieder geschlossen hatte, räusperte sich der Kommissar, blickte von seinem Schreibtisch aus auf die Kollegen in der Sitzgruppe und stellte endlich die Frage: »Was hat das mit dem Vogel zu bedeuten?«
Sie schauten sich ratlos an. Maier ergriff das Wort: »Ich habe mal einen Film gesehen, da … «
»Ach, hör mir doch auf mit deinen Filmen«, fiel ihm Hefele ins Wort.
»Lass Richard doch ausreden«, schaltete sich Kluftinger ein.
Alle Augen waren nun auf Maier gerichtet, der am Rande der Couch saß und nervös mit den Knöpfen seines Cordsakkos spielte.
»Also, da waren auch so komische Morde und der Täter hat immer einen Hinweis zurückgelassen. So denk ich mir das halt.« Er blickte seine Kollegen unsicher an. Zwei, drei Sekunden war es still, dann sagte Hefele: »Das war jetzt ja ein ganz wichtiger Beitrag.«
»Jeder muss hier sagen können, was er denkt. Und es stimmt schon, was Richard sagt«, verteidigte Kluftinger halbherzig seinen Kollegen.
»Es sieht aus wie ein Rätsel«, fühlte sich nun auch Strobl zu einem Beitrag ermutigt.
»Ein Rätsel, ja«, sagte Kluftinger nachdenklich und spürte, wie er eine Gänsehaut bekam. Dann stand er ruckartig auf und sagte: »Das müssen wir jetzt lösen.«
In geschäftigem Tonfall fuhr er fort: »Zuerst müssen wir natürlich rausfinden, um wen es sich handelt. Gibt es von den Vermisstenanzeigen schon was Neues?«
»Ich kümmere mich gleich mal darum«, sagte Hefele und stand ächzend auf. Kluftinger bemerkte zum ersten Mal, dass sein rundlicher Kollege im Stehen kaum größer wirkte als im Sitzen. »Gut. Ihr zwei setzt euch gleich mal mit der Spurensicherung in Verbindung. Macht denen ein bisschen Druck. Irgendwas müssen die doch finden. Reifenspuren, Fußabdrücke oder so. Ich steig dem Pathologen mal auf die Zehen, dass wir die Ergebnisse möglichst schnell kriegen.«
Als sich alle erhoben hatten und das Zimmer verlassen wollten, fiel Kluftinger noch etwas ein. »Ach ja, das mit dem Vogel halten wir vorerst mal unter Verschluss. Bis wir genau wissen, was es damit auf sich hat, sind wir mit derartigen Informationen vorsichtig. Alles klar?«
Die Kollegen nickten. Sie waren zwar nicht schlauer als vorher, Kluftingers Aktionismus hatte ihnen aber doch das Gefühl gegeben, etwas tun zu können, anstatt ratlos auf bessere Zeiten warten zu müssen.
***
Es war keine halbe Stunde vergangen, da wurde Kluftingers Bürotür kraftvoll aufgestoßen. Hefele kam hereingelaufen. Seine schwarzen Locken wippten mit jedem seiner flinken Schritte. »Ich glaub, ich hab was«, sagte er mehrmals, bis er den Schreibtisch seines Chefs erreicht hatte. Dann legte er ihm wortlos einen Stapel Papier auf die Arbeitsplatte.
Kluftinger sah sich die Blätter an, alles Vermisstenanzeigen: Eine nur mit Bademantel und Nachthemd bekleidete vierundachtzigjährige Frau war aus dem Altersheim im Freudental in Kempten verschwunden, da recherchierten die Kollegen bereits bei den Kindern der Dame. Bereits geklärt hatte sich das Verschwinden eines vierzehn Jahre alten Jungen, der im Internat in Hohenschwangau am gestrigen Dienstag nicht zum Abendessen erschienen war, allerdings noch im Laufe der Nacht in einem Stadel unterhalb der Königsschlösser durchgefroren und von Heimweh geplagt, ansonsten aber völlig unversehrt gefunden worden war.
Der Kommissar hob den Kopf. Er zog die Augenbrauen nach oben und blickte seinen Kollegen fragend an. Dessen stolzes Grinsen verschwand sofort, als er die Ungeduld des Kommissars sah. Er blätterte die Zettel durch, die Kluftinger in den Händen hielt, zog einen bestimmten heraus und sagte: »Den mein ich.« In schwungvoller Handschrift hatte jemand einen Namen und eine Adresse darauf notiert: Gernot Sutter, Stuibenweg 3, Durach.
»Ist er das?«, fragte Kluftinger, der jetzt etwas aufgeregt war.
»Ich weiß es nicht. Seine Frau hat vor kurzem angerufen. Für eine Vermisstenanzeige ist es zwar noch zu früh gewesen, aber der Kollege am Telefon hat sich trotzdem mal die Beschreibung aufgeschrieben. Aussehen, Kleidung – passt alles.«
»Dann nix wie hin«, sagte Kluftinger, schnappte sich den Zettel und eilte mit Hefele aus dem Zimmer.
***
Als Hefele den Dienstwagen aus der Einfahrt des Präsidiums in Kempten Richtung Illerbrücke lenkte, musterte Kluftinger seinen Kollegen von der Seite. Es war sonderbar: Mit ihm war er so gut wie nie unterwegs. Meist nahm er Strobl mit, wenn es auf Dienstfahrt ging, Maier drängte sich ab und zu auf, aber Hefele? Dabei war er ein guter Polizist. Vielleicht blieb er auch lieber im Präsidium: Durch seine geringe Körpergröße und seine ganz und gar nicht geringe Breite wirkte er irgendwie träge. Dennoch wusste Kluftinger nicht, ob er nicht vielleicht gerne öfter vor Ort wäre. Beklagt hatte er sich jedenfalls noch nie. Eigentlich wusste er überhaupt nicht viel über seinen schnauzbärtigen Kollegen. Er nahm sich vor, das zu ändern. Allerdings nicht gerade jetzt, denn der mysteriöse Leichenfund beanspruchte zu viel seiner Aufmerksamkeit.
Da Hefele in Durach aufgewachsen war und seine Eltern noch immer dort wohnten, konnte er seinen Chef zielsicher zum Neubaugebiet unterhalb des Dorfbergs dirigieren.
Sutters Haus lag an einer Wendeplatte, die das Ende einer gepflasterten Spielstraße bildete. Eine Doppelgarage war in den Hang gebaut, darüber lag ein großzügig geschnittenes Haus, dessen Front nur aus Glas und Holz zu bestehen schien. Rechts neben der Garage befand sich ein kleines Mäuerchen, an dem die Zahl 3 in Form einer großen Edelstahlziffer prangte, etwas kleiner darunter stand der Name des Hausherrn.
»Wenn der es ist: Versteckt hat er sich mal nicht!«
Der Kommissar parkte vor dem Garagentor.
Kluftinger läutete. Zu seinem Erstaunen tönte im Haus kein Gong oder eine Orgelsinfonie, er hörte lediglich eine schlichte, mechanische Klingel. Im Haus rührte sich nichts. Noch einmal drückte er den Klingelknopf.
»Ja?«, meldete sich eine leise Frauenstimme über die Sprechanlage. Nun musste er Taktgefühl beweisen, musste einfühlsam sein, psychologisch vorgehen. Die Äderchen an Kluftingers Nase wurden tiefrot. Er fühlte sich nicht wohl, seine Kopfhaut juckte. Todesnachrichten zu überbringen gehörte ganz und gar nicht zu seinen Stärken.
»Kluftinger, Kripo Kempten. Frau Sutter, es geht um ihren Mann«, sagte der Kommissar und bückte sich dabei, um den Mund ganz nah an die Sprechanlage zu bringen. »Würden Sie uns bitte kurz reinlassen?«
Sofort surrte der Türöffner und Kluftinger und Hefele stiegen die grob behauenen Natursteintreppen zum Haus hinauf.
Kluftinger wollte gerade das Hauseck passieren, als ihm ein Basketball vor die Füße rollte. Er hielt kurz inne und dem Ball folgte ein etwa acht- oder neunjähriges Mädchen.
»Oh, zu wem wollen Sie denn? Mein Vater ist nicht da«, begrüßte die Kleine die beiden Beamten und schob gleich eine Frage hinterher. »Wer sind Sie denn eigentlich?«
»Du, wir wollen kurz zu deiner Mama.«
»Ach so, die ist da«, sagte sie und schnappte sich mit einem vorwurfsvollen Blick auf den Kommissar den Ball, den der inzwischen aufgehoben hatte. »Spielst du mit mir?«, fragte sie wesentlich freundlicher in Richtung Hefele, was Kluftinger ärgerte. Mit Kindern konnte er nicht so recht umgehen, er wusste auch nicht wieso.
»Sonst gern, aber jetzt geht das gerade nicht«, erwiderte sein Kollege und erntete von dem Mädchen ein enttäuschtes »Schade!«.
»Na ja, vielleicht ganz kurz«, ließ er sich doch noch erweichen, als er daran dachte, welch schwere Zeit dem Mädchen bevorstand.
Die Kleine ging Hefele und Kluftinger voran zur Haustür, über der ein Basketballkorb angebracht war und vor der ein vielleicht vierzehnjähriger Junge saß. Er hob den Kopf, sah zu den Polizisten auf und grüßte mit einem ernsten »Hallo «.
Noch eine Halbwaise, dachte Kluftinger und fühlte, wie sein Mund trocken wurde.
»Kommen Sie wegen meinem Vater?«
Am Gesicht des Jungen war abzulesen, dass er durchaus mit einer schlechten Nachricht rechnete.
»Ja, wir müssen mit deiner Mutter reden.«
Der Junge nickte und fragte nicht weiter nach.
In diesem Moment öffnete sich die Haustür, vor der allerdings noch ein Schmiedeeisengitter angebracht war, das Frau Sutter aufschloss.
»Kommen Sie … « Frau Sutter war in den Vierzigern, sehr gepflegt und attraktiv. Sie war schlank, hatte dunkelbraunes, schulterlanges Haar und trug einen dünnen schwarzen Rollkragenpullover. Auf ihrer Brust hing ein großer Bernsteinanhänger an einer Goldkette. Auf Kluftinger wirkte sie wie die Zahnarztfrauen im Fernsehen, die irgendwelche Kosmetika anboten. Frau Sutter passte bei genauerer Betrachtung dann aber doch nicht in dieses Klischee: Sie war blass, um die Augen lagen tiefe Schatten, sie wirkte sehr nervös, fast aufgelöst.
Wortlos geleitete sie Kluftinger ins Wohnzimmer und deutete auf eine honigfarbene Ledercouch, auf der er sich niederließ. Hefele war zurückgeblieben, um wenigstens ein paar Körbe mit der Kleinen zu werfen.
»Endlich! Es wird wirklich Zeit, dass sich mal jemand um die Sache kümmert. Das ist ja bodenlos, mein Mann ist verschwunden und keiner fühlt sich dafür zuständig!«
Damit hatte Kluftinger nicht gerechnet: Sie wollte nicht etwa zuerst wissen, ob man etwas über ihren Mann herausgefunden hatte, sie beschwerte sich vielmehr lautstark über die Trägheit der Polizei. Und damit war sie noch nicht fertig.
»Was meinen Sie, wie es mir geht? Können Sie sich das vorstellen? Und die Kinder fragen, was mit ihrem Papa ist. Wir machen uns solche Sorgen, verstehen Sie das? Wir haben Angst!« Frau Sutter hatte sich in Rage geredet, ihre Tonlage stieg mit der Lautstärke.
»Tun Sie doch endlich was«, schrie sie schließlich heraus, bevor sie heftig zu weinen begann.
»Frau Sutter, beruhigen Sie sich bitte, wir sind ja jetzt da.«
»Jetzt, ja, jetzt, nach ewiger Zeit mal.«
Kluftinger war nicht wohl. Er hatte beinahe Angst. Vor hysterischen Frauen, das wusste er, musste man sich in Acht nehmen. In dem Zustand, in dem Frau Sutter sich befand, konnte man nicht vorhersagen, wie sie als Nächstes reagieren würde.
»Hätten Sie vielleicht ein Bild Ihres Mannes?«
Wortlos, die Lippen aufeinandergepresst, ging sie zu einem weißen Sideboard, auf dem ein großes Foto in einem Edelstahlrahmen stand. Ohne ihn anzusehen, reichte sie es ihm.
Es war der Moment der Gewissheit: Das Foto zeigte das Mordopfer mit seiner Frau und den beiden Kindern, die er im Garten gesehen hatte, am Markusplatz in Venedig. Jetzt wurde es ernst.
Wie sollte er dieser Frau nur die Wahrheit sagen, ohne dass sie völlig zusammenbrach? Er war Polizist, klar, aber im Überbringen von Todesnachrichten hatte er wenig Übung. Er hätte sich besser gefühlt, wenn sein Kollege das übernommen hätte.
Verzweifelt und ein wenig beschämt über seine schwach ausgeprägten psychologischen Fähigkeiten, fing er an: »Frau Sutter, ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen.« Noch bevor er beim Wort traurig angekommen war, verfluchte er sich innerlich dafür. Was ihn aber völlig überraschte, war die Reaktion der Ehefrau.
»Tot? Er lebt nicht mehr, oder? Autounfall?«
Auf einmal war Frau Sutter gefasst, wischte sich die Tränen ab, setzte sich ruhig an den Esstisch in der anderen Ecke des Wohnzimmers.
»Warum hat man ihn nicht gefunden, wenn etwas mit dem Auto passiert ist?«
Kluftinger konnte nicht einmal gleich reagieren, so perplex war er. Er sah die Frau einen Augenblick entgeistert an.
»Kein Unfall, Frau Sutter.«
Die Türglocke tönte. Ausgerechnet jetzt kam der Depp!
»Mein Kollege, ich … «
»Jacqueline, die Tür!«
Noch ein Kind? Kluftinger wurde ganz heiß. Es wäre ihm nicht unrecht gewesen, wenn er selbst aufstehen und zur Tür hätte gehen können.
»Warum kein Unfall? Was ist passiert? Sagen Sie endlich, was ist denn los?«, drängte ihn die Frau unruhig.
»Wir müssen annehmen, dass Ihr Mann einem Verbrechen … «
»Verbrechen? Mein Gott!«
Hefele betrat den Raum, gefolgt von einem jungen Mädchen, das aber sofort wieder hinausging.
»Hefele, entschuldigen Sie … «, wollte sich der Polizist vorstellen, Kluftinger bedeutete ihm aber mit einer Geste, dass dies nun nicht angebracht wäre. Schnell setzte er sich neben seinen Chef. Der begann erneut:
»Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde Ihr Mann umgebracht, Frau Sutter.«
Kluftinger sah zu ihr hinüber. Sie sah ihn starr an und schüttelte den Kopf.
»Nein«, versetzte sie bestimmt. »Nein, da müssen Sie sich täuschen. Gernot kann nicht … «
»Wir haben ihn gerade in der Nähe von Hirschdorf tot aufgefunden und glauben Sie mir, alles deutet auf ein Verbrechen hin.« Kluftinger wollte der Frau zumindest heute noch die Einzelheiten zum Tode ihres Ehemanns ersparen. Frau Sutter stützte ihren Kopf in die Hände und begann wieder zu weinen. Dem Kommissar bot sich eine Pause, in der ihm ein Bedürfnis bewusst wurde, das er unterdrückt hatte, seit er in dieses Haus gekommen war. Jetzt aber wurde es beinahe übermächtig: Wenn er nicht sofort auf die Toilette käme, würde es einen weiteren Wasserschaden an diesem Tag geben. Aber er konnte unmöglich eine Frau, die gerade vom Mord an ihrem Mann erfahren hatte und so bitterlich weinte, mit einer so profanen Frage wie der nach dem Klo behelligen. Nervös rutschte Kluftinger hin und her. Er begann zu schwitzen. Er suchte Blickkontakt zu seinem Kollegen, der aber gerade in die andere Richtung sah.
»Gsst!« Hefele reagierte nicht. »Gssst!«, gab der Kommissar nun etwas lauter von sich. Hefele drehte sich um, während Frau Sutter den Kopf weiterhin in ihren Händen vergraben hatte. Mit zusammengezogenen Brauen zuckte Hefele fragend mit den Schultern.
»Mss bisln!«, zischte der Kommissar.
Hefele runzelte die Stirn.
»Mss bisln!«, wiederholte Kluftinger. Sein Kollege hatte noch immer nicht verstanden. Hefele rutschte zu seinem Chef, so dass dieser ihm ins Ohr flüstern konnte: »Ich muss zum Biseln, aber schon dermaßen dringend! Ich lass euch kurz allein. Weißt du, wo hier ein Klo ist?«
Frau Sutter sah auf und sagte mit monotoner, brüchiger Stimme: »Nach dem Eingang, die erste Türe rechts«, und ließ den Kopf wieder in die Hände fallen.
»Oh, danke«, hauchte Kluftinger, dessen Gesichtsfarbe sich innerhalb einer einzigen Sekunde in ein leuchtendes Rot verwandelt hatte, und fügte in Gedanken ein ›Kreuzkruzifix‹ hinzu. Ihm war so schnell nichts peinlich, aber das hätte es jetzt nicht gebraucht. Hätte er sich ja auch denken können: In vielen Häusern war die Toilette die erste Türe nach dem Eingang.
Andererseits … die Frau hatte im Moment andere Probleme, als sich über den Kommissar zu wundern, beruhigte er sich selbst. Und schließlich konnte er nicht einfach in einem fremden Haus herumlaufen und das Klo suchen. Er erhob sich leise und verließ den Raum.
Als er das Wohnzimmer des Mordopfers wieder betrat, saß Hefele mit Frau Sutter am Esstisch auf der mit Sicherheit maßgefertigten Eckbank aus hellem Holz, die nahtlos in die Ofenbank überging, die wiederum zu einem alten Kachelofen gehörte. Kluftinger fiel der Ofen auf, weil sie damals, als sie ihren nachträglich hatten einbauen lassen, keinen alten bekommen hatten und neue Industriekacheln verwenden mussten. Stil hatte der Sutter, keine Frage. Zeitlos schön war auch die Eckbank, in deren Zentrum ein großer, quadratischer Tisch stand, wie man ihn früher in Wirtshäusern gehabt hatte. Dieser allerdings war nachgebaut.
Hefele hielt eine Packung Papiertaschentücher in der Hand und zog eines heraus, um es Frau Sutter zu geben, die sich etwas gefasst hatte.
»So«, sagte Kluftinger entschlossen, zog seine Hosenbeine etwas hoch und setzte sich an den Kachelofen. Er hatte nicht vor, die Frau des Toten lange zu behelligen, da es ihr aber etwas besser zu gehen schien, wollte er ihr doch einige Fragen stellen, um wenigstens Ansatzpunkte für die ersten Ermittlungsschritte zu haben.
»Frau Sutter, wenn Sie können, wäre es gut, wenn Sie uns von Ihrem Mann erzählen würden.«
»Natürlich, ich verstehe.« Die Frau bemühte sich nach Kräften, Fassung zu bewahren. »Was wollen Sie wissen?«
»Was macht Ihr Mann beruflich?«, fragte Kluftinger, der bewusst auf die Vergangenheitsform verzichtete: Das Präsens würde ihr möglicherweise weniger bewusst machen, dass ihr Ehemann nicht mehr am Leben war. Das immerhin war von einer Fortbildung hängen geblieben, in der es um Fragetechniken bei Mordoder Unfallopfern nahestehenden Personen ging. Sonst wusste er von diesem Seminar eigentlich nur noch, dass es damals gute Wienerle gegeben hatte.
»Er ist Reiseveranstalter«, sagte sie. Kluftinger sah sie nur an. Nach ein paar Sekunden Pause fuhr sie von sich aus fort. Auch eine Technik, die er einmal bei einem Seminar gelernt hatte.
»Er organisiert Tagesfahrten, vor allem für ältere Leute. Die bekommen so einen Tag Urlaub für wenig Geld und haben Gelegenheit, nützliche Dinge zu kaufen.«
»Was sind das für Dinge?«
»Nun, Resonanzgeräte, Magnetfelddecken, Materialien für die Aromatherapie. Das Neueste sind Strahlen-Neutralisatoren.«
Der Kommissar fragte nicht nach, worum es sich dabei handelte. Sie würden noch genug Zeit haben, solche Details zu klären. »Kaffeefahrten also?«, resümierte er stattdessen.
»Tagesfahrten, Herr Kluftinger. Ich hasse den Ausdruck ›Kaffeefahrten‹ und mein Mann auch. Die Leute müssen da nichts kaufen, verstehen Sie?« Sie klang, als habe sie diese Rechtfertigung nicht zum ersten Mal benutzt.
Kluftinger versuchte sofort, das Gespräch wieder in ruhigere Bahnen zu lenken: »Frau Sutter, gehen die Geschäfte Ihres Mannes gut?«
»Nun, sonst hätten wir uns dieses Haus kaum leisten können. Ja, ich denke, sie gehen sehr gut. Aber übers Geschäft sprechen wir kaum.«
Augenscheinlich war es die richtige Taktik, in der Gegenwartsform von Sutter zu sprechen. »Wo befindet sich die Firma?«
»In Ursulasried, im Gewerbegebiet. Gernot, mein Mann, braucht Platz zum Lagern der Waren, die er verkauft.«
»Wie heißt der Betrieb?«
»Steinbock-Touristik. Das Sternzeichen von Gernot.«
»Führt Ihr Mann die Firma allein?«
»Ja. Er hat eine Mitarbeiterin, eine Art Sekretärin und einige Verkäufer – ich meine Reisebegleiter, die auf den Fahrten dabei sind. Aber die sind nicht fest angestellt … Ansonsten macht er alles selbst.«
Kluftinger wunderte sich. Die Kaffeefahrten passten nicht in das Bild, das Sutter ihm mit seinem Haus bot. Alles wirkte gediegen und stilvoll, nicht neureich, nicht aufgesetzt, nicht übertrieben.
Arzt, Rechtsanwalt, irgendein anderer Akademiker, das hätte er erwartet, aber ein Kaffeefahrten-Heini?
»Ihr Mann muss sicher viel arbeiten. Hat er da noch Zeit für die Familie und die Kinder?«
»Er nimmt sie sich. Er liebt Melvin und Alina über alles. Wir unternehmen jedes Wochenende etwas zusammen, gehen zum Baden, machen Ausflüge, im Winter zum Skifahren. Wenn man es sich richtig einteilt, geht das schon. Obwohl Gernot auch sonst viele Verpflichtungen hat. Er ist Elternbeiratsvorsitzender an der Grundschule; Alina ist jetzt neun, Melvin geht ja schon aufs Gymnasium in Kempten. Mein Mann ist Kassier im Tennisclub, da ist er natürlich auch eingespannt«, sagte Frau Sutter, der scheinbar immer weniger präsent war, was geschehen war.
»Sie arbeiten nicht?«
»Stundenweise in einer Boutique in Kempten. Aber mehr, um mir die Zeit zu vertreiben. Und jetzt, wo auch Jacqueline sich um die Kinder kümmert … «
Auf Kluftingers fragenden Blick erklärte Frau Sutter » … ein Au-pair-Mädchen aus unserer französischen Partnergemeinde, die für ein Jahr bei uns ist.«
Nobel, nobel, dachte sich Kluftinger. Und wie gut der Name zu Melvin und Alina passte …
»Frau Sutter, hatte Ihr Mann Feinde, war er in seinen letzten Tagen anders als sonst, war er verschlossener?« Kluftinger verfluchte sich innerlich. Nun war er doch ins Imperfekt abgerutscht. Wenn das mal gut ging.
»Ob er Feinde hat? Hatte … Feinde, Sie meinen, ob … «, war alles, was sie herausbrachte, bevor ihre Stimme in Tränen erstickte.
Priml, dachte sich Kluftinger, das haben wir ja wieder gut hingebracht. Er verzieh sich aber den kleinen Fehler. Wenigstens hatte er nun einige Dinge erfahren. Er gab Hefele ein Zeichen, dass es nun an der Zeit war, abzubrechen. Der ging auf die Witwe zu, legte ihr eine Hand auf die Schulter und fragte in leisem Ton, ob sie jemanden hätte, der sich um sie und die Kinder kümmern könnte.
Ihre Eltern wohnten in Bechen, fünf Minuten zu Fuß entfernt, stammelte Frau Sutter.
Kluftinger ging in den Hausgang. Er suchte Jacqueline, das Aupair-Mädchen. Sie war nicht zu sehen. »Fräulein Jacqueline? Hallo?«, rief er.
Wenig später öffnete sich die Küchentür und Jacqueline trat heraus. Kluftinger schätzte sie auf etwa achtzehn Jahre. Der Kommissar wurde beinahe verlegen. Nicht, dass sie eine ausgesprochene Schönheit gewesen wäre. Sie hatte sogar eine leichte Hakennase. Aber in ihrem Wesen lag Charme. Sie hatte eine sportliche Figur, schulterlanges, braunes Haar und strahlte ihn aus tiefblauen Augen an.
»Msjö?«
Er wollte ihr etwas in ihrer Sprache erwidern, aber Französisch kannte er nur aus Filmen. »Bonndschur«, fiel ihm ein, als er aber am fragenden Blick des Mädchens erkannte, dass sie ihn nicht verstanden hatte, wurde er rot und fügte schnell sachlich hinzu: »Mein Name ist Kluftinger, von der Polizei. Es ist etwas mit Herrn Sutter passiert, aber das soll Ihnen Frau Sutter selbst erklären. Können Sie bitte ihre Eltern verständigen?«
»Die Öltarn von Sophie? Isch rufe sie gleisch an, Msjö«, sagte das Mädchen, das etwas erschrocken wirkte.
Der Kommissar fand ihren Akzent zum Niederknien. Er kam sich unbeholfen vor, weil er nicht einmal ein französisches Wort herausgebracht hatte, und – was noch schlimmer war in diesem Moment – er fühlte sich alt. Vor dreißig Jahren, ja, da hätte er auf Teufel komm raus mit dem Mädchen geflirtet. So beschränkte er sich aber auf ein verlegenes Lächeln und ein »Vielen Dank, Fräulein Jacqueline«. Erst als sie bereits am Telefon war, fiel es ihm ein: Merci. Das kannte er. Er drehte sich noch einmal um, doch die junge Französin sprach bereits. Er senkte den Kopf und ging zurück ins Wohnzimmer.
***
Als Kluftinger etwa eine Stunde später in Altusried den Passat in seine Hofeinfahrt lenkte, merkte er erst, wie sehr ihn dieser Tag geschafft hatte. Dabei war er nicht einmal besonders lang gewesen. Aber der furchtbare Anblick hatte ihm eine Seite seines Berufes offenbart, die er bisher nicht kennen gelernt hatte. Je mehr er versuchte, die Erinnerung wenigstens für einen Augenblick loszuwerden, desto öfter sah er das grausige Bild der Leiche mit der toten Krähe vor sich.
Er stellte sein Auto vor der Garage ab und ging langsam zur Eingangstür. Er hoffte, dass Erika mit dem Wasser klargekommen war, denn er wollte nur noch ins Bett. Als er die Tür aufschloss, wurde ihm aber sofort klar, dass daraus so schnell nichts werden würde. Das erste, was er erblickte, waren zwei Koffer, die mitten im Hausgang standen. Darauf lag zusammengefaltet Erikas Mantel.
Sofort fühlte er sich schuldig. Hätte er sie doch nicht so einfach allein lassen sollen? O je, das würde wieder Hundeblicke, Engelszungen und Geduld brauchen, bis das in Ordnung gebracht wäre. Dabei standen ihm eben diese Mittel gerade jetzt nicht zur Verfügung.
Er hörte, wie die Tür zum Schlafzimmer geöffnet wurde. Gleichzeitig fühlte er, wie sein Herz schneller schlug und die Äderchen auf seinen Wangen sich mit Blut füllten.
Noch bevor seine Frau im Hausflur zu sehen war, setzte er schon zu einer Entschuldigung an: »Erika? Erika, horch, ich meine, das war … « Reiß dich zusammen!, schrie er sich in Gedanken an. Seine Frau hatte es über die Jahre geschafft, ihn in solchen Fällen zu einem stotternden Kleinkind zu degenerieren.
Als sie um die Ecke bog, ballte er die Hände in seinen Taschen zu Fäusten zusammen. »Also, das war so … «
Weiter kam er nicht. Seine Frau ging auf ihn zu, nahm seinen Kopf in beide Hände, gab ihm einen Schmatz auf den Mund und sagte: »Gut, dass du endlich da bist. Ich hab schon alles arrangiert.«
Jetzt war er baff. Seine Frau war offenbar überhaupt nicht sauer. Und er hätte sich beinahe bei ihr entschuldigt. Hätte ihr sein schlechtes Gewissen offenbart und reumütig versucht, ihr die Situation zu erklären. Hätte sich vielleicht sogar zu einer Entschädigungs-Essenseinladung hinreißen lassen. Er biss sich auf die Lippen. Er musste lernen, sich in diesen Situationen besser in den Griff zu bekommen.
Dann fielen ihm die Koffer wieder ein. »Warum … ?«
Seine Frau ahnte die Frage bereits und unterbrach ihn: »Ich hab alles so gut wie irgend möglich trocken gelegt. Dann hab ich beim Siggi angerufen, aber der ist nicht da. Ich hab ihn nur über Handy erreicht.«
Siggi war ein Schulfreund von Kluftinger und ihr Klempner.
»Er ist ganz kurz zwischen zwei Terminen vorbei gekommen und hat sich das Ganze angeschaut. Ist wohl was Größeres, hat er gemeint, jedenfalls konnte er es auf die Schnelle nicht beheben. Er kommt zwar gleich morgen noch mal, aber vorläufig haben wir kein Wasser mehr.« Sie machte eine Pause. »Und jetzt stell dir vor, wer zufällig bei mir angerufen und uns ein Nachtlager angeboten hat, während ich noch beim Badschrubben war?«
Den letzten Satz hatte sie schon etwas fröhlicher gesagt als die Schilderungen der häuslichen Katastrophe.
»Meine Mutter?«, versuchte er es mit dem schlimmsten Szenario, das ihm auf die Schnelle in den Sinn kam.
»Die Annegret«, sagte sie und lächelte ihn an. »Und jetzt kommt die gute Nachricht: Sie hat gesagt, dass wir selbstverständlich bei ihr wohnen können, solange das Wasser bei uns nicht läuft.«