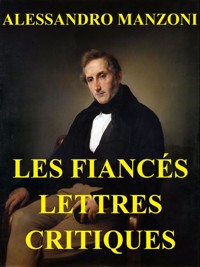14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Italien, 1630: Die beiden jungen Verlobten Renzo und Lucia, deren Hochzeit von dem örtlichen Feudalherrn Don Rodrigo aus Boshaftigkeit verhindert wird, trennen sich in der Hoffnung, bald an einem anderen Ort wieder zueinander zu finden. Doch der Weg zu ihrem gemeinsamen Glück ist voller Dornen, und so müssen sie sich in turbulenten Zeiten nicht nur ihrer Widersacher, marodierender Soldaten und übler Verleumdungen erwehren, sondern auch versuchen, der grassierenden Pest zu entgehen, die Tausende dahinrafft ... Alessandro Manzonis "I Promessi Sposi" ist das erste Beispiel des modernen italienischen Romans und gilt nach Dantes Göttlicher Komödie als das bedeutendste Werk der klassischen italienischen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1200
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
Kapitel.
EINLEITUNG.
„Die Weltgeschichte läßt sich wahrhaftig umschreiben als ein hehrer Krieg gegen die Zeit; denn sie entreißt der Zeit die von ihr Gefangenen, um sie, die schon zu Leichnamen geworden sind, wieder ins Leben zurückzurufen, Heerschau über sie zu halten und sie von neuem ins Treffen zu stellen. Die hehren Helden aber, die auf dieser Wallstatt Palmzweige und Lorbeeren ernten, raffen nur die prächtigste und glänzendste Beute zusammen, indem sie mit ihren Tinten die Unternehmungen der Fürsten und Machthaber und erlauchten Herren einbalsamieren und mit der durchdringenden Nadel des Geistes die goldenen und seidenen Fäden durchziehen als ein immerwährendes Geflecht von preiswürdigen Taten. Meiner Schwäche jedoch ist es nicht verstattet, sich zu solchen Gegenständen und zu so schwindelnden Gipfeln zu erheben, wie es die Bewegung in den Labyrinthen der Staatsaktionen unter dem Widerhall der Kriegsfanfaren erforderte; und ich bescheide mich, das, was mir von denkwürdigen Dingen, gleichwohl nur Handwerker und kleine Leute betreffend, kund geworden ist, dem Gedächtnis der Nachwelt in einer ganz schlichten und lauteren Geschichte zu erzählen oder besser zu überliefern. Auf einer engen Bühne werden darin Tragödien jammervollen Schreckens und Szenen großartiger Ruchlosigkeit zu sehen sein mit Zwischenspielen von tugendhaften Handlungen und englischer Güte als Gegensatz zu den teuflischen Machenschaften. Wahrhaftig, bedenkt man, daß diese unsere Himmelstriche beherrscht werden von dem Katholischen Könige, unserem Herrn, der die Sonne ist, die nie untergeht, und daß über ihnen mit zugeworfenem Lichte als nimmer abnehmender Mond der Held aus edlem Stamme ergänzt, der pro tempore eine Stelle einnimmt, während die erlauchten Senatoren wie Fixsterne und die anderen erhabenen Obrigkeiten gleich kreisenden Planeten überallhin das Licht verbreiten, so daß sie alle zusammen einen hehren Himmel darstellen, so läßt sich, wenn man dann statt dieses Himmels eine Hölle finsterer, verworfener und grausamer Handlungen, von vermessenen Menschen in stetiger Steigerung begangen, erblickt, keine andere Ursache dafür erfinden, als teuflische Tücke und Anstiftung, um so mehr als die menschliche Bosheit für sich allein nicht ausreichen würde, so vielen Helden zu widerstehen, die sich mit Argusaugen und Briareusarmen für das Gemeinwohl abmühen. Indem ich darum diese Dinge erzähle, die sich in meiner frühesten Jugendzeit zugetragen haben, sollen, obwohl die Mehrzahl der handelnden Personen schon vom Schauplatze der Welt verschwunden ist und den Parzen ihren Tribut gezollt hat, doch aus gewichtigen Gründen ihre Namen, nämlich die ihrer Geschlechter, verschwiegen bleiben, und dasselbe muß von den Örtlichkeiten gelten, deren Lage nur generaliter angezeigt werden wird. Und dies wird niemand als eine Unvollkommenheit der Erzählung und als eine Verunstaltung dieses meines groben Erzeugnisses bezeichnen, außer einem Kritiker, der die Philosophie nicht einmal verkostet hat; Leute, die mit ihr vertraut sind, werden sich überzeugen, daß der besagten Erzählung nichts Wesentliches gebricht. Da es augenscheinlich ist und von niemandem geleugnet wird, daß die Namen nichts anderes als reine Zufälligkeiten sind…“
Habe ich mir aber die heldenhafte Mühe genommen, diese Geschichte aus dieser verblichenen und zerfetzten Handschrift abzuschreiben und habe ich sie, wie man so sagt, herausgegeben, wird sich dann auch jemand finden, der sich die Mühe nehmen wird, sie zu lesen?
Diese zweifelnde Überlegung, auf die ich bei der Plage, eine mir zufällig aufgestoßene verkritzelte Stelle zu entziffern, gekommen war, ließ mich in der Abschreibearbeit innehalten, und ich dachte nun mit größerem Ernste nach, was da zu tun sei. Es ist ja wahr, sagte ich mir, die Handschrift durchblätternd, daß dieser Schauer von schwülstigen Worten und blumigen Wendungen nicht in einem fort durch das ganze Buch anhält: der gute Mann aus dem siebzehnten Jahrhundert hat eben im Anfange ein bißchen zeigen wollen, was er kann; im Verlaufe der Erzählung und manchmal auf längere Stellen wird der Stil viel natürlicher und einfacher. Gut; aber wie alltäglich ist er! wie plump! wie liederlich! Lombardische Ausdrücke zuhauf, dazu verkehrt angewandte Redensarten, willkürliche Fügungen, verschrobene Satzverbindungen! Und dazu da und dort eine spanische Verschnörkelung eingestreut; und dann, was noch schlimmer ist, an den schrecklichsten oder rührendsten Stellen der Geschichte, bei jedem Anlasse zur Verwunderung oder zum Nachdenken, kurz überall dort, wo etwas rednerischer Schwung erforderlich wäre, der freilich nicht aufdringlich sein dürfte und dem guten Geschmack entsprechen müßte, ermangelt der Mann nie, den Schwung seiner also angetanen Einleitung anzubringen. Und indem er dabei mit einer erstaunlichen Fertigkeit die gegensätzlichsten Eigenschaften miteinander verquickt, bringt er es fertig, auf ein und derselben Seite, in ein und demselben Satze, in ein und demselben Worte plump und geziert zu erscheinen. Also: hochtönende Ergüsse, gewaltsam zusammengesetzt aus jämmerlichen Sprachwidrigkeiten, und durchaus diese anspruchsvolle Unbeholfenheit, die das wesentliche Kennzeichen der Bücher dieses Landes in diesem Jahrhundert sind. Das ist wirklich nichts, was man den heutigen Lesern vorsetzen dürfte, die von dieser Art der Übertreibung zu sehr gewitzigt sind und allen Geschmack daran verloren haben. Ein Glück nur, daß ich auf diese Erwägung schon beim Beginne dieser unseligen Arbeit gekommen bin; ich wasche mir die Hände in Unschuld.
Im Begriffe nun, die alte Scharteke zuzumachen und wegzulegen, tat es mir leid, daß eine so hübsche Geschichte durchaus unbekannt bleiben sollte; schien sie mir doch, insoweit sie Geschichte ist – vielleicht wird der Leser anders urteilen – merkwürdig genug zu sein. Warum, dachte ich mir, sollte es nicht angehen, die Folge der Begebenheiten aus der Handschrift herauszugreifen und die Sprache zu ändern? und weil sich kein triftiger Grund dagegen fand, war der Entschluß rasch gefaßt. Da hat man also den Ursprung dieses Buches, erklärt mit einer Aufrichtigkeit, die der Bedeutung des Buches entspricht.
Freilich schienen uns einige Vorgänge und manche Bräuche, wovon unser Verfasser berichtet, so seltsam und so fremdartig, um ein schlimmeres Wort zu vermeiden, daß wir, bevor wir ihnen Glauben schenkten, andere Zeugnisse befragen wollten; und wir haben uns der Mühe unterzogen, die Urkunden jener Zeit durchzustöbern, um uns klar zu werden, ob es damals in der Welt wirklich so zugegangen ist. Diese Nachforschungen haben unsere Bedenken zerstreut: bei jedem Schritte stießen wir auf ähnliche und auf ärgere Dinge; schließlich – und das war für uns das Entscheidendere – haben wir einige Personen erwähnt gefunden, von denen wir, da wir sie nur aus unserer Handschrift gekannt hatten, in Zweifel gewesen waren, ob sie wirklich gelebt haben. Gelegentlich werden wir auch das eine oder das andere dieser Zeugnisse anführen, um Berichte zu bewähren, deren Seltsamkeit den Leser versuchen könnte, ihnen den Glauben zu verweigern.
Da wir nun aber die Sprache unseres Verfassers als unerträglich verworfen haben, was für eine Sprache haben wir an ihre Stelle gesetzt? Darauf kommt es jetzt an.
Wer immer es, ohne darum gebeten worden zu sein, unternimmt, eine fremde Arbeit zu ändern, muß darauf gefaßt sein, genau Rechenschaft ablegen zu müssen, und übernimmt gewissermaßen auch die Verpflichtung dazu: das gilt mit Fug und Recht als eine Regel, und wir haben keineswegs die Absicht, uns ihr zu entziehen. Um uns ihr vielmehr bereitwillig anzupassen, haben wir uns vorgenommen gehabt, uns hier bis in Einzelheiten für die von uns eingehaltene Schreibart zu verantworten; zu diesem Ende haben wir in der ganzen Zeit der Arbeit danach getrachtet, alle gegebenenfalls möglichen Urteile zu erraten, in der Absicht, sie alle schon im voraus zu widerlegen. Darin wäre auch die Schwierigkeit nicht gelegen gewesen; denn um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist uns auch nicht ein Urteil eingefallen, ohne daß sich uns zugleich auch die siegreiche Antwort geboten hätte, eine von den Antworten nämlich, die die Fragen wenn schon nicht lösen, so doch verändern. Oft brachten wir auch zwei Urteile ins Handgemenge miteinander und ließen sie sich gegenseitig bekämpfen, oder es gelang uns dadurch, daß wir ihnen auf den Grund gingen und sie aufmerksam verglichen, zu entdecken und darzutun, daß sie, wie entgegengesetzt sie auch scheinbar waren, doch zu derselben Gattung gehörten und beide nur davon herkamen, daß die Tatsachen und Grundlagen, worauf der Schluß hätte beruhen sollen, nicht beachtet worden waren; dann stellten wir sie zu ihrer großen Verwunderung einander gegenüber und ließen sie sich gegenseitig ihre Haltlosigkeit beweisen. So hätte es denn noch nie ein Buch gegeben, dessen Verfasser so augenscheinlich dargetan hätte, daß er richtig vorgegangen ist; aber was mußten wir sehen? Als wir daran waren, alle die genannten Vorwürfe und Antworten zusammenzufassen und einige Ordnung in sie bringen, da wäre, Gott bewahre uns, ein ganzes Buch daraus geworden. Daraufhin ließen wir unsere Absicht fallen, und zwar aus zwei Gründen, die dem Leser sicherlich einleuchten werden: einmal, weil ein Buch, das den Zweck verfolgte, ein anderes Buch oder besser die Schreibart eines anderen zu rechtfertigen, als etwas Lächerliches erscheinen könnte, und dann, weil bei Büchern eines auf einmal genügt, wenn es nicht schon selber überflüssig ist.
1. KAPITEL.
DER Arm des Comer Sees, der sich zwischen zwei ununterbrochenen Bergketten je nach ihrem Vorspringen und Zurücktreten in lauter Buchten und Busen gen Mittag hinwindet, verengt sich zwischen einem Vorgebirge auf der rechten und einem ausgedehnten Uferlande auf der andern Seite gleichsam mit einem Ruck und nimmt Lauf und Aussehen eines Flusses an; und die Brücke, die dort die beiden Ufer verbindet, scheint diese Veränderung dem Auge noch deutlicher zu machen und bezeichnet den Punkt, wo mit dem Aufhören des Sees die Adda wieder anfängt, freilich nur, um sofort wieder den Namen eines Sees anzunehmen, wo die Ufer, sich von neuem voneinander entfernend, gestatten, daß sich das Wasser ausbreitet und in neuen Busen und Buchten verläuft.
Das Uferland, entstanden aus dem Geschiebe dreier Sturzbäche, senkt sich von der Lehne zweier in einem Zuge liegender Berge herab, deren einer der St. Martinsberg heißt, während der andere von seinem gezackten Kamm, wodurch er wirklich einer Säge ähnelt, mit einem lombardischen Wort der Resegone, die Große Säge, genannt wird; es ist auch unmöglich, daß ihn nicht jeder, schon wenn er ihn das erstemal sieht, besonders von gegenüber, z. B. von den nördlichen Mauern Mailands aus, an diesem einfache Merkmale in diesem langgestreckten Gebirgszuge von den anderen Bergen mit minder bekannten Namen und gewöhnlicherer Form unterschiede. Eine gute Strecke weit steigt das Gelände den Fluß entlang langsam und stetig; dann zerfällt es in Hügel und Täler, in Hänge und Matten, je nach dem Gerippe der beiden Berge und der Arbeit des Wassers. Der Rand mit den eingeschnittenen Mündungen der Gießbäche besteht nur aus Sand und Kiesgeröll; der Rest sind Halden und Weingärten mit eingestreuten Ortschaften, Dörfern und Gehöften, dazwischen hier und dort Gehölze, die sich bergan fortsetzen.
Lecco, die vornehmste unter diesen Ortschaften, die auch der Gegend den Namen gibt, liegt nicht weit von der Brücke am See und, wenn er steigt, zum Teile auch im See; heutzutage ist es ein großer Burgflecken und ist auf dem Wege, eine Stadt zu werden. Zu den Zeiten, wo die Ereignisse vorfielen, die wir zu erzählen unternehmen wollen, war dieser Burgflecken, an sich schon stattlich, überdies noch befestigt und hatte darum die Ehre, einen Kommandanten zu beherbergen, und den Vorteil, eine ständige Garnison von spanischen Soldaten zu besitzen, die die Mädchen und Frauen des Landes Zucht lehrten, hin und wieder einem Gatten oder einem Vater auf die Schulter klopften und gegen Ende des Sommers nie ermangelten, sich in die Weingärten zu zerstreuen, um die Trauben zu lichten und den Bauern die Mühe der Weinlese zu erleichtern.
Von einer dieser Ortschaften zur anderen, von den Höhen zum Ufer, von einem Hügel zum anderen liefen und laufen noch heute mehr oder minder steile oder ebene Wege und Steige, bald eingeschnitten und zwischen zwei Mauern begraben, so daß man, wenn man den Blick hebt, nichts sonst sieht als den Himmel und etwa eine Bergspitze, bald erhöht auf freien Erdwällen: von dort schweift dann das Auge über mehr oder minder ausgedehnte Bilder, die aber allesamt reich sind und stets etwas Neues bieten, je nachdem der Standpunkt des Beschauers mehr oder weniger von der weiten Landschaft umfaßt und je nachdem sich der eine oder der andere Teil besonders heraushebt oder zurücktritt, abwechselnd verschwindet oder erscheint. Dort dieser Streifen, da jener, da ein großes Stück des weiten und veränderlichen Wasserspiegels: hier als See, an seinem Ende in eine Wirrnis von Bergen gepreßt oder besser jäh verloren und langsam verbreitert zwischen anderen Bergen, die sich nacheinander dem Blicke darbieten und mit den Dörfchen am Ufer vom Wasser verkehrt abgespiegelt werden, dort als Flußarm, dann wieder als See, dann noch einmal als Fluß, der sich endlich in schimmernden, immer schmäleren Schlangenwindungen zwischen den Bergen verliert, die ihn begleiten, um sich, auch selber langsam verschwimmend, im Horizonte zu verlieren. Der Ort selber, von wo ihr diese mannigfachen Bilder betrachtet, ist überall auch an sich ein Bild für euch; der Berg, an dessen Fuß ihr dahinschreitet, entfaltet euch höher hinauf in der Runde seine Gipfel und Zinnen nebeneinander und übereinander, wechselnd bei jedem Schritte, indem sich, was zuerst eine einfache Spitze schien, in eine Reihe oder einen Kreis von Spitzen auflöst, und ihr das, was ich euch soeben auf dem Hange darbot, nun auf der Kuppe seht; und die gastliche Heiterkeit dieser Lehnen mildert gar lieblich die sonstige Unwirtlichkeit und verleiht der Großartigkeit der übrigen Landschaftsbilder einen um so höheren Reiz.
Auf einem dieser Steige kehrte am Abende des 7. Novembers 1628 Don Abbondio, Pfarrer einer der oben erwähnten Ortschaften, gemächlich von einem Spaziergange heim; der Name der Ortschaft findet sich ebenso wie der Zuname des Pfarrers in der Handschrift nicht, weder hier, noch anderswo. Er sprach leise sein Brevier, schloß auch wohl dann und wann zwischen einem Psalm und dem anderen sein Buch, indem er den Zeigefinger der Rechten als Zeichen drinnen ließ, um nun beide Hände auf den Rücken zu legen und, die rechte mit dem geschlossenen Buche auf der linken ruhend, seinen Weg weiter zu verfolgen, die Augen gesenkt und hin und wieder die Steine, die auf dem Wege Anstoß gaben, mit dem Fuße zur Mauer stoßend; dann hob er das Gesicht und ließ seine Blicke, nachdem er sie hatte müßig in der Runde kreisen lassen, auf den vorspringenden Felsmassen eines Berges haften, die das Licht der schon verschwundenen Sonne, durch die Spalten des gegenüberliegenden Berges brechend, hier und dort wie mit breiten, ungleichmäßigen Purpurstreifen überzog. Nachdem er dann das Buch wieder geöffnet und einen andern Absatz hergesagt hatte, kam er zu einer Biegung des Pfades, wo er stets gewohnt war, die Augen vom Buche aufzuschlagen und Umschau zu halten; so tat er denn auch an diesem Tage. Nach der Biegung lief der Weg etwa sechzig Schritte gerade fort, um sich dann wie ein Ypsilon zu spalten: der Weg zur Rechten führte bergaufwärts und zum Pfarrhaus, der zur Linken senkte sich ins Tal hinab bis zu einem Gießbach, und auf dieser Seite reichte die Mauer dem Wanderer nur bis zu den Hüften. Die inneren Mauern der beiden Pfade endigten, statt sich in einem Winkel zu vereinigen, in einer kleinen Kapelle, die mit langen, geschlängelten und in eine Spitze auslaufenden Figuren bemalt war, die nach der Absicht des Künstlers und in den Augen der Bewohner der Umgebung Flammen darstellten; mit diesen Flammen wechselten andere, unmöglich zu beschreibende Figuren ab, die die Seelen des Fegefeuers darstellen sollten: Seelen und Flammen ziegelfarben auf einem gräulichen Grunde und so wie dieser stellenweise durch das Abbröckeln der Tünche beschädigt. Als der Pfarrer nach der Biegung den Blick in der gewohnten Weise auf die Kapelle richtete, sah er etwas, was er nicht erwartet und lieber nicht gesehen hätte. Bei dem Zusammenflusse, um es so zu sagen, der zwei Wege befanden sich zwei Männer einander gegenüber, der eine rittlings auf der niedrigen Mauer, ein Bein nach außen baumelnd und den anderen Fuß auf den Weg gesetzt, sein Gesell an die Mauer gelehnt mit auf der Brust verschränkten Armen. Ihre Kleidung, ihr Gehaben und was man sonst von dem Punkte, den der Pfarrer erreicht hatte, wahrnehmen konnte, ließen keinen Zweifel darüber, was sie waren. Beide trugen sie auf dem Kopf ein grünes Netz, das auf der linken Schulter in einer großen Troddel endigte und über der Stirn einen gewaltigen Haarschopf hervortreten ließ, die langen Schnurbärte waren an den Spitzen geringelt, die Wämser wurden am Saume von einem glänzenden Ledergürtel geschlossen, der beschwert war durch zwei angehakte Pistolen, über der Brust hing jedem wie ein Schmuckstück ein kleines Horn voll Pulver, und aus der rechten Tasche der weiten Pluderhosen ragte bei jedem der Griff eines Messers, während ihnen links ein Stoßdegen hing, der Korb mit Messingblättchen beschlagen, die sich, blank gefegt, wie zu einem Buchstaben zusammenfügten: auf den ersten Blick ließen sich die beiden als Angehörige der Gilde der Bravi erkennen.
Diese Gilde, heute gänzlich verschwunden, stand damals in der Lombardei in der höchsten Blüte und war sehr alt. Für den, der von ihr keinen Begriff hätte, seien einige Stellen aus Urkunden mitgeteilt, die ein genügendes Bild von ihrem besonderen Wesen, von den Anstrengungen, die gemacht wurden, um sie auszurotten, und von ihrer Hartnäckigkeit und Widerstandskraft werden geben können.
Mit dem Datum vom 8. April 1583 hat der durchlauchtige und erhabene Herr Don Carlos von Aragon, Fürst von Castelvetrano, Herzog von Terranuova, Markgraf von Avola, Graf von Burgeto, Großadmiral und Großkonnetabel von Sizilien, Statthalter von Mailand und Generalkapitän Seiner Katholischen Majestät in Italien, „genau unterrichtet von der unerträglichen Not, worin die Stadt Mailand wegen der Bravi gelebt hat und lebt“, eine Achtserklärung gegen sie veröffentlicht. Er „erklärt und bestimmt, daß in diese Acht alle eingeschlossen sind und als Bravi und Landstreicher gelten sollen, … die, ob nun fremd oder einheimisch, keinen Beruf haben oder ihn, wenn sie einen haben, nicht ausüben, … sondern sich ohne Lohn oder für Lohn zu irgendeinem Ritter oder Edelmann, Beamten oder Kaufmann halten, … um ihm Hilfe und Vorschub zu leisten oder geradezu, wie sich annehmen läßt, anderen nachzustellen…“ Allen diesen befiehlt er, binnen sechs Tagen das Land zu verlassen bei Galeerenstrafe für die Widerspenstigen, und er gewährt allen Gerichtsbehörden weitgehende und unbegrenzte Vollmachten zur Durchführung dieser Verordnung. Aber im nächsten Jahre, am 12. April, erläßt der besagte Herr wegen der Wahrnehmung, „daß die Stadt noch immer voll ist der besagten Bravi, … die zu ihrem früheren Lebenswandel zurückgekehrt sind und weder an Zahl abgenommen, noch ihre Weise geändert haben“, eine zweite gleichermaßen nachdrückliche und denkwürdige Kundmachung, worin er unter anderen Verordnungen vorschreibt:
„Daß jedermann, ob aus dieser oder einer fremden Stadt, von dem aus zweier Zeugen Mund feststeht, daß er gemeiniglich als Bravo gilt und diesen Namen hat, auch wenn nicht bewährt wird, daß er irgendein Verbrechen begangen hätte,… schon auf den bloßen Verdacht hin, ein Bravo zu sein, ohne sonstige Anschuldigungen, von den besagten Richtern und jedem einzelnen von ihnen der Folter unterworfen und peinlich befragt werden darf, … und auch wenn er keinerlei Verbrechen gesteht, immerhin für die besagten drei Jahre auf die Galeere geschickt werden soll, nur wegen des Rufes und Namens eines Bravos, wie oben.“ All dies und noch ein mehreres, das übergangen wird, weil „Seine Herrlichkeit darauf besteht, bei jedermann Gehorsam zu finden.“
Hört man so kräftige und entschlossene Worte eines solchen Herrn, die von derlei Verordnungen begleitet werden, so ist man sehr geneigt, zu glauben, daß schon bei ihrem Widerhall allein alle Bravi verschwunden wären; aber das Zeugnis eines nicht weniger hochmögenden und nicht mit weniger Titeln ausgestatteten Herrn zwingt uns, das gerade Gegenteil zu glauben, und dieser Herr ist der durchlauchtige und erhabene Herr Juan Hernandez von Velasco, Konnetabel von Kastilien, Oberkammerherr Seiner Majestät, Herzog der Stadt Frias, Graf von Haro und Castelnovo, Herr der Casa von Velasco und der der sieben Infanten von Lara, Statthalter von Mailand usw. Am 5. Juni 1593 bringt er ihnen, gleichermaßen genau unterrichtet, „wieviel Schaden und Zerrüttung die Bravi und Landstreicher anrichten … und von den schlimmen Wirkungen, die sich von dieser Gattung Menschen für das Gemeinwohl und zum Hohne der Rechtsprechung ergeben“, von neuem in Erinnerung, daß sie binnen sechs Tagen das Land zu verlassen haben, wobei er die Vorschriften und Drohungen seines Vorgängers beinahe wörtlich wiederholt. Am 23. Mai 1598 schreibt er dann, „zu nicht geringem Mißvergnügen seiner Seele unterrichtet, daß … in dieser Stadt und diesem Staat die Zahl dieser Leute“ – nämlich der Bravi und Landstreicher – „alltäglich steigt, und daß von ihnen weder bei Tage noch bei Nacht etwas anderes kund wird als Wunden, mit Vorbedacht geschlagen, Mordtaten und Räubereien und alle anderen Gattungen von Verbrechen, die sie um so leichter begehen, als sie darauf bauen, daß sie von ihren Häuptern und Gönnern beschirmt werden“, dieselben Heilmittel vor, aber in verstärkter Dosis, wie man es bei hartnäckigen Krankheiten zu tun pflegt; „jedermann hüte sich also all-wege“, schließt er dann, „dieser Kundmachung in irgendeinem Teile zuwider-zuhandeln, weil er statt der Milde Seiner Herrlichkeit ihre Strenge und ihren Zorn zu verspüren bekäme, … da Seine Herrlichkeit entschlossen ist und be-schlossen hat, daß dies die letzte und unumstößliche Verwarnung sein soll.“
Nicht dieser Meinung freilich war der durchlauchtige und erhabene Herr, der Herr Don Pedro Enriquez von Ecevedo, Graf von Fuentes, Kapitän und Statthalter von Mailand; und daß er nicht dieser Meinung war, dafür hatte er gute Gründe. „Genau unterrichtet von der Not, worin Stadt und Staat wegen der übergroßen Zahl der Bravi sind, … und entschlossen, einen so verderblichen Samen gänzlich zu vertilgen …“, erläßt er am 5. Dezember 1600 eine neue Kundmachung, gleichermaßen voll der härtesten Drohungen, „mit dem festen Vorsatze, darauf zu beharren, daß diese mit aller Strenge und ohne Hoffnung auf eine Nachsicht durchaus durchgeführt werden“.
Immerhin muß angenommen werden, daß er sich dieser Sache nicht mit dem guten Willen angenommen hat, den er aufzubieten wußte, um gegen seinen großen Feind Heinrich IV. Kabalen anzustiften und ihm Feinde zu erwecken: bezeugt doch dieserhalb die Geschichte, wie er es fertigbrachte, gegen diesen König den Herzog von Savoyen, der durch ihn um mehr als eine Stadt kam, zu bewaffnen, und wie er es fertigbrachte, daß sich der Herzog von Biron, der durch ihn um seinen Kopf kam, in eine Verschwörung einließ, während es von diesem so verderblichen Samen der Bravi sicher ist, daß er noch am 22. September 1612 weitergewuchert hat. An diesem Tage hatte der durchlauchtige und erhabene Herr Don Juan von Mendoza, Markgraf der Hynojosa, Grande usw., Statthalter usw., ernstlich daran gedacht, sie auszurotten. Zu diesem Ende ließ er den königlichen Kammerdruckern Pandolfo und Marco Tullio Malatesti die gewohnte Kundmachung verbessert und vermehrt zugehen, damit sie sie zur Vertilgung der Bravi druckten. Diese aber erhielten sich weiter, um am 24. Dezember 1618 von dem durchlauchtigen und erhabenen Herrn, dem Herrn Don Gomez Suarez von Figueroa, Herzog von Feria usw., Statthalter usw., dieselben und stärkere Schläge zu empfangen. Da sie jedoch auch daran nicht zugrunde gingen, sah sich der durchlauchtige und erhabene Herr, der Herr Gonsalvo Hernandez de Córdova, unter dessen Statthalterschaft der Spaziergang Don Abbondios fällt, gezwungen, die gewohnte Kundmachung gegen sie zu verbessern und neu zu verlautbaren; das war am 5. Oktober 1627, also ein Jahr, einen Monat und zwei Tage vor diesem denkwürdigen Geschehnis.
Und auch diese Verlautbarung war nicht die letzte; die späteren glauben wir aber nicht mehr erwähnen zu brauchen, weil sie über den Zeitabschnitt unserer Geschichte hinausgehen. Hinweisen wollen wir nur noch auf die vom 13. Februar 1632, worin wir von dem durchlauchtigen und erhabenen Herrn, el Duque de Feria, zum zweiten Male Statthalter, erfahren, daß „die größten Ruchlosigkeiten von denen begangen werden, die Bravi heißen.“ Das genügt, um uns zu vergewissern, daß es zu der Zeit, wovon wir handeln, unbedingt Bravi gab.
Daß die zwei oben Beschriebenen auf jemanden warteten, war gar zu augenscheinlich; was aber Don Abbondio noch mehr mißfiel, war, daß er sich aus gewissen Gebärden, die sie machten, klar werden mußte, daß der Erwartete er war. Bei seinem Erscheinen hatten sie sich nämlich beide angesehen und dabei die Köpfe mit einer Bewegung gehoben, woraus zu entnehmen war, daß sie beide auf einmal gesagt hatten: Das ist unser Mann; der, der rittlings gesessen hatte, war aufgestanden und hatte auch das andere Bein auf den Weg gezogen, der andere hatte sich von der Mauer entfernt, und beide gingen ihm nun entgegen. Immerfort das Buch offen vor sich hinhaltend, als ob er läse, schickte er den Blick darüber hinweg, um ihr Verhalten zu beobachten; und als er sie ihm geradeswegs entgegenkommen sah, wurde er von tausend Gedanken auf einmal bestürmt. Augenblicklich fragte er sich hastig, ob zwischen den Bravi und ihm rechts oder links irgendein Nebenweg abzweige; doch schon erinnerte er sich auch, daß dies nicht der Fall war. Er erforschte sich eilig selber, ob er sich gegen einen Mächtigen, gegen einen Rachsüchtigen vergangen habe; aber auch in dieser Besorgnis beruhigte ihn einigermaßen das tröstliche Zeugnis seines Gewissens. Inzwischen kamen ihm jedoch die Bravi immer näher, den Blick fest auf ihn gerichtet. Er steckte den Zeigefinger und den Mittelfinger der linken Hand ins Kollar, wie um es zurechtzurücken, und drehte, indem er sich mit den zwei Fingern rund um den Hals fuhr, das Gesicht nach rückwärts, zugleich den Mund verziehend, und blinzelte, wie er nur konnte, ob nicht jemand komme; aber er sah niemanden. Er warf einen Blick über die Mauer hinunter in die Felder: niemand; einen zweiten schüchternen auf den Weg vor ihm: niemand als die Bravi. Was tun? umzukehren, war zu spät; die Beine in die Hand zu nehmen, war dasselbe wie zu sagen: Lauft mir nach! oder noch ärger. Da er also der Gefahr nicht ausweichen konnte, ging er ihr entgegen, weil ihm die Augenblicke dieser Ungewißheit so peinvoll waren, daß er nichts sonst ersehnte, als sie abzukürzen. Er beschleunigte seinen Schritt, sprach ein Sätzlein mit lauterer Stimme, legte in sein Gesicht so viel Ruhe und Heiterkeit, wie ihm möglich war, und machte alle Anstrengungen, ein Lächeln vorzubereiten; und als er sich den beiden anständigen Kerlen gegenüber befand, sagte er im Geiste zu sich: Da sind wir, und blieb stehen.
„Herr Pfarrer?“, sagte der eine von den beiden, indem er ihm die Augen ins Gesicht bohrte.
„Was beliebt?“, antwortete Don Abbondio augenblicklich, indem er die seinigen von dem Buche hob, das in seinen Händen aufgeschlagen verblieb wie auf einem Betpulte.
„Sie haben die Absicht“, fuhr der Bravo fort mit der drohenden und zürnenden Miene eines Menschen, der einen Untergebenen bei einer Schlechtigkeit ertappt, „Sie haben die Absicht, morgen Renzo Tramaglino und Lucia Mondella zusammenzugeben!“
„Jawohl...“, antwortete Don Abbondio mit zitternder Stimme, „jawohl. Sie sind, meine Herren, Männer von Welt und wissen sehr wohl, wie es bei solchen Sachen zugeht. Der arme Pfarrer tut nichts dazu: sie machen ihre Geschichten untereinander ab, und dann ... und dann kommen sie zu uns, wie man zum Wechsler geht, um sein Geld zu beheben; und wir ... wir sind die Diener der Gemeinde.“
„Gut also“, sagte ihm der Bravo ins Ohr, aber in dem ernsten Tone eines Befehls; „diese Heirat darf nicht stattfinden, weder morgen, noch überhaupt.“
„Aber meine Herren“, erwidert Don Abbondio mit der sanften und höflichen Stimme, womit man einem Ungeduldigen zuredet, „aber meine Herren, lassen Sie es sich belieben, sich an meine Stelle zu setzen. Hinge es von mir ab... Sie sehen sehr wohl, daß dabei nichts in meine Tasche kommt...“
„Nun“, unterbrach ihn der Bravo, „wenn die Sache mit Geplapper zu entscheiden wäre, so würden Sie uns in den Sack stecken. Wir wissen nichts davon und wollen nichts wissen. Ein vorsichtiger Mann ... Sie verstehen uns...“
„Aber, meine Herren, Sie sind zu gerecht, zu billig...“
„Aber“, unterbrach ihn diesmal der andere Gesell, der noch nichts gesprochen hatte, „aber die Trauung wird nicht vor sich gehen, oder ...“; und hier folgte ein tüchtiger Fluch, „oder wer sie vornimmt, wird es nicht bereuen, weil ihm die Zeit dazu fehlen wird, und ...“; wieder ein Fluch.
„Still, still“, begann der erste Sprecher wieder, „der Herr Pfarrer ist ein Mann, der das Leben kennt; und wir sind anständige Kerle, die ihm nichts zuleide tun wollen, wenn er nur vernünftig ist. Herr Pfarrer, der erlauchte Herr Don Rodrigo, unser Gebieter, läßt sich Ihnen freundlich empfehlen.“
Dieser Name war für den Geist Don Abbondios wie mitten in einem nächtlichen Unwetter ein Blitz, der die Gegenstände für einen Augenblick undeutlich beleuchtet und den Schrecken mehrt. Unwillkürlich machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: „Wenn Sie mir eine Andeutung geben könnten ...“
„Oh, Ihnen eine Andeutung geben, der Sie Latein verstehen“, fiel der Bravo wieder ein mit einem halb dummen und halb frechen Lachen. „Das ist Ihre Sache. Und vor allem lassen Sie sich kein Wörtlein über diesen Rat entschlüpfen, den wir Ihnen zu Ihrem Wohle gegeben haben; sonst... hm... wäre es gerade, wie wenn Sie die Trauung vorgenommen hätten. Also, was sollen wir dem durchlauchtigen Herrn Don Rodrigo von Ihnen ausrichten?“
„Meine Ehrerbietung ...“
„Deutlicher, bitte.“
„ ... Ich bin bereit ... stets bereit, zu gehorchen.“ Und indem er diese Worte hervorstieß, wußte er selber nicht, ob er damit ein Versprechen gebe oder eine Höflichkeitswendung gebrauche. Die Bravi nahmen sie in der ernsteren Bedeutung oder stellten sich wenigstens so.
„Sehr wohl; gute Nacht, Herr“, sagte der eine, indem er sich mit seinem Gesellen zum Gehen wandte.
Don Abbondio, der wenige Augenblicke früher ein Auge darum gegeben hätte, sie los zu sein, hätte nun gern das Gespräch und die Verhandlungen verlängert. „Meine Herren ...“, begann er, das Buch mit beiden Händen schließend; sie aber schlugen, ohne ihm weiter Gehör zu schenken, den Weg ein, den er gekommen war, und entfernten sich, ein garstiges Lied singend, das ich nicht hieher setzen will. Der arme Don Abbondio blieb ein Weilchen mit offenem Munde stehen, wie verzaubert; dann schlug er den von den zwei Pfaden ein, der zu seinem Hause führte. Seine Beine schienen gelähmt zu sein, so daß er nur mit Mühe eins dem andern nachschleppte, und seine Gemütsverfassung wird der Leser besser verstehen, wenn wir ihm noch einiges über sein Wesen gesagt haben werden und über die Zeiten, wo ihm zu leben beschieden war. Don Abbondio war – das wird der Leser schon bemerkt haben – mit keinem Löwenherzen geboren. Im Gegenteil. Seit seinen ersten Lebensjahren hatte er wahrnehmen müssen, daß damals niemand einen schlimmeren Stand hatte als ein Tier ohne Klauen und Zähne, das trotzdem keine Neigung empfand, gefressen zu werden. Die gesetzliche Macht beschützte keineswegs den ruhigen und verträglichen Menschen, der über keine Mittel verfügte, andere fürchten zu machen. Nicht, daß es an Gesetzen und Strafen gegen die Gewalttaten einzelner gemangelt hätte. Eher gab es einen Überfluß von Gesetzen: die Vergehen waren mit kleinlicher Weitschweifigkeit aufgezählt und eingeteilt, die Strafen waren unsinnig hoch und konnten, wenn sie nicht zureichten, schier in jedem Falle nach dem Gutdünken des Gesetzgebers selber und dem von hundert Vollstreckern verschärft werden, und das Gerichtsverfahren war nur darauf zugeschnitten, den Richter von allem zu entheben, was eine Verurteilung hätte verhindern können; die Abschnitte, die wir aus den Kundmachungen gegen die Bravi angeführt haben, sind dafür kleine, aber treue Belege. Bei alledem, ja zum großen Teile deswegen erzielten diese von jeder Regierung neu veröffentlichten und verstärkten Kundmachungen nichts andres, als daß sie die Ohnmacht ihrer Urheber schwulstig bezeugten; oder wenn sie einen unmittelbaren Erfolg zeitigten, so lag der hauptsächlich darin, daß sie den Plackereien, die die Friedfertigen und Schwachen von den andern zu leiden hatten, neue hinzufügten und die Gewalttätigkeit und die Schlauheit dieser Bösewichte steigerten. Die Straflosigkeit war zu einer festen Einrichtung geworden und hatte Wurzeln, die von den Kundmachungen nicht getroffen wurden oder nicht ausgerissen werden konnten; da waren die Zufluchtsstätten, da waren die Vorrechte etlicher Stände, die von der gesetzlichen Gewalt zum Teile anerkannt, zum Teile mit galligem Schweigen geduldet oder auch mit eitlen Verwahrungen bestritten, aber von diesen Ständen und schier von jedem einzelnen ihrer Glieder mit tätigem Bedachte auf den eigenen Vorteil und anmaßender Eifersucht aufrechterhalten und gehütet wurden. Da nun diese Straflosigkeit von den Kundmachungen zwar bedroht und angetastet, aber nicht vernichtet wurde, galt es natürlich bei jeder Bedrohung und bei jeder Antastung neue Kräfte und neue Listen anzuwenden, damit sie erhalten bleibe. Das geschah denn auch in der Tat: wenn derlei Kundmachungen erschienen, die die Gewalttätigen hätten unterdrücken sollen, suchten diese in ihrer wirklichen Kraft neue und tauglichere Mittel, in dem fortzufahren, was die Kundmachungen abstellen wollten. Sie hatten es leicht, den harmlosen Menschen, der ohne eigene Macht und ohne Schutz war, bei jedem Schritte anzuhalten und zu belästigen; denn zu dem Zwecke, jedermann in der Hand zu haben, um so jedes Verbrechen zu vereiteln oder zu bestrafen, waren alle Bewegungen des Bürgers der Willkür von tausend Obrigkeiten und Vollstreckern unterworfen. Wer aber noch vor der Durchführung des Verbrechens einige Maßnahmen getroffen hatte, um sich beizeiten in einem Kloster, in einem Palast, wohin sich die Birri1 nie ihren Fuß zu setzen getraut hätten, zu verbergen, wer ohne sonstige Maßnahmen einen Rock trug, den zu verteidigen die Eitelkeit und der Vorteil eines mächtigen Geschlechtes, eines ganzen Standes verlangten, der war frei in seinen Handlungen und konnte das ganze Geraffel der Kundmachungen verlachen. Von eben den Leuten die ausersehen gewesen wären, sie zu vollstrecken, gehörten einige von Geburt dem mit Vorrechten ausgestatteten Teile an, einige wieder waren als Schützlinge von ihm abhängig; die einen und die andern hatten durch Erziehung, durch Rücksichten auf ihren Vorteil, durch Gewohnheit, durch Nachahmung eine Grundsätze angenommen und hätten sich wohl gehütet, sie einem an einer Straßenecke angeschlagenen Papierfetzen zuliebe zu verletzen. Die Männer weiter, die mit der unmittelbaren Vollstreckung betraut waren, hätten damit, auch wenn sie kühn wie Helden, gehorsam wie Mönche und bereit, sich zu opfern, wie Märtyrer gewesen wären, nicht zustande kommen können, geringer an Zahl, wie sie waren, als die, um deren Unterwerfung es sich handelte, um so mehr, als häufig die Wahrscheinlichkeit bestand, daß sie von dem, der ihnen sozusagen theoretisch ein Vorgehen auftrug, im Stich gelassen worden wären. Überdies waren sie gemeiniglich die verworfensten und ruchlosesten Kerle ihrer Zeit; ihr Amt galt als verächtlich auch bei denen, die sich davor hätten fürchten können, und ihre Bezeichnung als Schmach. Es war also ganz natürlich, daß sie, statt bei einer unmöglichen Unternehmung ihr Leben aufs Spiel zu setzen oder geradezu wegzuwerfen, ihre Untätigkeit und dazu noch ihr Einverständnis an die Mächtigen verkauften und sich nur vorbehielten, ihre verfluchten Befugnisse und die trotz alledem vorhandene Gewalt bei den Gelegenheiten auszuüben, wo keine Gefahr war, nämlich wo es sich um die Bedrückung und Quälerei von friedfertigen und wehrlosen Leuten handelte.
Wer angreifen will oder wer jeden Augenblick angegriffen zu werden fürchtet, sucht natürlich Verbündete und Gesellen; darum war in diesen Zeiten das Bestreben der einzelnen, sich in Stände zusammenzuschließen, neue Stände zu bilden und dem eigenen Stande die größte Macht zu verschaffen, bis auf die Spitze gestiegen. Die Geistlichkeit wachte über die Verteidigung und Ausdehnung ihrer Unverletzlichkeit, der Adel seiner Vorrechte, der Soldat seiner Freiheiten; die Kaufleute, die Handwerker waren in Zünfte und Genossenschaften eingetragen, die Anwälte bildeten eine Vereinigung, und selbst die Ärzte hatten ihre Körperschaft. Jede von diesen kleinen Oligarchien hatte ihre besondere und ihr eigentümliche Form; in jeder fand der einzelne den Vorteil, in dem Maße eines Ansehens und seiner Gewandtheit die vereinten Kräfte vieler für sich zu verwenden. Die Ehrenhafteren bedienten sich dieses Vorteils nur zu ihrer Verteidigung; die Schlauen und die Schlechten nützten ihn aus, um Schurkereien durchzuführen, wozu ihre eigenen Mittel nicht genügt hätten, und um sich die Straflosigkeit zu sichern. Die Kräfte freilich dieser verschiedenen Bünde waren gar ungleich; und besonders auf dem Lande übte der reiche und gewalttätige Adelige, umgeben von einer Rotte Bravi und einer Bevölkerung von Bauern, die ihm aus Familienüberlieferung anhingen und sich ihres Vorteils halber oder gezwungen als Knechte und Soldaten des Herrn betrachteten, eine Macht aus, der dort Glieder einer andern Vereinigung schwerlich hätten widerstehen können.
Unser Abbondio, weder adelig, noch reich und noch weniger beherzt, hatte also, schier noch bevor er die Jahre der Vernunft erreicht hatte, eingesehen, daß er in dieser Gesellschaft wie ein Krug ausgebrannter Erde war, der gezwungen ist, mit vielen eisernen Krügen Weggenossenschaft zu halten; darum hatte er auch gutwillig genug seinen Eltern gehorcht, deren Wunsch es gewesen war, daß er Priester werde. Um die Wahrheit zu sagen, hatte er nicht besonders viel nachgedacht über die Pflichten und edlen Zwecke des Amtes, dem er sich widmete; daß er sich eine gewisse Behaglichkeit des Lebens sicherte und in einen verehrten und mächtigen Stand eintrat, waren ihm zwei mehr als genügende Gründe für eine solche Wahl gewesen. Aber kein Stand schützt und sichert den einzelnen über eine gewisse Grenze hinaus, und keiner erläßt es ihm, sich ein besonderes System zurechtzulegen.
Don Abbondio, vollkommen in Anspruch genommen von den Gedanken an die eigene Ruhe, kümmerte sich nicht um die Vorteile, die zu erlangen viel Mühe oder ein wenig Wagemut erfordert hätten; sein System bestand hauptsächlich darin, daß er alle Gegensätze vermied und bei denen, die er nicht vermeiden konnte, nachgab: eine unbewaffnete Neutralität in allen Kämpfen, die rings um ihn ausbrachen, von den damals so häufigen Zwistigkeiten zwischen der Geistlichkeit und den weltlichen Behörden, zwischen der Bürgerschaft und der bewaffneten Macht, zwischen Adligen und Adligen angefangen bis herunter zu den Streitigkeiten zwischen zwei Bauern, entstanden aus einem Worte und mit den Fäusten oder mit den Messerstichen entschieden. Sah er sich durchaus gezwungen, zwischen zwei Streitenden Partei zu nehmen, stand er zu dem Stärkeren, immer freilich im Hintertreffen und wohl bedacht darauf, dem andern zu zeigen, daß er ihm nicht freiwillig feind sei; und es war so, als ob er ihm sagte: Aber warum habt es nicht Ihr verstanden, der Stärkere zu sein? ich hätte mich auf Eure Seite geschlagen. Indem er den Übermütigen aus dem Wege ging, ihre vorübergehenden und launenhaften Kränkungen übersah, ernstlicheren und mehr überlegten aber mit Unterwürfigkeit begegnete und auch den Barschesten und Mürrischsten, wenn er mit ihnen auf der Straße zusammentraf, mit Bücklingen und heiterer Ehrerbietung ein Lächeln abnötigte, hatte es der arme Mann fertiggebracht, die Sechzig ohne große Gefährlichkeiten zu überschreiten.
Immerhin soll damit nicht gesagt sein, daß nicht auch er sein bißchen Galle im Leibe gehabt hätte; dieses stetige Geduldüben, dieses häufige andern Rechtgeben und so viele schweigend geschluckte bittere Bissen hatten ihn so sauertöpfisch gemacht, daß, wenn er sich nicht manchmal hätte ein bißchen Luft machen können, sicherlich seine Gesundheit darunter gelitten hätte. Aber da es schließlich auf Erden und in seiner Nachbarschaft Leute gab, die er nur zu wohl als unfähig kannte, etwas Böses zu tun, so konnte er dann und wann an ihnen seinen lange zurückgehaltenen Unmut auslassen und auch selber der Lust frönen, ein wenig eigensinnig zu sein und ohne Ursache zu schreien; dann war er ein strenger Richter der Menschen, die sich nicht solche Beschränkungen auferlegten wie er, freilich nur, wenn er das Richteramt ausüben konnte ohne die Spur einer auch nur fernen Gefahr. Der Geprügelte war zum mindesten ein Dummkopf, der Getötete war schon immer ein boshafter Mensch gewesen; bei dem, der den Versuch, gegen einen Mächtigen rechtzubehalten, mit einem zerschlagenen Kopfe hatte bezahlen müssen, wußte er immer irgendein Unrecht zu finden: keine schwierige Sache, weil Recht und Unrecht nicht durch so scharfe Striche geschieden sind, daß jede Partei nur von dem einen haben könnte. Vor allem wetterte er gegen die von seinen Amtsbrüdern, die auf ihre Gefahr hin für den schwachen Unterdrückten gegen den mächtigen Bedränger eintraten: das nannte er mit aller Gewalt Händel suchen und einen Mohren weiß waschen wollen; auch sagte er mit strenger Miene, es sei eine Einmischung in weltliche Dinge auf Kosten der Würde des heiligen Amtes. Und gegen diese Leute predigte er, freilich nur unter vier Augen oder in einem kleinen Kreise, mit einer um so größeren Heftigkeit, je mehr es bekannt war, daß es ihnen fern lag, etwas, das sie persönlich betraf, übelzunehmen. Weiter hatte er einen Lieblingsspruch, womit er stets die Gespräche über derlei Gegenstände besiegelte: daß nämlich einem anständigen Kerl, der auf sich achte und sich nur um das kümmere, was ihn angehe, niemals eine Widerwärtigkeit zustoße.
Nun mögen sich meine fünfundzwanzig Leser vorstellen, was für einen Eindruck die erzählte Begegnung auf das Gemüt dieses armen Teufels machen mußte. Der Schrecken über diese garstigen Gesichter und über diese unheimlichen Reden, die Drohungen eines Herrn, von dem es bekannt war, daß er nicht eitel drohte, der plötzliche Zusammenbruch eines Systems, das so viele Jahre des Eifers und der Geduld gekostet hatte, und eine Sackgasse, die ihm keinen Ausgang zeigte – all diese Gedanken brausten ungestüm in dem gesenkten Haupte Don Abbondios: Wenn sich Renzo mit einem glatten Nein zufrieden gäbe, gut; aber er wird Gründe haben wollen: was soll ich ihm dann, um Himmelswillen, antworten? Eh, eh, auch er hat seinen Kopf: ein Lamm, wenn ihm niemand nahe tritt; wenn ihm aber einer widersprechen will... ih! Dazu ist er in diese Lucia verschossen, verliebt wie ... Solche Bürschchen, die sich verlieben, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, wollen heiraten und denken an nichts anderes; was für Scherereien sie einem armen anständigen Kerl auf den Hals laden, das macht ihnen keine Sorgen. O ich Ärmster! mußten sich denn diese zwei Galgenvögel just auf meinem Wege aufpflanzen und mit mir anbinden? Was geht's mich an? will denn ich mich verheiraten? warum haben sie nicht lieber mit... Da hat man es wieder: es ist einmal mein Unglück, daß mir die guten Gedanken immer einen Augenblick zu spät kommen; wenn ich daran gedacht hätte, ihnen einzugeben, daß sie mit ihrer Botschaft zu ... – Aber hier besann er sich, daß die Reue, zu der Unbill nicht geraten und nichts dazu getan zu haben, allzu unbillig sei; und er lenkte allen Groll seiner Gedanken gegen den, der ihn also um seinen Frieden brachte. Don Rodrigo kannte er nur vom Sehen und dem Namen nach, hatte auch noch nichts sonst mit ihm zu tun gehabt, als daß er die paar Male, wo er ihm auf der Straße begegnet war, die Brust mit dem Kinn und den Boden mit der Spitze eines Huts berührt hatte; wohl aber hatte sich ihm schon mehr als einmal die Gelegenheit geboten, seinen Ruf gegen Leute zu verteidigen, die mit leiser Stimme, unter Seufzern und die Augen zum Himmel erhoben irgendeine seiner Unternehmungen vermaledeit hatten, und hundertmal hatte er gesagt, daß er ein ehrenwerter Ritter sei. In diesem Augenblicke jedoch gab er ihm in seinem Herzen all die Namen, die er von anderen nie hätte auf ihn anwenden hören, ohne sie sofort mit einem Oho zu unterbrechen. Als er in dem Aufruhr dieser Gedanken zu der Tür eines Hauses, das am Eingang des Dörfchens stand, gekommen war, steckte er den Schlüssel, den er schon in der Hand hielt, hastig ins Loch, öffnete, trat ein, schloß wieder sorgfältig zu und rief alsbald voll Verlangen nach seiner vertrauten Gesellschaft: „Perpetua! Perpetua!“, seine Schritte immerhin dem kleinen Saale zulenkend, wo die Trägerin dieses Namens sicherlich sein mußte, um den Tisch für das Abendessen zu decken.
Perpetua war, wie jedermann sieht, die Magd Don Abbondios: eine anhängliche und treue Magd, die es verstand, je nach den Umständen zu gehorchen oder zu befehlen, zur Zeit das Gebrumme und die Launen ihres Herrn zu ertragen und zur Zeit ihn die ihrigen ertragen zu lassen, die von Tag zu Tag häufiger wurden, seit sie das kanonische Alter von vierzig Jahren erreicht hatte; ledig war sie geblieben, weil sie, wie sie sagte, alle Partien, die sich ihr geboten hätten, ausgeschlagen hatte, oder weil sie, wie ihre Freundinnen sagten, nie einen Hund gefunden hatte, der hätte anbeißen wollen.
„Ich komme schon“, antwortete Perpetua, indem sie die kleine Flasche mit Don Abbondios Lieblingswein an den gewohnten Platz auf dem kleinen Tisch stellte, und setzte sich langsam in Bewegung; sie hatte aber die Schwelle des Gemaches noch nicht betreten, als schon er eintrat, mit einem so verdüsterten Blicke, mit einem so verstörten Gesichte, daß es nicht der erfahrenen Augen Perpetuas bedurft hätte, um auf den ersten Blick zu erkennen, daß ihm etwas wirklich Außerordentliches zugestoßen war. „Barmherzigkeit! was haben Sie denn, Herr?“
„Nichts, nichts“, antwortete Don Abbondio, indem er sich keuchend in seinen großen Armstuhl fallen ließ.
„Was? nichts? Das wollen Sie mir weismachen? So hergenommen, wie Sie aussehen? Es ist etwas Außerordentliches geschehen.“
„Aber um Himmelswillen! Wenn ich sage, nichts, so ist es entweder nichts, oder etwas, was ich nicht sagen kann.“
„Was Sie nicht einmal mir sagen können? Wer wird sich Ihrer Gesundheit annehmen? wer wird Ihnen einen Rat geben?“
„Ach, schweigt doch, und stellt nicht noch etwas an; gebt mir ein Glas von meinem Wein.“
„Und Sie wollen mir gegenüber dabei bleiben, daß Sie nichts hätten?“, sagte Perpetua, indem sie das Glas füllte und es dann so in der Hand hielt, als ob sie es nur als Belohnung für das Vertrauen hergeben wollte, das so lang auf sich warten ließ.
„Gebt her, gebt her“, sagte Don Abbondio; er nahm das Glas mit der nicht recht sicheren Hand und lehrte es hastig, als ob es eine Arznei gewesen wäre.
„Wollen Sie mich also zwingen, herumzufragen, was meinem Herrn zugestoßen ist?“, sagte Perpetua, die, die Hände verkehrt in die Hüften gestemmt, die spitzigen Ellbogen nach außen, auf recht vor ihm stand und ihren Blick so fest auf ihn richtete, als ob sie ihm das Geheimnis hätte aus den Augen saugen wollen.
„Um Gottes willen, macht keine Klatscherei, macht keinen Lärm: es gilt ... es gilt das Leben!“
„Das Leben?“
„Das Leben.“
„Sie wissen sehr wohl, daß ich, so oft Sie mir etwas aufrichtig und im Vertrauen gesagt haben, niemals ...“
„Bübin! wie damals ...“
Perpetua ward inne, daß sie eine falsche Saite angeschlagen hatte; darum änderte sie augenblicklich den Ton und sagte mit gerührter und rührender Stimme: „Herr, ich bin Ihnen stets zugetan gewesen; und daß ich jetzt unterrichtet sein will, das macht der Eifer, weil ich wünschte, Ihnen helfen zu können, Ihnen einen guten Rat zu geben, Ihnen den Mut aufzurichten ...“
Es steht fest, daß Don Abbondio vielleicht ein ebenso großes Verlangen hatte, sich eines peinigenden Geheimnisses zu entledigen, wie Perpetua, es zu erfahren; nachdem er daher ihre erneuten und heftigeren Anstürme immer schwächer abgeschlagen hatte und nachdem er sie mehr als einmal hatte schwören lassen, daß sie nicht ein Sterbenswörtchen sagen werde, erzählte er ihr schließlich mit vielen Pausen und mit vielem Ach und Weh das betrübliche Ereignis. Als er zu dem schrecklichen Namen des Auftraggebers kam, mußte Perpetua einen neuen und feierlicheren Eid leisten; und kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen, so ließ er sich mit einem tiefen Seufzer in die Lehne eines Armstuhls zurücksinken, die Hände mit einer zugleich befehlenden und bittenden Gebärde erhoben, und sagte: „Um Himmels willen!“
„Das sieht ihm ähnlich!“, schrie Perpetua. „O dieser Schurke! dieser Frevler! dieser Mensch ohne Gottesfurcht!“
„Wollt Ihr schweigen? oder wollt Ihr mich gänzlich ins Verderben stürzen?“
„Ach, wir sind allein, und niemand hört uns. Aber was werden Sie tun, mein armer Herr?“
„Da hat man's“, sagte Don Abbondio mit grollender Stimme; „da hat man's, was für treffliche Ratschläge sie mir zu geben weiß! Mit Fragen kommt sie mir, was ich tun werde, was ich tun werde; als ob sie in der Klemme steckte und ich sie herausziehen müßte.“
„O, ich hätte Ihnen schon meinen armseligen Rat zu geben; aber dann ...“
„Aber dann, laßt hören ...“
„Mein Rat wäre, daß ich, da ja alle sagen, daß unser Erzbischof ein heiliger Mann ist, ein Mann, der das Herz auf dem rechten Flecke hat, der sich vor niemandem fürchtet und der ganz selig ist, wenn er, um einem Pfarrer zu helfen, einen von diesen Übermütigen zur Vernunft bringen kann, daß ich also sagen würde, und ich sage es auch, daß Sie ihm einen schönen Brief schreiben sollten, um ihn zu unterrichten, wie ...“
„Wollt Ihr schweigen? wollt Ihr schweigen? Ist das ein Rat für einen armen Teufel? Wenn ich eine Kugel ins Kreuz bekäme, Gott bewahre! würde sie mir der Erzbischof herausziehen?“
„Ah, die Kugeln kommen nicht so daher wie Konfetti; es sähe auch schlimm aus, wenn diese Hunde jedesmal beißen wollten, wenn sie bellen. Ich habe noch immer gesehen, daß der, der die Zähne zu zeigen und sich Achtung zu verschaffen weiß, auch respektiert wird; und gerade weil Sie nie auf Ihrem Rechte bestehen, ist es mit uns so weit gekommen, daß sie uns alle, mit Verlaub,...“
„Wollt Ihr schweigen?“
„Ich schweige schon; deswegen ist es aber doch wahr, daß, wenn die Welt merkt, daß einer bei jeder Mißhelligkeit bereit ist, die Segel...“
„Wollt Ihr schweigen? Ist jetzt die Zeit, einen solchen Unsinn zu reden?“
„Genug: Sie werden heute nacht darüber nachdenken; unterdessen beginnen Sie aber nicht damit, daß Sie sich selber weh tun und Ihrer Gesundheit schaden: essen Sie einen Bissen.“
„Nachdenken werde ich freilich“, antwortete brummend Don Abbondio; „sicherlich, nachdenken werde ich, ich muß ja auch nachdenken.“ Und indem er aufstand, fuhr er fort: „Zu mir nehmen will ich nichts, gar nichts; ich hätte einen andern Wunsch. Das weiß ich schon selber, daß ich nachdenken muß. Und just mir hat das zustoßen müssen!“
„So schlucken Sie wenigstens noch diesen Tropfen“, sagte Perpetua einschenkend; „Sie wissen, daß Ihnen der immer den Magen einrichtet.“
„Ach, dazu brauchte es etwas anderes, etwas ganz anderes.“
Mit diesen Worten nahm er das Licht und ging, immerfort brummend: „Eine niedliche Kleinigkeit! einem ehrlichen Manne wie mir! und wie wird's morgen gehen?“, und unter ähnlichen Klagen, um in seine Kammer hinaufzusteigen. Auf der Schwelle drehte er sich zu Perpetua um, legte den Finger auf den Mund und sagte langsam und feierlich: „Um Himmels willen!“ und verschwand.
1 Die bewaffnete Polizei.
2. KAPITEL.
MAN erzählt, daß der Prinz von Condé in der Nacht vor dem Tage von Rocroi tief geschlafen hat; aber einmal ist er sehr ermüdet gewesen, und dann hat er auch schon die notwendigen Verfügungen getroffen und alles, was am Morgen geschehen sollte, festgesetzt gehabt. Don Abbondio hingegen wußte noch nichts sonst, als daß der nächste Tag ein Schlachttag ein werde; darum ging ein großer Teil der Nacht auf ängstliche Überlegungen auf. Sich weder um die schurkische Mahnung, noch um die Drohungen zu kümmern und die Trauung vorzunehmen, war eine Lösung, die er nicht einmal in Erwägung ziehen mochte. Renzo die ganze Geschichte mitzuteilen und mit ihm einen Ausweg zu suchen ... Gott bewahre! „Laßt Euch kein Wörtchen entschlüpfen ... sonst... hm!“, hatte der eine von diesen Bravi gesagt; und wenn er fühlte, wie dieses „Hm“ in einem Innern widerhallte, empfand Don Abbondio, weit entfernt, an eine Übertretung des Gebotes auch nur zu denken, auch schon Reue, daß er zu Perpetua geschwatzt hatte. Fliehen? Und dann? Wieviel Ungelegenheiten und wieviel Verantwortung? Bei jeder Lösung, die der Arme zurückwies, warf er sich im Bett auf die andere Seite. Das, was ihm noch in jeder Beziehung das beste oder das am wenigsten schlechte schien, war, Zeit zu gewinnen, indem er Renzo hinhalte. Dabei fiel ihm auch schon ein, daß nur noch wenige Tage bis zu der Zeit fehlten, wo keine Hochzeiten stattfinden durften: Kann ich also den Burschen diese paar Tage hinhalten, so kann ich zwei Monate lang aufatmen; und in zwei Monaten können große Dinge geschehen. Und er grübelte nach, was für Ausflüchte er gebrauchen könnte; und obwohl sie ihm alle ein wenig leicht schienen, beruhigte er sich mit dem Gedanken, die Würde seines Amtes werde ihnen das richtige Gewicht und eine ältere Erfahrung ihm einen Vorteil über den unwissenden Renzo verleihen. Wir werden ja sehen, sagte er bei sich: er denkt an seine Liebste, ich an meine Haut; mehr beteiligt bin ich, abgesehen davon, daß ich auch der Schlauere bin. Juckt es dich am Leibe, lieber Sohn, so kann ich nichts dazu sagen; aber eine Lust, mir dabei einen Schaden zuzuziehen, habe ich nicht. Nachdem er also einigermaßen zu einem Entschluß gekommen war, konnte er endlich die Augen schließen; aber was für ein Schlaf! was für Träume! Bravi, Don Rodrigo, Renzo, Fußsteige, Felsen, Flucht, Verfolgung, Geschrei, Schüsse.
Das erste Erwachen nach einem Unglück und in Unannehmlichkeiten ist ein gar bitterer Augenblick. Kaum wieder einer selbst bewußt, ruft sich der Geist die gewohnten Bilder des vorhergegangenen ruhigen Lebens zurück; aber mit rücksichtsloser Plötzlichkeit drängt sich neben diese der Gedanke an den neuen Stand der Dinge, und das Mißvergnügen daran wird lebendiger bei diesem augenblicklichen Vergleich. Nachdem Abbondio diesen Augenblick schmerzlich verkostet hatte, wiederholte er sich alsbald eine nächtlichen Überlegungen, bestärkte sich darin und legte sie sich besser zurecht; dann stand er auf, um Renzo mit Furcht und zugleich mit Ungeduld zu erwarten.
Lorenzo, oder wie ihn alle nannten, Renzo, ließ nicht lange auf sich warten. Kaum war die Stunde gekommen, wo er sich, ohne eine Ungeschicklichkeit zu begehen, beim Pfarrer einfinden zu können glaubte, so ging er auch schon hin mit dem freudigen Ungestüm eines Zwanzigjährigen, der an diesem Tage die heimführen soll, die er liebt. Seit seinen Jünglingsjahren war er elternlos, und er übte das Gewerbe eines Seidenspinners aus, das sozusagen in seiner Familie erblich war, ein Gewerbe, das noch wenige Jahre vorher reichlichen Gewinn gebracht hatte, aber damals schon im Niedergange war, freilich noch nicht soweit, daß nicht daraus ein tüchtiger Werkmann seinen Lebensunterhalt hätte ziehen können. Die Arbeit nahm zwar von Tag zu Tag ab; aber die beständige Auswanderung der durch Versprechungen, Vorrechte und großen Lohn in die Nachbarstaaten gelockten Arbeiter brachte es mit sich, daß es denen, die im Lande blieben, nicht daran mangelte. Überdies besaß Renzo ein Gütchen, das er bearbeiten ließ und, wenn die Spindel stillstand, selber bearbeitete, so daß er sich für seinen Stand wohlhabend nennen durfte. Und obwohl dieses Jahr viel magerer war als die vorhergegangenen und obwohl sich schon eine wirkliche Teuerung fühlbar machte, so war doch unser junger Mann, der, seitdem er die Augen auf Lucia geworfen hatte, sparsam geworden war, mit aller Notdurft wohlversorgt und brauchte nicht mit dem Hunger zu kämpfen. Er erschien vor Don Abbondio in großem Staate, bunte Federn auf dem Hute, einen Dolch mit dem schönen Griffe in der Hosentasche und mit dem gewissen feierlichen und dabei doch trotzigen Wesen, das damals auch den ruhigsten Leuten eigen war. Der unsichere und geheimnisvolle Empfang Don Abbondios stand in einem seltsamen Gegensatz zu dem freimütigen und entschlossenen Auftreten des Jünglings.
Dem muß etwas durch den Kopf gehen, folgerte Renzo bei sich, und dann sagte er: „Ich bin gekommen, Herr Pfarrer, um zu erfahren, zu welcher Stunde es Ihnen paßt, daß wir uns in der Kirche einfinden.“
„Von welchem Tage sprecht Ihr?“
„Was? Von welchem Tage? Erinnern Sie sich nicht, daß der heutige festgesetzt ist?“
„Der heutige?“, erwiderte Don Abbondio, als ob er davon hätte das erstemal reden hören. „Heute, heute ... habt Geduld, aber heute kann ich nicht.“
„Heute können Sie nicht? Was ist denn geschehen?“
„Vor allem, seht Ihr, fühle ich mich nicht wohl.“
„Das ist mir unlieb; aber was Sie zu tun haben, erfordert so wenig Zeit und so wenig Mühe ...“
„Und dann, und dann ...“
„Und dann, was denn?“
„Und dann sind Verwicklungen da.“
„Verwicklungen? Was für Verwicklungen könnten das sein?“
„Ihr müßtet in meiner Haut stecken, um zu verstehen, wie viel Unannehmlichkeiten bei derlei Dingen entstehen und worüber man alles Rechenschaft ablegen soll. Ich bin allzu weichherzig, ich denke an nichts anderes, als jedes Hemmnis aus dem Wege zu räumen, alles zu erleichtern und nach dem Gefallen anderer zu handeln, und vernachlässige meine Pflicht; und dann treffen mich Vorwürfe und schlimmere Dinge.“
„Aber in Himmels Namen, so spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter und sagen Sie mir klipp und klar, was es gibt.“
„Wißt Ihr, wie viele und wie viele Förmlichkeiten zu einer regelrechten Heirat notwendig sind?“
„Etwas muß ich wohl davon wissen“, sagte Renzo, der schon ärgerlich zu werden anfing; „haben Sie mir doch damit in den letzten Tagen den Kopf zur Genüge warm gemacht. Ist denn aber nicht jetzt alles richtig abgewickelt? ist vielleicht nicht alles getan, was zu tun war?“
„Alles, alles, meint Ihr; drum habt Geduld, der Dummkopf bin ich, der ich meine Pflicht vernachlässige, um nur den Leuten keine Scherereien zu machen. Aber jetzt ... genug; ich weiß, was ich sage. Wir armen Pfarrer sind zwischen Hammer und Amboß, Ihr Ungeduldiger; Ihr tut mir ja leid, armer Junge, und die Oberen ... genug, alles darf ich nicht sagen. Und wir sind die, die das Bad ausgießen.“
„Aber so erklären Sie mir doch einmal, worin denn diese Förmlichkeit besteht, die noch zu erfüllen ist; und sie soll auf der Stelle erfüllt werden.“
„Wißt Ihr, wieviel Ehehindernisse es gibt?“
„Was soll ich denn von den Ehehindernissen wissen?“
„Error, conditio, votum, Cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis ...“, begann Don Abbondio, indem er an den Fingerspitzen mitzählte.
„Treiben Sie Scherz mit mir?“, unterbrach ihn der junge Mann; „was soll ich mit Ihrem Latinorum anfangen?“
„Also, wenn Ihr die Sachen nicht versteht, so überlaßt sie dem, der sie versteht.“
„Ei, da ...!“
„Ruhig, lieber Renzo, erbost Euch nicht, ich bin ja bereit, alles zu tun, ... was von mir abhängt. Ich wünschte nichts mehr, als Euch zufrieden zu sehen; ich will Euch wahrhaftig wohl. Ach ... wenn ich denke, daß es Euch so gut gegangen ist; hat Euch etwas gefehlt? Da ist Euch die Grille gekommen, zu heiraten ...“
„Was sind das für Reden, Herr?“, brach Renzo mit einem halb verdutzten und halb zornigen Gesichte los.
„Ich sag Euch's noch einmal, habt Geduld; ich sag Euch's noch einmal. Ich möchte Euch so gern zufrieden sehen...“
„Kurz ...“
„Kurz, mein Sohn, mich trifft keine Schuld; ich habe das Gesetz nicht gemacht. Und bevor wir eine Trauung vornehmen, sind wir geradezu verpflichtet, viele und viele Nachforschungen anzustellen, um uns zu vergewissern, daß kein Hindernis besteht.“
„Ach was! Sagen Sie mir doch einmal, was für ein Hindernis dazwischengekommen ist.“
„Habt Geduld; das sind keine Dinge, die sich so mir nichts, dir nichts auseinandersetzen ließen. Es wird ja nichts sein, hoffe ich; aber immerhin müssen diese Nachforschungen angestellt werden. Der Text ist klar und einleuchtend: Antequam matrimonium denunciet ...“
„Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ich nichts Lateinisches hören will.“
„Ich muß Euch aber doch erklären...“
„Aber haben Sie denn diese Nachforschungen noch nicht angestellt?“
„Noch nicht alle, wie ich hätte tun sollen, sage ich Euch.“
„Warum haben Sie es nicht beizeiten getan? warum mir sagen, daß alles fertig sei? warum warten...?“
„Nun also! Ihr werft mir meine allzu große Güte vor. Ich habe alles leichter genommen, um Euch rascher dienen zu können: aber ... aber jetzt ist mir eingefallen ... genug, ich weiß es.“
„Und was soll ich tun?“
„Noch ein paar Tage Geduld haben. Lieber Sohn, ein paar Tage sind keine Ewigkeit; habt also Geduld.“
„Wie lange?“
Wir sind auf gutem Wege, dachte Don Abbondio bei sich; und er sagte, liebenswürdiger als je: „Nun, in vierzehn Tagen werde ich trachten ... werde ich es besorgen ...“
„Vierzehn Tage! das ist wirklich eine Überraschung! Es ist alles geschehen, was Sie gewünscht haben, der Tag ist festgesetzt worden, der Tag ist da, und Sie kommen mir mit der Eröffnung, daß ich noch vierzehn Tage warten soll!“
„Vierzehn ...“, wiederholte er dann mit lauterer und zornigerer Stimme, den Arm gestreckt und mit der Faust in die Luft schlagend; und wer weiß, was für eine Teufelei er dieser Zahl angehängt hätte, wenn er nicht von Don Abbondio unterbrochen worden wäre, der mit einer schüchternen und ängstlichen Freundlichkeit seine andere Hand faßte:
„Regt Euch nicht auf, um Himmels willen; ich werde sehen, ich werde trachten, in einer Woche ...“
„Und was soll ich Lucia sagen?“
„Daß es ein Versehen von mir ist.“
„Und das Gerede der Leute?“
„Sagt nur allen, daß ich aus lauter Eifer, aus allzu großer Güte etwas versehen habe; schiebt alle Schuld auf mich. Kann ich besser mit Euch reden? Also auf eine Woche.“
„Und dann wird kein Hindernis mehr sein?“
„Wenn ich Euch sage ...“
„Gut also, ich werde eine Woche Geduld haben; aber merken Sie sich wohl, daß Sie mich, wenn die vorbei ist, nicht mehr mit Geschwätz auszahlen werden. Bis dahin empfehle ich mich Ihnen.“
Und nach diesen Worten ging er, indem er Don Abbondio eine weniger tiefe Verbeugung machte als sonst und ihm einen mehr bedeutsamen, als ehrfurchtsvollen Blick zuwarf.