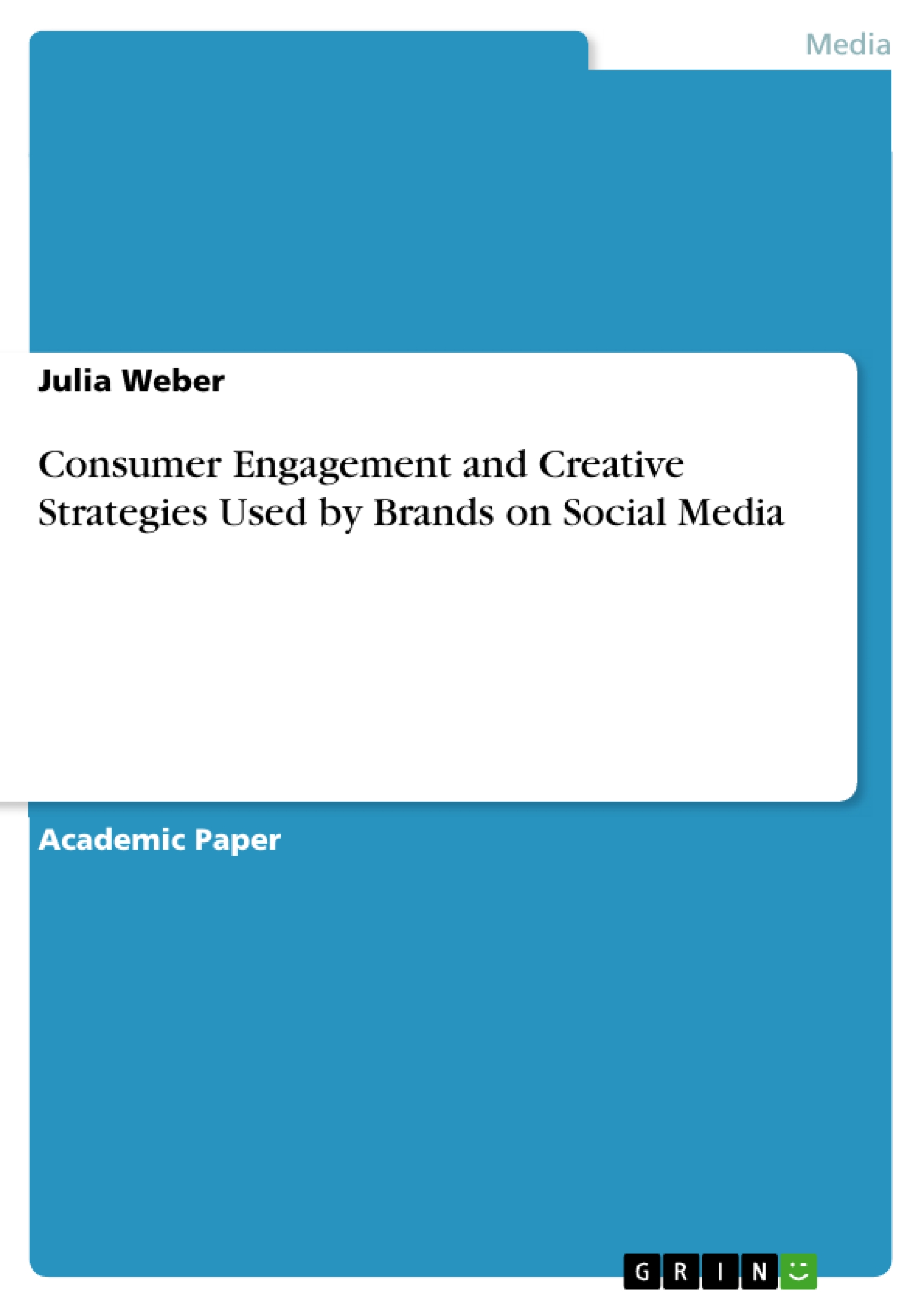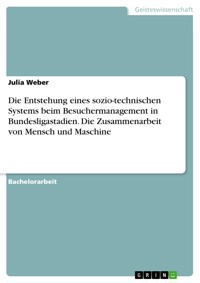19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julia Weber arbeitet an ihrem zweiten Roman, als sie schwanger wird. Ein zweites Kind? Wie wird ihr Leben sein? Woher Kraft und Zeit nehmen für zwei Kinder und das Schreiben? In der Angst, dass das Leben und seine Forderungen ihre Kunst auffressen könnten, beginnt Julia Weber schreibend ein Gespräch mit ihren Romanfiguren. Der Alltag drängt sich in ihre Kunst und die Kunst drängt sich in den Alltag, dazu die Frage, wie es gelingen könnte, das Leben zu viert mitsamt ihrer Kunst. Sie protokolliert Gespräche mit H., ihrem Mann, sammelt Briefe an ihre Freundin A., Nachrichten ihrer Mutter, Erinnerungen an das eigene Kindsein, das Hineinwachsen in einen Frauenkörper, in einen erwachsenen Alltag der Notwendigkeiten, das Dagegenhalten gegen die Notwendigkeiten mit Hilfe der Kunst, das Dagegenhalten gegen die grosse Traurigkeit, gegen die Angst, und immer wieder die Anläufe in den Roman, die Verwandlung des Lebens in Literatur, Bewusstheit, Glück. «Die Vermengung» ist eine eindrückliche Beschreibung des weiblichen Körpers und seiner Transformationen und die Erkundung einer weiblichen Biografie von heute zwischen Berufstätigkeit und Familie, zwischen Leben und Kunst, Freundschaft und Gesellschaft. Sie entwirft zugleich eine Poetik weit abseits einer hartnäckig überlieferten Genietradition, eine radikale und doch weiche, auf das Leben gerichtete Auffassung von Kunst. Ein hochpoetischer Text von grosser Kraft und Aktualität!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Julia Weber arbeitet an ihrem zweiten Roman, als sie schwanger wird. Ein zweites Kind? Wie wird ihr Leben sein? Woher Kraft und Zeit nehmen für zwei Kinder und das Schreiben?
In der Angst, dass das Leben und seine Forderungen ihre Kunst auffressen könnten, beginnt Julia Weber schreibend ein Gespräch mit ihren Romanfiguren. Der Alltag drängt sich in ihre Kunst und die Kunst drängt sich in den Alltag, dazu die Frage, wie es gelingen könnte, das Leben zu viert mitsamt ihrer Kunst. Sie protokolliert Gespräche mit H., ihrem Mann, sammelt Briefe an ihre Freundin A., Nachrichten ihrer Mutter, Erinnerungen an das eigene Kindsein, das Hineinwachsen in einen Frauenkörper, in einen erwachsenen Alltag der Notwendigkeiten, das Dagegenhalten gegen die Notwendigkeiten mit Hilfe der Kunst, das Dagegenhalten gegen die große Traurigkeit, gegen die Angst, und immer wieder die Anläufe in den Roman, die Verwandlung des Lebens in Literatur, Bewusstheit, Glück.
«Die Vermengung» ist eine eindrückliche Beschreibung des weiblichen Körpers und seiner Transformationen und die Erkundung einer weiblichen Biografie von heute zwischen Berufstätigkeit und Familie, zwischen Leben und Kunst, Freundschaft und Gesellschaft. Sie entwirft zugleich eine Poetik weit abseits einer hartnäckig überlieferten Genietradition, eine radikale und doch weiche, auf das Leben gerichtete Auffassung von Kunst. Ein hochpoetischer Text von großer Kraft und Aktualität!
Foto Aysşe Yavaş
Julia Weber, 1983 in Moshi (Tansania) geboren, aufgewachsen in Zürich. Nach einer Lehre als Fotofachangestellte mit gestalterischer Berufsmaturität studierte sie von 2009 bis 2012 literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Sie gründete 2012 den «Literaturdienst» und war 2015 Mitbegründerin der Kunstaktionsgruppe «Literatur für das, was passiert» zur Unterstützung von Menschen auf der Flucht. Im Limmat Verlag ist ihr Debütroman «Immer ist alles schön» lieferbar, der auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises war und vielfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit der Alfred-Döblin-Medaille, dem Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, dem Droste Förderpreis und dem Internationalen Franz Tumler Literaturpreis. 2021 las sie in Klagenfurt.
Julia Weber
Die Vermengung
In der Nacht, wenn das Kind schläft und ich nicht schlafen kann, weil ich Angst habe, es könnte aufhören zu atmen, schreibe ich. Ich habe sein Bettchen neben meinen Arbeitstisch geschoben, und immer wieder schaue ich hinein, lege meinen Finger unter die Nase des Kindes. Ich beschreibe Gerüche, die ich riechen kann, Kleider, die ich tragen, Klänge, die ich hören, und Menschen, die ich kennen kann. Ich schaue das Kind an und frage mich, ob es bleicher geworden ist, und lege meine Hand auf seine kleine Brust. Dann schreibe ich weiter, weil sein Brustkorb sich langsam hebt und senkt.
«Wenn ich sage ‹Hoffnung›, dann meine ich nicht Hoffnung auf etwas Bestimmtes. Ich glaube, ich meine einfach den Gedanken daran, dass es sich lohnt, die Augen offen zu halten.» Maggie Nelson, Bluets
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Textnachweise
Dank
I
Ich sitze in der Küche, sehe geradeaus durch das Fenster in den Hof, und weil die Tauben in den Blutbuchen gurren, schreibe ich von gurrenden Tauben. Und weil eine Frau einen Kinderwagen vor sich herschiebt und sich auf ihm abstützt, als könne sie ohne den Wagen nicht gehen, schreibe ich über eine Frau, die ihr Kind liebt. Ich schaue auf, es ist 12:07 Uhr, und ich sehe B. am anderen Ende des Hofes auftauchen, sie kommt langsam auf mich zu. Ihr Haar leuchtet hell, beinahe weiß. Sie hebt die Hand, als sie mich sieht.
Vielleicht bewegt sich mein Schreiben geradeso, wie wenn etwas näherkommt, aber ich erkenne nicht, was oder wer es ist, dennoch ist mir klar, diese Bewegungen kenne ich, dieses Geräusch sagt mir etwas, es ist mir vertraut, aber ich kann es nicht greifen. Und dann ist es da, für einen Moment, ganz klar, fixiert und im nächsten Moment wieder verschwunden.
Bist du aus Milch?, hat einer mich gefragt. Bist du wirklich, oder habe ich mir dich gewünscht? Erfunden? Sitze ich mit meinem Wunsch?
Ich bin wirklich, sage ich, ich bin Ruth. Ich will ein Glanz sein, kein Schatten. Ich habe das Verliebte in meiner Haut. Es liegt dicht unter meiner Oberfläche. Und ich sitze am Fenster, lege die Beine über den Fenstersims. Ich vergrößere meinen Blick und denke an meine Haut als Oberfläche der Welt. Das Weiß der Augen wird weißer. Die Härchen am Oberlippenrand, blonde, feine Härchen.
Mein Raum hat zur Straße hin zwei große Fenster und an den Fenstern weiße Vorhänge, wie Schnee, frisch gefallen. Und es gibt die Tauben, die gurren, die auf der Fensterbank hin- und hergehen. Es gibt das Klacken ihrer Krallen auf dem Blech der Fensterbank, und es gibt Wind, der sich im Weiß der Vorhänge verfängt, an manchen Tagen heult er leise in meinen Raum hinein und dehnt sich aus. Manchmal legt er sich zu mir in mein Bett. Hier bin ich morgens, mittags, abends auch, hier liege ich nackt, meine milchige Haut. Und so legt sich der Wind zu mir, an mich, auf mich, um mich herum.
Und wenn ich im Sonnenlicht die Zeichen auf meiner Haut entdecke, kleine Punkte, Flecken, die gestern noch nicht da waren, wenn ich die Flecken auf der Straße sehe unter meinem Fenster, die Kaugummiflecken, die Flecken von Bier und anderem, was die Körper der Menschen in der Nacht verließ, was den Rachen hochkam, weil kein Platz mehr war in diesen Körpern und für die Körper nicht in der Welt. Dann denke ich, alles wird fleckiger, älter, aufgerissen, überstrichen, vergraben. Die Menschen als Fleck, auch ich irgendwann nicht mehr als ein Fleck in der Welt. Dann schaue ich von der Straße in den Himmel und denke, lieber Gott, ich möchte nie alt werden. Ich kann nicht alt werden, lieber Gott, ich habe nichts außer meinem Mund, dieser Sinnlichkeit, ohne ihn, den Mund, wenn er trocken ist, bin ich nichts, werde ich unsichtbar sein. Ohne meine jungen Beine, ohne den süßlichen Geruch der Achselhöhlen, den feinen Pfirsichhärchen über meinem Mund. Lieber Gott, ich will keine Wüste werden, nicht unsichtbar, keine Sandsteinhaut, ich möchte nicht verderben, nicht nach Alter riechen. Lieber Gott, mach, dass ich in meinem Körper bleiben kann.
Und manchmal hat Gott auch nichts mit mir zu tun, ich glaube auch niemals recht an ihn. Wer soll denn das sein? Oder was? Ich denke aber, dass man Mitleid mit mir haben kann. Und wer hat Mitleid mit mir, wenn nicht Gott, weil, er ist ja so was wie ein alter Mann und auch sonst alles.
Manchmal falle ich in mich hinein, als wäre ich kein Mensch, vielmehr ein Brunnen, bleibe unten im eigenen kniehohen Wasser liegen, auf mir ein kleines Stück vom Mondschein.
Ich öle mich ein.
Ich creme die Zwischenräume der Zehen ein.
Wenn ich hinausgehe und die Tür hinter mir schließe, wenn ich durch das dunkle, enge Treppenhaus die Stufen hinuntersteige, wenn ich dann auf die Straße trete, glänze ich bis in die Menschen hinein, die sich auf der Straße nach mir umdrehen. Wenn ich bei den Menschen bin, dann wird es Sommer in ihnen.
Und zu der Frau, die sich trägt, als wäre sie eine Tasche voller schmutziger Wäsche auf dem Weg zur Wäscherei, sage ich: Komm zu mir.
Komm mit, sage ich zu ihr.
Sie erschrickt und schaut mich an, ich weiß, sie würde gerne.
Komm mit, sage ich zu ihr, und sie schaut mir ins Gesicht, schaut meine rosa Lippen an – und schaut – weg.
Komm doch mit, sage ich zu einem Mann, und auch er erschrickt, fasst sich an den Finger, dreht den Ehering.
Lass mal, sagt er und geht weg von mir.
Dreht sich um. Schaut mich an.
Ich, die ich im limettengrünen Kleid dastehe, an der Ecke, im Schatten der Birke, und ihm nachsehe. Ich, die ich alle Finger bewege wie Insektenbeinchen, wie die Aufregung des Frühlings, und eines meiner hellen Beine leicht anhebe und über das andere lege, an die Wand gelehnt. Und ich schaue in die Birke hinauf, weit nach oben, mein Hals muss schön aussehen dabei, ein Bogen der Sinnlichkeit ist der Hals. Manchmal singe ich ein Lied. Wenn ich den Text nicht kenne, summe ich, aber weil Summen nicht Singen ist, verstumme ich. Meistens glänze ich. Meistens wissen die Menschen wenig von diesem Glanz. Meistens sehen sie mich an, und dann fragen sie sich, wie es möglich ist, dass es so etwas wie mich gibt.
H. sitzt in seinem dunkelgrauen Bademantel in der Küche vor dem Computer und sucht nach Häusern im Süden von Schweden. Manchmal höre ich ihn, wie er hustet oder Schleim den Rachen hochzieht. Am liebsten direkt am Meer, ruft er, das Haus, sodass das Brechen der Wellen hörbar ist. Die Küste, ruft er. Vielleicht mit einer Veranda. Vielleicht mit roten Fensterrahmen und Türen. Mit dem Meeresrauschen, dem Wind. Und mit der Einsamkeit, vor allem anderen die Einsamkeit, ruft er.
Ich sitze auf der Toilette, draußen rennen drei Kinder in farbigen Skianzügen über die gefrorene Wiese. Eines in Rot. Eines in Grün. Eines in Gelb. Kein Wind.
Ich halte das weiße Stäbchen zwischen meine Beine hindurch in die weiße Emailschüssel, in den gelblichen Strahl. Urin läuft warm über meine Hand. Dann lege ich das Stäbchen auf ein Stück Toilettenpapier und wasche mir die Hände, sitzend, mit leicht nach links gedrehtem Oberkörper, die Hände werden rot unter dem heißen Wasser. Ich seife sie ein, ich warte. Und ich bleibe weiter sitzen, sehe meine Beine, die sieben Muttermale am linken Bein und die elf Muttermale am rechten, an den Oberschenkeln sind es viele und gegen unten weniger, an den Füßen noch je eines. Auf dem Badewannenrand liegt eine Schildkröte aus Plastik. An der Schildkröte ist eine gelbe Kordel befestigt, am Ende dieser Kordel ist eine viel kleinere Schildkröte angebracht, und zieht man an der kleinen, bewegt die große ihre vier Beine wie Propeller und bewegt sich so langsam durchs Wasser, wenn sie ins Wasser gelegt wird.
Nach zwei Minuten erhebe ich mich, ziehe die Unterhose hoch, ziehe die Hose hoch, schließe sie, gehe mit dem weißen Stäbchen in der Hand zu H., ich gehe über den grauen Plastikboden des Flurs, gehe in die Küche, das Licht fällt durch das Fenster, und ich setze mich ihm gegenüber an den alten Holztisch, und weil der Tisch alt ist, wackelt er, und weil er wackelt, wackelt auch der Salzstreuer, der auf dem Tisch steht, und kippt, rollt, weil er rund ist, über den Tisch und fällt zu Boden. Der Deckel löst sich und das Salz liegt auf dem Küchenboden. Eine kleine Salzwolke. Ich lege das Stäbchen zwischen H. und mich, und wir schauen drauf.
Kreuz heißt schwanger, sagt er.
Ja, sage ich.
H. schaut auf.
Meine Kunst ist ein Teppich, auf dem ich gehe, auf dem ich stehe. Die Kunst ist ein Gewächs, eine Flechte, die über alles drüberwächst. Alles, was ich bin, alles, was ich sein kann.
Das ist viel, sagt Ruth.
Die Kunst ist ein Trost in diesem Leben, in dem wir nicht wissen, was wir sollen, und doch soll man immer was, sage ich. Kunst darf den Schrecken neben die Schönheit stellen, kann den Tod und das Essen von Schwarzwälder Kirschtorte ineinanderfügen, damit ein Bild erzeugen, das weder vom Tod noch von Schwarzwälder Kirschtorte erzählt, sondern vielleicht von der Begrenztheit des Lebens. Kunst kann uns helfen, damit umzugehen, dass wir Menschen sind, die auf dieser Erde sehr viel reden und essen, dann zur Toilette gehen, und die vieles falschmachen und klein sind und sich wichtig nehmen und zum Zahnarzt gehen und die sich fragen, warum überhaupt dieses Existieren, wo doch am Ende alles nur darauf hinausläuft, dass wir tot sind.
Und dann schreibst du das?, fragt Ruth.
Ich bin schwanger, sage ich.
Und ich verwandle Menschen in Tiere, damit sie vergessen, dass sie geboren worden sind, sagt Ruth.
Ich kann nicht mehr, Ruth, sage ich, manchmal, da gab es Momente, in denen ich verstand, warum alles so ist, wie es ist, dann, wenn ich geschrieben habe. Ganz kurz nur, wenn du dich bewegt hast, wenn klar war, was du tun würdest, für einen Moment, wenn ich dich beschreiben konnte, wie du wirklich bist, dann gab es dich, war es so, als müsste alles genau so sein, wie es ist. Jetzt gibt es nur noch die Angst.
Die Angst ist ein Haus, in das ich eingezogen bin, sage ich, und alles, was mir gesagt wird, alle Ratschläge, dass es gut werden würde, und auch, dass ich nicht hineingehen solle in dieses Haus, die würden nichts nützen. Ich höre sie, ich höre sie sagen, es wird nicht das Ende sein, vielmehr wird dieses Kind ein Anfang werden, wird dich tragen, wird deine Kunst bereichern, wenn erst die Zeit wieder da ist. Du wirst sie dir nehmen, die Zeit und den Raum. Aber ich glaube nicht daran, Ruth. Ich kann nicht daran glauben. Ich werde mich in dieses Haus der Angst setzen und darin Mutter sein. Ich werde mich in dieses Haus setzen und meine Sorgen streicheln. Ich muss mich von dir verabschieden, Ruth.
Du bist so dramatisch, sagt Ruth und legt sich eine Hand an den Hals, legt den Hals etwas zurück, und sie lächelt. Sie lächelt so ein Lächeln. Das Lächeln einer Siegerin. Ein weißer Hals mit kreisrunden, dunklen Muttermalen. Gleichmäßig verteilt. Viele kleinere und größere, sehr dunkle, exakte Muttermale. Ein eleganter, langer Hals, den sie noch länger macht und mich anlächelt, mit schmalen Augen, einem wasserbettweichen Mund.
Die Angst ist ein Hochhaus, sage ich, mit tausend Fenstern, aus denen Menschen schauen. Das Hochhaus, Ruth, sage ich.
Und Ruth geht mit ihren Fingern von Muttermal zu Muttermal. Eines nach dem anderen tupft sie an.
Und Ruth sagt mit einer Stimme aus Milchschaum, manchmal kratze mitten in der Nacht eine Frau an ihrer Tür, sie wolle herein zu ihr und von ihr geliebt werden, und diese Frau, die trage meist ein gelbes Nachthemd, ein urinfarbenes Nachthemd, sagt Ruth, mit weißem, leicht ausgefranstem Rand und Pantoffeln aus Frottee, Pantoffeln mit einem Hundegesicht, mit je zwei Ohren an der Seite und einer roten Nase. Die Pantoffeln, also die Hundegesichter, würden lachen.
Das hast du erfunden, sagt Ruth.
Das bin ich, sage ich.
Nein, sagt Ruth. Jetzt hör auf, dich selbst zu bemitleiden.
Diese Frau sage dann zu ihr, wenn sie sie hereingelassen habe und die Frau sich schnell von allem frei gemacht und nackt und zufrieden bei ihr im Bett liege, in ihrem weiten Bett, und sie in den schwarzen Himmel schauen würden, wenn Mondlicht auf sie herunterfallen würde, weil Vollmond und das Mondlicht wie Milch, sage sie, in den Momenten, in denen ich sie berühren und küssen würde, habe sie für einen ganz kurzen Moment das Gefühl, alles, wirklich alles, verstanden zu haben, für einen Moment gebe es einen wirklich wahrhaftigen Grund zu leben.
Die Fenster des Hauses zähle ich. Und immer liegt Schnee, der Schnee liegt auf den Tassen, den Tellern, den Kerzenständern, den Büchern, den Fingern, den Stofftieren, den Bettdecken, auf allem, auch innen liegt der Schnee. Er fällt aus dem Himmel auch auf mich, und weil meine Fenster offenstehen, fällt der Schnee durch diese Fenster in mich hinein.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fenster.
A. sitzt neben mir auf der Bank an der Bushaltestelle. Vor unseren Gesichtern ist der Atem sichtbar. Sie nimmt den Kaugummi aus dem Mund und klebt ihn an die Bankunterseite.
Geschmacklos, sagt sie. Zündet sich eine Zigarette an.
Ich bin schwanger, sage ich.
Ha, sagt A., wie schön das ist.
Ja, sage ich.
Aber?, fragt sie.
Ich weiß nicht.
Das ist doch wunderbar, sagt sie. Bauch wird rund, Kind kommt zur Welt, die Wohnung schön warm, du kannst dich ein bisschen zurückziehen, Mutter sein. Hättest aber auch auf mich warten können. Ich friere bald die Eizellen ein. Na ja, aber mach du mal, bei mir kann es noch dauern.
Dann steht sie auf, nimmt die schwere Tasche auf die Schulter, die ihr eine Rille in die Haut drückt, verschwindet im Bus, winkt mir noch, schickt mir einen Handkuss.
Liebe Ruth,
als Kind lebte ich in einem Haus am Stadtrand von Zürich. Es hatte rote Fensterläden, Efeu an der Südseite und einen Balkon, auf dem eine Birke aus dem Steinboden wuchs. In diesem Haus wohnte ich mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester. Oben wohnte eine befreundete Familie, zwei Knaben, die etwas älter waren als meine Schwester und ich, und ihre Eltern. Das Treppenhaus roch nach dem alten Spannteppich auf den Treppenstufen und nach den Lederschuhen, die im Treppenhaus standen. Besonders an die Lederstiefel des Vaters, der oben wohnte, kann ich mich noch gut erinnern. Es sah aus, als wohne ein Cowboy in diesem Haus. Es waren schwere Stiefel aus Rindleder, die da standen auf der Treppe. Wann immer ich wollte, konnte ich hochgehen. Ich klopfte und ging hinein.
Als ich ein Kind war, wurde ich manchmal für einen Jungen gehalten, weil meine Mutter mir die Haare kurz schnitt, und ich freute mich sehr, denn wenn die Menschen mich für einen Jungen hielten, dann trauten sie mir mehr zu, sie hielten mich für stärker, und irgendwie scheint es mir, ich wurde auch stärker, wenn man mich für stärker hielt. Daran muss ich denken, liebe Ruth, weil ich schwanger bin und wieder weich werde, meine Weichheit sichtbar werden wird. Ich werde elastisch sein, nachgeben, die Haut und auch die Gefühle, sie werden hinausgehen, es werden welche hereinkommen, wie die Blaumeisen, die in das Häuschen fliegen, das befestigt wurde am Baum vor meinem Küchenfenster, und wieder hinaus, wie sie wollen, kommen und gehen, ohne dass ich es kontrollieren kann. Ich werde ein Brotteig sein, es wird ein Leben in mir entstehen. Daran muss ich denken, die ganze Zeit. Ich lege meine Hände ab und auch meinen Kopf. Und wie wenig es erlaubt ist, in dieser Welt weich zu sein, daran muss ich denken, wie wenig sie gilt, die Weichheit. Warum ist das so? Wir haben uns doch so viele Möglichkeiten gebaut. Müssen nicht mehr jagen, sind dem Wetter nicht mehr so sehr ausgesetzt.
Ich habe meine Kunst um mich gebunden, um den Teig herum, da liegt mein Schreiben, wie die Schale einer Nuss, um mein Inneres zu schützen. Jetzt bin ich schwanger, und die Schale wird weg sein.
Deine Julia
B. sitzt in ihrem Zimmer, rund um sich hat sie Plüschtiere aufgereiht, einen bleichen Elefanten, einen schielenden Hasen, einen kleinköpfigen Tiger, ein Känguru mit roten, glänzenden Boxhandschuhen, zwei Meerschweinchen, einen Elch im Trikot eines norddeutschen Fußballvereins.
Wir üben apportieren, sagt sie, es klappt schon ziemlich gut.
Ich bin schwanger, sage ich, und schon könnte ich wieder weinen, weil ich B. da sitzen sehe, und meine Liebe für sie ist so groß und das ungeborene Kind in meinem Bauch ist so klein.
Ist wohl so groß wie eine Nuss, sage ich und kann auch gerade so viel.
Wird es bleiben?, fragt B.
Sie schaut mich an, und auch die vielen Plüschtiere schauen mich an, alle Augen sind auf mich gerichtet, selbst der schielende Hase scheint mich anzuschauen.
Weiß ich nicht, sage ich, ist noch recht früh, aber mir ist schon sehr übel.
Warum ich es ihr aber erzählen würde, wenn es vielleicht wieder weggehe, dann sei sie wieder traurig wie beim letzten Mal, darüber, dass sie sich damit abgefunden habe, eine Schwester zu werden.
Ich würde es ihr erzählen, sage ich, weil ich dabei sei, mich zu verändern, und wenn sie nicht wisse, was mit mir los sei, dann würde sie mich vielleicht nicht verstehen, vielleicht auch so nicht, aber dann wisse sie wenigstens warum.
Sie habe der kleinen Nuss in meinem Bauch eine Nachricht hinterlassen, sagt B., sie habe ihr geschrieben, was sie da draußen erwarten würde und dass sie keine Angst haben müsse.
Aber, sage ich, sie habe doch, als sie in meinem Bauch gewesen sei, noch gar nicht gewusst, was sie hier draußen erwarten würde.
Ach, stimmt, sagt B., aber vielleicht wisse man es eben, wenn man dadrin sei, alles, und vergesse es bei der Geburt.
Aber dann hätte sie es ja nicht aufzuschreiben brauchen, dann wisse es das Kleine ja selbst.
Ach, ich solle sie doch in Ruhe lassen, sagt B., sie wolle jetzt weiterspielen.
O.k., sage ich, und dass ich es nicht blöd gemeint hätte, dass es mir leidtue, sage ich noch, und dass es mir wirklich leidtue, alles, sage ich und schließe die Tür und spüre die Blicke von B. und die der Plüschtiere in meinem Rücken und die Tränen in meinen Augen.
Halt, ruft B.
Kurz denke ich, sie ruft mich, drehe mich nochmals um, aber sie hat den kleinköpfigen Tiger gemeint.
In meiner Kindheit habe ich oft die Hände meiner Mutter betrachtet, während sie schrieb oder ein Hochbett für mich baute oder Feuer im Ofen machte, Spiegeleier briet, etwas notierte, während sie telefonierte oder die Pflanzen goss, meine kleine Hand in ihrer Hand lag, beim Spazieren oder während sie mir vorlas. Beim Vorlesen hielt meine Mutter das Buch mit einer Hand, mit der anderen fuhr sie die Seiten entlang, über die Seiten mit dieser schönen Hand, die Zeilen entlang, mit dem ausgestreckten Zeigefinger, Wort um Wort. Die Hände meiner Mutter sind sehr stark, sie spielt Geige. Und auf dem Handrücken gibt es die erhöhten Adern. Flüsse im Land, in alle Richtungen gehend. Irgendwann begannen auf ihren Händen weiße Flecken zu wachsen, auf den Handrücken breiteten sie sich aus, immer mehr und mehr. Wie Eisflächen, und ich liebte es noch mehr, diese Hände zu betrachten. Als wären sie eine Weltkarte, konnte ich die Flüsse, Straßen und Landesgrenzen entlanggehen.
Ich stehe dicht hinter H. in der Küche und sage, du darfst nicht an mir zweifeln. Wenn ich die Arme ausstrecken würde, könnte ich seinen Rücken berühren, das Frottee seines dunkelgrauen Bademantels. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellen würde, könnte ich mein Gesicht an seinen Hals legen. H. schraubt die Kaffeemaschine auf, er schüttet den Kaffeesatz in die Spüle. Draußen schreit ein kleines Kind, es klingt, als gäbe es nicht genug Luft für seine Lungen, als seien seine Lungen zusammengefaltet wie ein neu gekauftes Gummiboot. Es wird unter unserem Fenster hin- und hergetragen und irgendwann von einem Laubbläser übertönt. Kurz höre ich noch das luftarme Schreien, dann nur noch den Laubbläser, dann wird es still.
Du darfst nicht denken, nicht einmal zögerlich, nicht einmal tief in dir drinnen, wo du davon ausgehst, dass es nie jemand mitbekommen wird, nicht einmal in der hintersten, dunkelsten, staubigsten Ecke deines Ichs darfst du denken, dass ich, weil ich Künstlerin bin, keine gute Mutter sein kann oder dass sich die beiden Rollen, die ich habe in meinem Leben, gegenseitig schwächen. Manchmal ist dein Gesicht eine einzige Müdigkeit, sage ich, die Augen liegen tief in den Höhlen, als würden sie bald hineinfallen in dich, als würdest du lieber nach innen blicken als nach außen.
H. füllt die Maschine mit frischem Kaffee und schraubt den oberen Teil auf den unteren, stellt sie auf die rot leuchtende Herdplatte, unsere Gesichter spiegeln sich in der silbernen Kanne.
Meine Kraft reicht nicht, sage ich. Sie reicht nicht einmal dafür, die gesellschaftliche Meinung abzuwehren darüber, dass ich besser nicht Mutter und Künstlerin sein soll, vielleicht besser nur Mutter, oder wenn die Kunst, dann besser kinderlos. Von Stipendium zu Stipendium reisend in irgendwelche mittelgroßen deutschen Städte oder malerischen Schweizer Dörfer, in irgendwelche mit hellem Holz ausgebauten Türme, um dort allein zu schreiben, allein zu sein, allein zu lesen, vielleicht besser nur das Genie oder nur die Mutter, sich aufgeben, sich hingeben, Mutter sein. Ich schaffe es nicht. Und dann bricht es auf.
Ich breche auf an diesem Tisch in dieser Küche einer Genossenschaftswohnung, an diesem alten dunkelbraunen Tisch sitzend, dem der Schubladenknopf abgefallen ist, draußen liegt der Hof, darin die Blutbuche und dieser Embryo in meinem Bauch. Dieser Embryo, an dessen Seiten zwei rosarote Kügelchen mit Einbuchtungen wachsen, gerade jetzt gewachsen sind, vielleicht, aus denen einmal Hände werden, mit Fingern dran, die einen Schirm bei Regen halten oder Münzen, um etwas zu bezahlen, oder meine Hand, wenn wir irgendwo nebeneinander gehen, auf einem Weg, das Kind und ich. In diesem Moment, an diesem Tisch, in dieser Küche, das Bild an der Wand betrachtend, das H.s Nichte gezeichnet hat, ein braunes Monster mit drei Beinen, fürchte ich, dass ich nicht mehr leben können werde.
In diesem Moment in der Küche dieser Wohnung, meine Hände flach auf die Tischplatte gelegt, bin ich überzeugt, dass ich das nicht schaffe.
Und wenn wir erst mal einen Kaffee trinken?, fragt H.
Ja, gut, sage ich, aber es wird nichts nützen.
Ich habe damals aus meinem Fenster gesehen, ich habe Linda an einem der roten Tische sitzen sehen, der Kellner mit seinem lakritzschwarzen Haar bewegte sich wie ein Pferd zwischen den runden Tischen. Ein elegantes Pferd, das seine Hufe hebt. Und schnaubt. Auf dem Tablett trug er weiße Tässchen auf weißen Untertellerchen hin und her. Gerade stellte er eine Tasse vor sie hin, da hob Linda das Gesicht zu ihm, um sich zu bedanken, sie hob das Gesicht zur Sonne hin, musste die Hand an die Augen legen, weil sie geblendet wurde, und der Kellner hätte bloß einen Schritt nach rechts tun müssen, um ihr Schatten zu geben, aber er bewegte sich nicht. Sie sagte noch etwas, und er sagte etwas, und sie kniff die Augen zusammen, dann sank ihr Blick. Dann sah sie noch einmal hoch, als der Kellner bereits weg war. Ich erschrak, so schön war sie. Ihre Haut leuchtete, auch ihr beinahe weißes Haar.
Ich sah neben ihr die anderen Menschen in normaler Größe und wie sie heimlich zu ihr herübersahen, wie die Kinder vor ihrem Tisch stehen blieben und sie ansahen aus ihren großen Kinderaugen. Drei Kinder standen vor ihrem Tischchen und starrten sie an. Und die Eltern sagten nichts. Der Kellner brachte ein Gefäß mit Zucker.
In einem steinpilzbraunen Kleid, das zum Rot der Tische passte, setzte ich mich neben sie. Steinpilzbraun, und die Fingernägel ananasfarben, die Haare parfümiert. Ich legte meine Beine übereinander. Der Sonntag, das Sonnenlicht, die Unruhe in den Familien, die um mich waren und schnatterten wie eine Gänseschar. Wie Gänse, dachte ich.
Sah in Scharen die Gänse in ihrem Gänsegang wackeln und die vielen breiten, weißen Hintern über saftige Wiesen watscheln. Dreckklumpen an den Flossen kleben. Die Gänse, die am Ende der Weide verschwinden.
Ich sah Linda an, wie sie neben mir saß, ich sah ihre Hände mit den weißen Flecken, wie eine Landschaft wuchsen diese weißen Flächen über ihre Handrücken und die Adern, die abstanden, die nach allen Seiten verliefen, und ich hatte das Gefühl, diese Hände zu kennen, als hätten sie mein Gesicht schon einmal berührt, als wären es Hände, die meine Haut kennen. Und ich sah die Rille in ihrer Schulter von der schweren Tasche. Und wie sie nun ihr Gesicht zu mir wandte, mich ansah, wie sie war, zwischen den Tischen und Menschen, groß und bleich, in der tiefseeblauen Hose aus schwerem Stoff. Ihre Haut wie Marmor, eine schwere, weiße Haut. Als wäre sie dicker als bei anderen Menschen, dachte ich, als habe sie sich über die Haut noch eine Haut gelegt. Schwere Schuhe, schwarz, mit dicker Sohle.
In der Sonne sei es sehr heiß, sagte ich und sah in die Sonne, wusste nicht, was ich noch sagen könnte, weil ich eigentlich keine bin, die übers Wetter spricht.
Ich rede nicht gerne übers Wetter, sagte ich.
Ihr Gesicht wie eine steinige Berglandschaft, scharfe Kanten. Die Augen weit auseinanderliegend, und wie zwei schimmernde Oliven liegen die Pupillen im Weiß und das Weiß der Augäpfel und die Augäpfel in den Augenhöhlen.
Ich schwieg, weil sie schwieg, und Linda sah durch mich hindurch, als wäre ich ein offenes Fenster und hinter mir läge eine Landschaft.
Linda sah zu diesem Fenster hinaus. Der Blick lag in den Weiden.
Und ich gab mir Mühe, kein Fenster zu sein.
Das Weiß ihrer Arme schimmerte, wenn sie sich bewegte.
Du schimmerst, sagte ich.
Und weil ich nicht mehr wusste, was ich hätte weiter sagen können, legte ich meine Hand auf ihren Arm.
Ich wollte eigentlich allein sein, sagte Linda und scheuchte eine Wespe von meinen Lippen.
Ich wollte eigentlich allein sein, sagte sie.
Der Himmel dunkelte ein.
Ich bin gerne allein, sagte Linda.
Ein Wind kam durch die Straße und nahm ein paar Zeitungen und Servietten mit. Kinder kreischten kurz und hell auf, dann donnerte es direkt über uns im asphaltgrauen Himmel, heidelbeergroße Tropfen fielen auf uns herab, machten dunkle Punkte auf dem warmen Asphalt. Es dampfte, und die Menschen erhoben sich und stürmten davon. Sie stießen Stühle um und zogen Plastikabdeckungen über Kinderwagen, sie schimpften und versuchten, Haare und Kinder und Köpfe mit Händen und Regenschirmen und Plastiktüten vor dem Regen zu schützen. Der Kellner blieb im Hauseingang stehen, rauchte, wartete mit seinem Lakritzhaar und den dunkelsten blitzenden Augen, sah mich an.
Nur wir saßen noch an einem der Tischchen. Linda und ich. Ganz allein.
Hast du das gemacht?, fragte sie mich.
Und ich sagte ihr, da wohne ich. Zeigte nach oben hin.
Sollen wir zu mir?, fragte ich.
Nein, sagte sie und stand auf, wuchs immer höher hinauf, ging durch den Regen davon.
Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. So schön und so schief in die Welt gebaut und das Gesicht aus weißem Stein. So schön und so still. Ein Monument. Ein Mensch. Eine Traurigkeit als Landschaft, in der Linda geht.
Ich zähle die Schmetterlinge auf dem Kinderkleidungsstück für ein Neugeborenes, nicht größer als eine Tüte Chips. Und ich vergesse die Anzahl Schmetterlinge sofort, beginne von Neuem zu zählen. Ich vergesse es wieder, immer und immer wieder. Fünf Schmetterlinge? Sieben? Ich lege den Finger auf jedes einzelne Tierchen. Tupfe die Schmetterlinge ab, wie Ruth ihre Muttermale am Hals. Es scheint mir, als würden sie sich bewegen, davonflattern, es scheint mir, als würde ich die Hormone spüren, wie sie sich in mir ausbreiten. Wie Schmetterlinge flattern. Wie Zeitungspapier, das, zusammengeknüllt, sich langsam öffnet. Und meine Brüste wachsen, als täte jemand Sekunde um Sekunde eine Knetmasse hinein, in die Drüsen und Gänge der Brüste, die aufgehen wie ein Kuchen im Ofen.
Ich habe die Anzahl der Schmetterlinge vergessen, schreibe ich H., und es fällt mir auch sonst nichts ein.
Was für Schmetterlinge?, schreibt H.
Die auf dem Kinderkleidungsstück, schreibe ich.
Ob er nach Hause kommen solle?, fragt er.
Und ich will schreiben, nein, jetzt ist es zu spät. Aber ich schreibe, nein, nein, schon gut.
Und H. schreibt. Ich liebe dich.
Und ich denke, aber das nützt nichts.
Ich rieche die Süße der Milch, wie sie an meinem Hals klebt, ich rieche meinen Hals, die Süße der Milch. Ein Kamel. Ich denke an ein Kamel. Ich rieche nach Karamell und nach Grieß und nach Butter in der Pfanne erhitzt.
Und kann kein Wort aufschreiben. Es ist alles verklebt. Die Hormone verkleben mich. Ich mache Fäuste. Drücke die Finger, so fest es geht, zusammen, die Knöchel werden weiß. Draußen kommt der Frühling ganz langsam. Und das Licht verändert sich. Und die Schmetterlinge. Wie viele Schmetterlinge?, rufe ich, verdammt noch mal, die Schmetterlinge.
Klein und leer liegt das Kleidungstück vor mir, nicht größer als eine Tüte Chips, und ich versuche, mir das Kind vorzustellen, wie es darin liegt, aber ich sehe nichts, nichts außer einer ungeheuren Anzahl von Schmetterlingen.
Sie habe eine große Angst in sich gehabt, als sie erfuhr, dass sie ein Kind in sich trage, sagt Linda, obschon oder gerade weil alle um sie herum riefen: Das ist das unbedingte Glück. Sie werde sich entfalten wie eine Knospe im Frühling, habe man ihr gesagt, wie es manchmal in diesen Dokumentarfilmen zu sehen ist, die Knospen, die im Zeitraffer aufbrechen, und die Blüten, die sich herauswinden würden. Sie würde strahlen und das große Glück in ihren Armen tragen, wenn das Kind erst mal da sei, dann gäbe es nichts anderes mehr für sie. Und es gäbe keine schlechten Gedanken, die gäbe es nicht, riefen die Menschen um sie. Und Linda sagt, sie habe aber welche gehabt und habe gedacht, das könne nur bedeuten, dass sie eine schlechte Mutter sei. Die Gedanken an dieses Kind so groß wie eine Baumnuss. Sie habe es nicht gewollt, nicht in sich und nicht, dass es aus ihr herauskomme. Und heute schaue sie es manchmal an, und sie erinnere sich an dieses Gefühl, aber es gebe neben der Liebe für diesen Menschen, der das Kind geworden ist, keinen Platz mehr dafür, und trotzdem oder gerade deswegen wachse in diesen Momenten wieder eine Angst in ihr. Diese Liebe, die einen komplett ausfülle, diese Gedanken daran, dass diese Liebe alles andere überdecken könne und dass sie aber das andere in ihrem Leben, das, was nicht das Kind sei, ebenso brauche.
Und nie habe jemand ihr gesagt, dass diese Gefühle kommen würden. Vielmehr habe man ihr gesagt, dass dieses Muttersein bereits in allen Frauen vorhanden sei. Fertig produziert und darauf wartend, ausgelebt zu werden. Die Mutter als eine Figur in allen Frauen. Und auch habe man ihr gesagt, dass, wenn sie kein Kind bekommen würde, diese Figur, die Mutter in ihrem Körper, verkümmern würde und sie krank machen könne und unglücklich, unerfüllt, bucklig, bitter wie Löwenzahn, habe man ihr gesagt. Dass es das Logischste der Welt sei. Das unhinterfragte Glück.
Die Pilze seien im Untergrund miteinander verbunden, sagt A. Sie seien ein großes, zusammenhängendes System. Ein zusammenhängender Organismus, sagt sie.
Habt ihr Pilze gesammelt, frage ich, damals, als du Kind warst?
Ja, sagt sie. Steinpilze, Maronenröhrlinge, Eichhasen. Eher zwischen den Tannen als bei den Laubbäumen, sagt sie, und sie sagt auch, eher auf einer Lichtung, aber dafür müssten wir endlich einmal vom Weg abkommen.
Ich frage mich, ob es ihr Wunsch ist, endlich einmal vom Weg abzukommen.
Am steilen, von Tannennadeln bedeckten Hang finden wir Röhrlinge. A. geht voraus, die schwere, mit Heften und Büchern gefüllte Leinentasche an der Schulter hängend. In wadenhohen, schweren Stiefeln. Sie hält einen Ast zur Seite; bevor ich ihn fassen kann, lässt sie ihn los. Der Ast schlägt mir ins Gesicht. Ich bin nicht böse. Sie entschuldigt sich nicht. Das Blut tropft aus beiden Nasenlöchern ins Laub. Auf den gelben Blättern sieht es schön aus, auf den roten ist es unsichtbar, auf den braunen wird es sofort alt.
Unter uns die kuhgroßen Steinbrocken im Flussbett. Von Zeit und Wetter dorthin gebracht. Das Rauschen des Flusses und das Wetter, das sekündlich wechselt von kalt zu warm und von warm zu kalt. Und die Kuhglocken an den Hälsen der Kühe. Weiter weg das Läuten.
A. klettert glücklich abseits des Weges mit der schweren Tasche auf der Schulter. Ich klettere glücklich tropfend hinter ihr her.
Was sie da alles dabeihabe?, frage ich.
Alles, was sie vielleicht unbedingt benötige, sagt A.
Und für wen ich dies alles schreiben und zusammensammeln würde?, fragt A. , steigt immer höher am steilen Hang entlang.
Ich würde versuchen, sage ich und halte das Taschentuch noch etwas länger an die Nase als nötig, atme durch den Mund, meine Stimme ist belegt, ich würde versuchen, alles einzusammeln, aus dem Alltag herausnehmen, um zu schauen, wie es zu einer Geschichte werden könne. Alles, was einzeln zu stehen scheine, würde ich einsammeln und hoffen, dass es am Ende ein Ganzes ergebe, ein großes Ganzes. Ich wisse nicht, ob das möglich sei. Ich würde so versuchen, mit den Bildern, mit den aufgezeigten Einzelteilen meines Lebens die Bewegung darzustellen, die ich mache in meiner Kunst, wenn ich ein Buch schreibe. Von Intuition zu Kontrolle, zu Traum, zu Wach, zu Schweben, zum Boden.
Zu Himmel zu Hölle, sagt A., macht mit ihren langen Beinen große Schritte.
Ja, vielleicht auch das.
Zu Asphalt zu Wald, sagt sie.
Ja, auch das vielleicht.
Zu Leben zu Tod, sagt sie.
Ich verfolge auch den Trost, sage ich. Wo liegt er?
Da, ein Steinpilz, ruft A.
Die Kunst, sage ich, oder warum die Kunst Trost sein könne, obwohl oder gerade weil sie die Welt aufzeige in ihrer Dunkelheit. Warum die Kunst Trost sein könne. Wenn man ihretwegen weine, sage ich, weine man um die Welt, sage ich und bin etwas von mir selbst berührt, in diesem Moment, bleibe stehen, das Taschentuch an der Nase, eine Kruste hat sich gebildet am linken Nasenloch, die Kunst, der Trost, ich, sage ich.
Im Laub raschelt es.
A. ist zwischen den Bäumen verschwunden.
Als ich dieses Kratzen zum ersten Mal hörte, mitten in der Nacht, dachte ich an das Kratzen einer Rattenmutter in der Wand. Sie baut ihren Jungen ein Nest, dachte ich. Das Tier macht eine Höhle in die Wand für seine Jungen, die noch blind und frisch geboren unter ihrem Bauch liegen. In Schleim und nackt. Eine Rattenmutter, die sich durch die Isolierung frisst, in den Wänden wohnt, und ich stellte mir die Gänge in den Wänden vor, die Mutterratte und hinter ihr die Jungen, eines nach dem anderen, zwängen, schleichen sie durch das Gemäuer. Quietschen und fiepen.
Ich liege im Bett und streichle meine Hände, die auf der Decke liegen, im ausgekippten Mondlicht. Ich stehe auf, meine schmalen Beine, so knochig und gerade, als wären sie an den Unterleib geschraubt. Weiß, wie frisch gestrichen. Die dunklen Härchen an den Knöcheln. Die schwarzen Schamhaare sind ein Nest. Und ich schaue an mir hinab, muss leise kichern darüber, wie das Nest daliegt zwischen den Beinen, als hätte sich auch darin ein kleines Tier versteckt, denke ich. Und die schmalen, langen Arme, an den Armen die Hände, die Finger strecke ich von mir, und die Fingernägel feuerrot. Ruthchen, du bist schön, sage ich zu mir, deine Nase ist fein. Die Augenbrauen sind fein. Auch die Wangenhaut ist fein. Ich bin ein Fein, sage ich zur Rattenmutter in der Wand.
Und sie raschelt und kratzt an der Tür.
Wer da?, frage ich.
Ich bin es, ich bin es, flüstert die Nachbarin. Ich habe dich gesehen im Treppenhaus, und jetzt kann ich nicht mehr nicht an dich denken, Ruth. Schöne, schöne Ruth. Wie lange war ich nicht mehr hier bei dir? Ich vermisse dich und das Mondlicht, und ich vermisse dich so sehr, dass ich meinen eigenen Körper vermisse, also mich, also das Leben an sich.
Das ist viel, sage ich.
Ja, das ist es, sagt die Nachbarin.
Ihre Stimme ist eine schlecht gestimmte Geige.
Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr nicht daran denken, wie ich bei dir liege und es Vollmond ist, sagt sie, die nun hereingekommen ist und in einem urinfarbenen Nachthemd mit weißem Rand, in Pantoffeln aus Frottee, Pantoffeln mit einem Hundegesicht, mit je zwei Ohren an der Seite und einer roten Nase, vor mir steht.
Das weiße Licht des Mondes wird weiter über uns ausgekippt. So habe sie es sich vorgestellt, sagt sie, genauso, und sie legt den Bademantel ab, kriecht zu mir ins Bett und küsst mich. Sie hat keinen Geruch. Vollkommen geruchlos liegt sie neben mir. Sie legt ihre trockenen, schmalen Finger, vier an der einen und fünf an der anderen Hand, auf mich, auf meinen feinen Körper. Die Finger an den Seiten angebissen, wie von einer Ratte angeknabbert, die Finger sind an den Seiten ganz wund, sind an meinen Armen, halten meine Arme fest.
Was ist?, fragt Ruth.
Ich kann niemandem sagen, dass ich dieses Kind nicht will, nicht haben kann, sage ich. Ich kann niemandem sagen, dass ich meinen Körper verlieren werde an dieses Kind, meine Kunst, mein Leben, dass ich es darum nicht haben kann.
Wie lange hast du Zeit zu überlegen? Ruth spielt mit ihren Fingern.
Noch einen Monat vielleicht, sage ich.
Aber du kannst es nicht, sagt Ruth, du kannst es nicht, das sehe ich dir an. Du kannst es nicht wegmachen. Du liebst es schon jetzt zu sehr.
Du hast recht, ich bin zu schwach, ich kann es nicht, sage ich. Aber es ist kein Platz in meinem Leben, neben B. und der Kunst, da ist kein Platz mehr für noch einen Menschen, noch eine so große Liebe, noch ein Leben, an dem mein eigenes hängt, dessen Glück auch mein Glück ist, dessen Existenz meine Berechtigung zu leben.
Du bist bloß müde, sagt Ruth. Du bist müde.
Ich bin müde, sage ich.
Dann leg dich hin, sagt sie.
Und ich lege mich hin.
Und ich lege mich also in ihre Arme hinein, sage ich zu A., und Ruths Arme sind auch meine Arme, so lege ich mich irgendwie auch in meine Arme hinein.
A. schneidet den Blumenkohl, dann legt sie die Stücke in eine gläserne Auflaufform, reißt die Käsepackung auf und schüttet den Käse dazu.
Vielleicht solltest du eine Therapie machen, sagt A., etwas Käse fällt zu Boden, ich sammle die Stücke ein.
Oder ich lege mich in die Arme meiner Figuren, die meine Arme sind, sage ich.
Oder das, sagt A.
Sie schiebt den Blumenkohl in den Backofen. Schließt ihn, und wir setzen uns davor. Wir sehen uns als Spiegelung im Backofenfenster, ich mit plattem Haar und neben mir ist A. mit den Katzenaugen. Unsere Gesichter auf dem weißen Blumenkohl und dem Käse im Ofen. A. schaut mich an. Licht an. Wir verschwinden. Licht aus, wir sind wieder da. Licht an, wir verschwinden. Der Käse beginnt nach etwa acht Minuten, sich leicht zu bewegen, dann schmilzt er.
Ist er dunkelbraun, nehmen wir ihn raus, sagt A. und legt einen Arm um mich. Ich sehe, wie das Gesicht meines Spiegelbildes kippt, wie ich mein Gesicht an ihren Hals lege, dann schließe ich die Augen.
Und wir legen uns hin. Die magere Frau und ich, die Haut ist über ihre Hüftknochen gespannt. Ich küsse die Seite ihrer angebissenen Nagelbeete, und ich küsse auch ihre Hüftknochen. Ich lege mich um sie herum, ich knöpfe ihr Nachthemd auf, ziehe es ihr langsam vom Körper, langsam über die Beine, den Bauch, das Gesicht. Ich lege mein Gesicht an ihre kleine, magere Brust. Ich streichle ihren Brustkorb, das Schlüsselbein, ihr gelbes Haar wie das Gras auf den Wiesen im Herbst. Ich küsse ihre Knie und die Kniekehlen auch. Die geplatzten Adern an den Oberschenkeln, die trockenen Fersen, die Leberflecken, die gelben Spuren in den Augenecken, den trockenen, weißlich schuppigen Mund.
Sie atmet schwer, weil meine Küsse schwer sind. Es wächst ihr ein finsterbraunes Fell. Überall dort, wo meine schweren Küsse liegen bleiben, beginnen die Härchen aus der Haut zu wachsen. Ein weiches, feines Fell, es wächst ihr über den Bauch, um den Bauchnabel herum. Von den Schultern über die Brust breitet es sich aus, über den Hals zum Gesicht. Sie atmet und knurrt und legt zwei Pranken zur Seite hin, legt sie auf mich. Raue, graue Haut an den Handflächen und Krallen. Ein tiefes Rumoren in ihr. Ein tiefes, dunkles Brummen, die Nase feucht. Und ein warmer Atem aus ihrem Maul. Ich lege mich fein, wie ich bin, in ihr finsterbraunes Fell hinein. Was für ein Glück wir sind, sage ich zu ihr.
Ich sage zu H., wenn es nicht möglich ist, unsere Räume, insbesondere denjenigen der Kunst, zu schützen, sie von den Räumen, die wir für das alltägliche Leben bräuchten, zu trennen, und da wir sowieso alles teilen würden, könnten wir doch auch die Kunst und den Rest des Lebens vermengen.
Vielleicht haben wir gar keine Wahl, sagt H.
Vielleicht wäre es schön, sage ich.
Vielleicht aber auch etwas unübersichtlich, sodass uns schwindlig würde dabei, und vielleicht würde das Leben von der Kunst angegriffen im Sinne davon, dass wir nicht die Eltern sein könnten, die wir gerne wären, die sich selbst zurücknähmen und für die Kinder lebten; und umgekehrt würde die Kunst vom Leben angegriffen, indem wir Eltern sein müssten, Verantwortung tragen, Kompromisse eingehen, uns zurücknehmen, sagt H.
Vielleicht tue aber beides beidem gut, sage ich, vielleicht sei das die Rettung.
Vielleicht, sagt H.
Dann stehe ich auf, gehe ins Bad und übergebe mich in die Kloschüssel.
H. sagt, es tue ihm leid.
Ich schüttle die Arme, um etwas zu spüren.
Meine Angst sei ein Haus, sage ich. Ein Hochhaus. Eine Villa. Ein Schloss sogar, das ganze Viertel einer Großstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hätten uns alles aufgebaut, und jetzt stürze alles wieder ein wie in diesen amerikanischen Filmen, in denen ein Monster am Horizont auftaucht und über der Stadt schwebend Lava hinunterwirft auf die Zivilisation, und die Zivilisation bricht zusammen. Genauso.
Nein, sagt H., so schlimm könne es nicht sein.
Doch, sage ich.
Er könne in sein Atelier gehen und sich hinsetzen, sage ich, und vielleicht könne er für einen Moment vergessen, dass alles anders werden wird, vielleicht vergesse er sogar manchmal für einen Moment, dass er nochmals Vater eines Kindes werde, und vielleicht schreibe er über Texel, eine holländische Insel, die von den Nationalsozialisten besetzt gewesen sei. Vielleicht schreibe er darüber, wie er sich das Wetter vorstelle dort auf der Insel, damals kurz vor Kriegsende im April 1945, und was die Menschen auf der Insel gemacht hätten damals, als sie erfahren hatten, dass der Krieg vorüber war, Deutschland kapituliert. Vielleicht schreibe er über die Nutztiere auf der Insel und die Wellen der Nordsee. Oder Wellen im Allgemeinen. Und vielleicht hole er sich dann irgendwann einen Kaffee an der Tankstelle, und die Frau, die ihm den Kaffee gebe, sage, sie habe ihm die letzten drei Kaffees abgestempelt, den nächsten kriege er umsonst, dann überreiche sie ihm eine Karte, auf der bereits drei Kaffees mit einem Smiley abgestempelt sind.
Ich könne das nicht mehr. Ich könne keinen Augenblick nicht an dieses Kind denken, in meinem Körper werde eine Spannung erzeugt, die mich alle paar Minuten aufstehen und springen lasse, einfach so. Als würde jemand einen Spanngurt anziehen. Ich müsse in die Höhe springen. Oder mich übergeben.
Und dann übergebe ich mich wieder in die Kloschüssel. H. kniet neben mir auf dem dunklen Badezimmerboden, es knirscht, als hätte jemand Sand darauf verstreut.
Und H. legt seine Hand auf meinen Rücken. Macht Kreise. Flüstert mir etwas ins Ohr, aber ich verstehe es nicht, weil mein Würgen lauter ist.
Ich schaue auf die schlafende Frau in meinem Bett, und ich streichle ihre Arme, die auf der Bettdecke liegen, mit meinem Blick. Ich sehe ihre Flecken zurückkehren, die Falten im Gesicht und am Hals. Langsam wird sie wieder die Frau, die sie war. Als sie erwacht, scheint die Sonne ins Zimmer und auf das Bett, auf uns. Sie öffnet die Augen, ist geruchlos, ist wieder Mensch, lächelt mich an. Sie sagt kein Wort, sie steht auf, geht auf normalen Beinen einer Frau durch den Raum, nimmt das Nachthemd vom Stuhl, zieht es an, sie schaut auf den Holzboden, fährt mit dem großen Zeh eine Rille im Boden entlang, und dann zieht sie die Socken über die Füße, geht mit den Füßen in die Pantoffeln, nimmt den Morgenmantel, geht in den Morgenmantel hinein, geht etwas krumm hinaus aus dem Raum. An der Tür dreht sie sich um.
Tschüss Ruth, sagt sie.
Tschüss, sage ich, machs gut.
Sie habe am See einen veganen Kuchen gegessen, sagt A. und dann habe sie sich gefragt, ob sie das sei, ein Mensch, der veganen Kuchen in einem Restaurant an einem Schweizer See bestelle. Und sie habe den Kuchen gegessen, und er sei sehr trocken gewesen. Sie habe gehustet, so trocken sei er gewesen. Ob ich mir das vorstellen könne, wie trocken dieser Kuchen gewesen sei, und die Bedienung habe streng geschaut. Ob sie das Husten vielleicht als Vorwurf aufgefasst habe, habe sich A. kurz gefragt, oder ob dieser Mensch bereits mit einem strengen Blick zur Welt gekommen sei. Und dann habe sie ein Glas Leitungswasser bestellen wollen, aber habe vor lauter Husten kaum sprechen können, darum habe sie auf eine Limonade auf der Karte gezeigt, und die Bedienung habe diese Geste offensichtlich als frech aufgefasst, habe im Weggehen ihrer Kollegin, die gerade die leeren Tische gewischt habe, einen weiteren, vielsagenden Blick zugeworfen. Sie habe sie gerne besänftigen wollen, ihr sagen, dass sie es doch nicht bös gemeint habe, vielmehr habe sie den viel zu trockenen, veganen Kuchen im Hals und brauche dringend etwas Flüssigkeit, um ihn runterzuspülen, ansonsten befürchte sie, würde sie am Ende vielleicht sogar ersticken. Nach langer Zeit sei dann die Bedienung mit der Limonade wiedergekommen und habe diese vor sie hingestellt. Bitteschön, habe sie laut gesagt, und A. habe sich wirklich Mühe gegeben, habe sich bedanken wollen, aber es sei nur ein klägliches Krächzen aus ihr gekommen. Sie habe dann den Kuchen mit der Limonade runtergespült. Später habe sie in Tränen aufgelöst am Ufer des Sees gestanden, aber erst viel später, erst als sie diesen Schwan gesehen habe, am Ufer stehend und auf den See blickend. Der Schwan habe seine Flügel ausgebreitet. Er habe sie geschüttelt und auf die Wasseroberfläche geschlagen, dann sei er in den See hinausgeschwommen. Er sei vornübergekippt, das Hinterteil wie eine Boje im Wasser geschwommen, seinen langen Hals habe er ausgestreckt, und mit seinem Schnabel das Geflecht von den Steinen am Grund des Sees gezerrt. Das habe sie selbstverständlich nicht sehen können, aber das wisse sie, das sei ihr Wissen über den Schwan. Und sie hätte gerne den Kuchen an den Schwan verfüttert. Und sie hätte gerne, wie in vielen anderen Augenblicken ihres Lebens, genau da am See mit dem Schwan und dem Kuchen, ein komplett neues Leben begonnen. Nicht als bisexuelle Kulturschaffende, vielleicht als Bäuerin in Polen. Oder als Rechtsanwältin in Madrid.
A. sagt, sie wisse ganz genau, bei der ganzen Unschärfe, die sie umgebe, dass sie Kinder wolle, mindestens eines, lieber aber zwei, eigentlich sogar drei. Aber da sei nun niemand, der diese mit ihr bekomme. Da sei bloß eine Freundin, die eines in sich trage und es aber nicht wolle oder sich nicht sicher sei, ob sie es wolle. Von außen betrachtet sei das ein skurriles Bild, von innen tragisch und von ganz innen, also von uns aus gesehen, unglaublich traurig auch. Es sage auch viel über unsere Generation aus. Nichts sei mehr logisch und körperlich begreifbar, es müsse alles definiert und verstanden, begriffen, erläutert und abgesegnet werden. Ich sitze neben A. und bin schon lange wieder in Tränen aufgelöst. Es tue ihr leid, sagt sie. Das müsse es nicht, sage ich.
Sieben Tage warte ich. Sieben Tage in Öl und Zeit und am Fenster sitzend, die Straße im silbernen Licht und die Bäume im Sommer, die Krähen in den Kronen der Bäume, ihr Krähen. Sieben Tage hängt der Wind in meinen weißen Vorhängen. Sieben schrecklich, schrecklich langweilige Tage.
Ich streiche die Fußnägel in Lila, dann in Flieder, dann apfelgrün, dann weiß, dann grau. Ich warte und warte, und die Wände bleiben weiß, und der Himmel vor dem Fenster bleibt in diesem sonderbaren, langweiligen, immer gleichen Plastik- Sommer-Hellblau, und meine Gedanken werden grün und dann grau, sie welken, fallen in mir vom Baum und liegen als Laub in mir herum und verfallen und modern und riechen nach Schnecke und Regen und keinem guten Sein. Gedankenlaub. Ich warte. Es wird Herbst und dann Winter in mir. Mir ist kalt. Ich sehe aus dem Fenster, und ich denke an Linda. Und ich denke daran, was sie mir erzählen könnte. Und ich denke daran, wie es ist, sie zu berühren, und wie ihre Stimme klingen würde und wie sie schmecken würde, ihre Stimme und Linda selbst, in was sie sich verwandeln könnte. Hummer, Schlange, Krebs, Fisch, Qualle, vielleicht ein Felltier.
Und dann, nach sieben Tagen kommt Linda die Straße entlang. Ich denke ihre Haut bereits zu kennen, so lange und fest habe ich an ihre Haut gedacht. Ich kann es kaum erwarten, sie zu berühren. Sie würde fest sein, da bin ich mir sicher. Eine Oberfläche, eine Haut wie ein Trampolin, denke ich. Ich sehe sie gehen in ihren schweren, schwarzen Stiefeln. Sie wird größer und größer. So weit auseinanderliegend die Augen, ein Silberblick. Linda hebt ihr Gesicht. Mein Herz rennt in eine andere Stadt und zurück. Sie sieht mich an. Meine Hände werden kalt, auch mein Gesicht. Eine Kälte beißt mich ins Gesicht. Ich hebe eine Hand und bewege sie wie einen toten Fisch, und auch sie hebt eine Hand. So stehen wir. Ich am Fenster oben und sie unten, zu mir hochblickend. Dann werfe ich den Schlüssel hinunter, der schon sieben Tage dalag, und ich sehe, wie sie den Schlüssel aufhebt, und ich höre sie die Tür öffnen, dann höre ich die Schritte im Treppenhaus, leise und dann lauter, immer lauter. Langsames Fallenlassen der Füße auf die Treppenstufen. Ihr Körper, der näherkommt. Und ich werde warm, ich spüre, wie mein Körper mit ihrem Näherkommen wärmer wird. Ich ziehe mich aus. Setze mich aufs Bett, das in der Mitte des Raumes steht, streichle meine Beine. Ich höre ihr Atmen auf der Treppe, den Schlüssel am Schlüsselbund, ihr Innehalten vor der Tür. Sie legt das Ohr an die Tür. Sie kommt herein. Sie sieht mich an.
Du bist nackt, sagt sie, dreht sich um und geht wieder hinaus, schließt die Tür. Dann Stille.
Eine lange Stille.
Willst du nicht hereinkommen?, frage ich.
Linda öffnet die Tür, steht gebückt im Türrahmen, sieht mich wütend an. Weil sie gebückt stehen bleibt, sehe ich ganz oben, zuoberst auf ihrem Kopf einen Wirbel. Ein heller Haarwirbel. Er sieht aus, als könnte man in ihn hineinspringen und würde so in Linda landen. Wie im Klo, wenn man spült. Wie ein Abfluss auch. Wie in einen Abfluss hinein. Sie macht einen großen Schritt ins Zimmer, schließt die Tür, steckt den Zeigefinger in den Ring am Reißverschluss ihres Overalls und zieht ihn nach unten, steigt wütend aus einem Hosenbein, aus dem anderen, wie aus einer Haut. Sie schüttelt die Haut und hängt sie über einen Stuhl.
Sie trägt sehr hellblaue Socken und eine sehr weiße, viel zu große Unterhose. Wütend zieht sie auch die Unterhose aus und reißt die Socken von den Füßen, einen nach dem anderen. Wirft alles zu Boden. Dann steht sie vor mir und ist wunderschön.
Und jetzt?, fragt sie böse.
Komm zu mir, sage ich.
Sie legt sich zu mir unter die weiße Decke, es ist, als würde sich ein Holzbrett zu mir legen.
Ich lache sie an, sie schaut böse zurück.
Schön, bist du endlich da, sage ich.
Ich liebe ihren Silberblick.
Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen, sage ich.
Sie habe keine Ahnung, sagt sie, sie wisse nicht, wie das gehe, warum sie hergekommen sei, und sie wisse nicht, was sie nun, da sie aber nun einmal hier sei, von mir oder von der Situation wolle. Sie wisse nicht, was ich in ihrem Leben nun tun würde und warum und schon gar nicht wisse sie, wie man sich berühre, so als Frau und Frau. Hier bei mir sei alles anders, und es