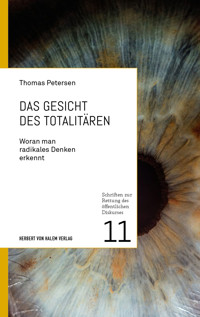Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen, denen man Umfrageergebnisse oder Statistiken präsentiert, reagieren darauf mit dem Satz "Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe." Doch dieser Satz ist nicht nur logisch Unsinn. Die allermeisten Statistiken sind nicht gefälscht und wer sich weigert, sie zur Kenntnis zu nehmen, dem entgehen wichtige Informationen. Es ist allerdings nicht ganz leicht, mit Statistiken umzugehen. Wer die »Sprache der Zahlen« nicht versteht, der wird von ihnen leicht in die Irre geführt. Mit diesem Band führt der Autor fundiert und unterhaltsam in die Welt der Umfragen und Statistiken ein. Er zeigt dem Leser, warum man Umfragen benötigt, wie sie funktionieren, wie man verlässliche Untersuchungen von pseudowissenschaftlichen »Studien« unterscheidet und wie die Ergebnisse von Umfragen und anderen statistischen Erhebungen zu deuten sind. Nebenbei erfährt der Leser, warum der ADAC-Skandal eigentlich kein Grund zur Aufregung war, was so gefährlich am gesunden Menschenverstand ist, was man beim Kauf von Nüssen beachten sollte, warum man als Umfrageforscher manchmal die falschen Fragen stellen muss, woran Friedhofsgärtner Traktorenmarken erkennen, warum die Armutsstatistik nichts über Armut aussagt, wie man nervöse Börsenmakler beruhigen kann – und warum Pferde am liebsten Mädchen beißen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme dieses Buch
Kathrin,
Thomas B.
und Anja,
denn es ist der Versuch einer Antwort
auf ihre gelegentlich gestellte Frage
„Was machst Du eigentlich bei der Arbeit?“
Inhalt
Eine endlose Diskussion
Wozu Umfragen gut sind
„Ich bin nicht befragt worden“
Laufzettel, Klingelschilder und ein großer Sack mit Nüssen
Wie man richtig in den Wald hineinruft
Routine, Nachsicht und Traktoren
Warum Pferde am liebsten Mädchen beißen
Wissen ist besser als Nichtwissen
Anmerkungen
Literatur
Glossar
1 Eine endlose Diskussion
Anfang des Jahres 2014 herrschte große Aufregung in der deutschen Öffentlichkeit. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte herausgefunden, dass der ADAC bei der Ermittlung des Preises „Gelber Engel“ für das angebliche Lieblingsauto der Deutschen gemogelt hatte. Zunächst hieß es, „nur“ die Teilnehmerzahlen der Internet-Abstimmung, die der Preisverleihung zugrunde lag, seien falsch angegeben worden, wenig später stellte sich heraus, dass darüber hinaus auch die Ergebnisse manipuliert worden waren. Die veröffentlichte Rangliste spiegelte gar nicht die tatsächliche Reihenfolge der beliebtesten Autos in Deutschland wider. Die Enthüllung stürzte den Automobilclub in eine schwere Krise. Der Preis „Gelber Engel“ wurde abgeschafft, der Präsident musste zurücktreten, die Automobilhersteller gaben ihre Preise zurück, tausende Mitglieder verließen den Verein. Sie, wie auch viele andere Bürger, Politiker und Journalisten fühlten sich vom ADAC hintergangen, ihr Vertrauen war enttäuscht worden.
Die Enttäuschung wäre ihnen erspart geblieben, wenn sie auch nur ein wenig von Umfrageforschung verstanden hätten, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann:
Vor rund zwanzig Jahren blieb ich an einem Freitagabend mit meinem altersschwachen VW-Bus auf der Autobahn liegen. Der ADAC-Mechaniker, der mir zur Hilfe kam, stellte fest, dass die Benzinpumpe kaputt gegangen war. Der 24-Stunden-Ersatzteilservice von VW hatte natürlich schon längst Feierabend. Der Mechaniker betrachtete ein paar Minuten lang sinnend meine kaputte Benzinpumpe, dann sagte er entschlossen: „Aus Scheiße mach Bonbons“ und modellierte das zu Bruch gegangene Schräubchen aus Lötzinn nach. Es funktionierte. Das war ein großartiger Mann. Sein Motto und sein Handeln habe ich nie vergessen.
Seit diesem Tag bin ich vollauf überzeugtes ADAC-Mitglied, erhalte regelmäßig die Mitgliederzeitschrift und weiß deswegen, dass sie zwanzig Jahre lang, bis zu dem Skandal, voll war von statistischen Daten, die das Papier nicht wert waren, auf das sie gedruckt worden waren. Ich kenne keine andere Publikation, die so viel offensichtlichen statistischen Unsinn enthielt. Anfangs waren es meistens „TED-Umfragen“, bei denen Teilnehmer nach Belieben anriefen und ihre Meinung sagten, später waren es Internet-Abstimmungen, die als angebliche Bevölkerungsmeinung präsentiert wurden. Beide Methoden sind zur Messung der Bevölkerungsmeinung völlig ungeeignet, die Ergebnisse waren dementsprechend auch nicht selten geradezu unfreiwillig komisch. Als ich in den Zeitungen las, es herrsche große Aufregung darüber, dass der ADAC die Ergebnisse seiner Internet-Abstimmung zum „Lieblingsauto der Deutschen“ manipuliert habe, war ich deswegen überhaupt nicht enttäuscht, sondern mein einziger Gedanke war: Na und? Falscher konnten die Zahlen durch die Manipulationen doch ohnehin nicht werden. Der eigentliche Skandal lag in der Bezeichnung „Lieblingsauto der Deutschen“, die durch die Methode niemals auch nur annähernd gerechtfertigt war, selbst wenn die Zahlen nicht verändert worden wären. Doch darüber regte sich niemand auf.
Das Beispiel zeigt, warum es sich lohnen kann, sich zumindest ein wenig mit den Regeln der Statistik und der Umfrageforschung vertraut zu machen: Man verhindert damit, dass man von falschen Zahlen in die Irre geführt wird – und man schafft damit erst die Voraussetzungen dafür, dass man aus richtigen Zahlen einen Informationsgewinn ziehen kann.
Vor allem aber zeigt das Beispiel, wie wenig die Experten bisher mit ihren Versuchen in der Öffentlichkeit durchgedrungen sind, die Möglichkeiten und Grenzen der Umfrageforschung und anderer statistischer Informationen zu erläutern. Wären sie erfolgreicher gewesen, hätte es die Aufregung über den ADAC nicht geben können, ja wahrscheinlich hätte der ADAC dann weder die obskure Methode zur Ermittlung des „Lieblingsautos der Deutschen“ gewählt, noch wäre er auf den Gedanken gekommen, die Ergebnisse zu manipulieren.
Eine Wutrede
Die Schuld an dieser Situation ist nicht beim Publikum, sondern bei den Forschern selbst zu suchen. Sie sind nur in seltenen Ausnahmefällen gute Propagandisten ihrer eigenen Sache. Nur die wenigsten von ihnen können sich in die Lage von Nichtexperten hineinversetzen, und deswegen fallen die Empfehlungen der Wissenschaftler zum Umgang mit ihrer Profession meistens ziemlich wirklichkeitsfern aus.
Das ganze Ausmaß des Problems wurde mir vor einigen Jahren auf einer Fachtagung am Comer See in Norditalien klar. So sehr, dass es mir selbst den Tagungsort verleidete. Bereits zum achten Mal seit fast eineinhalb Jahrzehnten saßen wir mit rund 25 Sozialwissenschaftlern aus einem Dutzend Ländern zusammen und klagten darüber, dass anscheinend nur wenige Menschen in der Öffentlichkeit in der Lage sind, gute, informative Umfragen von schlechten, oberflächlichen oder gar völlig unsinnigen zu unterscheiden. Wieder einmal klagten wir darüber, dass gute Umfrageforschung von schlechter verdrängt wird, weil sie im Zweifel billiger ist und schneller zur Verfügung steht, vor allem dann, wenn es darum geht, ein unliebsames Forschungsergebnis rasch zu „widerlegen.“ Zum wiederholten Mal erhoben die Kollegen die Forderung, die Redaktionen in Zeitung und Fernsehen müssten doch wenigstens die methodischen Basisdaten einer von ihnen veröffentlichten Umfrage mit dokumentieren, und doch war es klar, dass dies folgenlos bleiben würde. Was sollte das alles?
Nicht dass der Ort unangenehm oder die Klagen unberechtigt gewesen wären. Ganz im Gegenteil. Man kann sich kaum einen besseren Ort für eine kleine Tagung vorstellen als die Villa la Collina in Cadenabbia am Comer See, das Anwesen, auf dem Konrad Adenauer seit den späten 1950er-Jahren seine Ferien verbrachte. Die Villa selbst dient heute als elegantes Gästehaus, etwas unterhalb davon hat die Konrad-Adenauer-Stiftung ein kleines Tagungszentrum eingerichtet, das für intensive Diskussionen in angenehmer Atmosphäre wie geschaffen ist – wenn man keine Angst vor den großen, harmlosen aber grimmig dreinblickenden Hunden hat, die dort herumlaufen, und wenn man die Dauerbeschallung durch knatternde Zweitakt-Fahrzeuge erträgt, mit denen die Gärtner der Anlage stets demonstrativ nahe am Tagungsraum vorbeifahren, wohl um zu demonstrieren, wie eifrig sie mit der Instandhaltung des parkartigen Grundstücks beschäftigt sind.
Der Grund, warum sich die in der „World Association for Public Opinion Research“ (WAPOR) zusammengeschlossenen Umfrageforscher aus Universitäten und privaten Instituten seit 1996 alle zwei Jahre in Cadenabbia trafen, war eben jene Beobachtung, dass Qualität in der Umfrageforschung sich kaum durchsetzen kann, weil in der Öffentlichkeit die Qualitätskriterien fehlen, mit denen sich gute Forschung von schlechter unterscheiden lässt. „Es kommt dabei eben immer dasselbe heraus“, sagte einmal der Allensbacher Forscher Friedrich Tennstädt: „Es sind immer Prozentzahlen.“
Der konkrete Auslöser für die Einrichtung der Tagungen in Cadenabbia war eine Rede – man kann beinahe sagen: Verzweiflungsrede – des amerikanischen Umfrageforschers Daniel Yankelovich gewesen, die dieser gehalten hatte, als ihm im Jahr 1995 der „Helen Dinerman Award“, die höchste Auszeichnung die es in der Umfrageforschung gibt, für sein Lebenswerk verliehen worden war. Seit die Umfrageforschung in der Öffentlichkeit von den Medien kontrolliert werde, hatte er ausgeführt, hätten auch journalistische Interessen die Oberhand über die Qualität und Verlässlichkeit der Umfrageergebnisse gewonnen: „So traurig es ist, die Medien riskieren nichts, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und haben darum auch kein Interesse daran, in die Qualität von Umfragen zu investieren. Eine rituelle Bekundung der Drei-Prozent-Fehlerspanne ist alles. Seit die Medien die Umfragen kontrollieren, ist die ‚Quicky-Umfrage‘ die Regel geworden. Und wenn einmal irgendwo eine gute Umfrage gemacht wird, wird sie mit den schlechten zusammengeworfen. Schlechte Umfragequalität vernichtet gute Umfragequalität.“ Solange die Medien nur unter dem Gesichtspunkt: aktuell? aufregend? bewerten, werde man, so Yankelovich, „immer mehr von diesen oberflächlichen Umfrage-Schlaglichtern haben, immer mehr Berichte, die sich nur auf eine einzelne Frage stützen, immer mehr Konfusion, immer mehr Irreführung und immer weniger Beitrag zum Verständnis der Bevölkerung.“ 1
Beipackzettel und Karate
Nun, mehr als ein Jahrzehnt nach Yankelovichs Brandrede, saßen wir zum wiederholten Mal in Cadenabbia bei der Veranstaltung, die wir ins Leben gerufen hatten um zu überlegen, wie man sich der Entwicklung entgegenstellen könnte, und stellten fest, dass in den vorangegangenen Jahren alles eher noch schlimmer geworden war. Inzwischen hatte eine Flut billiger und größtenteils unnützer Online-Umfragen die Öffentlichkeit überschwemmt. Waren es ein Jahrzehnt zuvor fast nur die sogenannten „Ted-Umfragen“ gewesen, die mit vollkommen irreführenden Ergebnissen gelegentlich Eingang in die Berichterstattung fanden und dort so behandelt wurden, als handele es sich dabei um eine verlässliche Information, waren es nun ungezählte Online-Abstimmungen, die den Nutzer von Internet-Seiten aller Art zur Beteiligung einladen: Soll der Minister zurücktreten, ja oder nein? Wird Bayern deutscher Fußballmeister? Wer soll bei der Landtagswahl als Kandidat antreten? Oder eben: Was ist Ihr Lieblingsauto? Klicken Sie hier, stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück einen exklusiven Kugelschreiber. Viele dieser „Umfragen“ sind kaum sinnvoller als die Abstimmung, zu der die „Thüringer Allgemeine“ ihre Leser im November 2005 aufrief (Abb. 1).
Abb. 1: Missglückte Leserumfrage
(Quelle: Thüringer Allgemeine vom 5. November 2005)
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist weder gegen Ted-Umfragen noch gegen Abstimmungen im Internet oder auch per Zeitungscoupon etwas einzuwenden, solange allen Beteiligten klar ist, dass es sich dabei um ein Spiel und nicht um eine ernstzunehmende Informationsquelle handelt. Zur Stärkung der Bindung der Leser an ihre Zeitung oder zur Ermittlung des Wettkönigs bei „Wetten Dass?“ sind diese Verfahren sicherlich gut geeignet. Doch es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht die Resultate solcher Spiele als Information über den vermeintlichen Bevölkerungswillen präsentiert werden, von den meisten Lesern und Zuschauern von richtigen Repräsentativumfragen nicht zu unterscheiden.
So klagten wir also erneut über die Verbreitung schlechter Umfragequalität und vor allem über die Unfähigkeit oder den Unwillen der Massenmedien, zwischen den verschiedenen Informationsquellen und -arten zu unterscheiden. Als Konsequenz solcher Klagen begannen wir, wie wir es ebenfalls schon seit Jahren getan hatten, Forderungen zu formulieren, welche Informationen denn in jedem Fall in der Berichterstattung über Umfragen enthalten sein müssten: Die Frageformulierungen gehörten selbstverständlich dazu, die Zahl der Befragten, die Art, wie die Befragten ausgewählt wurden, die statistisch bedingte Fehlertoleranz, die alle Umfragen unvermeidlich kennzeichnet, der Name des Auftraggebers und so weiter. Hat man einmal eine solche von den Kenntnissen und Informationsbedürfnissen der Experten diktierte Liste zusammengestellt, lässt sich leicht Klage darüber führen, dass eben diese Kriterien von den Redaktionen in den allermeisten Fällen nicht eingehalten werden. Daran schließt sich dann folgerichtig die Frage an, wie man die Redakteure dazu erziehen könne, diese Fachinformationen in ihre Berichterstattung aufzunehmen.
Doch nach und nach wurde mir klar, dass wir mit diesen Ansätzen, die Zeitungen dazu zwingen zu wollen, ihre Leser über alle fachlich relevanten Details einer Umfrage zu informieren, weder den Redaktionen noch den Lesern gerecht wurden. Welche Redaktion käme schon auf die Idee, ihren wissenschaftlichen Meldungen Beipackzettel mit detaillierten Beschreibungen der angewandten Methoden und der wissenschaftlich definierten Grenzen ihrer Aussagekraft beizufügen? Und was hätte der Leser denn dadurch gewonnen, wenn er mit Informationen über Stichprobenverfahren und Fehlertoleranzen überhäuft würde, die er ohnehin nicht verstehen kann. Er interessiert sich – wenn überhaupt – nur für die inhaltliche Aussage einer Umfrage, nicht für die Details ihrer Durchführung.
Und war nicht, so die daran anschließende Überlegung, der ganze Ansatz verkehrt, den Zeitungslesern etwas aufzubürden, was eigentlich die Aufgabe der Journalisten sein sollte, nämlich zu entscheiden, welche Information verlässlich und sinnvoll ist und welche nicht? Bei keiner anderen Art der in Medien verbreiteten Information käme man auf den Gedanken, vom Mediennutzer zu verlangen, er solle gefälligst selbst die Spreu vom Weizen trennen, etwa indem man sämtliche eingehenden Nachrichten aus guten wie aus obskuren Quellen unterschiedslos in der Zeitung abdruckt, einige Informationen über den Charakter der Quelle hinzufügt und dann den Leser mit der Aufgabe allein lässt zu entscheiden, welcher Information er vertrauen kann und welcher nicht. Ein wenig erinnern mich die Versuche, die Redaktionen dazu zu erziehen, technische Details von Umfragen mit zu veröffentlichen, damit die Leser deren Qualität einschätzen können, an die Forderungen, der Bevölkerung angesichts problematischer Medieninhalte „Medienkompetenz“ anzuerziehen. Das sei, las ich einmal, als wollte man wachsender Kriminalität damit begegnen, dass man den Menschen Karate beibrächte.
Die Verantwortung der Journalisten
Die Verantwortung für die Berichterstattung über Umfragen liegt nicht bei den Zeitungslesern und Fernsehzuschauern, sondern bei den Journalisten und all den anderen Akteuren in der Öffentlichkeit, die mit Umfragen umgehen und ihre Ergebnisse verbreiten: Politiker, Verbandsvertreter, Wirtschaftsfachleute, Analytiker. Aber können diese Teilnehmer des öffentlichen Lebens denn der Aufgabe gerecht werden, die ihnen in diesem Zusammenhang zufällt? Was haben wir, die Sozialwissenschaftler, denn getan um ihnen die Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie entscheiden können, welcher statistischen Information aus Umfragen oder anderen Quellen Vertrauen geschenkt werden kann und welcher nicht?
Sicherlich haben viele Journalisten heute ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert, die meisten von ihnen haben sich dabei auch durch Kurse der Statistik und der „Methoden empirischer Sozialforschung“, wie es an den Universitäten heißt, quälen müssen. Doch nur die wenigsten dürften sich für diese vergleichsweise sperrige Materie wirklich interessiert haben. Hinzu kommt, dass die Ausbildung in Methoden der Umfrageforschung trotz einiger Fortschritte in den letzten Jahren an sehr vielen deutschen Universitäten noch immer so weit von der wirklichen Umfrageforschung entfernt ist, dass die Studenten kaum Kenntnisse erwerben, mit denen sich in der Praxis etwas anfangen lässt. Es gibt auch heute noch Lehrbücher der Umfrageforschung in Deutschland, die in der akademischen Ausbildung als Standardwerke gelten, deren Autoren offensichtlich nie erlebt haben, was passiert, wenn sie versuchen, die darin beschriebenen Verfahren tatsächlich anzuwenden.
Man kann aber annehmen, dass die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit mit Umfragen umgehen, auch über diesen Hintergrund nicht verfügen, was vollkommen verständlich ist. Hätten sie sich in ihrer Ausbildungszeit besonders für die Methoden der Umfrageforschung interessiert, wären viele von ihnen nicht Journalisten, PR-Berater, Politiker oder Verbandssekretäre, sondern Sozialwissenschaftler geworden. Sie interessieren sich für Umfragen nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie ein wichtiger Bestandteil ihres Berufslebens sind. Was also kann man tun, um diesen Leuten bei der Sichtung und Einordnung des Materials, das sie erreicht und das für sie von Bedeutung sein kann oder auch nicht, zu helfen?
Viele Sozialwissenschaftler würden an diesem Punkt wahrscheinlich darauf verweisen, dass sie Aufsätze oder gar Bücher über Methoden der Umfrageforschung geschrieben haben, in denen schließlich alles stünde, was man wissen müsse. Auch ich habe, gemeinsam mit Elisabeth Noelle-Neumann, ein solches Buch geschrieben.2 Ich behaupte in aller Bescheidenheit, dass es allgemeinverständlich geschrieben ist, jedenfalls erfreut es sich eines kontinuierlichen Zuspruchs unter Studenten. Doch es hat acht Haupt- und rund 170 Unterkapitel und ist 656 Seiten dick. Damit ist es wahrscheinlich noch das am populärsten gestaltete deutsche Buch zur Methode der Umfrageforschung. Ich empfehle es dem interessierten Leser nachdrücklich (und selbstverständlich völlig uneigennützig), doch zu erwarten, dass ein solches Buch auch nur von einem erwähnenswerten Teil derjenigen gelesen wird, die im Alltag mit Umfragen umgehen, wäre weltfremd.
Der Missstand ist nicht der Regelfall
Dagegen gibt es eine ganze Reihe populärer Bücher, die den Leser vor den Fußangeln warnen, die in statistischen Analysen und damit im Prinzip auch in Umfragen lauern können. In – wie ich gerne annehme – bestem aufklärerischem Bestreben werden den Lesern die Tricks vorgeführt, mit denen allerlei Manipulateure Statistiken zur Irreführung der Öffentlichkeit missbrauchen. Statt jedoch den Lesern ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie die meist mit etwas Übung leicht durchschaubaren Manipulationen erkennen und somit die Mehrzahl korrekter statistischer Informationen für sich nutzbar machen können, wird ihnen der Eindruck vermittelt, die Manipulation sei allgegenwärtig.
Das Publikum folgt dieser Argumentation anscheinend bereitwillig, denn sie enthebt einen der Mühe, sich gründlicher mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen. So erreicht folgerichtig fast jede Diskussion, in der statistische Daten eine Rolle spielen, früher oder später dadurch ihren intellektuellen Tiefpunkt, dass jemand triumphierend zu Protokoll gibt, er glaube keiner Statistik, die er nicht selbst gefälscht habe (eine Aussage, die übrigens ebenso hartnäckig wie fälschlicherweise Churchill zugeschrieben wird, was man eigentlich nur als Beleidigung von dessen Intelligenz auffassen kann).
Dass der offensichtliche Unsinn des Ausspruches meist weder dem Sprecher selbst noch seinen Zuhörern bewusst wird, sollte für Sozialwissenschaftler kein Grund zur selbstgerechten Klage sein. Man darf sich nicht wundern, wenn die öffentliche Wahrnehmung von Umfragen und Statistiken von solchen Vorstellungen geprägt ist, wenn man selbst nicht in der Lage ist, ein entsprechendes Gegengewicht zu schaffen. Ein wirklich leicht verständliches Buch, das den Eindruck korrigieren könnte, fehlt bis heute.
Mit dem vorliegenden kleinen Buch soll gar nicht erst versucht werden, dieses Ungleichgewicht vollständig aufzuheben, doch es kann vielleicht dazu beitragen, die Perspektive wenigstens etwas zu korrigieren. Natürlich gibt es in der Umfrageforschung, wie auch überall sonst, Manipulation und Missbrauch, doch wie überall sonst auch, sind diese Fälle die Ausnahme. Und diese Ausnahmen ändern nichts daran, dass repräsentative Umfragen eine einzigartig nützliche Informationsquelle über viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind. Sie bieten Informationen für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die mit anderen Mitteln nicht zu gewinnen, und die in vielen Fällen für die richtige Einschätzung einer gesellschaftlichen Situation und damit für eine angemessene politische Entscheidung unentbehrlich sind. Es lohnt sich damit auch für viele Menschen, die keine Sozialwissenschaftler sind (oder werden wollen), sich mit der Methode der Umfrageforschung auseinanderzusetzen. Für sie ist dieses Buch geschrieben. Ohne Formeln, ohne Abschweifungen in Fachdiskussionen und hoffentlich weitgehend frei von sozialwissenschaftlichem Jargon wird im Folgenden erläutert, wozu Repräsentativumfragen gut sind, welches Denken ihnen zugrunde liegt, wie Umfrageforschung funktioniert und wie man sinnvollerweise mit ihren Ergebnissen – wie auch mit anderen statistischen Informationen – umgehen sollte.
Sozialwissenschaftler werden in diesem Buch kaum Neues finden, Experten für Umfrageforschung vielleicht sogar manche kritikwürdige Vereinfachung ausfindig machen, doch sie brauchen dieses Buch ohnehin nicht. Mir ist es wichtig, dass ein Journalist, ein Politiker oder einfach ein interessierter Bürger sich leicht verständliche Informationen über Umfragen beschaffen kann, die ihm nicht in erster Linie erzählen, wo überall Manipulation und Betrug lauern, sondern die ihm helfen, diese einzigartige Informationsquelle zu verstehen und zu nutzen.
2 Wozu Umfragen gut sind
Im Institut für Demoskopie Allensbach hängt in einem Raum, in dem oft Gäste empfangen und bewirtet werden, ein großes Ölgemälde an der Wand. Das Gemälde stammt, soweit sich das heute noch rekonstruieren lässt, aus dem 19. Jahrhundert und wurde in Südamerika gemalt. Es zeigt eine Meeresbucht mit einem Strand, auf dem als einzige Menschen weit und breit drei Spaziergänger zu sehen sind. In der Meeresbucht schwimmt ein einzelnes prächtiges Segelschiff. Dahinter erhebt sich eine kleine Felseninsel aus dem Meer, auf der eine mittelalterliche Burgruine thront. Umgeben ist die Bucht von üppiger, tropisch anmutender Vegetation, im Hintergrund erheben sich mächtige, steile Felsengebirge.
Es ist kein besonders schönes oder hochwertiges Ölgemälde. Elisabeth Noelle-Neumann (1916-2010), die Gründerin und langjährige Leiterin des Allensbacher Instituts, hat es vor Jahrzehnten in einer Galerie in Buenos Aires gekauft. Sie versicherte mir einmal glaubwürdig, dass es ihr gefalle, doch nicht deswegen ist es hier von Interesse. Interessant an diesem Bild ist der Name, unter dem es verkauft wurde. Es trägt den Titel „Der Hafen von Hamburg.“
Es gibt keinen Ort namens Hamburg in Lateinamerika, den dieses Bild darstellen könnte, und mit dem Hafen von Hamburg in Deutschland hat die dargestellte Szene nicht das Geringste zu tun. Der Maler ist offensichtlich nie in Hamburg gewesen. Er hat anscheinend auch niemanden gefunden, der ihm den tatsächlichen Hamburger Hafen beschrieben hat. Das Bild ist das Produkt purer Phantasie. Für jemanden, der Hamburg nie gesehen hat, mag es einleuchtend sein: Die Meeresbucht ist sehr realistisch dargestellt, Schiff, Landschaft und Strand haben möglicherweise reale Vorbilder. Da Hamburg in Europa liegt und es dort mittelalterliche Burgruinen gibt, könnte auch der Gedanke an eine solche Ruine in Hamburg plausibel erscheinen. Das Bild ist durch und durch überzeugend – nur eben vollkommen falsch.
Wenn ein Maler versucht, einen Ort darzustellen, von dessen Aussehen er offensichtlich nicht die geringste Kenntnis hat, erscheint uns das eigenartig. Doch wenn in öffentlichen Diskussionen, bei juristischen oder politischen Debatten, selbst in sozialwissenschaftlichen Abhandlungen Behauptungen über das angebliche Verhalten der Gesellschaft, die Ziele, Motive und Gefühle der Bevölkerung, über ihre angeblichen Kenntnisse und Sorgen aufgestellt werden, gestützt allein auf Vermutungen und vermeintlich logische Schlussfolgerungen, dann erscheint das nur sehr wenigen Menschen ungewöhnlich. Mit Vehemenz werden dann Thesen über das angebliche Verhalten der Gesellschaft entwickelt, bestritten und verteidigt, und die an der Diskussion Beteiligten scheinen stets zu glauben, dass derjenige Recht habe, der über die besten theoretischen Argumente verfügt. Der Gedanke, dass die Vermutungen über die Gesellschaft der Prüfung bedürfen könnten, dass man – im übertragenen Sinne – nach Hamburg fahren muss um zu erfahren, wie es dort wirklich aussieht, kommt meistens nur den wenigsten an einer solchen Debatte Beteiligten. Der Mensch, hat Konrad Lorenz einmal geschrieben, habe zuerst das Nachdenken gelernt und erst sehr viel später, nämlich in der frühen Neuzeit, das Nachsehen.3 Doch Lorenz’ Bemerkung bezog sich auf die Geschichte der Naturwissenschaften. In öffentlichen Diskussionen und selbst in Teilen der Sozial- und Geisteswissenschaften ist das Nachsehen bis heute alles andere als selbstverständlich.
Wenn wir überrascht sind, stehen wir der Wirklichkeit gegenüber