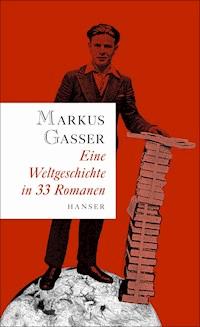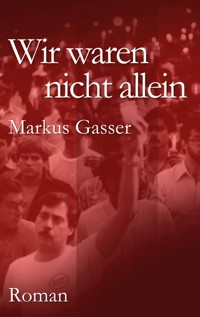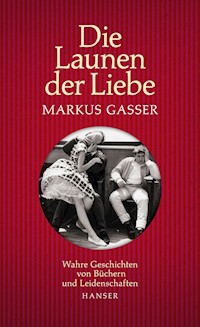11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Ufer der Themse finden Kinder beim Spielen die Leichenteile des größten Verbrechers im britischen Königreich, und nur einer weiß, wie sie dort hingelangt sind ... London besteht um 1700 aus zwei Städten, in beiden regiert die Gewalt. In der Unterwelt kämpfen Einbrecher und Auftragsmörder um die Vorherrschaft, am Hof streiten sich Minister und Aristokraten um die Gunst der Königin: Alles untersteht der Kontrolle Queen Anne Stuarts, religiös und politisch Andersdenkende werden zu Staatsfeinden erklärt, zum meist tödlichen Pranger verurteilt und weggesperrt im gefürchtetsten Kerker Europas, Newgate Prison. So wie Daniel de Foe, Unternehmer, Journalist, Kirchengegner, Geheimagent wider Willen und Intimfeind Queen Annes. Doch als er entdeckt, wer in London wirklich die Fäden zieht, schlägt er sich, gegen die Obrigkeit, auf die Seite der Kriminellen ? mit dem Beistand seiner scharfsichtigen Frau Mary de Foe und der respektlosen Margaret «Midge» Crane. Und um seiner Vernichtung zu entkommen, plant er einen letzten, spektakulären Coup. Markus Gasser erzählt in "Die Verschwörung der Krähen" über Wahrheit und Würde in einer korrupten Welt, über Armut, Seuchen und Krieg, den schmalen Grat zwischen Schuld und Unschuld, über die Entstehung des investigativen Journalismus unter dem Druck von Zensur, Fake News, Populismus und Paranoia - und über die Liebe in liebloser Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Markus Gasser
Die Verschwörung der Krähen
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Am Ufer der Themse finden Kinder beim Spielen die Leichenteile des größten Verbrechers im britischen Königreich. Nur einer weiß, wie sie dorthin gelangt sind: Daniel de Foe.
London besteht um 1700 aus zwei Städten, in beiden regiert die Gewalt. In der Unterwelt kämpfen Einbrecher, Fälscher und Auftragsmörder um die Vorherrschaft, am Hof streiten sich Minister und Aristokraten um die Gunst der Queen: Alles ist unter Anne Stuarts Kontrolle, religiös und politisch Andersdenkende werden zu Staatsfeinden erklärt, zum meist tödlichen Pranger verurteilt oder weggesperrt im gefürchtetsten Kerker Europas. So wie Daniel de Foe: Unternehmer, Journalist, Kirchengegner, Geheimagent wider Willen und Intimfeind der Queen. Als er herausfindet, wer in London wirklich die Fäden zieht, schlägt er sich gegen die Obrigkeit auf die Seite der Kriminellen – mit dem Beistand seiner klugen Frau Mary de Foe und der impulsiven Margaret «Midge» Crane, dem Mädchen für alles in einem Nobelbordell. Um sich vor seiner Vernichtung zu retten, plant er einen letzten, spektakulären Coup. Voll unvergesslicher Charaktere und dramatischer Wendungen erzählt Markus Gasser in «Die Verschwörung der Krähen» über die Liebe in liebloser Zeit, über Armut, Seuche und Krieg, die Selbstachtung in einer korrupten Welt, den schmalen Grat zwischen Schuld und Unschuld und die Entstehung des investigativen Journalismus in einer Ära von Zensur, Fake News, Populismus und Paranoia − eine historische Abenteuergeschichte über unsere Gegenwart.
Über den Autor
Markus Gasser, geboren 1967 in Österreich, ist Romancier, Essayist, Universitätsdozent, Kritiker und Schöpfer des beliebten YouTube-Kanals «Literatur Ist Alles». Zuletzt erschienen u.a. «Die Launen der Liebe», «Das Buch der Bücher für die Insel» und «Eine Weltgeschichte in 33 Romanen». Der Autor lebt mit seiner Frau und einer labyrinthischen Bibliothek in Zürich.
www.m-gasser.ch
Inhalt
Karten
1: Niemand verschwindet – 1730
2: Enemy of the People – 1703
3: Keiner von uns – 1660–1703
4: Fake News – 1704–1720
5: True Crime – 1721
6: Die Verschwörung der Krähen – 1725
7: Niemand entkommt – 1730
8: Midge – 1734
Personenverzeichnis
Karten
IN ROMEVILLE, wie die Verbrecherwelt Londons ihr Reviereinst nannte, befindet sich ein unterirdisches Tunnelsystem.
Lange Zeit ist sein Zweck völlig unbekannt geblieben. Auf ihm ruht noch immer die große, uralte Stadt.
1
Niemand verschwindet
1730
FRÜHER WAR ER DURCH FENSTER in die Freiheit gesprungen, nun war er unterwegs in sein Grab.
Diesmal würde er für immer verschwinden, wie der erste Schnee, der gerade fiel und sich spurlos in den schwarzen Äckern Kents verlor. In einer Neumondnacht von Donnerstag auf Freitag im Oktober 1730 stand ein siebzigjähriger Reisender, den Mantelkragen bis über beide Ohren hochgeschlagen, auf dem seitlichen Trittbrett einer Kutsche, klammerte sich ans Dachgestänge und balancierte die Rumpeleien mit seinen noch immer erstaunlich gelenkigen Beinen aus. Er war aus dem Wageninneren gestiegen, um den argwöhnischen Blicken der fünf anderen Passagiere nicht weiter ausgesetzt zu sein, und fragte sich nur eines: «Wann überfallen sie endlich den verfluchten Karren, wie es Mendez versprochen hat?»
Eine schlaflose Krähe umkreiste schweigend die Kutsche und wusste genau, was mit diesem Herrn hier los war: Sein nervöser Charakter hatte langes Warten nie ertragen, und auch diese Reiseetappe ins Grab war ihm bisher viel zu gemütlich verlaufen. Doch jetzt gelangten sie in die bewaldete Gegend um Sevenoaks, und die Pferde nahmen entschlossen keuchend einen Hügel in Angriff. Ein Windstoß kam den erschöpften Tieren zu Hilfe, mit Schwung ging es plötzlich aufwärts. Aber seine Angst verflog dadurch nicht.
Sogar in diesem elenden Nest Charleton, dachte er, hatte man ihn erkannt, obwohl sich die Bewohner nicht bloß zur Jahrmarktszeit schonungslos mit hausgebranntem Gin betranken und durch die Werktage schlurften wie Untote. Dabei hatte er sich tagsüber bei einem gleichgesinnten Sattlermeister versteckt und sich nur nachts für ein Stündchen einen Spaziergang durch ein paar Gassen gegönnt. Der grünäugige Fahrgast mit der versilberten Vollperücke kam ihm von Charleton her irgendwie bekannt vor. In einer Kutsche misstraute grundsätzlich jeder jedem, und vielleicht täuschte er sich; vielleicht täuschte er sich aber auch nicht, und der Grünäugige war ein Agent der Regierung und seit Wochen hinter ihm her. Höchste Zeit also, dass er sich beseitigte, bis es so wirkte, als wäre er allen nur im Traum erschienen oder von irgendwem erfunden worden und als hätte er gar nie gelebt.
Er hatte die schärfsten Flugblätter gegen Kirche und Krone geschrieben, in Gefängnissen gesessen, die Queen gereizt bis aufs Blut und sich mit Verbrechern verschworen. Er hatte das gesamte Königreich mit einem Netzwerk von Spionen überzogen und ein doppeltes Spiel getrieben in zahllosen Zeitungen unter hundertsiebenundachtzig Pseudonymen. Er hatte von anderen Autoren gestohlen, ihre Nester geplündert wie eine Elster und die Beute zu seinem Besitz erklärt. Er hatte Städte ans Meer verlegt, eine Insel darin versinken und für einen Schiffbrüchigen eine neue daraus hervorsteigen lassen, mit Papageien und Pinguinen.
Doch seinen «Robinson Crusoe» las in fünf Jahren sowieso keiner mehr, seine Gläubiger in London drohten ihm wieder einmal mit Newgate Prison, und Mary und die Kinder wollten wahrscheinlich nichts mehr von ihm wissen. Kein Nachruf, nicht einmal ein Grabstein sollte von ihm bleiben mit seinem Namen darauf, den seine Verfolger mit dem Teufel in Verbindung brachten, De Foe, «the foe», der Feind, der Widersacher. Der war er für sie alle, sie allesamt von Anfang an ja auch tatsächlich gewesen, sagte er sich: Zunächst reinen Gewissens, mit Ungeduld und Stolz und Belustigung, dann voller Verachtung und Zorn.
Die Kutsche hielt. Die Pferde hatten die Hügelkuppe hinter sich gebracht und schnauften genüsslich in den Schnee, zerkauten die Luft und dachten an Kräuterwiesen im Frühsommer. De Foe wollte gerade ins Wageninnere zurückklettern, als sieben Reiter aus dem Nebel tauchten und die Kutsche umstellten. Den Passagieren blieb keine Zeit, Uhren und Geldbeutel in ihre Stiefel zu stecken. Der Kutscher kramte in seinem Waffenkasten, als ginge ihn das Ganze nichts an. Einer der Reiter riss die linke Tür der Kutsche auf, ein anderer rief aus dem Dunkeln: «Wer’s noch nicht erlebt hat, hat davon gelesen, und wer nicht lesen kann wie ich, hat davon gehört, und wer noch nie davon gehört hat, hört es jetzt und kann es vielleicht bald seiner Frau Gemahlin erzählen, nämlich raus mit euch allen, und eins und zwei und drei …» – der Reiter im Dunkeln zählte offenbar die aussteigenden Passagiere ab – «… und der ehrwürdige Großvater dort drüben natürlich auch.»
Die Wegelagerer hielten reglos wie einarmige Vogelscheuchen Flinten auf die Gruppe gerichtet. Ihr Wortführer trat in den Lichtkreis der Kutschenlaternen. Die Passagiere wurden ganz still: Seine Augen waren weiß wie Milch. Vor ihnen stand breitbeinig ein Blinder, kaum älter als achtzehn, der sie streng fixierte. Er sah sie mit den Ohren, sah besser als sie. Der Regierungsagent bereute seine Berufswahl; die versilberte Vollperücke saß ihm schief auf dem Kopf. Es war auch zu dumm, dass ihm kurz vor dem Ziel ein so peinlicher Zufall in die Quere kam. Er reichte seine kostbare Perücke dem Blinden, der die Geste souverän überging.
«Ich bedaure es aufrichtig, dass unsere Zeit so knapp bemessen ist. Welche Sünden man einander nicht zu beichten hätte! Nachdem wir euch um alles erleichtert haben, was euch sonst noch so belastet, lassen wir euch Exzellenzien selbstredend frei und in unsere glorreiche Metropole Londinium passieren», sagte der Blinde. «Nur den Opa da, den Herrn Großschriftsteller Daniel de Foe» – und er wies mit dem kleinen Finger seiner Rechten auf den Alten, der seit längerer Zeit vor Kälte oder Kühnheit oder Panik unnötig laut mit beiden Füßen aufstampfte –, «den behalten wir, den knöpfen wir uns später vor, den weiden wir aus.» De Foe atmete innerlich auf.
Jetzt erst verstand er den Rätselsatz von Mendez: «Lassen Sie sich von dem Blinden führen.» Er fühlte sich fast unanständig vor Glück. Abraham Mendez hatte Wort gehalten. Dass er dies alles noch einem ganz anderen als Mendez verdankte, dem grausamsten Ungeheuer jener Jahre, kam ihm absurd vor, aber was machte das schon? Für Mr. Daniel de Foe war der Weg nun endgültig frei auf seiner Fahrt in die Grube. Doch wo sie lag, wusste nur Mendez – und die Krähe natürlich. Sie erhob sich, kreiste einen Moment und schwenkte ab, um den anderen davon zu berichten, wie reibungslos die ganze Sache gelaufen war.
2
Enemy of the People
1703
ES WAR NICHT Daniel de Foes erste Flucht gewesen.
Drei Jahrzehnte zuvor, 1703, als er noch gern in den Spiegel blickte und alle Zähne im Mund hatte und alle Haare auf dem Kopf und nicht so recht glauben konnte, dass er die magischen Vierzig überschritten hatte, erließ Queen Anne Stuart in der «London Gazette» einen Steckbrief gegen ihn, «einen Mann mittlerer Größe, hager, braune Gesichtsfarbe, braunfarbiges Haar, trägt aber meist eine Perücke, hat eine gekrümmte Nase, scharfes Kinn, graue Augen, ein großes Muttermal um die Mundpartie, Inhaber einer Ziegelei.» Die Queen setzte fünfzig Pfund auf den Mann mit Ziegelei, Perücke und Muttermal aus – eine Summe, von der eine sechsköpfige Familie gut ein Jahr lang leben konnte. Dann rief sie ihren Staatssekretär Earl of Nottingham zu sich und stotterte ausnahmsweise kein bisschen, als sie den kürzesten Befehl erteilte, den Nottingham je von ihr gehört hatte: Er solle diesen Foe, Erzfeind von Krone und Kirche und Haupt einer Verschwörung, aufstöbern, möge es Krone und Kirche kosten, was so was nunmal koste. Rechne er sich das selber aus.
Thema beendet.
Nichts hatte die Queen seit ihrer Krönung derart in Rage gebracht wie die Hetzschrift De Foes, die – vorgeblich im Namen der höchsten geistlichen Würdenträger – zur Ausrottung aller religiösen Abweichler aufrief, wie De Foe selbst einer war. Ihre Kirche, die einzig wahre, die Ecclesia Anglicana, mit verstellter Stimme als gewalttätig zu verleumden, war der hinterhältigste Trick, der ihr je untergekommen war. Die Hetzschrift spaltete die Nation, die ihr schon gespalten genug erschien.
Nottingham war ganz hingerissen von der Entschiedenheit Ihrer Majestät und nestelte erregt an seinen Smaragdknöpfen: Verschwörer wie diesen De Foe kreuz und quer durch England und den Kontinent zu jagen, das war nicht die übliche Aktenwälzerei, sondern echte Handarbeit und eine prestigeträchtige Herausforderung. Noch am selben Abend traf Nottingham den Schatzmeister zum Federballspiel, der auch das Budget des Geheimdiensts verwaltete und längst unterrichtet war über das dringliche Bedürfnis der Queen, den Schmähling an den Galgen zu bringen. Unmerklich ließ Nottingham den Schatzmeister mehrere Runden gewinnen, und dieser Geizhals sicherte ihm daraufhin eine derart hübsche Finanzierung zu, dass Nottingham ihn am liebsten umarmt hätte. Er trommelte die tüchtigsten Männer seiner Privatmiliz zusammen: Für Geld hätten sie sogar den Leibhaftigen ausfindig gemacht. Das Netz war ausgeworfen, und den Hecht sah er schon darin zappeln.
Von seinen Fluchtabenteuern erzählte der Hecht später oft und gern und beteuerte, nicht zu übertreiben, zumindest nicht maßlos: Wie er sich in Cádiz, wo er nebenbei mit Portwein und Sherry Handel trieb, zwei Wochen lang im Keller seines Exporteurs verborgen hatte und beinahe verhungert wäre (verdurstet natürlich nicht). Nach einem Schiffbruch setzten ihn maurische Korsaren an der Küste Marokkos gefangen; er nahm zum Schein den muslimischen Glauben an, um nicht als Sklave in die Goldminen Brasiliens verkauft zu werden, und ließ sich von Sultan Moulay Rachid belehren, dass Religion nichts sei als Politik und Maskerade und dass allen Menschen Rechte und Freiheiten zustanden, ob sie Juden waren oder Mauren oder Christen wie er. Solle doch jeder selig werden oder zur Hölle fahren nach seiner Fasson. Die Europäer freilich würden noch viele finstere Jahrhunderte brauchen, bis sie begriffen, dass nicht alles, was sich ihre Fanatiker dachten, auch gut fürs ganze Universum sei: Wenn sie sich bis dahin nicht alle wechselseitig massakriert hätten.
Auf den Hügeln um Tanger, von denen aus man zugleich das Mittelmeer und den Atlantik sah, lernte De Foe den Umgang mit einer neumodischen Handfeuerwaffe von einem schottischen Baron im Exil, MacGregor, der die Queen und ihre Kirche (in drei Sprachen) verfluchte wie die Pocken, hielt die Waffe jedoch ungeschickt wie einen frisch geangelten Fisch, schoss sich in die linke Schulter und überlebte nur, weil der Schotte Sohn eines Chirurgen war.
In Leiden belagerten Nottinghams Halunken einen Gasthof am Rhein, De Foe legte Feuer ans Dach, nutzte das Durcheinander und machte sich mit dem Wirt durchs Ufergebüsch davon.
In Rotterdam entkam er nachts durch ein Fenster, das Gott für ihn offen gelassen hatte, stürzte aber in den riesigen Bottich eines Färbers und ertrank nur darum nicht in der purpurroten Brühe, weil er den angeketteten Papagei fast zu Tode erschreckte, der mit seinem Marktgeschrei die Färberfamilie weckte.
Eine Geheimdepesche, die wochenlang durch die Hände Gleichgesinnter gewandert war, erreichte ihn in Delft: Seine Tochter Hannah sei an Typhus erkrankt. Auf einem niederländischen Segler flog er unter knirschenden Tauen an die englische Küste, ohne weiter auf die Agenten Nottinghams zu achten. Er fand Hannah wieder halbwegs bei Kräften, floh über Londons bequem ineinandergeschobene Dächer, kam bei Handwerkern unter, die er früher in seiner Ziegelei beschäftigt hatte, und musste bei einem seiner Spaziergänge nur ein einziges Mal einen Passanten mit seinem Degen bedrohen und mit einem Satz, der in die Legenden der Stadt einging: «Wenn Sie mir nochmals begegnen sollten, mein lieber, guter Freund, dann lassen Sie mir bitte eine halbe Stunde, bevor Sie nach den sogenannten Friedensrichtern rufen. Das wäre nett, danke sehr.»
Als Nottingham davon hörte, ließ ihn seine Zuversicht im Stich. Er fühlte sich dünn und allein. Ihm drohte eine weitere Schlappe in seiner Karriere. In jeder Ecke lauerten Kleinminister und Parlamentarier, Höflinge samt und sonders, die sich wichtiger nahmen als er und nach seinem Posten grapschten. Er gehörte nicht hierher. Er gehörte nirgendwohin. Hatte er sich über die Monate schon mehrfach ausgemalt, wie sich der Widersacher bei Verhören in seinen Ketten wand, wie er mit Kleinmädchenstimme bereute, seine Mitverschwörer preisgab und schließlich neben zwei anderen Volksverhetzern in leichter Brise vom Balkengerüst in Tyburn baumelte, so erschien ihm De Foe nun allmählich wie ein Gespenst, körperlos und ungreifbar, zugleich nirgends und überall. Jetzt hieß es, wieder ruhig und klar zu werden im Kopf: Er glaubte doch nicht an Gespenster, er ließ sich doch einzig und allein von unwiderlegbaren Tatsachen leiten. Und so eine unwiderlegbare Tatsache war dieser De Foe.
Der erwachte eines Nachmittags zur gleichen Zeit auf dem Dachboden eines Schiffbauers mit dem Mund wie voller Erde. Er glaubte sich von Ellbogen gestoßen, atmete in Krämpfen, und unter ihm pochten die Dielen. Er war so durchdrungen von der Angst, das ewige Versteckspiel sei letzten Endes vergebens, dass er schließlich seine Frau Mary bat, Nottinghams hartes Herz zu erweichen.
Aber als Mary mit einem Gnadengesuch bei Nottingham vorsprach, fiel dem Earl nichts anderes ein, als sie drei Stunden in einem Vorzimmer der vielen Vorzimmer warten zu lassen. Dann befahl er sie zu sich und fragte, wo ihr Mann sei.
«Dort, wo er immer ist, in seiner Ziegelei.»
«Da waren wir schon.»
«Das dachte ich mir.»
Nottingham streichelte sein Tintenfass, einen Eulenkopf aus Gold. «Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass sich Ihr Mann in Lebensgefahr befindet?»
«Das verwundert mich nicht. Nur ein bisschen anders zu denken als Sie, Sir, bedeutet schon Hochverrat. In einem Staat wie dem Ihren ist keiner sicher. England ist noch recht barbarisch.»
Er musste sich beherrschen, Gelächter stieg in ihm hoch, und um nicht laut draufloszuprusten, presste er die Lippen zusammen. Er sah sich inmitten einer Horde zotteliger Flachlandschotten am Eingang einer Höhle um ein loderndes Feuer herumlungern.
«Sie sind ein Engel, Mrs. De Foe, der alles vergibt. Das weiß ich, weil ich weiß, dass ihr Mann einer hundsgewöhnlichen Austernverkäuferin in Bristol ein Kind gemacht hat.»
«Diese Verleumdung haben seine Gegner in Umlauf gesetzt, um seinen Ruf zu ruinieren.»
«Das ist er schon.»
«Na dann.»
Hier versagte seine größte Kunst, die darin bestand, seinen Gegner mit Güte zu zwingen, ihn um einen Ausweg zu bitten.
Nottingham blickte zur Decke hoch, als wäre da ein Pfad in den Himmel zu finden, und fuhr sich mit den Fingerknöcheln an die Schläfe. Plötzlich kam ihm sein Hirn vor wie der geblähte Papierdrache seines verstorbenen Sohnes, bereit zum Aufstieg, an ihren Sonntagen im Sommer damals, zu zweit. «Halte den Drachen mit seiner Nase immer gegen den Wind, Sid. Ja, genau so! Toll machst du das. Und jetzt: Lass ihn fliegen!»
Er musste hier raus. Verdrossen machte er De Foe mit schneidigen Worten nieder – «Versager, Staatsfeind, Schafsnase, Bankrotteur, Schröpfkopf, Arschgesicht!» –, verfiel dann in ein anderes Extrem, fasste Mary de Foe an die Brust und schlug mit gönnerhaftem Lächeln einen kleinen Tauschhandel vor, obwohl er bereits an ihrem resoluten Schritt in den Saal herein erahnt hatte, dass eine Frau wie sie einen solchen Handel nie erwägen würde. Sie erwiderte nur: «Exzellenz, was Sie sind, sind Sie durch den Zufall der Geburt. Aber was wir sind, und seien es Schafsnasen, das sind wir durch uns.» Sie strich sich übers Kleid, als wäre es besudelt, warf ihm einen belustigten Blick zu, «und wenn Sie uns hiermit entschuldigen wollen», machte kehrt und ging.
Es dauerte ein Weilchen, bis sich Nottingham von seiner Verblüffung erholt hatte. Leider war an dieser schweren Beleidigung seiner angeborenen Hoheit etwas dran. Andererseits konnte dieses Frauenzimmer ja nicht ahnen, wie viele Intrigen er hatte spinnen müssen, um (Zufall der Geburt hin oder her) die Gunst einer launischen Königin zu gewinnen, die am Tag dreimal ihre Meinung wechselte wie ihre Roben. Und Mary de Foes dreiste Sätze erinnerten ihn daran, dass sie eine Staatsfeindin war, genau wie ihr Mann. Von nun an nahm Nottingham die Sache noch persönlicher als die Queen. Eigentlich lag am Grund seines Wesens eine kaum erträgliche Schwermut – er weinte nicht selten und mit Genuss, aber heimlich, nach Mitternacht –, doch umso entschlossener wollte er in den Augen der Queen einer Kanone gleichen, die einen De Foe vom heiligen Boden Englands wegpusten konnte.
«Hast du erst seinesgleichen, hast du irgendwann ihn selbst.» Nottingham durchforstete seine schwarze Liste nach politisch verdächtigen Boten, die Manuskripte zu den Druckern brachten. Einer von ihnen entpuppte sich rasch als Gesinnungsgenosse des Widersachers, dem Nottingham mit dem Brandeisen erst gar nicht drohen musste: Der Bote brauchte die fünfzig Pfund, da er gerade eine Dienstmagd geschwängert hatte und aufrichtig verliebt in sie war. Er verriet Nottingham Name und Adresse von De Foes Drucker, doch statt ihm das Kopfgeld zu übergeben, sperrte Nottingham den Boten zur Sicherheit weg. Dann nahm er Drucker Croome ins Verhör, das sich für Drucker Croome so anfühlte, als wäre er von einem Dämon besessen, den er selber loswerden wollte. Nottingham hielt Croome das Brandeisen unter die Nase, der Dämon entwich und spuckte den Stadtteil Spitalfields aus. Endlich war Nottingham auf der richtigen Spur. Schon vor Tagen hatte ein Spitzel in Spitalfields, jenseits der nördlichen Stadtmauer, in einem Mann mit brauner Haut und Hakennase Daniel de Foe erkannt.
Gerade wollte Nottingham der Queen vergnügt von seinem Durchbruch berichten, als per simpler Penny-Post ein unversiegelter Brief eintraf. Er kam von De Foe. Der Brief war schlicht und unverschämt. Er werde sich ausliefern, stand darin zu lesen, wenn man ihm – so erstens – Gefängnis und Pranger erspare und er in der Armee der Queen in den Niederlanden dienen dürfe. Und wenn man – so zweitens – die seinetwegen Eingesperrten, den Boten Bellamy und den Drucker Croome, noch heute freilasse. Nottingham dachte nicht daran. Wenn er sich eine Vorstellung von alledem gemacht hätte, wozu Daniel de Foe noch fähig war: Wie viel Ärger wäre ihm erspart geblieben! Doch als er seinen Fehler erkannte, war es längst zu spät.
Weil eine Durchsuchung des Stadtteils nur für unnötigen Aufruhr sorgen würde, streute Nottingham das Gerücht, schottische Katholiken wollten Spitalfields in Brand stecken, und an einem Samstagmorgen im Mai 1703 schwärmten die Männer seiner Privatmiliz durch die menschenleeren Gassen des Stadtteils und scheuchten verschlafene Katzen auf, bis sie De Foe im Haus eines Seidenwebers fanden, wo er in der Küche saß bei Kaffee und gezuckerten Erdbeeren mit Zimt und, die Hände verschränkt, seine Daumen miteinander verglich. Zu ihrer Verwunderung wehrte er sich nicht. Sie schleppten ihn umgehend nach Newgate Prison.
De Foe wusste, dass sie ihn in Newgate nicht töten würden, auch wenn hier die wenigsten lange genug lebten, um einen Gerichtssaal von innen zu sehen. Man hätte schon am Gestank krepieren können. So scheußlich nach Harn, Kot, nassem Stroh und Rauch von billigem Tabak hatte es nicht einmal in der Korsarenfestung Sala des Sultans Moulay Rachid an der Küste Marokkos gerochen. Doch der zweite Oberaufseher Bodenham Rewse nahm Mr. De Foe derart freundlich in Empfang, als hätte er seit seiner Geburt auf diese Begegnung gewartet. Er eskortierte ihn durch gewundene Gänge und über schmale Stufen zum Press Yard hinauf und formierte sein Haar dabei mit einem Kamm. Der Gestank schlich ihnen hinterdrein, musste bei einer Wendeltreppe dann plötzlich verschnaufen und gab sich geschlagen, als sie den Press Yard erreichten. Von dort konnte man den Innenhof überblicken, wo Schließer zur Mittagspause gerade einen Gefangenen nackt herumhopsen ließen.
Dagegen könne er nichts machen, entschuldigte sich Bodenham Rewse, das habe Tradition hier, «In Schwung bringen», so heiße das Spiel. Vor seiner Zeit hätten sie dem Gefangenen danach die Hoden abgeschnitten.
Wenn das kein Fortschritt sei, bemerkte De Foe.
Zu seinem Ärger war er in der geräumigen Zelle nicht allein.
«Ganz der Ihre», sagte ein braun gebrannter Franzose, der mit gespannter Gelassenheit am Sims des eisenvergitterten Fensters lehnte, die Arme verschränkt, die Beine überkreuz. «Willkommen in der teuersten Herberge Ihrer Stadt. Treten Sie ruhig näher. Ich fresse Sie nicht sofort auf. Das hätte Ihr Vorgänger mit mir am liebsten gemacht, ein Frauenmörder, von Adel übrigens, wäre ich ihm gestern Nacht nicht mit meiner Geheimwaffe zuvorgekommen.»
«Ich hatte bereits Umgang mit Kannibalen im Pazifik», versetzte De Foe. «Aber in diesem Höllenloch bin ich zum ersten Mal.»
Letzteres stimmte.
«Und Sie haben natürlich Ihren Obolus an Bodenham Rewse entrichtet, den Höchstpreis, fünfhundert, nehme ich an? Ansonsten wären Sie nicht hier, bei mir. Offenbar haben Sie die Mittel dazu.»
«Gerade noch und bald nicht mehr.»
«Ärgern Sie sich nicht über unseren Bodenham Rewse. Herrschsucht ist sein geringstes Laster, obwohl die härtesten Repressalien in seiner Macht stünden. Er hat das Zehnfache des Höchstpreises ausgeben müssen, um seinen Posten zu kaufen und Vizekönig in diesem Reich der lebendig Begrabenen zu werden. Major Bernardi nebenan zahlt noch viel mehr als Sie und sitzt mit seiner ganzen Familie ohne Gerichtsurteil schon ein Jahrzehnt hier herum.» Die Flucht aus Newgate sei noch keinem gelungen, auch nicht für Berge von Gold, und der Ausbrecher müsse erst noch geboren werden, der es durch sechs Gittertore bis zur Kapelle schaffe und von dort dann aufs Dach. «Aber Niederlagen nimmt unser Major Bernardi nicht hin. Ebenso wenig wie Sie. Ich habe Ihren Wutausbruch gegen die Kirchenoberen überflogen. Etwas zu lang geraten, aber gefährlich. Also: nicht schlecht.» Offenbar hatte der Fremde irgendwo aufgeschnappt, dass De Foe zu den «Dissentern» gehörte, und hoffte, dass dies etwas furchtbar Verwegenes und wenig Respektables sei.
Und völlig daneben lag er damit ja auch nicht: Die Dissenter, Dissidenten, Abweichler, Nonkonformisten, ob sie nun Quäker waren, Baptisten oder Presbyterianer wie De Foe, nahmen sich die Freiheit, die Bibel selber, in ihrer eigenen Sprache und nicht auf Latein zu lesen und auszulegen. Sie warfen dem Papst in Rom und der Ecclesia Anglicana ein «Verflucht!» an den Kopf, wenn Papst und Ecclesia dem Volk Bibelpassagen nach Willkür verkürzten und verdrehten und Gott in den Käfig ihrer Interessen sperrten und als gegeben annahmen, Gott höchstpersönlich hätte sie in ihre Ämter befördert. (Außerdem predigten die Papisten und Anglikaner miserabel und schenkten beim Abendmahl vor allem sich selber ein.) Die Dissenter galten als Ketzer, weil sie Kirche und Staat voneinander trennten. Religion war Privatsache. Auch ihr eigener Glaube ging nur sie selbst etwas an. Manche waren nicht einmal sonderlich fromm: Es missfiel ihnen einfach, welch tyrannischen Lauf die Dinge seit vier Jahrzehnten nahmen, von einem Dekret zum nächsten, das man gegen sie erließ, von einer verstümmelten Leiche zur nächsten, die man in die Straßengräben Londons warf, um das jeweilige Dekret zu besiegeln. Viele Dissenter wollten ein vom ganzen Volk gewähltes Parlament, weil frei zu sein und unabhängig von Krone und Kirche für sie ein und dasselbe war.
Der merkwürdige Franzose hieß Antoine de Guiscard. Er nannte sich Marquis, war aber keiner. Dann wieder nannte er sich Abbé de la Bourlie: Was er nicht mehr war. Als Jüngster von seinem Vater zum Priester bestimmt und nach dem Jesuitenkolleg mit den niederen Weihen versehen, habe er sich bei aller Gottesliebe zur Enthaltsamkeit nicht entschließen können.
«Katholiken», brummte De Foe in sich hinein, «vergreifen sich an allem, was durch ihre Sakristeien trabt.»
«Wie?»
«Nonnen», sagte De Foe laut.
Ja, an Nonnen habe er sich auch versucht, lächelte der Franzose. Offenheit schien überhaupt zu Guiscards Charakter zu gehören. Er erzählte, ohne sich Zeit zum Atmen zu lassen, wie er aufseiten der hugenottischen Protestanten in den Cevennen gegen den Papistenkönig Nummer vierzehn gekämpft hatte, den er verächtlich «Louise» nannte, kniete sich nieder und zeichnete mit Kreide jeden Ort seiner Irrfahrten auf den Boden hin, bis der einer wilden Landkarte Frankreichs glich. Doch lebte Guiscard auch von seiner Schlauheit, denn als abzusehen war, dass die Hugenotten scheitern würden, hatte er sich aus dem Staub gemacht. Auf dem Place de Grève in Paris von vier Pferden in Stücke gerissen zu werden, war nicht nach seinem Geschmack. Stand auf, klopfte sich den Kreidestaub von den Hosen und ging zum praktischen Teil seiner Ansprache über, die in einer Lobrede auf seine Geheimwaffe ihren Höhepunkt fand.
Man meide, dozierte Guiscard, zunächst den Fraß aus der Kantine hier, der die Vergehen der hiesigen Küche ins Maßlose treibe. Ferner meide man Bier, Brandy, Gin und das Wasser. De Foes Familie solle ihnen unverdünnten, direkt aus dem Bordeaux importierten Wein bringen (am besten einen Château Trompette), Wachskerzen, Kohle, Schinken, frisch zubereitetes Kalbfleisch, Rinderzunge, Geflügel – und Guiscard hätte sich in die Menüfolge für ein Festgelage hineingesteigert, wäre er sich nicht selber mit einer Bedingung ins Wort gefallen: «Dafür stecken Sie unseren Schließern jeden Tag etwas Geld zu, und wir beide sind fein raus und die besten Freunde.» Der Gin hier, erklärte Guiscard weiter, versenge die Eingeweide und mache schwachsinnig, und im Wasser lauerten dämonische Tierchen, die nur unterm Lichtmikroskop zu erkennen waren und auf Dauer wie Gift wirkten. Als Sohn eines Apothekers war Guiscard mit allen möglichen Giften vertraut, und eines davon war ohne Geruch und Geschmack und hinterließ keine Spur im Körper. Er trug das weiße Pulver stets bei sich. Davor werde sich niemand schützen können, weder ein Frauenmörder von Adel, der Earl of Nottingham noch die Queen.
De Foe nickte nervös.