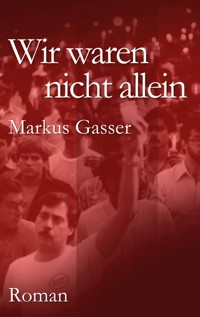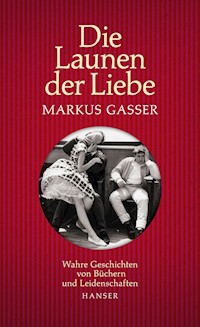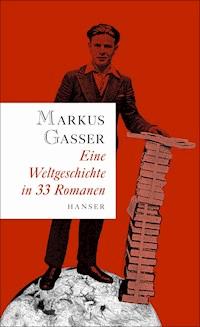
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller und der Historiker sind Wahlverwandte. Beide wollen ihr Publikum fesseln, ob sie erdachte Geschichten erzählen oder packende Tatsachen. Den Schriftstellern liefert die Vergangenheit spannenden Stoff zur Genüge. Markus Gasser präsentiert nun 33 Romane, die zusammen eine Weltgeschichte vom Alten Ägypten bis in unsere Gegenwart ergeben. Thomas Mann, Umberto Eco, Leo Tolstoi, Stefan Zweig und Orhan Pamuk: Sie und viele andere erzählen mit ganz unterschiedlichen Stimmen aus unterschiedlichen Zeiten. Markus Gasser schickt uns auf eine Entdeckungsreise durch die Epochen der Welt- und Literaturgeschichte: Ein verblüffendes literarisches Spiel, ein großes Lektürevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Weltgeschichte der ganz besonderen Art: Markus Gasser reist mit 33 Romanen in die Vergangenheit. Thomas Mann, Umberto Eco, Daniel Defoe, Lew Tolstoi, Toni Morrison, Stefan Zweig: Sie und viele andere erzählen aus unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Stimmen die Geschichte unserer Welt. Dieses Buch schickt uns auf eine Entdeckungsreise durch die Epochen der Welt- und Literaturgeschichte, weckt die Neugier auf Romane, die wir noch gar nicht kannten oder schön längst lesen wollten: Ein verblüffendes literarisches Spiel, ein großes Lesevergnügen.
Hanser E-Book
Markus Gasser
EINE WELT-
GESCHICHTE
IN 33
ROMANEN
Carl Hanser Verlag
INHALT
KAPITEL 1 Die versunkene Stadt
Evelyn Waugh: »Wiedersehen mit Brideshead«
Lyonesse, England, 1944 n.Chr.
KAPITEL 2 Als der Mensch den Tod bezwang
Thomas Mann: »Joseph und seine Brüder«
Heliopolis, Ägypten, 1350 v.Chr.
KAPITEL 3 Worin der Leser ganze Schiffsladungen von Schimpfwörtern ertragen muß
Homer: »Ilias«
Troja, Westküste Anatoliens, 1250 v.Chr.
KAPITEL 4 Wie es sich anfühlt, von Hühnern regiert zu werden
Thornton Wilder: »Die Iden des März«
Rom, oberirdisch, 45 v.Chr.
KAPITEL 5 Was man auf Latrinen alles erfahren kann
Henryk Sienkiewicz: »Quo vadis«
Rom, unterirdisch, 64 n.Chr.
KAPITEL 6 Die Empörung der Krähen
Kazuo Ishiguro: »The Buried Giant«
Camalet, Somerset, 537 n.Chr.
KAPITEL 7 Sie sind noch immer unter uns
Umberto Eco: »Das Foucaultsche Pendel«
Jerusalem, 1187 n.Chr.
KAPITEL 8 Vom Paradies, das im Westen liegt
Jane Smiley: »Die Grönland-Saga«
Gardar, Grönland, 1399 n.Chr.
KAPITEL 9 Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich euch einiges erspart
Mark Twain: »Persönliche Erinnerungen an Jeanne d’Arc«
Rouen, Frankreich, 1431 n.Chr.
KAPITEL 10 Der Reiher Tausendrot
Leo Perutz: »Die dritte Kugel«
Tenochtitlan, Mexiko, 1519 n.Chr.
KAPITEL 11 Mach es wie die Spinnen
Hilary Mantel: »Falken«
London, oberirdisch, 1534 n.Chr.
KAPITEL 12 Der Spalt, durch den das Licht einfällt
John Banville: »Kepler«
Prag, Böhmen, 1600 n.Chr.
KAPITEL 13 Wie ich dich zum ersten Mal sah
Tracy Chevalier: »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«
Delft, Niederlande, 1666 n.Chr.
KAPITEL 14 Wo man unweigerlich in schlechte Gesellschaft gerät
Daniel Defoe: »Moll Flanders«
London, unterirdisch, 1721 n.Chr.
KAPITEL 15 Im Königreich der Austern
Choderlos de Laclos: »Gefährliche Liebschaften«
Paris, 1786 n.Chr.
KAPITEL 16 Wir nähern uns dem Ende der Welt
Lew Tolstoi: »Krieg und Frieden«
Moskau, 1812 n.Chr.
KAPITEL 17 Folge der Wasserspur ihrer Füße hinab in den Fluß
Amitav Ghosh: »Die Ibis-Trilogie«
Kanton, China, 1838 n.Chr.
KAPITEL 18 Ich habe die Hölle gesehen, und sie ist weiß wie Schnee
Elizabeth Gaskell: »Norden und Süden«
Manchester, England, 1842 n.Chr.
KAPITEL 19 Laß einfach stehen, was dir nicht schmeckt
Liam O’Flaherty: »Zornige grüne Insel«
Galway, Irland, 1846 n.Chr.
KAPITEL 20 Die Ungebundenheit der Vögel beleidigt sie
Philipp Meyer: »Der erste Sohn«
Fredericksburg, Texas, 1849 n.Chr.
KAPITEL 21 Eine Kathedrale des Lichts, zu erleuchten die Heiden
J.G. Farrell: »Die Belagerung von Krishnapur«
Lucknow, Indien, 1857 n.Chr.
KAPITEL 22 Ihr gehört allen, euch gehört nichts
Toni Morrison: »Menschenkind«
Cincinnati, Ohio, 1873 n.Chr.
KAPITEL 23 Was Tante Daisy dazu sagen würde
Stefan Zweig: »Ungeduld des Herzens«
Bruck an der Leitha, Österreich-Ungarn, 1914 n.Chr.
KAPITEL 24 Ich bin doch zu schade für nur einen allein
Christopher Isherwood: »Mr. Norris steigt um«
Berlin, Deutsches Reich, 1933 n.Chr.
KAPITEL 25 Dies kostbarste Blut
E.L. Doctorow: »Billy Bathgate«
Manhattan, New York, 1935 n.Chr.
KAPITEL 26 Mutter, sie essen Menschen, und, Mutter, sie rezitieren Gedichte, und niemand fällt ihnen ins Wort
Richard Flanagan: »The Narrow Road to the Deep North«
Paß der Drei Pagoden, Thailand, 1943 n.Chr.
KAPITEL 27 Ich werde dir helfen, wenn ich muß, dich töten, wenn ich kann
Hans Fallada: »Der Alpdruck«
Feldberg, Mecklenburg, 1945 n.Chr.
KAPITEL 28 Habt keine Angst
Mario Vargas Llosa: »Das Fest des Ziegenbocks«
Santo Domingo, Dominikanische Republik, 1961 n.Chr.
KAPITEL 29 Der berauschte Wald
T.C. Boyle: »Drop City«
Boynton, Alaska, 1970 n.Chr.
KAPITEL 30 Heute spricht keiner mehr von Jerry Westerby
John le Carré: »Die Karla-Trilogie«
Berliner Mauer, Grenzübergang Bernauer Straße, 1977 n.Chr.
KAPITEL 31 Woanders gibt es Menschen, die glücklicher leben als wir
Orhan Pamuk: »Das Museum der Unschuld«
Istanbul, 1984 n.Chr.
KAPITEL 32 Der unsichtbare Reyaz Bhai
Vikram Chandra: »Der Pate von Bombay«
Mumbai, 2002 n.Chr.
KAPITEL 33 Du kannst damit tun, was immer du willst
Chimamanda Ngozi Adichie: »Americanah«
Lagos, Nigeria, 2009 n.Chr.
QUELLEN
KAPITEL 1
DIE VERSUNKENE STADT
Evelyn Waugh: »Wiedersehen mit Brideshead«
Lyonesse, England, 1944 n.Chr.
Als man Wachen vor seinem Zelt postieren mußte, damit ihn die eigenen Leute nicht im Schlaf erschlugen, träumte sich Leutnant Evelyn Waugh Nacht für Nacht in eine glücklichere Vergangenheit zurück. Meist sah er sich dann im Bannkreis eines alten herrschaftlichen Hauses wieder mit seinen Säulen, Obelisken und golden aufleuchtenden Kuppeln inmitten eines Parks, wo eine bronzene Sonnenuhr daran gemahnte, daß jeder Tag ohne Lachen ein verlorener war. Damals trank Leutnant Waugh oft freudlos im Übermaß, und aus seinen Phantasieflügen erwachte er finster, verknöchert und kalt vor Zorn.
Sein Universum hatte sich zur Hölle verkehrt. Verflogen war die Freude, mit der er aus freien Stücken in die Armee eingetreten war, seitdem Großbritannien im Krieg gegen Hitler einen Stalin als Kampfgefährten erdulden mußte, der wie Hitler plante, den Kontinent unter seine Herrschaft zu zwingen. Vor die Wahl zwischen diesen beiden Bestien gestellt, hätte er sich ungerührt erschießen lassen. Seine anarchische Spottlust war nie zimperlich gewesen; nun aber kannte sie keine Rangunterschiede mehr. Gemeine Soldaten, die auch nur ein klein wenig Verständnis für die Ausrottungsideologien jener Jahre bekundeten, wies er mit arktisch lächelnden Kränkungen zurecht. Strammbürokratisch blasierte Generäle auf Besuch in Englands Hinterlandquartieren übergoß er scheinbar zufällig mit einem Glas billigen Rotweins und erklärte, er werde seine größte Tugend, die Trinkseligkeit, nicht der Laune einer leeren, wenn auch hochdekorierten Uniform opfern. So war er in Ungnade gefallen – eigentlich Schriftsteller von Beruf und auch darin ein Schandmaul seit je, älter als seine Jahre, untersetzt, dicklich und zuallererst sich selbst eine Last. Er hatte nicht einfach nur Feinde: auch seine besten Freunde brachte er mit einem wohlgezielten Satz gegen sich auf. Selten in der Geschichte des britischen Militärs war ein Antrag auf Diensturlaub begeisterter bewilligt worden: Noch als er längst verschwunden war, dachte man sich in der Offiziersmesse sportsmäßig die qualvollsten Todesarten für ihn aus.
Jenen Kosmos von Frieden und Pracht, den sich Leutnant Evelyn Waugh im Rücken böser Zeit verzweifelt erträumt hatte, gewann er erst im Hotel Eastern Court, Dartmoor, zur Gänze wieder zurück. Das kleine Hotel kauerte, seit dem Mittelalter kaum verändert, wie in einer anderen Zeit – auch wenn es mit derselben Nahrungsknappheit geschlagen war wie der Rest des Königreichs. Spätnachts konnte man hungrige Kobolde auf ihrer Suche nach ein paar Eiern leise vor sich hin schimpfen hören. In den düsteren, geduckten Zimmern qualmten die Kamine, und draußen glucksten die Moore gespenstisch und karg. Mit nie gekannter Schadenfreude hätte sich seine Kompanie daran ergötzt, wie dieser Widerling verdrossen zerkochte Sojabohnen kaute und sich nach seinem Wein verzehrte, der ihm in den schönsten Jahren seines Lebens mit okkulter Kraft zur Gewißheit verholfen hatte, daß die Menschheit jeder Katastrophe gewachsen war.
Schriftsteller schreiben, weil ihnen etwas fehlt, und an einem magenleeren Februarmorgen des Jahres 1944 – die Alliierten waren im Ansturm auf Rom – nahm Waugh verfroren und verschnupft sein Opus Magnum in Angriff, »Brideshead Revisited«, »Wiedersehen mit Brideshead«, und die aus Hitler und Stalin gewirkte Hölle verblaßte darin und verschwand.
Die Kobolde hielten den Atem an. Zersprengt war die Mauer, die ihn vom ersehnten Damals trennte, und auf einmal sah er sich in das champagnerklare Oxford seiner sinnenreich verbummelten Studienjahre zwischen den Kriegen entrückt. In Dartmoor darbte er; zugleich aber lehnte er beschwingt am kühlen Stein einer Kirche in Oxford im Sommer 1923 nach einem majestätisch üppigen Mahl und noch und noch einem Glas Cointreau. Im Erdgeschoß des Eastern Court nahmen ältere Damen angewidert und verzagt ihr bißchen Frühstück ein; er genoß währenddessen, überwältigt von der ersten großen Liebe seines Lebens, in einem hochherzigen Venedig überbackene Sandwiches in »Harry’s Bar« oder rollte in einem schnurrenden Cabriolet durch ein Tal zum Herrensitz Brideshead mit der lachlustigen Sonnenuhr und einem Weinkeller, dessen Flaschen sofort geleert werden mußten, bevor sie verdarben. Nach einem sachten Gewitter kehrten die Schmetterlinge zu ihren Kastanienblüten zurück; und er war daheim.
Niemals wieder kam Waugh dem Himmel so nah. Als die Alliierten im Sommer 1944 sein Europa befreiten, erlöste er Lord Marchmain von Brideshead auf Papier aus der Qual des Sterbens und brachte sein Werk zur Vollendung. Er hatte sein ganz persönliches Lyonesse geborgen, jene mythische »Stadt der Löwen« an Englands Küste, die einst im Meer versunken war. Noch zu seiner Zeit zogen die Fischer von Cornwall in ihren Netzen Hausrat aus dieser Stadt ins Trockene hoch, erspähten die Dächer und Türme und Korallenpaläste und dicht wogenden Wälder im Wasser und hörten die Kirchenglocken vom Grund des Ozeans her läuten zur Warnung für Boote, die der Sturm in den Rachen der Klippen trieb.
Warum kam Evelyn Waugh diese keltische Legende um Lyonesse so bezaubernd vor? Sie rechnete mit dem ältesten Zeitvertreib der Menschheit ab: Kaum war ihr im Kampf um Unsterblichkeit eine Zivilisation geglückt, wünschte sie sich schnurstracks wieder deren Untergang herbei. Bald würde Waugh unter Indiens dunstigen Mangrovenwäldern die Ruinen gestürzter Städte erahnen, die dem zermürbenden Monsun anheimgefallen und nunmehr von Affen bewohnt waren, die ohne Gedächtnis kreischend nicht wußten, worauf sie da hockten. Sie erinnerten ihn an die Utopisten, die plump und roh die Vergangenheit samt und sonders der Plünderung preisgaben und von unaussprechlich Großem im Nebel einer Zukunft schwärmten, die kein Mensch je heil überstand. Wenn es nach denen ging, mußte immerzu irgendwas bröckeln: der nachbarliche Pfahlbau hier, ein Imperium dort. Die indischen Reiseführer indes sprachen von ihren antiken Königen, als wären sie selbst es gewesen, die einst jene Städte errichten ließen. »Sie können nicht vergehen«, versicherten sie und tippten sich an die Stirn: »Hier drin gibt es sie noch«. Wen wird es verwundern, daß für Schriftsteller wie Waugh alles Frühere Lyonesse ist, eine versunkene Stadt? Was soeben noch unwiederbringlich entschwunden schien, holen sie im Feuereifer ihrer Beschwörungsmacht Stück für Stück aus den Fluten an Land.
Nie werden wir hautnah in Erfahrung bringen, wie die Vergangenheit wirklich war; doch was Schriftsteller ihren Fundstücken abgewinnen konnten, wiegt das Verlorene auf, und manches Werk besitzt solche Lebendigkeit, daß es sich gegen jede historische Berichtigung zu behaupten weiß: Der Julius Caesar von Shakespeare wird der Julius Caesar schlechthin bleiben und Marc Anton – »Freunde, Römer, Mitbürger, hört mich an« – auf ewig seine Rede vor Caesars Leichnam gehalten haben, weil Shakespeare sie für ihn geschrieben hat. Plötzlich steckt man in der Menge auf dem Forum Romanum fest und reibt sich die Augen: Sie ist realer als unser Hier und Jetzt um uns her. Was geht hier vor? Wir haben uns lediglich zur Millionengemeinde der leidenschaftlich phantasiehörigen Leser bekehrt. Man glaubt, man hätte nur ein Leben; dann öffnet man ein Buch, tritt ein, hängt ein Schild vor die Tür, »Bitte nicht stören, bin auf Zeitreise« – und schon hat es einen mitten hineinverschlagen in die fernsten Epochen, als gehörten sie unserer privaten Erinnerung an. Wir sind, so heißt es, die Geschichten, die wir von uns erzählen können; mit jedem Buch wächst uns eine neue zu, und nur die Kürze unseres Daseins verhindert, daß wir die gesamte Menschheit in uns versammeln.
Derart verwandelt, ist uns beinah jede Rolle recht. Zustoßen wird uns schon nichts. Niemand kam bislang, nur weil er von den Kreuzzügen las, durch einen Schwerthieb um. In jedem Dereinst hätten wir auch jedermann sein können, etwa der bespöttelt erfolglose Gaukler dort, der sich von Wallensteins Regimentern anwerben läßt, oder jene Korbflechterin, die nachts nicht schlafen kann, weil sie ihre Halbschwester verdächtigt, sie treibe Schwarze Magie; ein blutjunger Priester der Maya, der sein Messer zitternd über die Brust seines Opfers hält und nicht zustechen kann; ein römischer Legionär, der sich, angeekelt von den drogenpilzbegeisterten Folterritualen der Wilden, in der grauen Einöde Britanniens nach seiner Frau auf Sizilien sehnt; der hilflos haspelnde Berater eines Pharao, der bezweifelt, Gott zu sein, und genug davon hat, sich in einem Tempel selber anzubeten, und eine Königin, Hatschepsut, die nichts lieber wäre als Gott und bei öffentlichen Anlässen deshalb einen künstlich befestigten Kinnbart trägt, der ärgerlich kitzelt; oder jener Holzwurm auf Noahs Arche, der darüber staunt, daß der Schöpfer, als er auf sein Schwemmgericht verfiel, dabei nicht gleich mit aller Kreatur reinen Tisch zu machen beschloß. Und der letzte Dinosaurier, der sich beschämt – und als »tumber Kaltblütler«, »feuerverspieener Raublurch« und »Eidechsenschnauze« beschimpft – von den ersten Menschen anhören muß, was für ein Evolutionssegen das Aussterben seiner Spezies doch war.
Seien wir nicht überrascht: Notgedrungen nehmen die schwindelnden Metamorphosen hinauf und hinab zu den Anfängen der Anfänge traumhafte Formen an. Unter Ruinen liegen meist weitere Ruinen begraben, und so gibt es, machen wir uns auf die Suche nach dem Ursprung der Dinge, immer noch und noch ein Davor, das sich zuletzt im Es-war-einmal verliert. Ohnedies verfügen Schriftsteller über den mythischen Blick und phantasieren sich gern bis ins Morgendunkel der Zivilisationen zurück, in jene Tage der Dämmerung, »hinter die kein Mensch je zu blicken vermag«, da die Welt noch »derart jung war, daß die Wissenschaft sie nicht erfassen kann und ihre Spekulationen« – munkeln die Schriftsteller weiter – »so willkürlich sind wie die Gespinste der Einbildungskraft«. Sie nehmen Historisches, als wäre es erfunden; und daraus Erfundenes geben sie als historisch aus. Schon ihr Urvater Homer soll Sproß einer Flußnymphe gewesen sein. Und fragten wir sie, womit unsere Geschichte wann wo begann, würden sie nicht ohne Stolz erwidern: »Natürlich mit uns, den Erzählern, wem sonst?«
KAPITEL 2
ALS DER MENSCH DEN TOD BEZWANG
Thomas Mann: »Joseph und seine Brüder«
Heliopolis, Ägypten, 1350 v.Chr.
Jahrtausendelang fürchteten wir nichts so bitter wie die Nacht. Sie belauerte uns mit Geschöpfen, die den Tod brachten, mit Skorpionen, Schlangen, Schakalen. Auch die Ahnen beschwerten unser Gewissen, die wir im aufgebracht niederdonnernden Regenschauer allzu schludrig und ohne Grabbeigaben verscharrt hatten. Manche von ihnen kehrten zurück und hauchten den Kindern Krankheiten ein. Damals schliefen wir schlecht: Starb uns die Sonnenscheibe allabendlich unter die Hügel weg, lagen wir frierend aneinandergedrückt, in Finsternis oft panisch erstarrt. So mochte in uns die Liebe aufgekommen sein, grob noch, hastig und wortlos. Kaum daß jedoch das Feuer gebändigt und die Beute, gebraten, leichter zu kauen war, sprachen wir uns mit verkleinertem Gebiß bald in ganzen Sätzen aus. Und so fing es an.
Denn unter uns gab es immer einen, der nicht mal zum Fischfang taugte, sich aber aus dem Höhlengekritzel der Jäger die ersten Schauergeschichten erdachte, ohne je Zeuge zu sein, wie seine muskelprotzigen Brüder dem Eber, der Gazelle durch Wälder und Steppe hinterherliefen. Bloße Schimären – Götter und Dämonen – sicherten ihm seine Existenz: Was er sich in Sorge ums eigene Überleben erträumte, wuchs bei seinem Publikum zu einem Verlangen nach immer Unerhörterem heran. Das vertrieb die Langeweile und verlieh der Furcht vor der Nacht Namen und Gesicht. Auf die Frage nach unserem Woher und Wozu kam ihm eine Mär vom Anfang der Welt in den Sinn, die zumeist mit einem Krieg zwischen einer drachenförmigen Riesenschlange aus Wasser und einer schwankend mächtigen Gottheit begann. Und schon war dieser eben noch schlachtreife Weichling eine Unentbehrlichkeit.
Darum erschlugen die Jäger den Nichtsnutz auch nicht: Sie wollten im Schein der Aschenglut nach dem Essen einer handfesten Fabel mit Happy-End lauschen, die Sinn versprach und das geräuschvolle Schweigen bis zum Sonnenaufgang zu überstehen half. Er braute ihnen aus urwüchsigen Ängsten jene Thriller zusammen, die man später »Mythen« nannte, und beruhigte sie damit auch wieder, brachte die Götter und Gespenster auf ihre Seite und Licht ins Dunkel des Schlafs. Seitdem träumten wir nicht mehr schwarzweiß.
Freunde hatte er auch weiterhin nur in seinem vielbevölkerten Kopf. Doch nahm er dafür die schwächlichen Kleinen vor den bulligen Großsprechern mit einer hingezischten Schaudersentenz in Schutz. Seine Stimme drang in die Nebel der Schmerzen vor, mit denen die Verwundeten darniederlagen, und eröffnete ihnen das Geheimnis jenseitiger Gefilde, wo man jeder Pein enthoben war. Seine Klage um die Verstorbenen wünschte sich nichts leidenschaftlicher als deren Wiederkehr ins Hier und Jetzt: Das Kühnste an ihm war, daß er den Tod haßte, als könnte er kraft seiner Worte dem Gang der Welt Einhalt gebieten, bis niemand mehr starb.
Mit diesem Urfeind der Nacht kam der Schriftsteller in die Welt. Er blieb sich immerzu gleich: So wie er heute seinen Bleistift über leerem Blatt kreisen läßt – ein Architekt, der kurz vor Baubeginn bedächtig die Qualität der Steinquader prüft –, so kaute er bereits im altägyptischen Heliopolis um 1350 vor Christus sinnierend an der Spitze seines binsenen Pinsels, eine Papyrusrolle auf dem Schoß. Seitdem der Weise Imhotep die Stufenpyramide ersonnen hatte und dafür geheiligt worden war, stand der Schriftsteller gleich nach dem Pharao nilauf, nilab für fast alles, woran die Ordnung des Kosmos hing. Er benötigte weder Grabkammer noch Gedenkstein, schuf sich »seine Erben in Büchern«, die zugleich seine Seele bewahrten. Heiter komponierte er gar Nachrufe auf sich selber, wie Thomas Mann mit Begeisterung bemerkte, als er »Joseph und seine Brüder« entwarf: Der Tod focht ihn schon seines Berufs wegen nicht an.
Denn in Ägypten war der Schriftsteller Magier und Priester, Heiler und Bestatter, Traumdeuter und Erfinder der Sonnenuhr, Mathematiker und Notar, Historiker und Astronom, Buchführer der königlichen Kornkammern und Verfasser erotischer Liebeslieder, opulenter Gottesgesänge, verwickelter Kochrezepte und unterwürfiger Bittbriefe an die Dahingegangenen, die in ihren Sarkophagen fortdauerten nur dank seiner Schrift und rhythmisch exakt wiederholter Totenbeschwörungen in Prosa und Vers: Nicht von ungefähr hießen die Skriptorien und Bibliotheken in Ägypten »Häuser des Lebens«; nicht von ungefähr empfand Thomas Mann die tägliche Expedition in dieses schreib- und vitalitätsbesessene Land über dreitausend Jahre später als Zeitreise par excellence und wie eine Fahrt zu den Ursprüngen seiner selbst, wenn er für »Joseph und seine Brüder« in sein Arbeitszimmer verschwand; und nicht von ungefähr versichert er dem Hebräer Joseph in Gestalt eines stattlich weißgewandeten Obergelehrten auf dem Marktplatz von Heliopolis, der Gott seiner Stadt, der Gott der Sonne, ehre auch die andern Götter der Erde und sei im Grunde mit ihnen eins; und umgekehrt anwenden ließe sich das naturgemäß auch.
Ägypten, Israel und Babylon, Phönizien, Rom, Syrien und Griechenland: In Thomas Manns Menschheitsroman sollten sich alle Zivilisationen rund um das »Große Grün« – wie Ägypten das Mittelmeer getauft hatte – vorab gegen jenes »Dritte Reich« vereinen, das zum Vaterland des Todes geworden war mit seinen Krematorien, Massengräbern, dem silbern blinkenden Totenkopf auf dem Kragenspiegel seiner schwarzen Uniform. Nicht nach der Mode skeptisch verschämt oder mit achselzuckender Hochmütigkeit würde bei ihm vom Gott der Juden die Rede sein: Nun brauchte es ihn, und er existierte erst recht. Damit verspielte Thomas Mann in Deutschland sein letztes Prestige; ihm war es recht; Gott auch; und seine jüdischen Leser liebten ihn dafür desto mehr.
Allerdings kam man als Autor von solchem Ehrgeiz dem Schöpfer, der den Planeten mit bloßen Worten ins Leben gerufen hatte, auch am nächsten und durfte sich das Recht herausnehmen, hie und da mitzureden, wenn der Verfasser der Bibel etwas einsilbig zu Werke gegangen war. So ist der Joseph Thomas Manns nicht der Tugendbold aus der Heiligen Schrift: Ein Prachtexemplar von Jüngling zwar, himmelsäugig und belesen, hat sich der Siebzehnjährige seinen Charme freilich über den Kopf wachsen lassen und prahlt sich eine Zukunft als Auserwählter zurecht. Wofür ihn die Brüder an eine Händlerkarawane nach Ägypten verschachern, das sich unser Zierbengel nur als vulgäre Unterwelt vorzustellen vermag: Treibt man es hier nicht mit geschminkten Toten? Lassen sich Jungfrauen nicht zur Belustigung des Pöbels von einem Widder bespringen?
Trotzdem bestaunt Joseph die Ringmauern Askaluns, die Riesen aus den Felsen hervorgetürmt haben mußten, schultert Gazas köstlichen Wein, den zwei Kamele – nur nach außen hin gelassen – durch die Glutwüste schleppen, und hört lernwillig die Götterfabeln in der schwindelnd alten Metropole Memphis mit ihren breiten Sphinxalleen und scharfriechenden Rinnsteingassen, wo rippenmageres Volk fidel die Brauen hochzieht: Joseph tut es ihnen nach (das kann er) – und läßt mit beunruhigter Faszination von Station zu Station ein weiteres seiner Vorurteile zurück, bis er in Theben endlich zum Diener des emailleberingten Edelhöflings Potiphar avanciert, der um den Hals eine goldgefertigte Kette mit dem Skarabäus am Herzen trägt, Symbol der Sonne, des Lebens und Lichts, das Amulett gegen die Nacht.
Darum also gleißt Heliopolis über und über von Gold: Fortwährend tränen einem die Augen vor lauter hin- und herfunkelndem Sonnenlicht. Darum illuminieren Armeen von Öllampen und Fackeln das hunderttorige Theben, kaum fällt die Dämmerung über die Stadt. Täglich hemmt die blinde Riesenschlange Apophis die unterirdische Barkenfahrt des Sonnengottes Aton und bedroht damit die Welt, bis Tempelhüter das Wachsabbild der Schlange mit einem Feuersteinmesser zerhackt und verbrannt haben. Und wenn der Nil segensreich über die Ufer tritt, tun die Landeskinder bei ihren zahllosen Feierlichkeiten das ihre dazu: Sie zechen sich mit breiigem Bier durch die Fluchzeit der Finsternis, hüpfen vor Freude, wie es Sitte ist, auf einem Bein und sehen – so sie noch können – dem Maskenspiel der Priester zu. Darin zieht Apophis immer den kürzeren und schnaubt geknickten Hauptes davon. Und Joseph, mehr und mehr ein Ägypter, hüpft und trinkt schüchtern mit.
Längst hat er begriffen, daß es ihn in das Zauberreich ewig ersehnter Unsterblichkeit verschlagen hat, und diese Phantasieleistung ist uns nur einmal in der Geschichte so glaubhaft anschaulich geglückt: Der Tod war nicht Tod, sondern Krankheit und heilbar obendrein. Als Ägypter starben wir nicht – wir kamen davon. Wer nach dem Aussetzen des Herzens, gesalzen, mit Sägemehl gestopft und harzgetränktem Leinen umwickelt, in seiner Pyramidenkammer lag, die Krüge mit Leber, Lunge, Magen, Gedärm um sich geschart, hatte den höchsten Grad an Lebendigkeit erreicht. Frau und Kind, Bäcker und Brauer, Weinbauer und Töpfer, ein tanzwütiger Spaßzwerg, die junge Geliebte, der kostbare Silberschmuck und vertrautes Mobiliar füllten in Bildern und Hymnen die Wände der unterirdischen Pyramidenkammern bis an den Deckenrand aus und nahmen später leibhaftig Gestalt an. Schon zu Lebzeiten konnten wir in Listen verzeichnen, zu welchem Fest des Pharao wir als unsichtbare Wanderer zwischen Diesseits und Jenseits geladen sein wollten, und unsere Lieblingsspeisen reichte uns auf zierlichen Tischen eine Dienerschaft, die zudem in der Kochkunst die von drüben weit übertraf: Kranichstopfleber, Taubenragout, Honigkuchen, Feigenkompott und luftig aufgegangenes Brot in Tellern aus Bergkristall. Schlecht versorgt oder gar aus der ewigen Ruhe gerissen zu werden ziemte sich nicht, wie es Pharao Echnaton widerfuhr: Man strich ihn aus den Königslisten, zerschlug seine Statuen und Büsten, meißelte seinen Namen aus dem Stein der Monumente und entweihte sein Grab. Denn Echnaton hatte – mit Josephs Hilfe, so Thomas Mann – verkündet, daß alle Götter außer dem einen, wahren Gott Aton falsche Götter waren, zu denen von nun an auch das Ehepaar Isis und Osiris zählte, das einem sicher ins Jenseits half. Der Weg dorthin war den Ägyptern damit versperrt.
Wie verliebt Echnaton in seinen Einfall war, bekamen selbst Babylons Gesandte zu spüren, die er stundenlang in der Sonne stehen ließ, bis manche dem Hitzschlag erlagen, während er, mit dem länglichen Gesicht eines etwas blasierten Engländers, müde in seinen Kissen hing, und seine verbale Lobpreisung des einen Gottes fand solch meisterliche Extreme, daß einen das Gefühl beschlich, es würden ihm gleich Flügel wachsen, damit er zu seinem »Vater am Himmel« entflattern könne. Dieser Musensohn und Zärtling war eben kein Ramses, der bei seinen Schlachten barhäuptig in kraftvoll sinnverlorenen Metzelexzessen alles zusammendrosch, was nicht wie er selbst aussah, jedem Hinterhalt entrann, hundertdrei Kinder zeugte und das Volk unbesehen an all die Kleingötter glauben ließ, die die Sumpfgebiete überwacht und die Dämonen der Seuchen in Schach gehalten hatten: Seit Echnatons fixer Idee kamen ganze Rattenkolonnen ungehindert aus ihren Schlupflöchern und überrannten die Siedlungen, als gehörten sie ihnen allein. Als die Pest das Land überfiel, war Echnaton schuld daran: Bis in die fernen Regionen Nubiens hatte er die alten Tempel geschlossen und deren Papyri und Bildnisse zerstört. Kein liebender Schutzgeist griff den Steineklopfern mehr heimlich unter die Arme, wenn sie in der höllischen Heißluft versagten. Nur noch von der Sonne durfte man sich ein Bild machen, die einem ohnehin tagaus, tagein hochoben vor Augen stand. Und nachts war sie, noch immer, nicht da.
Mochte Aton später als Gott der Juden, Christen, Muslime eine verdienstvolle Karriere beschieden sein: den Ägyptern war er zu unhandlich, abstrakt, humorlos und hatte auch keine Geschichten zu bieten. Andernorts aber residierte ein launiger Gott, von dem es fast schon wieder zuviel zu erzählen gab, und der schuf die schönste Frau der Welt, um einen sagenschweren Krieg zu entfachen.
KAPITEL 3
WORIN DER LESER GANZE SCHIFFSLADUNGEN VON SCHIMPFWÖRTERN ERTRAGEN MUSS
Homer: »Ilias«
Troja, Westküste Anatoliens, 1250 v.Chr.
Man hätte diesen Unglücksknaben sofort steinigen sollen: Der Menschheit wäre dieser erste Krieg der Kriege erspart geblieben, der auch für seine Sieger eine totale Niederlage war. Hatten nicht schon die Frauen der Stadt Kiesel nach Paris geworfen, als er mit seiner Liebesbeute Helena und Kisten voll Geklunker gewohnt prahlerisch in die gepflasterten Straßen Trojas einzog und so die schwarzen, bauchigen Schiffe der Griechen übers Meer brachte, sechzigtausend Mann und mehr?
Der Oberbefehlshaber des trojanischen Heeres wünscht sich nichts sehnlicher, als daß Paris ins neblige Dunkel des Totenreichs Hades verschwinden möge: Hektor kann einfach nicht glauben, was für ein Drückeberger sein eigener Bruder ist. Mit seltener Wucht drängen die Griechen von der Küste her über die felsigen Hänge zu den Toren Trojas hoch, und Paris sitzt in den marmorn spiegelnden Hallen der Palastzitadelle und besieht mit stolzer Hingabe seine pedantisch verzierten Waffen, den bronzenen Brustpanzer, Bogen und Schild; Helena, wegen der die Griechen seit neun Sommern die Stadt bestürmen, überwacht selbstverloren die Webarbeiten des verängstigten Dienstpersonals. Zum Glück ist kein Maler zur Stelle, der die Szene auf einer Vase verewigt: Ohne Reue hätte ihn Hektor erwürgt.
Das faule Idyll läßt ihn an sein künftiges Schicksal denken: Er wird sterben müssen, weil Paris die von Zeus gesegnete Gastlichkeit mit Füßen trat und die Gemahlin des Spartakönigs Menelaos verschleppte, die sich der Weiberheld wie eine jener Hündinnen hält, die im sonnenstillen Winkel der Zitadelle vor sich hin schniefen. »Du heilloser Spinner«, bricht es aus Hektor hervor, »bummelst dumm herum, während vor den Mauern unsere Leute kämpfen und sterben?« Doch mit Strafpredigten kommt man einem Paris nicht bei, »du hast ja so recht, Hektor«, erwidert er lau. Nur Helena trauert. Warum hat sie bei der Überfahrt von Sparta nach Troja nicht den Mut gefunden, sich in den salzigen Fluten zu ertränken? Draußen ufert das Schlachten ins Unabsehbare aus.
Weshalb führen Männer Krieg? Helena, die einsamste und insgeheim klügste Gestalt der »Ilias«, weiß es nicht recht: der Ehre halber? Der Kampf um diese Ehre gewähre ihnen Nachruhm, sagen sie, und Nachruhm Unvergänglichkeit. Auch ist man, keine Frage, an die Familie und oft noch an Eide gebunden: Freundschaft verpflichtet. Doch weit greifbarer sind ihnen doch die geltungssichernden Dinge, die Purpurschleppe, die Axt aus Jade, des Nachbarn Weib. Von verzweifelter Schönheit, hat Helena im knarzenden Bett Paris stets zu Diensten zu sein, bis sie ihm zu alt oder er es leid geworden ist. Wir werden, schwören sich zur gleichen Zeit ungestüme Gesellen im griechischen Lager, erst befriedigt heimkehren können, wenn ein jeder mindestens eine Jungfer Trojas vergewaltigt hat. »Danach schlitzen wir«, hetzt ihr Kommandeur Agamemnon, »noch alle schwangeren Frauen auf«. Als es einst nach Troja ging und kein Lüftchen die Segel blähte, ließ Agamemnon für eine geballte Ladung Rückenwind seine Tochter auf einem Altar wie eine Opferkuh massakrieren – ohne den üblichen Schlag auf den Hinterkopf zur Betäubung davor.
Was zunächst wundersam auch seine Wirkung tut: Aus Arkadien, Salamis, Thessalien, Rhodos, Kreta, Aulis, Athen schwärmen die Griechen wie eine Flotte von Delphinen durchs Wasser, schrecken die unvorbereiteten Trojaner aus ihrer Pferdezucht hoch und richten sich am Strand samt Backstube und Waffendepot gemütlich ein, um die Stadt ein bißchen zu zerstören. Doch Troja bleibt, schwer ummauert, uneinnehmbar: Jahr für Jahr rennen die Griechen gegen die Festung an, plündern die umliegenden Inseln leer, beweisen ihren Kampfgeist auch untereinander tapfer in der Verlästerung ihrer Gaumenvorlieben, »Ihr Saumagenfresser!«, »Niederträchtiges Aalmaul!« – und bald macht das Witzwort die Runde, es sei bekömmlicher, sich von den Spartanern lebendig häuten zu lassen, als ihre lappigen Klebrigkeiten verdauen zu müssen. In diesem kleinen Vielvölkerstaat an Trojas Gestade kann man sich nicht einmal darauf einigen, ob in heißer Asche geröstete Zwiebeln die Manneskraft fördern und wieviel Honig, Ziegenkäse und Gerstenmehl man dem Wein von Lesbos – bekanntlich dem besten der Gegend – in den goldnietenbeschlagenen Kelchen beimengen muß. Im zehnten Jahr faulen die Taue und Balken der Schiffe, und die Krähen streiten sich frühmorgens im klumpigen Sand um Überbleibsel dieser lästig lärmenden Riesen: kümmerlicher Ertrag vom Tag zuvor, an dem wieder nichts entschieden worden ist.
Schließlich streckt eine Pestepidemie dermaßen pfeilgeschwind noch die Stärksten nieder, daß man auch in Troja den Gestank der wolkig rauchenden Leichenfeuer riechen kann, und als der kriegsentscheidend kostbarste Recke der Griechen, Achill, eine Sklavin an seinen suffköpfigen Kommandeur abgeben muß, verweigert er zürnend den Wehrdienst, will endlich nach Hause und verfällt leierumsäuselter Depression. Auf seine goldene Rüstung in der Ecke blickt er wie auf ein Spielzeug, dem er längst entwachsen ist. In schlafloser Sorge um den greisen Vater auf seiner Insel jenseits des Meeres, hat er mit feiner Urteilskraft als erster die Sinnlosigkeit auch dieses Krieges erkannt: Er wiegt den Wert seines Lebens nicht auf. Doch ist es immer leichter, einen Krieg zu beginnen, als ihn zu beenden: Von einem gebrochenen Waffenstillstand zum nächsten verfügt der Krieg rasch über seinen eigenen Willen, treibt gleich einer Mikrobenlegion durch unser Blut und schlummert in den heilenden Wunden, bis wir vergessen haben, worum wir eigentlich kämpften, und uns zuletzt nur Ehre und nochmals Ehre als Platzhalter bleibt.
Dieser Eigenwille des Krieges trägt bei Homer den Namen »Olymp«. Die tückische Brut der Götter dort droben hat nämlich vor lauter Unsterblichkeit Zeit zuhauf. Von ihrer Langeweile erschöpft, blicken sie, bald leidlich amüsiert, bald knapp vor tätiger Parteinahme atemlos hingerissen, auf das Schauspiel mörderischer Katzbalgereien herab, dem zu ihrem hellen Entsetzen plötzlich der Stillstand droht. Achill macht nicht mehr mit? Kein Trojafall ohne Achill. Also wird man Achill in den Gefechtseifer hurtig zurückzwingen müssen: Er soll unter den Trojanern aufs unterhaltsamste wüten, dann aber auch selber, an seiner legendären Ferse getroffen, elendig verröcheln. Doch so hatte Zeus den Krieg gerade nicht in Planung gegeben: Ursprünglich wollte er Großmutter Erde nur ein wenig von der Bürde überzähliger Menschheit entlasten, die schlechter als erhofft geraten war. Nun jammert es ihn, wie erbärmlich sie dort unten verendet, und Tränen aus Blut fallen wie ein letzter Regen aufs Land.
Auch Blitze schickt er mitunter hin und her und donnert gewaltig. Gleichwohl gilt er bei seinen himmlischen Kollegen als allzu hinhaltend selbstkritisch und kompromißbereit, als daß sie ihn nicht mir nichts, dir nichts hinters Licht führen wollen. Besonders seine Ehe mit Hera verdüstert den ewig zweiten Frühling seiner Seitensprünge und Trinkgelage bei Nektar und Ambrosia: Dieses »dumme Luder« – so sie über sich selbst – konspiriert unentwegt mit seinem Bruder Poseidon, der jetzt schnaubend mitten unter die Griechen tritt und sie mit frischer Schlagetotfreude beseelt. »Wer im Kampf heute nicht sein Bestes gibt«, brüllt Poseidon, »den werden die Hunde fressen!«, und was dieser Gott des Meeres doch alles vermag: Schon siehst du Troja in Flammen aufgehen, unbesiegbar bebt der Speer in deiner Faust, und du stichst ihn dem nächstbesten Trojaner durchs Auge, schneidest ihm mit neugeschärftem Erz ruckzuck den Kopf ab und hältst ihn an der Speerspitze triumphal der ganzen Feindesbande entgegen, und einem anderen bohrst du einen Pfeil durchs Schambein, der ihm die Hoden zerfetzt. Bei diesem munteren Treiben soll es auch bleiben: Hera streckt ihren ohnehin zerstreuten Gemahl erotisch nieder, besinnungslos sinkt er nach dem rauschenden Beischlaf in die Kissen und verpaßt, wie der Trojaner Hektor Achills liebsten Freund in Stücke haut. Dessen Pferde beweinen ihn starr und still, und Achill ergreift derart werwölfische Mordgier, daß sich der wirbelnde Strom Skamandros mit Toten füllt, mannshoch über die Ufer tritt und fleht und flucht: »Ich komme nicht mehr zum Meer, und du meuchelst einfach weiter? Hör endlich auf, du Widerling!« Und eine bislang harmlose Ulme, an die sich Achill klammert, klatscht krachend Beifall und sinkt mit der ganzen Böschung entwurzelt in den Fluß.
Nach einem Wettstreit wechselseitiger Schmähungen, »Feige Null!«, »Räudiger Köter!«, »Was redest du mal wieder für einen Schwachsinn daher, du blöder Ochse!«, treibt Achill Hektor seine Lanze durch die Kehle, und keiner der Griechen versäumt es, beim Vorübergehen mit seinem Schwert kichernd im Fleisch dieses Toten herumzusticheln, »Wie leicht unser Hektor jetzt nachgibt, schau einer mal an!« Erst als sein Vater nachts trauerkrumm in Achills Hütte schleicht und kniend um die Leiche Hektors bittet, ist Achill beschwichtigt und teilt mit ihm rosinengefülltes Brot und knusprig gebratenes Schaf. So krochen wir auch Weihnachten 1914 nach Christus unbewaffnet aus unseren Schützengräben und kamen auf dem Niemandsland des Schlachtfeldes über alle Sprachbarrieren hinweg freundschaftlich miteinander ins Gespräch, tauschten unsere Zigaretten und merkwürdigen Namen aus, sahen einander dabei in die Augen und suchten vergebens Böses darin. Dann wütet der Krieg zeitverquer wie ein Feuer fort.
Als soldatenunwürdige Feigheit hätte Achill die List des Odysseus abgetan, sich im Bauch eines Rosses aus Tannenholz zu verbergen, das die Trojaner zur Versöhnung der Götter in ihre Stadt karren, um nach einer Jubelfeier verkatert zum Bratspieß greifen zu müssen, als die Griechen das Tor der Zitadelle sprengen und – ehrenhaft, immer ehrenhaft – die Kinder und häßlich betagten Frauen niedermachen. Fünf Jahrhunderte später sah Homer Troja in Schutt und Trümmern vor sich, und kein siegesgemutes Geschwader fuhr dereinst bejubelt in die Heimathäfen ein: Durchs ganze Mittelmeer getrieben gelangten nur wenige Griechen nach Haus. Achill klagte im Hades, er wäre lieber der Ackerknecht eines Hungerleiders, statt die Ehre zu erdulden, Herr unter den nach Atem und Wärme lechzenden Toten zu sein. Agamemnon verblutete in seinem Badezimmer, in Vergeltung für den Altartod seiner Tochter, und manch anderer wurde, als er erfahren wollte, wie lange sein Leben noch währte, vor dem Orakel in Delphi erdolcht; Odysseus fand seine Insel von Putschisten besetzt und brach, als er vom Ende Trojas erzählte, das seine strategische Meisterleistung war, in Schluchzen aus. Spartakönig Menelaos verkümmerte im Gram über den Krieg – und die wiedergewonnene Gattin Helena mischte ihm Abend für Abend eine schlaffördernde Droge aus Ägypten in seinen Wein. Seither wächst man an Niederlagen nicht: Man stirbt daran. Doch seither fahren wir dennoch, Fackelzüge und verbrannte Erde als Endziel vor Augen, abenteuernd aus, und kommen, auch wenn wir heimkehren, nie mehr wirklich zurück.
Nur einer, Aeneas, entrann der brennenden Stadt, seinen Vater auf den Schultern, in die gebirgigen Wälder und baute, als der Himmel schwer war von Schnee, wie Noah ein Schiff, landete verirrt an der Mündung des Tiber und errichtete seiner Familie ein neues Troja, das spätere Rom; der griechische Philosoph Platon verbannte die »Ilias« aus seinem idealen Staat, einer Militärdiktatur; und nichts Erzählenswertes geschah offenbar in Europa, bis ein Konsul als neuer »Vater der Nation« vor dem römisches Senat bekräftigte, daß er der Nachfahre jenes Aeneas sei.
KAPITEL 4
WIE ES SICH ANFÜHLT, VON HÜHNERN REGIERT ZU WERDEN
Thornton Wilder: »Die Iden des März«
Rom, oberirdisch, 45 v.Chr.
Noch ehe die Hebamme mit gerötetem Gesicht die Wohnung seiner Eltern in Madison, Wisconsin, betreten hatte, war Thornton Wilder schon zur Welt gekommen, und wenn es ihn später ebenso rastlos von Ort zu Ort trieb, wanderte er dabei zugleich immer die Zeitalter der Menschheitsgeschichte ab: Ein Palmblattfächer in Singapur glich dem windstillen Federkranzschmuck einer Majestät der Maya in El Mirador, die beklommen einer kalendarisch verzwickten Prophetie der Priester lauschte, in Venedig erinnerten die Mauern der krummen Gassen winters bei zigarrenrauchdichtem Nebel an die Regale der qualmenden Bibliothek von Alexandria und ein vor Anker liegendes Schiff fernab an die Palastkirche Konstantinopels, die Hagia Sophia, ehe betrunkene venezianische Kreuzfahrer sie ihrer Schätze beraubten.
Gerade in den großen Städten Europas – und bald kannte Wilder sie alle – fanden sich viele Epochen in nur einem Prachtbau vereint. Im Pantheon Roms war wenig Phantasie vonnöten, um die Statuen der Jungfrau, der Märtyrer, Engel, Architekten, Päpste und Kardinäle in das üppige Chaos der älteren Gottheiten zurückverwandelt zu sehen. Nach zwei Jahrtausenden Christentum fiel mittags noch immer die Lichtsäule von der Himmelsöffnung der Kuppel aus heidnischer Vorvergangenheit auf den Boden aus Quarzporphyr, Marmor, Granit, während sich in der staubzermürbten Aprilhitze draußen junge Römer streitlustig durch den Ostersonntag tranken wie früher beim Weinfest zu Ehren Jupiters. Was gestern war, würde morgen gewesen sein.
»Wo treibt sich denn Thorny gerade herum?« sollte zu einem Scherz unter Thornton Wilders Schwestern werden, weil die Frage selten punktgenau zu beantworten war. Am leichtesten fiel »Thorny« die Arbeit eben in herbstlich verwaisten Kurpalästen, im grellgelben Kabinenlicht eines nervös hüstelnden Luxusdampfers und, warum nicht, auf dem feinledernen Rücksitz seines Automobils. Kaum war er in jenes Haus in Neuenglands Wäldern zurückgekehrt, das er der Familie aus den Einkünften seiner notorisch preisgekrönten Dramen und Romane errichtet hatte, warf seine Weltneugier wieder ihre Netze aus, »Wäre ich doch schon weg!« – und nachdem er 1945 aus dem Militärdienst entlassen worden war, sprang er in seinen Chrysler Convertible, raste auf unzuverlässigen Reifen nach Florida und hatte ein merkwürdiges Manuskript im Handgepäck, »Die Iden des März«: Dokumente aus den letzten Monaten der Römischen Republik, Staats- und Liebesbriefe, Spitzelberichte, Tagebuchblätter und Mauerinschriften, die Wilder mit derart übernatürlichem Scharfsinn und sakramentaler Sorgfalt erfand, daß er beim Eintrag in ein Gästebuch zuweilen verwundert innehielt und rätselte, wer er jetzt eigentlich sei.
Fieberhaft hatte er sich im Labyrinth der Lebensläufe Caesars, Catulls, Cleopatras verlaufen, und des Labyrinthes Mitte entdeckte er erst, als ihn zwischen den Ruinen der Halbinsel Yucatán die Erinnerung an die maisbierseligen Mayarituale wie Panik überfiel. Weil sich die Sonne bei ihrem nächtlichen Spurt durch die Nacht auszehrte wie ein Langstreckenläufer und Menschenblut brauchte, um wieder zu Kräften zu kommen, hatten sich Jungprinzen mit Rochennadeln aus ihrem Allerheiligsten, dem Penis, den götternährenden Saft gewonnen; Priester rissen eingefangenen Waldbewohnern das noch zuckende Herz aus dem Leib und kauten, die getrockneten Häute der Leichen auf den Schultern, die schmackhafteren Teile versonnen zu den balsamischen Zitronendüften des Copalweihrauchs – schauerliche Glanzleistung all jener abergläubischen Tolldreistigkeiten seit Menschengedenken, die auch den über fünfzigjährigen Gajus Julius Caesar in Wilders Roman in Rage bringen. Denn ihr erstes Opfer ist im Herbst 45 vor Christus allemal er selbst.
Was unseren Imperator in diesen Monaten auch nach drei Bechern wohlgereiften Falernerweins schlecht schlafen läßt. Sucht er, mit verächtlichem Blick auf die zierlich gekämmten Gärten der Reichen, in seiner Villa auf dem Palatinhügel um Mitternacht bei einer mottenumgeisterten Öllampe seine Gedanken schriftlich zu sammeln, hört er honigmosttrunkene Plebs vor einem verrußten Bordell in der Subura zanken und dabei seinen Namen rufen wie bei der Beschwörung fremder Gottheiten, deren Sudelzeremonien beizuwohnen er seiner Frau verboten hat. Seine Mutter empfing ihn, heißt es, von einem Blitzstrahl und gebar ihn durchs Ohr. Oft baten ihn Bauern entlang der Via Appia, seinen Fuß auf ihre weniger fruchtbaren Felder zu setzen; als man die Gebrechlichen, »Husch, husch«, von den angeblich heilsamen Mauern seines Hauses vertrieben hatte – worauf sie zunächst erzürnt den Mittelfinger zeigten –, machten sie es sich seufzend bequem unter seinen schrillfarbenen Statuen. Einem noch recht rüstigen Fanatiker gelang es gar, in seine Gemächer vorzudringen: Gleich einem Attentäter den Dolch in den Falten seiner Toga verborgen, wollte er Caesar »nur ein heiligendes Blutströpfchen« für jene Phiolen abluchsen, die in Mysterienzirkeln der Stadt zu kursieren scheinen wie Caesars magischer Harn, den die Dienerschaft nebst Schnipseln seiner Zehennägel und Barthaare in der Subura für Unsummen verschachert. Als ihn die Wachen überraschten, flehte der Verrückte Caesar verzückt an, er möge von seiner Hand geschlachtet werden.
Warum müssen die Auguren eigentlich nicht laut auflachen, wenn sie einander über den Weg laufen? Täglich belästigen Caesar an die fünfzehn Berichte über den unsicheren Flug eines Adlers hier, über die unheilkündende Taubenniere dort, »die noch eingehender zu untersuchen sein wird«. Nach dem Morgenappetit von Vögeln – die man, wie jeder weiß, durch eine gezielte Nulldiät zu seinen Gunsten bestechen kann – bestimmen die Auguren, ob eine Schlacht zu schlagen oder zu verschieben sei: Caesar regiert Millionen, wird aber selbst von Hühnern beherrscht. Das Orakelunwesen schließt über Wochen die Tore des Senats. Manch einer bleibt morgens im Bett, wenn er von der Zahl Siebzehn geträumt zu haben glaubt; ein zweiter ersieht aus dem faulen Gekröse eines Widders, daß bis auf weiteres gegen jeden Senatsentscheid ein Veto eingelegt werden muß. Mit den anderen Feinden des Tatendrangs könnte Caesar sich abfinden: mit der schlappen Intrigenspinnerei einer Clodia Pulcher, die ihren Zeitgenossen jedes selbsterworbene Glück mißgönnt; mit dem Juden- und Frauenhaß und strafbanksauren Jubel des Rhetorikgimpels Cicero auf »die Republik«, an deren Spitze er sich vorab selber wähnt; mit diesem herumklügelnden »Demokraten« Marcus Brutus, der um der Rassereinheit willen Ausländern bereits gewährte Bürgerrechte wieder entziehen will; auch mit Cleopatra, die ihm für seine Glatze ein Haarwuchsmittel aus zermahlten Pferdezähnen, Wildmark und Bärenfett anrühren läßt, das seiner Eitelkeit so gar nicht schmeichelt und überdies erbärmlich juckt.
Doch ein Taumel frömmelnden Wahns hat die ganze Stadt erfaßt, der die Teilnahmslosigkeit adelt: Noch die obersten Ränge schleppen ihr gescheitertes Stegreifleben hinter sich her, klagen dafür »das lauernde Schicksal« an und erblicken in bösen Omen am schauernden Himmel den Untergang des Imperiums. Sie nehmen hin und geben nichts. Wie sterbensmüde ist Caesar in diesen Monaten darüber geworden, daß sich selbst enge Vertraute Schlager trällernd – »Sag nicht nein, kleine Belgierin« – an ihre Gastmähler vergeuden, gefüllte Sauzitzen, vor Fett triefende Murmeltiere, feigengemästete Gänse, Pfauenzungenragout und laute Pausen dazwischen. Noch während sich Cleopatra auf ihrer Flotte Richtung Rom durchs Mittelmeer fächeln ließ, gerieten sie sich in die Perückenhaare ob der Frage, was exquisiter schmeckt: die afrikanische Schnecke oder der Fangschneckenkrebs. Die Ruder- und Brettspielclubs halten schon ihr bißchen japsendes Kraulen durch den Tiber für einen Staatsakt. Was ist zu tun? Würde Caesar alle Kulte und Feiern untersagen, wäre Rom verzagt wie eine Schafherde bei einem Sturm aus britannischem Eis.