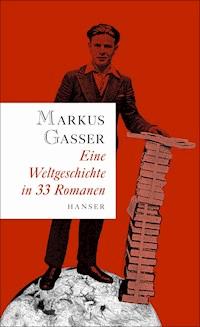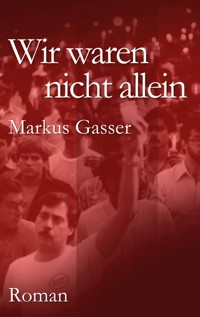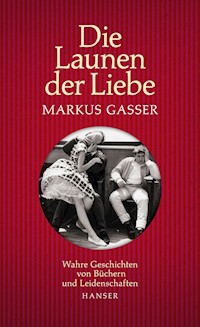17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die brillante Unternehmerin Lillian Cutting ist so erfolgreich und unabhängig, wie es eine Frau um 1880 nur sein kann. Auf ihrem eigensinnigen Weg nach oben hat sie gegen alle gesellschaftlichen Konventionen verstoßen und ganz New York gegen sich aufgebracht. Dort ist man sich einig: Diese Frau muss verschwinden. Ein für alle Mal. Koste es, was es wolle. Dabei hätten alle damit rechnen können, dass Lil ihre Freiheit, ihre Würde und ihr Vermögen niemals opfern würde. Und als es so weit kommt, dass es um ihr nacktes Überleben geht, dreht "Lil the Kill" den Spieß um. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung im New York um 1880, nicht nur unter den herrschenden Familien der Stadt, den Belmorals und Vandermeers: Lange Zeit hat die Eisenbahnmagnatin Lillian Cutting, an der Seite ihres loyalen Mannes Chev, mit ihrem exzentrischen Führungsstil noch die kühnsten Spekulanten überflügelt. Und sich mächtige Feinde gemacht. So scheint es ihrem Sohn Robert nach Chevs Tod ein Leichtes, Lillian mit Hilfe eines sendungsbewussten Psychiaters zu entmündigen und in eine geschlossene Anstalt wegsperren zu lassen. Aber Lil nimmt den Kampf auf - gegen eine Gesellschaft, die Eigensinn als Krankheit denunziert. Rasant, komisch und unerschrocken schildert Markus Gasser, wie eine furchtlose Frau an ihren hochmütigen Peinigern fantasievoll Rache nimmt. «Lil» ist eine universelle Geschichte voller Zorn und Trost über die Jagd nach dem großen Geld, listige Söhne und unversöhnliche Töchter, das Recht auf den eigenen Lebensentwurf und über Machtkämpfe, wie wir sie heute noch führen - erzählt von Lils Nachfahrin Sarah, die mit den verfänglichen Methoden der Psychiatrie noch eine ganz persönliche Rechnung offen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Markus Gasser
LIL
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Sie ist eine Ausnahmeerscheinung im New York um 1880, nicht nur unter den herrschenden Familien der Stadt, den Belmorals und Vandermeers: Lange Zeit hat die Eisenbahnmagnatin Lillian Cutting, an der Seite ihres loyalen Mannes Chev, mit ihrem exzentrischen Führungsstil noch die kühnsten Spekulanten überflügelt. Und sich mächtige Feinde gemacht. So scheint es ihrem Sohn Robert nach Chevs Tod ein Leichtes, Lillian mit Hilfe eines sendungsbewussten Psychiaters zu entmündigen und in eine geschlossene Anstalt wegsperren zu lassen. Aber Lil nimmt den Kampf auf − gegen eine Gesellschaft, die Eigensinn als Krankheit denunziert.
Rasant, komisch und unerschrocken schildert Markus Gasser, wie eine furchtlose Frau an ihren hochmütigen Peinigern fantasievoll Rache nimmt. «Lil» ist eine universelle Geschichte voller Zorn und Trost über die Jagd nach dem großen Geld, listige Söhne und unversöhnliche Töchter, das Recht auf den eigenen Lebensentwurf und über Machtkämpfe, wie wir sie heute noch führen − erzählt von Lils Nachfahrin Sarah, die mit den verfänglichen Methoden der Psychiatrie noch eine ganz persönliche Rechnung offen hat.
Über den Autor
Markus Gasser ist Essayist, Autor zahlreicher Bücher, Universitätsdozent und Schöpfer des beliebten YouTube-Kanals «Literatur Ist Alles». Bei C.H.Beck erschien 2022 sein Roman «Die Verschwörung der Krähen».
Inhalt
1: Die Frau aus Chicago
2: Insel der Hoffnung
3: Freaks
4: Die Wahrheit über Einhörner
5: Lil the Kill
6: Glass House
7: Der Feenkönig
Ich musste dich treffen:mitten ins Herz.So hast du es verdient.
Medea
1
Die Frau aus Chicago
ICH DENKE NICHT MEHR AN SELBSTMORD seit jenem Morgen, an dem mich mein Chefredakteur Torri del Benaco um zehn Uhr siebzehn mit der Nachricht weckte: «Sarah! Sie haben ihn.»
«Ah ja? Wen denn?», fragte ich, mürrisch und kraftlos, «Jack the Ripper? Donald Trump?»
In jenem Sommer 2017 war ich, nach Operation und Strahlentherapie, von meinem Job als Journalistin beim Wall Street Journal beurlaubt. Ich lag mit Fieber zu Hause in meinem Apartment im Greenwich Village, ein Kühlkissen auf meine brennenden Augen gepresst, trottete vom Schlafzimmer zur Toilette und wieder zurück, wünschte mir keinen nächsten Sommer und wurde nie wirklich wach.
Jetzt war ich es: Das Krankenhaus der Cutting Foundation im Norden Manhattans − einst eine Nervenklinik − sollte in ein Luxushotel verwandelt werden, und beim Ausräumen des Hauptgebäudes hatte ein Arbeiter im Bauschutt der tiefen Keller, zwischen verfaulten Matratzen und zerbrochenen Aktenschränken, jenen Brief Lillian Cuttings gefunden, der im April 1880 an die Anwältin Colby Sandberg adressiert, dann aber nicht abgeschickt worden war.
Warum nicht? Das wusste ich.
Der gehetzte Torri, der sogar nachts durch Dutzende Telefonate schlingert, sagte nur noch: «Sarah, fahr sofort rauf … wenn du das schaffst. Vielleicht hilft es dir.»
Es half. Lange hatte eine meiner Tanten die Briefe, Tagebücher, Prozessakten der Cuttings und Sandbergs unter Verschluss gehalten, weil sie einen weiteren Skandal fürchtete, so als wären jene Briefe, Tagebücher, Aktenbündel ein böses Familiengeheimnis − was sie natürlich auch sind. Nach dem Bankrott jener Tante, die mit ihren achtundachtzig ebenso verzagt durch die Welt wankt wie in den achtundachtzig Jahren zuvor, gingen die Briefe, Tagebücher, Akten endlich in meinen Besitz über. Aber dieser eine Brief Lil Cuttings an Colby Sandberg, ein schief beschriebenes Blatt voller Angst und Zorn, war das letzte, erschütternde Dokument, das mir zu dieser Geschichte gefehlt hatte.
Jetzt bin ich sie uns schuldig.
«Sie ist ja auch verdammt typisch für euch Menschen», meint Miss Brontë.
Und sie hat recht. Es ist nur aus Zufall die Geschichte meiner Familie, der Cuttings, die Leute tragen darin nur zufällig englische Namen, sie hätte sich ebenso gut in Berlin oder Baden, Paris oder Prag, Wien oder Warschau zutragen können. Doch tut sie mir weh. Ich grabe sie aus, um sie für mich zu begraben. Ich blicke zurück, um nicht nach vorne blicken zu müssen. Danach muss ich weit, weit weg, wie Chev Cutting, der nach einem Streit mit Robert oft zu seiner Lil sagte: «Es wird Zeit für unsere Inseln.»
Die Affäre um das Ehepaar Chev und Lillian Cutting und ihren Sohn Robert kann noch heute, in unserem an Skandalen ja nicht gerade armen Jahrhundert, jeden fröhlichen Abend vermasseln. Wir debattieren über korrupte Banken, schamanische Fernheilung, Frauen in Chefetagen und ob es eine gute Sache sei, reich und berühmt zu werden, indem man ohne Kompromiss tut, was man tun will.
Bis unweigerlich der Name Cutting fällt.
«Die macht sich wichtig wie Lillian Cutting», sagen die einen − «Also für mich ist Lillian Cutting eine Heldin», die anderen.
«Das meinst du nicht ernst! Die hatte keine Ideale, bloß Aktien. Die war doch krank. Wer bitte ruiniert seinen eigenen Sohn?»
«Wäre Lil ein Mann gewesen, würdest du in deiner Wortwahl vorsichtiger sein.»
«Jetzt geht das wieder los.»
«Was bitte ist ‹das›?»
Und schon ist der Abend im Eimer.
Doch sie alle erinnern sich der Familie Cutting nur im Groben, mit Schaudern, Bewunderung und Amüsement. Wie entsetzt wären sie, wenn man ihnen die ganze Geschichte servieren würde. Sie brächten für eine Weile kein Wort mehr heraus.
Allgemein bekannt ist, dass die Millionenerbin Lillian Cutting um 1880 mit ihren exzentrischen Investitionen ganz New York in besorgtes Erstaunen versetzte. Sie mehrte ihr Vermögen nach einer Logik, die den Experten verrückt und selbst dem Börsenprofi John D. Rockefeller wie Schwarze Magie vorkam − zum Trost ließ sie ihn beim Billard, gekonnt unauffällig, jedes Mal gewinnen. Nach einem ihrer Big Deals folgte ihr eine ganze Entourage von Fotografen bei Windstärke neun auf die Fähre nach Brooklyn Heights, mit ihren schweren, vom Flugwasser salzfleckig gewordenen Kameras. Lillian Cutting wäre lieber mit Kieseln in jedem Schuh von einer Vorstandssitzung zur nächsten gehumpelt, als ein verlängertes Wochenende in einem Strandhotel zu verbringen, die nackten Zehen im warmen Sand. Sie konnte fast jeden umstimmen, mit einer Gefälligkeit hier, einer gezielt verhaltenen Drohgebärde dort.
So weit die Legende über Lillian Cutting, meine Großmutter mit vierfachem «Ur-» vorneweg, und da ist, wie bei allen Legenden, natürlich etwas dran. Doch sie verschweigt, dass es in den meisten Kreisen der obersten Ränge New Yorks als äußerst unfein galt, auch nur Lils Namen zu nennen. Sie beleidige, sagte man dort, jeden Sinn für Proportion, Anstand, Geschmack, und jene obersten Ränge meinten damit, dass sich Lillian Cutting ein Leben anmaßte, das ihr als Frau nicht zustand. Sie weigerte sich auch ganz offen, zu ihnen zu gehören, zu den Erlauchten Vierhundert, die bei allen wirklich wichtigen Fragen den Ton angaben − bei der richtigen Anreihung des Tafelsilbers für ein Bankett, der richtigen Speisenfolge (den Fisch mit Gurken bitte-sehr vor der gebratenen Ente an Brombeergelee, nicht andersherum), der richtigen Sitzordnung bei Direktorenkonferenzen: Fragen, die Lillian Cutting schlicht idiotisch fand, und sie sprach es auch offen aus. Sie war ein Mensch, den man nicht so leicht einschüchtern und mürbe machen konnte.
Bis man es konnte.
Lil war «Lillian Billion», «Lil the Kill» und «Cutting Lil». Die Erlauchten Vierhundert rühmten sich, in Chev Cutting den brillantesten Augenarzt des Landes zu besitzen, und sie konsultierten ihn alle. Dennoch, und obwohl er bis ins hohe Alter verknallt in Lil war wie ein Teenager, blieb sie immer «das geniale Miststück», das irgendwie jeder weghaben wollte. So überraschte es selbst die ahnungslosesten Schoßhündchen nicht, als ihre Herrchen und Frauchen Lillian Cutting mit offener Schadenfreude niedermachten, kaum dass Chev gestorben war und sich ihnen der Stoff dafür bot.
Wären die Erlauchten Vierhundert damals nicht derart aus der Fassung geraten − wie viel Elend und Peinlichkeit hätten sie sich erspart. Mancher wäre nicht vom Balkon gestürzt oder spurlos verschwunden, manch anderer hätte sich nicht die Pulsadern geöffnet, und niemand wäre, ganz zuletzt, in New Mexico lebendig begraben worden. Aber schlauer ist man im Nachhinein immer. Niemand weiß das besser als ich. Die Narbe an meinem Kopf erinnert mich täglich daran.
Mit knapp vierzig Jahren bin ich in den Augen meiner kleinen Nichten bereits «ein altes Reptil». Das hat was: Meist fühle ich mich wie achtzigeinhalb. Mir ist oft schwummrig, es flimmert mir vor den Augen, ich werde schwach und schwer und fürchte dann, es geht wieder los. Es gibt Tage, da dusche ich bis zu dreimal für den Fall, dass ich plötzlich tot umfalle: Wer würde sich gern verschwitzt und schmutzig von einem Leichenwäscher begrapschen lassen wie von diesem Typen aus dem Nobelbestattungsinstitut nebenan mit seinem «Dich-krieg-ich-auch-noch»-Lächeln? Ich schlafe wenig und dann schlecht. Aber statt wie früher in ein Rotweinglas zu heulen, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, lange vor Anbruch des Tages durch die Stadt zu streifen, ganz altmodisch zu Fuß und bei jeder Witterung. Dabei male ich mir aus, was die Leute vor vielen Jahrzehnten in den Straßen New Yorks umgetrieben haben mag, auch sie zu Fuß und bei jeder Witterung. Und ich stelle mir vor, wie die Wölfe in einer Winternacht zurückkehren werden wie damals, als sich ein Rudel aus Kanada im Central Park niederließ, 1880, in Lils ärgstem Jahr.
So treibe ich mir die Panik aus.
Der letzte Mülltruck faucht um die Ecke wie ein uralter Drache, der sich endlich schlafen legen will. Hin und wieder weicht mir einer dieser heldenhaften Wall-Street-Jogger aus und grüßt nicht zurück − offenbar existiere ich gar nicht mehr. Hin und wieder hebe ich behutsam eine Raupe auf, die sich über die Asphaltritzen müht, und setze sie auf das Blatt eines Zitronenbaums − bald wird sie sich als Roter Admiral entpuppen, der bei starken Winden in großen Höhen bis nach Island fliegt. Hin und wieder begehe ich einen verzeihlichen kleinen Mord an einem Taxifahrer, dessen einziger Lebenssinn darin besteht, fast den Bordstein zu streifen, um mich mit Schmutz zu bespritzen − nur ein zärtlicher Rasiermesserschnitt und nur in Gedanken natürlich; Spaß macht es trotzdem.
Mich beleben vor allem jene Teile der Stadt, wo Manhattan so aussieht, wie ich empfinde, wo es sich unbeherrscht an sein starres Schachbrettmuster nicht halten will − die Viertel im West Village etwa, Commerce Street zwischen Bedford und Barrow. Dort verirrt man sich leicht; dort verbergen sich weite Innenhöfe, kleine Kirchen und Kneipen, von denen selbst altgediente New Yorker behaupten, dass es sie nie gegeben hat. Eifersüchtig behüte ich diese Welt. Sie gehört mir, ich zu ihr, hier bin ich daheim zwischen Nacht und Traum, und aus Prinzip sind es stets auch andere Winkel und Gassen, die ich mit meinem Dobermann Miss Brontë unsicher mache. Doch kaum spüre ich den Sonnenaufgang, der nach Regen riecht und Neubeginn, finde ich mich immer vor jenem Haus am Washington Square Nummer sieben wieder, das Colby Sandberg und ihr Mann Jay 1880 gerade gekauft hatten. Colby und Jay Sandberg nämlich waren es, die die Sache mit Lil Cutting ins Rollen brachten, bis sie sich zu jenem Riesenskandal auswuchs, der das Leben so vieler ins Chaos stürzte.
Das albtraumhafte Gerümpel des Vorbesitzers − verrenkte Elfenbeinfigürchen und Wandteppiche, die mit dem Weltuntergang drohten − räumten unsere Sandbergs erst gar nicht aus. Für innenarchitektonische Tüfteleien fehlte ihnen die Zeit. Ihre Kanzlei lief auf Hochtouren und war eine der ersten, die ein Telefon besaßen. Wenn es zu Scheidungen kam, konnte sich in jenem guten, alten New York nur der, der zu Hause die Hosen anhatte, einen ordentlichen Anwalt leisten, und die Sandbergs vertraten vor Gericht mit herber Hingabe die weibliche Gegenpartei. Sie schlugen bei den Prozessen derart hohe Summen für ihre Klientinnen heraus, dass sie auch selbst bestens davon leben konnten. So bildeten Jay und Maxine Colbert Sandberg − «Colby» für ihre Freunde − das Schreckenspaar aller feinen Clubs in New York, in denen nur Männer zugelassen waren: Jay Sandberg war für die Konservativen in jenen Clubs «der Zickenadvokat», Colby Sandberg, seine Beraterin, Assistentin, angeblich noch fanatischer als er. Die versessenen Judengegner unter ihnen sagten gern, es sei typisch für «dieses raffgierige Volk», dass sogar die Frauen aus dem privaten Elend anderer ihren Profit schlagen wollten.
«Man wechselte sogar die Straßenseite, wenn man die Sandbergs von fern erkannt hat», ergänzt Miss Brontë.
«Du erinnerst dich tatsächlich, was ich dir über die beiden erzählt habe?»
Miss Brontë macht es sich auf dem Trottoir vor dem Haus bequem, legt den Kopf auf die rechte Pfote und erwidert: «Natürlich. Hört man aber immer wieder gern. Nur lass diesmal die elendslange Beschreibung des Balles weg.»
Also, Miss Brontë, weil du es bist: Am Morgen des ersten April 1880, einem Donnerstag, nicht lange nach dem grotesken Frühlingsball der Vandermeers − «Danke!», brummelt Miss Brontë −, machte der Besuch einer seltsamen Fremden aus Chicago Colby Sandberg noch unruhiger, als sie es ohnehin schon war.
Unruhig war sie, weil das Höchstgericht unseres umsichtigen Staates New York den Antrag Colbys abgelehnt hatte, als selbstständige Anwältin tätig zu sein, und zwar mit der Begründung, dass die naturgegebene Zartheit des weiblichen Geschlechts dasselbige zum Ersten − und erwiesenermaßen − für alle Obliegenheiten des öffentlichen Lebens untauglich mache; und dass zum Zweiten − ebenfalls erwiesenermaßen und nach dem Willen Gottes, unseres Schöpfers − die Berufung der Frau sich darin erfülle, den edlen Dienst als Gattin und Mutter auszuüben. Fürderhin sei die weibliche Empfindsamkeit den drastischen Fällen, mit denen sich die Justiz oft konfrontiert sehe, einfach nicht gewachsen.
«In dieser Begründung steht so viel ungedruckter Dreck, dass man das Gedruckte gar nicht entziffern kann», sagte Jay Sandberg und zuckte erregt mit den Augenbrauen. Er war ein Wutausbruch auf zwei Beinen, selbst wenn er schlief. «Warum zitieren sie nicht gleich diesen Goethe, als er schon völlig plemplem war und meinte, es sei doch unglaublich, wie der Umgang mit den Weibern uns Männer herabzieht. Wenn wir Maxine Colbert Sandberg als Anwältin zulassen − denn genau das, Colby, genau das ist hier eigentlich zu lesen! −, dann kommt ein Amazonenheer von Colby Sandbergs auf die gleiche Idee und besetzt am Schluss die Ränge des Höchstgerichts. Das Holz in unserem Kamin würde sich weigern, in Gesellschaft dieses Wischs zu verbrennen.»
«Dieser Wisch ist aber, erwiesenermaßen, das Gesetz unseres Herrn», grollte Colby, verbarrikadierte sich im Haus und aß vier Tage lang nichts.
In allerletzter Instanz jedoch hatte das Höchstgericht der Vereinigten Staaten das Sagen in der Sache, und dessen Entscheidung stand noch aus. In diesen Tagen ließ der Schlaf Colby im Stich. Jeder Versuch, sich frühmorgens mit ihrem Charles Dickens in traumlose Erschöpfung zu lesen, schlug fehl, und so erwartete sie auf ihrem Grübelsofa im dritten Stock mit glasigem Blick den Tagesanbruch und ihre böhmische Köchin.
Die sieben Herren des Höchstgerichts, die über Colbys Antrag zu befinden hatten, schnarchten noch, als die Sonne an jenem Morgen des ersten April 1880 ihre gemütliche Runde um den Washington Square begann. Bienen begutachteten die Blüten des Kirschbaums. Colby war gerade dabei, im Morgenmantel und mit einem zerfransten Strohhut in den blauschwarzen Haarschopf gedrückt, auf der Veranda die kostbaren Kletterrosen ihres Mannes mehr zu misshandeln als zu stutzen. Colby mochte Rosen nicht sonderlich − so, wie sie Blumen aller Art nicht sonderlich mochte (mit Dornen oder ohne, egal), Tapeten mit Muster, Zigarrenrauch, Grüntee und unangemeldeten Besuch. Aber da stand er, ihr unangemeldeter Besuch, so plötzlich, als wäre er vom Dach herabgeflogen, in Gestalt einer Miss Emma Golding, schlicht, ernst, hochgewachsen, mit einem kleinen Muttermal an der Oberlippe, und ließ nach kurzer Begrüßung einen derart verwickelten Roman vom Stapel, dass Colby bald nicht mehr hinhörte − bis Miss Golding ihren Roman mit dem Namen Robert Cutting beschloss.
Colby ließ die Schere sinken. Die Rosen atmeten erleichtert auf. «Die hat sie doch nicht alle», stöhnte eine, «mir hat sie fünf Fiederblättchen wegmassakriert.» Einer anderen hatte Colby − bekanntlich besonders schmerzhaft − die Sprossachse gekrümmt.
«Na dann, Miss Golding, kommen Sie doch mal rein und erzählen alles der Reihe nach. Ich hoffe, Sie mögen keinen Grüntee. Also, was hat Robert Cutting Ihnen genau angetan?»
Er hatte sie vergewaltigt.
Was unerträglich gewesen sei, auch eines chirurgischen Eingriffs wegen … − Miss Golding drückte einen Daumen gegen ihre Stirn, als hätte sie Kopfschmerzen − … den er … nun: «très charmant» fand. Er hatte ihr gleich danach gesagt, sie hätte es doch darauf angelegt, sich doch kaum gewehrt − hatte im selben Moment aber erkannt, dass schon diese Bemerkung, «kaum gewehrt» (in Wahrheit hatte sie ihm mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen), auf ein Bekenntnis hinauslief, sie vergewaltigt zu haben. Aber sie hätte eben so ihre Art mit den Männern, und irgendwie lustig gewesen sei es doch, sich ein bisschen durchs Hotelzimmer jagen zu lassen und danebenzubenehmen − oder nicht? Dann fiel ihm ein, dass dies zumindest für sie so nun auch wieder nicht so recht stimmte, und er versprach ihr «eine Art Schmerzensgeld». Doch war er jedes Mal, wenn sie in seiner Bank auftauchte, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen, nicht zu sprechen gewesen, irgendwo in den Staaten unterwegs − so unauffindbar wie seine Mutter Lillian Cutting, die sich neuerdings strikt weigerte, seine Schulden zu begleichen.
Colby war übel. Sie schluckte, stand auf, tapste um den Küchentisch herum. Der Boden unter ihr wankte wie ein Schiffsdeck. Ihr Blick irrte einer jungen Wespe an der Decke hinterher.
«Ach ja, Lil! Ich kenne Lillian Cutting von früher her», sagte sie lahm, um ihr Entsetzen zu überspielen, «aber von der habe ich seit Monaten nichts mehr gehört. Sie erholt sich, heißt es, gerade von einer kleinen Verstimmung im Sanatorium des großen Doktor Matthew Fairwell. Seit dem Tod ihres Mannes hat sie eben ihre … Aber über Lillian Cutting hat man sich doch immer die seltsamsten Geschichten erzählt. Gewisse Kreise reden natürlich gleich von Zusammenbruch und Wahnsinn im Frühstadium und was-sonst-noch. Wahrscheinlich Unfug, doch darüber maße ich mir kein Urteil an, dafür kenne ich sie nicht gut genug.»
«Und das ist alles, was dir dazu einfällt, du dummes Ding?», fragten die ruhigen Augen Miss Goldings.
«Darf ich mich setzen?», fragte Colby zurück, Miss Golding streckte ihre Rechte aus, was besagte: «Aber bitte sehr. Ist ja dein Haus, und Stühle gibt’s hier genug.»
«Ich weiß nicht, weiß einfach nicht», Colby sammelte sich, «was ich dazu sagen soll. Soll ich was sagen? Mir fällt nichts ein. Mir fällt immer was ein. Ich habe in meinem Leben schon so viele Fälle mit Jay durchgeackert, aber nicht das. Das gibt es nicht. Darüber spricht kein Mensch.»
Miss Golding nickte leicht.
«Zuerst rede ich mit Lil», entschied Colby, «dafür kenne ich sie denn doch gut genug. Sie will sich um Roberts Finanzen nicht mehr kümmern, einverstanden, aber was Robert Ihnen angetan hat, das geht Lillian Cutting weiß Gott etwas an. Ich werde mich darum kümmern, mein Ehrenwort», und nachdem sich Miss Emma Golding mit einem geflüsterten «Tausend Dank» verabschiedet hatte, zog sich Colby eilends um und trat auf die Veranda hinaus.
«Meine Rosen haben mit dir ja ganz schön was durchmachen müssen», sagte Jay, die Pranken in seine Hüftpolster gestemmt.
«Rosen, hm?» Colby hielt Jay die Visitenkarte des Hotels vor die Nase, in dem Emma Golding abgestiegen war. Auf der Rückseite stand die Adresse der Sandbergs und darüber mit blassblauer Tinte ihr eigener Name, «Emma Golding»; ihre Anschrift in Chicago war bis zur Unleserlichkeit verwischt.
Jay schwieg noch wie eine Statue, als Colby längst mit ihrer Erzählung fertig war.
«Das ist sehr, sehr schlimm, aber was sag ich!», Jay massierte seine geröteten Augenlider, «und es überrascht mich trotzdem. Ist dir diese Miss Golding vertrauenswürdig vorgekommen? Robert war doch immer ein anständiger Kerl. Etwas schwierig, nun gut, das gebe ich zu. Wie es bei einem Kind von Chev und Lil kaum anders zu erwarten ist.»
«Sieh doch einer an.» Colby schniefte verächtlich. «Als wäre Robert das Opfer. Miss Golding ist es, nicht er, schon vergessen? Oder geht unser Herr Frauenanwalt mit seinen Geschlechtsgenossen gerade in Verteidigungsstellung?»
«Bleiben wir nüchtern», erwiderte Jay. «Vor Gericht können wir damit jedenfalls nicht. Vielleicht interessiert sich die Presse dafür. Aber wenn Robert Cutting es so weit getrieben hat, wie Miss Golding behauptet, wäre der Ruf der Cuttings endgültig dahin. Und Lil wird schon wissen, was da zu tun ist. Wir sind es ihr schuldig, dass sie davon erfährt.»
«Jetzt tust du so, als ob wir ihre besten Freunde wären.»
«Du hast dieselbe Schule besucht wie sie, das genügt. Nur dein vermaledeiter Stolz hat es bislang nicht zugelassen, Lil um einen Gefallen zu bitten. Niemand kann sich leichter dafür einsetzen, dass vier von den sieben Höchstrichtern zu deinen Gunsten stimmen.»
«Wegen mir? Es geht um Emma Golding aus Chicago, nicht um mich. Wegen mir fahre ich bestimmt nicht zu Lil nach Hops Island, in diese Irrenkolonie, du … −»
Jay umarmte Colby so potzblitz und liebevoll wie ein Bär seinen Lieblingsbaum: «Waffenstillstand, ja? Zugegeben und verflucht noch mal, ich bin manchmal wirklich ein ignoranter Stinkwurm» − und eine treffendere Bezeichnung wäre Colby in diesem Moment auch nicht eingefallen.
«Und die Frau aus Chicago», gähnt Miss Brontë, «hatte erreicht, was sie wohl erreichen wollte. Wann gibt es Frühstück?»
«Geduld, ich brauche nicht mehr lang.»
«Das bezweifelt man doch sehr.»
Ganz schön frech, die Gute. Um sie zu ärgern, zünde ich mir meine Morgenzigarette an, die immer wieder wie die erste meines Lebens schmeckt, nach Herbst und ein bisschen Feuer − zu wenig, um irgendetwas damit abzufackeln.
Miss Brontë zieht vorwurfsvoll die Augenbrauen hoch.
«Und da fürchtet sich unsere Sarah Cutting vor der Rückkehr ihres Hirntumors», grummelt sie.
Ich trete die Zigarette auf dem Bordstein aus.
«Willst du wirklich, dass dein Frühstück flachfällt? Reis mit Hühnerbrust samt Leber und Pansenstreifen obendrauf? … Na denn.»
Mit dem Sanatorium Hops Island hatte sich Doktor Matthew Fairwell sechs Jahre zuvor einen Lebenstraum erfüllt, dank seines Mäzens Andrew Carnegie und anderer Gönner, die ungenannt bleiben wollten. Auf einem Hügel im äußersten Norden Manhattans, dem heutigen East Harlem, ließ er eine aufgelassene Schule für Gouvernanten zu einem Schloss umbauen, wie man es seinesgleichen an Größe und Stil auf der ganzen Welt nicht fand. Denn mit seiner ehrgeizigen Energie − und nach vier (sehr) gründlichen Whiskeytouren durch die Five Points − hatte Fairwell das Ding immer besser und dann noch mal anders machen wollen, bis es aussah wie ein architektonisches Delirium tremens im Dauerzustand: Ein babylonischer Zikkuratturm, Marmor von einem französischen Palais aus Jahrhundert Nummer fünfzehn, normannische Torbögen, die hohen, schmalen Fensterreihen aus der Zeit Queen Annes und eine Unmenge Gotik waren wild durcheinandergemischt. Über dem Haupteingang saß auf einer Kalksteinspitze eine Bronzekugel und auf der Bronzekugel eine Uhr aus Gold, der der Minutenzeiger fehlte, als wollte die Uhr sagen: «Hier eilt nichts mehr. Lasst euch Zeit.» Erschießenswerte Knirpse mit Flügeln an den Schultern hangelten sich die Balkone hinab, riesige Schlüssel zum Himmelreich in ihren dicken Fingern, und grinsten dümmlich. Wenn es regnete, spien gleich neben ihnen Dämonenstatuen verdrossen Wasser aus.
Bei der Stadtverwaltung galt der Bau als Gipfel der Verschrobenheit. Fairwells Mäzen Andrew Carnegie wurde nervös und ließ ein Gutachten erstellen, wonach das Gebäude binnen eines Jahres einstürzen werde. Dann kamen auch noch die ewigen Spaßvögel daher, aus Bayern eingewanderte Bauarbeiter, und verblödelten Fairwells zuversichtlichen Taufnamen für seine Insel der Hoffnung, «Hope’s Island», zu «Hopfeninsel», «Hops Island», weil sie sich den Witz nicht verkneifen konnten, darin werde entweder mehr gesoffen als geheilt oder jede Geistesverirrung mit einem Biergelage wegtherapiert. Vier der deutschstämmigen Bauarbeiter wurden bald darauf unter ungeklärten Umständen von einem Stahlträger erschlagen; doch der Name blieb, und ebenso unangefochten blieb auch die massive Klinik stehen, hinter der sich jeden Tag unnatürlich lange die aufgehende Sonne verbarg. Sie verurteilte die drum herum verstreuten Bauernhöfe zu einer Dunkelheit, die selbst Schuppen und Scheunen schwermütig werden ließ. Weshalb die Schweine, war zu hören, hier auch nicht grunzten, sondern knurrten − und die Hühner hatten ihre Lust zum Brüten verloren und legten die kleinsten Eier Manhattans. Fixierte man Hops Island nur lange genug, meinten die Bauern, dann warf dieser Irrenkasten einen gereizten Blick zurück.
«Eine Kleinstadt für sich», befand hingegen Colby, als ihr flotter kanariengelber Einspänner das Tor von Hops Island passierte, zwischen Säulen, auf denen gusseiserne Laubfrösche fröhlich zum Sprung ansetzten: «Kühn. Komisch. Gefällt mir.»
Einfach werde das nicht, «doch nehmen wir die Herausforderung an!», sagte Doktor Matthew Fairwell, als Colby ihn bat, Mrs Lillian Cutting sprechen zu dürfen. Über ein riesiges, gedrechseltes Rohr, das am Rand seines Schreibtischs befestigt war, ließ er «unseren Gast aus Eins Strich Eins» zu sich rufen und führte Colby dann über eine Wendeltreppe auf die Dachterrasse seines Büroturms, von der aus man ganz Hops Island überblicken konnte, schwarze Kühe, schmucke Gesindehäuser und Gemüsegärten, eine Kapelle, Parks und Teiche mit Enten − und dahinter, über den Hudson River hinweg, ahnte Colby das Meer. «In den Teichen gibt es sicher Karpfen», dachte sie, «und diese kleinen roten Fische, wie heißen die noch gleich?»
«Berauschend!», sagte sie zu Doktor Fairwell.
«Berauschend, a-ha.» Fairwell zwinkerte irritiert. «Muss ich fürchten, aus diesem Wort einen sarkastischen Unterton herauszuhören?»
«Im Gegenteil, Professor, von mir ist nichts Böses zu erwarten, ich war darüber verblüfft und danke Ihnen, dass Sie mich so ganz ohne Formalitäten hier haben hereinplatzen lassen.»
Fairwell lächelte weltschmerzlich.
«Ich muss Ihnen ein Geständnis machen: Für den Direktor dieser Heil- und Pflegeanstalt bin ich einfach zu empfindsam, von meiner Mutter her erblich eigentlich zur Seelenstörung disponiert. Zwar klinisch unauffällig und, rein kategorial betrachtet, noch keine Paranoia persecutoria, aber originär und» – Fairwell dehnte angewidert das Wort – «groooß-staaadt-tüüh-pisch. Und damit kämpft in diesem kapitalistischen Moloch des Niedergangs doch ein jeder.»
Über ihnen hing schlaff die amerikanische Flagge, als ginge sie ihr Moloch des Niedergangs nichts an.
«Wie uns die Gier der Finanzhyänen», klagte Fairwell mit eingefallener Stimme, «doch geistig verkrüppelt hat und unsere Kultur zersetzt.» Colby wollte schon zu der Frage ausholen, wovon Fabrikarbeiter, Bäcker, Zeitungsjungen, Kaufleute und Gelehrte wie er, Fairwell, denn lebten, wenn nicht auch von diesen «Hyänen», den Cuttings, Belmorals und Carnegies − als Fairwell leicht erschauerte: Ein kalter Windstoß vom Atlantik her fuhr ihm durchs Haar. Die Fahnenstange klirrte. Fairwell ignorierte den Wink: «Insgesamt, alle, samt und sonders! Wir leben im eisernen Zeitalter, im Spätherbst eines Äons, einer sich auflösenden Welt, die für viele zur Hölle geworden ist. Schöne, wohltuende Worte wie ‹Insel›, wie ‹Hoffnung› welken dahin wie die Werte, die sich dahinter verbergen. Dass wir Häuser in die Wolken bauen und unser mechanisiertes Dasein irgendwann vielleicht in den Weltraum schleudern werden, mag ein Vergnügen für die Massen sein, aber nicht für uns Denkende, uns zwei.»
Colby nickte zerknirscht.
«Doch finden wir uns ab. Ich habe es mir daher angelegen sein lassen, mich über den Spottnamen ‹Hops Island›» − Fairwell schnaubte empört − «nicht mehr zu grämen, sondern ihn mir zu eigen zu machen, wenngleich er sich so ausnimmt, als wäre dieser Hort der Heilung hier die letzte Kaschemme in den Five Points! Leicht fällt es mir nicht. Aber meine Frau hilft mir dabei.»
«Darüber würde ich mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen, Professor. Inzwischen ist dieses Wunderwerk der Baukunst eine Institution. Wie Sie. Ich bin einfach nur hin und weg. Es ist hier so anders als überall in der Stadt. Diese Stille, sie …» − Colby suchte nach Worten − «… glättet die Stirn.»
«Genau!, ja!», Fairwells graue Augen weiteten sich kindlich, «genau dazu ist diese Bucht des Friedens auch da, Mrs Sandberg, es atmet sich freier hier!»
Fairwell schnaufte in Colbys Nacken, als sie die Wendeltreppe hinabstiegen, in den Büroturm zurück, die Tür öffnete sich leise, Lillian trat ein, und zu Colbys Erleichterung sah sie nicht viel anders aus als vor einem Jahr, groß, fast einen Kopf größer als Fairwell, und stattlich, stattlich wie immer, etwas bleich vielleicht, in einem Kleid wie für einen Ball − Samt, hochaufgeschlossen, nachtblau, am Hals mit grün gefärbtem Affenpelz gesäumt, vermutlich von Midor.
«Colby, du? Wie unerwartet! Ich brauche … −»
«… ein Glas Sherry!», rief Doktor Fairwell aus den Tiefen seines Vollbarts. «Wie immer zu dieser bedeutenden, dieser prekären Stunde, als Chev von uns ging, wie konnte ich das nur … Stoßen wir auf ihn an. Auf Chev Cutting! Und auf die Genesung der Menschheit.»
Der Vorschlag wurde einstimmig begrüßt.