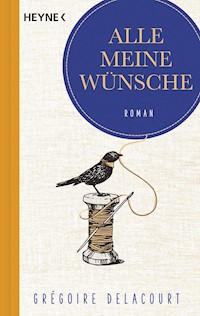9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Sommer am Strand in Nordfrankreich: Sonne, Meer, Dünen und Bars. Hier treffen vier Paare ganz unterschiedlichen Alters aufeinander: zwei Teenager im Rausch der ersten Liebe, eine 35-jährige auf der Suche nach einem neuen Glück, eine gelangweilte Hausfrau , die sich ins Abenteuer stürzt, und ein altes Ehepaar, das sich noch genauso liebt wie am ersten Tag. All diese Menschen begegnen sich, ohne zu wissen, dass ihre Geschichten eng miteinander verwoben sind und ihre Schicksale sich gegenseitig beeinflussen. Bis es während des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag zu einem dramatischen Höhepunkt kommt. Delacourt hat eine Hommage an die Liebe und an den Sommer geschrieben, die einmal mehr zeigt, dass die großen Gefühle ganz unabhängig von Alter und Lebensphase sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Ähnliche
Grégoire Delacourt
Die vier Jahreszeiten des Sommers
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Atlantik
Für Dana, Dana, Dana und Dana
»Und ich, ich war wie die Lampions nächtlicher Feste: Der Schmerz und die Freude mehrerer Lieben verzehrten mich.«
Valery Larbaud, Kinderseelen
PIMPERNELLE
In jenem Sommer sang Francis Cabrel Hors Saison, und alle sangen Cabrel.
In jenem Sommer war der Sommer schnell gekommen. Praktisch schon am letzten Mai-Wochenende, als die Temperatur plötzlich auf zwanzig Grad kletterte. In den Gärten hörte man wieder Lachen, trockenes Husten wegen der ersten fettigen Rauchwolken, die von den Grills aufstiegen, und die Jauchzer der Frauen, die halbnackt beim Sonnenbaden ertappt wurden. Es war wie Vogelgezwitscher. Als wäre das ganze Dorf eine Voliere.
Abends trafen sich die Männer wieder zum Rosé, gut gekühlt, um den Alkohol zu überlisten, den Fluch zu bannen und noch mehr zu trinken. Jetzt hatte der Sommer wirklich angefangen.
In jenem Sommer gab es Victoria. Und es gab mich.
Victoria hatte goldenes Haar, smaragdgrüne Augen, wie zwei kleine Edelsteine, und ihr Mund war so verlockend wie eine reife Frucht. Victoria! Sie ist mein schönster Sieg, sagte ihr Vater ständig, begeistert von seinem Bonmot.
Noch gehörte sie mir nicht, aber ich näherte mich ihr behutsam.
Victoria war dreizehn. Ich war fünfzehn.
Ich sähe schon ein bisschen wie ein Erwachsener aus, sagte meine Mutter, und diejenigen, die meinen Vater gekannt hatten, erinnerte ich an ihn. Meine Stimme war schon fast tief, manchmal heiser, wie morgens, nach dem Aufwachen. Über meiner Oberlippe sah man schon ein bisschen dunklen Flaum. Ich fand das Ganze damals nicht besonders schön, aber Victorias smaragdgrüne Augen konnten über manche Dinge hinwegsehen.
Ich war ihr Freund. Und ich träumte davon, viel mehr zu sein.
Am Anfang jenes Jahres, als es so kalt geworden war, hatte meine Mutter ihre Arbeit verloren.
Sie war in Lille Verkäuferin bei Modes de Paris gewesen. Ihr Charme und ihr Feingefühl wirkten Wunder, mit ihrem sicheren Geschmack hatte sie viele plumpe Gestalten schöner und eleganter aussehen lassen. Aber das konnte sie nicht vor einer Lawine von Ungerechtigkeiten bewahren.
Nachdem sie wochenlang ihren Kummer in Tränen und Martini ertränkt hatte, beschloss sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, und meldete sich für einen Buchhaltungskurs an. Wenn ich schon selbst kein Geld habe, sagte sie, kann ich wenigstens das der anderen zählen. Ich mochte ihre Ironie, die ihr half zu überleben. Sie schnitt sich die Haare und kaufte sich ein blassrosa Frühlingskleid, das ein bisschen zu sehr ihre schlanke Taille und den üppigen Busen betonte.
Nach dem Tod meines Vaters – sein Herz hatte am Steuer seines roten Wagens versagt, ihn auf der Stelle getötet und noch drei weitere Opfer gefordert – hatte meine Mutter keine Lust mehr, ihr Herz einem anderen zu öffnen.
Nichts und niemand kann ihn ersetzen, klagte sie, er ist und bleibt meine einzige Liebe, das habe ich geschworen.
Sie glaubte, was ich damals auch gern glauben wollte, dass die Liebe einzigartig ist.
Als er starb, war ich drei Jahre alt. Ich erinnerte mich nicht an ihn. Meine Mutter weinte, weil mir Bilder und Gerüche, seine starken Arme und pikenden Küsse fehlten. Sie gab sich Mühe, meinen Vater trotzdem lebendig zu halten, und zeigte mir oft die Fotos ihrer Anfangszeit: in einem Garten, am Strand von Étretat, unscharf in einem Zugabteil zweiter Klasse, auf einer Restaurantterrasse, an einem Brunnen in Rom, auf einem schönen Platz hinter dem Palazzo Mattei di Giove, in einem riesigen weißen Bett, wahrscheinlich morgens, er sieht ins Objektiv, sie fotografiert, er lächelt, er ist schön – Gérard Philipe in Der Teufel im Leib –, er wirkt verschlafen, glücklich, nichts kann ihm passieren. Mich gibt es noch nicht. Nur den Anfang eines großen Liebesfilms.
Sie erzählte mir von seinen Händen. Von seiner zarten Haut. Seinem warmen Atem. Sie erzählte mir, wie er mich ungeschickt in die Arme nahm. Wie er mich wiegte. Sie flüsterte die Lieder, die er mir als Neugeborenem ins Ohr summte. Sie weinte um den Abwesenden. Um die Stille. Sie weinte um ihre Ängste, und ihr Weinen machte ihr Angst. Beim Betrachten der wenigen Fotos stellte sie sich seine heutigen Falten vor. Da, siehst du, seine Augen wären wie kleine Sonnen. Und seine Löwenfalte hier, die wäre noch tiefer geworden. Er hätte auch ein paar weiße Haare, da und da, er wäre noch schöner.
Sie stand auf und rannte in ihr Zimmer.
Als ich größer wurde, wünschte ich mir einen Bruder, zur Not eine Schwester, vielleicht auch einen dicken, kuschligen Hund, aber meine Mutter blieb ihrer großen verlorenen Liebe treu. Und nicht einmal der betörende Charme des jungen Apothekers – er sieht aus wie ein Hollywoodstar, sagte man im Dorf –, nicht einmal seine Präsente und Versprechungen konnten sie umstimmen.
In jenem Sommer war meine Mutter beim Kapitel Lastenhefte und Verluste durch höhere Gewalt. Bei Tabellen und Zahlen. Bei Einwegverpackungen.
In jenem Sommer musste ich sie abfragen. Ich war ihr Lehrer. Sie nannte mich ihren kleinen Mann. Sie fand, dass ich meinem Vater immer ähnlicher wurde. Sie war stolz. Sie liebte mich. Sie lächelte mich an, und ich zerschnitt mir die Zunge beim Anlecken der vielen Umschläge, in die sie ihren Lebenslauf gesteckt hatte, wie in eine Flaschenpost. Sie griff nach meiner Hand. Sie küsste sie.
»Tut mir leid mit dem Sommer, Louis, sei mir nicht böse.«
In jenem Sommer fuhren wir nicht in den Urlaub.
Wir wohnten in Sainghin-en-Mélantois.
Ein nichtssagendes Dorf, das jedem anderen glich. Eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert, Saint Nicolas. Ein Pferdewettbüro Le Croisé. Ein Supermarkt 8 à Huit. Eine Bäckerei Dhaussy. Ein Blumenladen Rouge Pivoine. Ein Café du Centre. Ein anderes Café. Und noch ein drittes, in dem diejenigen gestrandet waren, die sich nicht mehr vorwärtsbewegten. Angeblich war es Gift, das sie tranken und das sie ins Schwanken brachte. Dann erzählten sie von Schiffsreisen und Stürmen, die sie nicht erlebt hatten, aber an die sie sich dennoch erinnerten. Von Gespenstern. Von Orten, an denen sie gewesen waren, ohne sich je von hier wegzubewegen, um in einen Krieg zu ziehen oder ein Mädchen zu erobern. Einer von ihnen hatte mich eines Abends am Arm gepackt, als ich aus der Schule kam. Eine Tonkinesin, Jungchen, brüllte er, der Körper einer Göttin, eine hinreißende Schlampe, o ja, eine Wilde mit Nachtaugen. Eines Tages packt es dich auch, Kleiner, das mächtige Feuer, wenn dein ganzer Körper glüht.
Er hatte recht.
Die Frauen ihrer Träume schwammen auf dem Grund ihrer Gläser. Manche behaupteten, dass sich in ihren Gesichtern die Karten und das Leid der Länder abzeichneten, in denen sie nie gewesen waren.
Sainghin-en-Mélantois. Gleich hinter den Kneipen standen die ersten Backsteinhäuser, deren Gärten sich wie eine Patchworkdecke bis zum Rain der großen Rüben- und Getreidefelder ausbreiteten, und die Sandwege, die bis zum Wald von Noyelle führten, wo die Jungen an den ersten schönen Tagen vor den Mädchen »Männer« spielten, indem sie mit ihren Gewehren auf Spatzen und Finken zielten, die Gott sei Dank schneller flogen als Schrot.
Ein Dorf, wo jeder jeden kannte und wo vieles totgeschwiegen wurde, Wahrheiten wie Lügen. Ein Dorf, wo man tuschelte, dass der Schmerz der einen die Erbärmlichkeit der anderen beruhige. Wo das Fehlen von Zukunft traurige Gedanken aufkommen, Wut hervorbrechen und nachts Leute verschwinden ließ.
Victorias Eltern hatten ein großes orangerotes Backsteinhaus an der Straße nach Astaing. Ihr Vater war Bankier beim Crédit Nord, Place Rihour Nr. 8, in Lille. Er ist überhaupt nicht lustig, sagte Victoria, er zieht sich immer an wie ein Opa, und sein Lächeln sieht aus wie eine Grimasse. Ihre Mutter war »Hausfrau«. Ein zartes Wesen, das sich fast am eigenen Blut vergiftet hätte. Von ihr hatte Victoria die Porzellanhaut geerbt, von ihr stammten die feinen Manieren, die genauen Bewegungen, als wäre jede die letzte, von ihr stammte dieses absolute, gefährliche – das sollte ich später begreifen – Gefühl für die Liebe und vor allem für das Begehren. Sie schrieb Gedichte, die ihr Bankiersgatte auf eigene Kosten verlegen ließ, kleine Hefte, aus denen sie einmal im Monat im Salon ihres großen Hauses vorlas. Zu den Reimen wurde Tee und Kuchen von Meert gereicht, an dem sich die Zuhörer labten. Angeblich waren diese Leckereien poetischer als die eigenartige Lyrik der Dichterin, auf den Tellern reimten sich marron und citron, wie in Éclair à la Glace à la crème de marron/Tarte flambée aux pommes aromatisée au citron.
Victoria hatte eine ältere Schwester. Pauline. Eine siebzehnjährige Schönheit, aber da war auch etwas Dunkles, Verwirrendes, das mich ebenso erschreckte wie faszinierte. Etwas, das an die Sinne rührte. Schwindel weckte. Wenn ich mit meinen fünfzehn Jahren voller Saft, Ungeduld und Dringlichkeit nachts zu träumen begann, dachte ich an den Körper von Pauline.
Aber meine Liebe gehörte Victoria.
Ich weiß noch, wo ich sie zum ersten Mal sah. Es ist mehr als dreizehn Jahre her.
Ich kam in die Gemeindebibliothek und wollte mir ein paar Comics ausleihen. Sie war schon da, mit ihrer Mutter, die einen Gedichtband von Henri Michaux suchte. Hier gibt es ja überhaupt nichts, das ist keine Bibliothek, das ist ein Witz, regte sie sich auf. Aber wer liest denn heutzutage noch Gedichte, Madame, Gedichte! In Sainghin-en-Mélantois! Lesen Sie lieber Kriminalromane, hier, in diesem Buch finden Sie Poesie, Erlösung, Niedertracht, zerspringende Seelen.
Victoria schaute mich an, sie amüsierte sich über die Erwachsenen, schämte sich für ihre Mutter. Sie war elf. Die Haare blond wie die einer Schauspielerin, lang wie bei Brigitte Bardot. Unglaubliche Augen – dass sie genau die Farbe von Smaragden hatten, habe ich erst später gesehen. Und eine unberechenbare Dreistigkeit.
Sie war vorsichtig näher gekommen.
»Liest du Asterix, um Latein zu lernen?«
»Victoria!«
Sie lachte.
»Super, jetzt brauchst du nicht mehr nach meinem Vornamen zu fragen.«
Dann ging sie zu ihrer Mutter. Zum Glück.
Denn obwohl mir eisiger Schweiß den Rücken runterlief, war mir plötzlich ganz heiß.
Ich hätte kein einziges Wort herausgebracht.
Denn soeben war mein Herz explodiert, wie das meines Vaters.
Anfang Juli machte sich das halbe Dorf auf den Weg nach Le Touquet oder Saint-Malo, die andere Hälfte fuhr nach Knokke-le-Zoute oder De Panne.
Victoria und ich blieben in Sainghin. Wie meine Mutter, die für ihre Buchhaltungsprüfung lernte. Wie ihr Vater, der das Gesicht verzog, während er die Darlehensanträge der Studenten studierte. Wie ihre Mutter, die sich bemühte, aus ihrer Feder Worte fließen zu lassen, die eines Tages das Herz der Welt berühren und die Schwermut der Verzweifelten ins Wanken bringen würden. Pauline war in Spanien, sie lebte nachts, von Ponche Caballero und von Unbekannten.
Neben uns wohnten die Delalandes. Sie waren erst zwei Jahre zuvor aus Chartres hergezogen. Er war zum Autozulieferer Quinton Hazell in Fretin versetzt worden, sie fand im Jahr darauf eine Stelle als Dozentin für Bibelexegese an der Katholischen Universität von Lille. Beide waren um die vierzig, kinderlos, ein sehr schönes Paar. Er ähnelte dem Schauspieler Maurice Ronet, nur dunkelhaariger. Sie ähnelte Françoise Dorléac, in Blond. Sie sah ihn mit den Augen einer Aufseherin und einer Verliebten an. Einer eifersüchtigen Frau. Ihr Haus war eins der wenigen im Dorf, die einen Swimmingpool besaßen, und dank guter Nachbarschaftsbeziehungen hatte Gabriel – nenn mich Gabriel, hatte mich Monsieur Delalande gebeten – mich mit der Reinigung des Pools beauftragt, während er mit seiner Frau bis Anfang September an der baskischen Küste Urlaub machte. Sie suchten den Wirbel des Südwindes, den vent fou, wie man ihn dort nennt, und das Peitschen des Ozeans, hatte er uns erklärt, als wollte er uns daran erinnern, wie platt, traurig und ausweglos hier alles war.
Mit dem Geld für die Reinigung des Pools würde ich mir an meinem sechzehnten Geburtstag ein Mofa kaufen können. Victoria und ich hatten schon eins ins Auge gefasst, eine gebrauchte Motobécane, eine »Bleue« in gutem Zustand, die ein Rentner des Dorfes verkaufen wollte. Ich sah uns bereits auf dem langen, mit schwarzem Klebeband geflickten Plastiksattel sitzen, ihre Arme um meine Taille, meine linke Hand auf ihrer, ihr Atem in meinem Nacken, auf dem Weg in ein Leben zu zweit.
Ich konnte es kaum erwarten, dass sie älter wurde.
Ich konnte es kaum erwarten, dass ihre kindliche Anmut und ihr Duft nach Seife und Blumen verflogen.
Ich konnte es kaum erwarten, dass sie endlich auch so einen scharfen und warmen Geruch verströmte, wie ich ihn manchmal bei Pauline, bei einigen Mädchen meiner damaligen Klasse, bei manchen Frauen auf der Straße wahrnahm.
Jeden Morgen wartete ich bei ihrem Haus. Jeden Morgen kam sie auf mich zu geradelt. Sie lachte. Die Smaragde in ihren Augen glänzten. Und jeden Morgen rief die Dichterin aus einem Fenster im Obergeschoss, bevor sie sich wieder ihren melancholischen Versen zuwandte:
»Macht keine Dummheiten! Bring sie zum Mittagessen zurück!«
Wir waren allein auf der Welt. Wir waren Victoria und Louis, wir waren unzertrennlich.
Wir flitzten zur Marque, die bis Bouvines fließt – wie die gleichnamige Schlacht im Juli 1214 –, und wenn wir uns erschöpft auf den Boden warfen, flocht ich ihr Eheringe aus Gras, die sie lachend über ihre zarten Finger schob, und zählte die Anzahl unserer zukünftigen Kinder in der Falte ihres kleinen Fingers. Aber ich werde dich nicht heiraten, sagte sie. Und als ich fragte, warum nicht, antwortete sie, dann wäre ich nicht mehr ihr bester Freund. Ich verbarg meine Kränkung und protestierte:
»Doch! Ich bleibe immer dein Freund, mein ganzes Leben.«
»Nein. Wenn man sich richtig liebt, kann man sich verlieren, und ich will dich nicht verlieren, Louis.«
Dann sprang sie auf wie ein Zicklein und schwang sich wieder auf den Fahrradsattel.
»Wer als Erster zu Hause ist!«
Ihre Unschuld hielt mich auf Abstand. Das Ende der Unschuld nahm sie mir weg.
Da unterdrückte ich mein Jungsbegehren. Ich lernte Geduld – ein heftiger Schmerz.
Wenn wir zur Mittagszeit nach Hause kamen, hatte uns ihre Mutter im Schatten der großen Linde im Garten ein Picknick vorbereitet: Schinken, Salat, Limonade, wenn es kühler war, eine Käsetorte, zum Nachtisch Arme Ritter oder Mousse au Chocolat. Ich mochte den Schnurrbart, den der Kakao auf Victorias Lippen zeichnete, ich träumte davon, ihn mit meiner Zunge wegzuwischen, während mein Blut sich staute und meinen Penis in ein gieriges Männerglied verwandelte. Hastig senkte ich vor Lust und Scham den Blick.
Die Nachmittage verbrachten wir im Garten der Delalandes. Victoria hatte Gabriel nur einmal kurz gesehen, das hatte genügt, sie fand ihn schön, »hoffnungslos, zum Sterben schön«.
Mit einem großen Kescher half sie mir, die auf dem Wasser schwimmenden Blätter aus dem Pool zu fischen. Einmal in der Woche musste ich mit einem Teststreifen den pH-Wert des Wassers prüfen und mich vergewissern, dass er immer bei 7,4 lag.
Die meiste Zeit über aber badeten wir.
Manchmal schwammen wir mehrere Bahnen um die Wette. Es war entzückend, wie Victoria auf dem Rücken schwamm, ihre Armbewegungen ähnelten denen einer Eisläuferin. Wenn sie so auf der Wasseroberfläche lag, dachte ich, sie werde davonfliegen. Im unendlichen Blau verschwinden. Mich verlassen. Dann tauchte ich, packte ihre Füße, hielt sie fest. Sie schrie, tat so, als hätte ich sie erschreckt. Und ihr Lachen flog sehr hoch, bevor es in mein Herz zurückfiel. Ich zog sie in die hellen Tiefen. Ich wollte untergehen, mit ihr untergehen, endlos versinken, wie in Abyss, und dieses Paradies, den Ort aller denkbaren Vergebung finden. Aber im letzten Moment stiegen wir immer wieder auf. Verschreckt und lebendig.
Wie gerne wäre ich mit ihr gestorben, in jenem Sommer.
Manchmal spielten wir Wasserball, aber in ihrer Ungeschicklichkeit katapultierte sie den Ball oft ans Ende des Gartens, und ich musste aus dem Wasser steigen, um ihn zu holen. Sie sah mir lachend zu, und ich sprang sofort wieder mit einer riesigen Fontäne in den Pool, um sie zu beeindrucken. Sie verdrehte die Augen, mit einem schon so weiblichen Überdruss. Ihre Augen waren gerötet, wie von Frauen, die viel weinen. Von Frauen, die sich verlieren werden. Ihre lockigen nassen Haare lagen wie ein Kranz auf ihrer Stirn.
Sie war meine Prinzessin.
»Irgendwann darfst du mich küssen«, flüsterte sie mir eines Nachmittags zu, dann schwamm sie zur Leiter, hinter sich ein Lichtstreifen.
Wir lagen nebeneinander auf den Holzplatten, die das Becken umgaben, und ließen uns von den Sonnenstrahlen trocknen. Sie trug einen Bikini, das hübsche Oberteil verbarg zwei sanfte Wölbungen, und wenn sie es auszog, um ihr Kleid wieder überzustreifen, befahl sie mir, mich umzudrehen, und ließ mich schwören, nicht hinzusehen. Sonst bringe ich dich um und werde dich mein Leben lang hassen. Ich lachte laut, und mein Lachen ärgerte sie, sie floh und ließ mich allein im Garten zurück. Unser Eden.
Da, wo die Schlange lauert.
Meine Mutter machte sich Sorgen.
Es wäre ihr lieber gewesen, wenn ich meine Zeit mit Jungs in meinem Alter verbracht hätte, wenn ich abends mit blutigen Knien nach Hause gekommen wäre, wenn ich mich geprügelt hätte, mein Gesicht rot vom Rennen und mein Herz wie eine fröhliche Trommel. Meine Mutter wünschte sich zerrissene T-Shirts, Baumhütten, Stürze, Splitter, rostige Nägel, Krankenwagen, Mutterängste und Auferstehungen.
Sie wünschte sich für mich eine raue, männliche Jugend. Sie fürchtete, dass mich das Fehlen eines Vaters zur Memme machen würde. Sie hatte mich zum Judo geschickt, aber nach einem bösen kuchiki-daoshi hatte ich aufgegeben. Sie hatte mich beim Fußball angemeldet, aber wegen meiner Unfähigkeit landete ich auf der Ersatzbank.
Ich war ein Kind, das wenig sprach. Ich hütete mich vor Brutalität, hütete mich vor den anderen. Vor unbändiger Gewalt. Vor Spucke, vor Dreck. Vor allem, was demütigt.
Jungen interessierten mich nicht. Ich mochte die sanfte Stille, die zarte Art, mit der sich Mädchen ihre Geheimnisse zuflüsterten und erröteten, wenn sie die Welt entwarfen und ihre Fäden spannen.
Manchmal verspotteten mich die anderen Schüler, schubsten mich im Schulflur, auf den Treppen. Einer rief Louise, das verletzte mich. Ein Großer versuchte es mit einem Fausthieb. Wehr dich! Wehr dich, wenn du ein Mann bist! Los! Ich zuckte mit den Schultern, aber er warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen meine Brust. Es gab böses Gelächter, aber ich ging nicht zu Boden. Ich weinte nicht. Ich schützte mein Gesicht. Meine Mutter sollte nicht sehen, wie ich mich schämte, sie sollte sich keine Sorgen machen, nicht den toten Vater zu Hilfe rufen, der mich mit seiner schmerzlichen Abwesenheit die unsichtbare Schönheit der Dinge sehen ließ.
Später, als Victoria nicht mehr da war, stürzte ich mich in das Getümmel der Männer auf den Sportplätzen. Ich ertrank unter den Schlägen, die die Zärtlichkeit und die ungewisse Sanftheit der Gefühle vernichten. Und ich betete jedes Mal dafür, dass dieser Teil meiner Kindheit zertrümmert und ganz und gar zerstört werde.
Aber die Gewalt siegt nicht über alles.
»Du kannst doch nicht deine ganze Zeit mit Victoria verbringen«, sagte meine Mutter immer wieder, »das gehört sich nicht. Vergiss nicht, dass sie noch ein kleines Mädchen ist, und du bist fast schon ein Mann.«
»Mama, ich bin fünfzehn! Das ist doch kein Männeralter.«
»Ich habe einen Bruder, ich weiß Bescheid. Du brauchst Freunde.«
»Sie ist meine Freundin.«
»Und was macht ihr den ganzen Tag?«
»Ich warte.«
Ich warte darauf, dass sie größer wird, Mama. Ich warte darauf, dass sie den Kopf an meine Schulter lehnt. Ich warte darauf, dass ihr Mund zittert, wenn ich mich ihr nähere. Ich warte auf die betörenden Düfte, die sagen, komm, du kannst dich jetzt in mir verlieren, in mir verbrennen. Ich warte darauf, ihr Worte zu sagen, die man nicht zurücknehmen kann. Die Worte, die die Weichen stellen für ein Leben zu zweit. Für das Glück. Und manchmal für eine Tragödie.
Ich warte darauf, dass sie auf mich wartet, Mama. Dass sie ja sagt. Ja, Louis, ich werde deinen Ehering aus Gras tragen und ich werde dir gehören.
»Ich warte.«
Da nahm mich meine Mutter in die Arme, erstickte mich fast, wie um mich zurückzuholen zu der Zeit, als wir zu dritt waren, als nichts Böses passieren konnte, der Zeit vor dem roten Wagen und dem explodierenden Herzen.
»Du bist wie er, Louis. Du bist wie dein Vater.«
Am letzten 14. Juli des Jahrhunderts fuhr der Bankier mit seiner Dichterin und ihrer Tochter ans Meer.
Und Victoria lud mich ein. Zwei Autostunden, und wir waren in Le Touquet.
Der Deich war schwarz von Menschen. Fahrräder, Skateboards, Roller, Kinderwagen und Tretautos für Erwachsene. Geschrei. Zuckerwatte. Von Nutella triefende Crêpes und Waffeln. Ich erinnere mich an süßes, vergängliches Glück. An helle Öljacken direkt auf der Haut, an den wirbelnden Sand, der in den Augen brannte.
Am Strand war hie und da ein kleiner Windschutz aufgestellt. Familien drängten sich aneinander, um nicht vom Wind weggetragen zu werden. Und sich zu wärmen, wenn die Sonne verschwand.