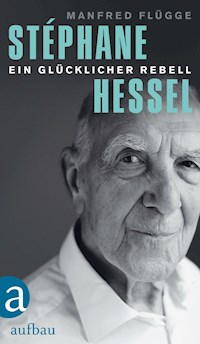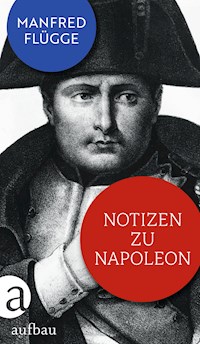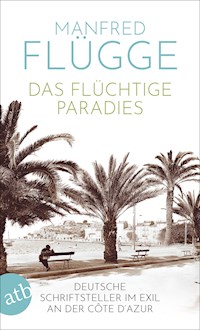9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Eine Frau sollte keine Angst haben vor dem Fallen." Marta Feuchtwanger.
Muse, Grande Dame, Ikone des deutschen Exils - Marta Feuchtwanger gehört neben Katia Mann und Alma Mahler-Werfel zu den großen Dichterfrauen des 20. Jahrhunderts. Manfred Flügge erzählt das Leben dieser außergewöhnlichen Frau, die durch ihre Schönheit, ihren selbstbewussten Witz und ihre Lebensklugheit schon die Zeitgenossen faszinierte. Ein unvergleichliches Frauenschicksal, ein spannender Eheroman, ein plastisches Zeitbild und, schließlich, eine Lektion zum Thema Glück - brillant geschrieben und gestützt auf umfangreiches, teilweise bisher unerschlossenes Material, darunter die intimen Tagebücher Lion Feuchtwangers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Eine Frau sollte keine Angst haben vor dem Fallen.« Marta Feuchtwanger
Muse, Grande Dame, Ikone des deutschen Exils – Marta Feuchtwanger gehört neben Katia Mann und Alma Mahler-Werfel zu den großen Dichterfrauen des 20. Jahrhunderts. Manfred Flügge erzählt das Leben dieser außergewöhnlichen Frau, die durch ihre Schönheit, ihren selbstbewussten Witz und ihre Lebensklugheit schon die Zeitgenossen faszinierte.
Ein unvergleichliches Frauenschicksal, ein spannender Eheroman, ein plastisches Zeitbild und, schließlich, eine Lektion zum Thema Glück – brillant geschrieben und gestützt auf umfangreiches, teilweise bisher unerschlossenes Material, darunter die intimen Tagebücher Lion Feuchtwangers.
Über Manfred Flügge
Manfred Flügge, geboren 1946, studierte Romanistik und Geschichte in Münster und Lille. Von 1976 bis 1988 war er Dozent an der Freien Universität Berlin. Heute lebt er als freier Autor und Übersetzer in Berlin.
2014 erhielt er den »Literaturpreis Hommage à la France der Stiftung Brigitte Schubert-Oustry« und in Cognac den Prix Jean Monnet du Dialogue Européen.
Im Aufbau Verlag sind seine Bücher »Die vier Leben der Marta Feuchtwanger«, »Das Jahrhundert der Manns«, »Stadt ohne Seele. Wien 1938«, »Das flüchtige Paradies. Deutsche Schriftsteller im Exil an der Côte d’Azur« und »Stéphane Hessel – ein glücklicher Rebell« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Manfred Flügge
Die vier Leben der Marta Feuchtwanger
Biographie
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vier Leben
Anfänge
Leib und Seele
Morgenroth
Feuchtwangers
Der Zug nach dem Süden
Übergänge
Wie man im Krieg München erobert
München verblasst
Berlin als Sprungbrett
Das erste Haus
Offene Ehe
Fluchten
Winterreise
Flucht ins Blaue
Die großen Tage von Sanary
Nachmittage eines Fauns
Moskau und die Folgen
Vor dem Sturm
Unholdes Frankreich
Im Lager
Über Grenzen
Ankünfte
Annäherung
Traumschloss
Alpträume
Prophet und Spieler
Partylöwin
Aussöhnung
Letzte Bilder
Vom Standpunkt des Glücks
Anhang
Chronik
Villa Aurora
Literatur- und Quellenverzeichnis
Dank
Register
Bildteil
Bildnachweis
Impressum
»Eine Frau sollte keine Angst haben vor dem Fallen.«
Marta Feuchtwanger (1975)
»You intrigue me. You have to tell me more about you.«
Henry Miller zu Marta Feuchtwanger (1941)
»Als ich hörte, dass der Film Die unwürdige Greisin – nach einer Geschichte von Brecht – in Westwood gespielt wurde, bin ich in Nacht und Nebel, bei strömendem Regen und durch einen Erdrutsch ganz allein ins Kino gefahren, um die letzte Vorstellung anzusehen. Da saß ich und fühlte mich sehr verbunden mit der alten Dame.«
Marta Feuchtwanger an Helene Weigel (1967)
für Mila Ganeva
Vier Leben
Eines Morgens überraschte Marta Feuchtwanger in ihrer kalifornischen Villa einen ungebetenen Gast. Besonnen und freundlich grüßte sie den jungen Mann, reichte ihm Brot und Kaffee und erteilte Ratschläge für ein vernünftiges Leben. Mit Umsicht und Humor meisterte sie eine kritische Situation, wie schon so oft.
Auch der Biograph ist ein Einbrecher. Von der indiskreten Besichtigung eines fremden Lebens kehrt er bereichert und belehrt zurück. Gern teilt er seinen Gewinn, der aber nicht in einem Handstreich zu erringen ist. Das Material zu diesem Buch stammt aus Marta Feuchtwangers Interviews, aus ihren Memoiren und Briefen, aus Dokumenten des Feuchtwanger-Archivs in Los Angeles, aus Gesprächen mit Zeitzeugen, aus vielen Büchern und Aufsätzen über das Leben der Emigranten, aus Lion Feuchtwangers fragmentarisch erhaltenem Tagebuch und aus einer einfühlsamen Lektüre seiner Romane. Nicht immer stimmen die verschiedenen Berichte und Zeugnisse überein, insbesondere für das dramatische Jahr 1940. Nicht alles lässt sich plausibel rekonstruieren. Vieles, was wir aus Lions und ihrem Leben zu wissen glauben, beruht auf Martas späteren und oft glättenden Darstellungen. Das Gedächtnis ist auch nur ein Instrument. Es kennt seine eigenen Gesetze und Widersprüche und seine empfindlichen Zonen.
Sie trägt seinen Namen, und dieser Name trägt sie über die Zeiten. Doch wenn es um »Feuchtwanger« geht, muss sie lachen: »Ich habe meinen eigenen Komparativ geheiratet.« Des Rätsels Lösung? Ein Urgroßvater hieß Feuchtwang, denn dessen Vorfahren stammten aus demselben Ort in Franken wie die Familie von Lion.
Meistens erzählt man sein Leben, um auch ihres zu beleuchten. Lions zahllose Liebschaften, seine politischen Einlassungen, sein Status als Autor von Weltruf haben auch ihr Dasein bestimmt und müssen deshalb einbezogen werden, um ihre Situation zu spiegeln. Zudem hat sie sich stark mit seinem Werk identifiziert, nicht zuletzt weil sie großen Anteil an dessen Entstehung hatte. Ihre Biographie ist jedoch mehr als eine andere Perspektive auf sein Leben und Schreiben. Nach dem Auftritt in einem Kurzfilm erhielt Marta Feuchtwanger in Hollywood eine lobende Erwähnung als supporting actrice, und es scheint, als sei das ihre Rolle auch für Lion gewesen. Und doch spielte sie eine Hauptrolle, denn erst ihre Geschichte vollendete die seine. Sie hatte ein Leben vor seiner Zeit und eines danach – sie überlebte ihn um fast dreißig Jahre. Die achtundvierzig bewegten Jahre mit ihm wurden durch den Bruch von 1933 in zwei unterschiedliche Perioden geteilt. Aber ob drei Leben oder vier oder sieben, was für die Katzenliebhaberin passender wäre – in treulosen Zeiten verkörperte sie eine Art Beständigkeit.
In den Briefen und Gesprächen aus ihren letzten Jahren spürt man, dass Marta Feuchtwanger verwundert und vergnügt auf den dichten Erzählstoff blickte, zu dem ihr Leben geworden war. Überhaupt musste sie viel lachen, als ein junger Amerikaner, Spross einer Emigrantenfamilie, sie Mitte 1975 in Los Angeles über ihre Erlebnisse und Zeitgenossen ausfragte. Zu jedem Thema suchte sie die passende Pointe, als wäre ihr Leben eine bittere Farce gewesen, ein Übermaß an Schicksal, nun zu Anekdoten destilliert wie Kristallkugeln zur Betrachtung der Vergangenheit. Das Schicksal dieser Frau, die unter so vielen Autoren lebte, aber selbst nicht schrieb, war es, alle Erfahrungen zu berühren, die ihr Jahrhundert bereithielt, die schlimmsten wie die besten. Sie hat alles durchlitten und überwunden, lebte jenseits von Groll und Bitterkeit.
Ihrem Erinnerungsbuch gab Marta Feuchtwanger den Titel »Nur eine Frau«, ein Ausdruck ihres trockenen Humors und ihrer aufrichtigen Bescheidenheit. Kadidja Wedekind, die Tochter des Dramatikers und Freundin seit den Münchner Tagen, kommentierte das Buch im Januar 1984 so: »Noch nie hat jemand das Leben und dann die Emigration so energisch vom Standpunkt des Glücks geschildert – des Glücklichseins und des Glück-Habens.« Das habe nur eine Frau von ihrer Weisheit und Souveränität, ihrer Lebensfreundlichkeit und ihrem himmlischen Humor gekonnt. Es war aber kein zugefallenes Glück, es war die Arbeit eines ganzen Lebens.
Immer hat es Lion und Marta Feuchtwanger an schöne Küsten gezogen, als läge dort ihre eigentliche Heimat. Die Umtriebigen und schließlich Vertriebenen brauchten einen festen Ort. Und die Herrin von Haus und Garten war Marta. Doch ihr Heim schien gleichsam mit ihnen zu wandern, von Deutschland über Südfrankreich nach Kalifornien, wurde immer weiter nach Westen und Süden gerückt und dabei immer grandioser, als würden nach jedem Verlust Schönheit und Reichtum zunehmen, bis endlich, nach der größten Gefahr, der äußerste Westrand erreicht wurde, von dem aus man nach Osten zurückblickte, dem Sonnenaufgang entgegen. Ihr Haus, ihr Garten – ein verpflanzbares Paradies.
Zuletzt wohnte Marta Feuchtwanger in einem pseudospanischen »Schloss« über dem Pazifik, und es schien, als hätte sie darauf hingearbeitet, in diesem Ambiente zu residieren und bei ihren Auftritten in der Stadt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ihre ersten drei Etappen konnten als Vorgeschichte des letzten Kapitels erscheinen, das alles Erfahrene zusammenfasste, ihr Bild für immer prägte und ihre Lebensgeschichte versöhnlich abschloss. Nach Lions Tod wurde Marta Feuchtwanger im kulturellen Leben von Los Angeles eine beinahe mythische Figur, um die sich viele Anekdoten rankten. Die Erbschaft ihrer Zeit wirkt fort in der Kulturwerkstatt »Villa Aurora«, wie ihr letztes Domizil nunmehr heißt.
Marta Feuchtwangers Geschichte ist, wie jedes bedeutsame Leben, auch ein Roman ihrer Epoche: eine Münchner Jüdin, die zur Weltbürgerin wurde, eine unvergleichliche Zeugin eines Jahrhunderts, das ihr viel zugemutet, aber auch viel gegeben hat, eine moderne Frau mit ihrer eigenen Form der Emanzipation, eine einflussreiche Anregerin, eine blendende Erscheinung bis ins hohe Alter, Sportlerin, große Liebende, Emigrantin und Repräsentantin, auch Märtyrerin zuweilen, mit einem schwierigen Kompagnon, an dessen Größe und Irrtümern, Engagement und Freiheitswillen sie teilhatte, und zuletzt und für immer eine zeitlose Symbolgestalt des deutschen Exils.
Anfänge
Leib und Seele
»Ich habe gar nicht an mich geglaubt.«
M. F.
Auf den Kinderbildern blickt sie noch kess und neugierig in die Welt. Über den Augen der Jugendlichen liegt ein leichter Schleier, sanfte Trauer und verhaltener Stolz. Etwas bedrückt sie, sie muss es verbergen und will sich doch in Szene setzen. Traut sie der Welt nicht, oder hat man ihr Selbstvertrauen gebrochen? Zugleich sucht sie, ein großes Tuch über den rundlichen Kopf gelegt, nach einer trotzigen Pose, in der sie sich behaupten kann.
Geboren wurde Marta am 21. Januar 1891 in München als drittes Kind von Leopold und Johanna Löffler, wohlhabenden, wenn auch nicht reichen Geschäftsleuten, die seit 1884 eine Wohnung im Haus Nummer 4 der Windenmachergasse bewohnten, mit Blick auf die Frauenkirche. Ein Großvater der Mutter, ein geborener Feuchtwang, war nach dem frühen Tod seiner Eltern von einer Tante namens Reitlinger adoptiert worden. Er wurde ein erfolgreicher Händler und später Bankier. Seine schönen Töchter lockten junge Offiziere ins Haus, die den Umgang mit Juden sonst eher mieden. Sie tanzten mit den Mädchen und erhielten vom Vater günstige Kredite. Nach dem Krieg von 1870/71 ließ sich keiner mehr von ihnen blicken. Der in Schwierigkeiten geratene Bankier wollte die Offiziere verklagen, doch seine Töchter flehten ihn an, die schmucken Uniformträger in Frieden zu lassen. Er gab nach, grämte sich und ist bald darauf gestorben.
Seine Witwe, geborene Landauer, eine energische und attraktive Person, eröffnete ein Geschäft für Damenbekleidung. Beim Verkauf halfen die drei Töchter Sidonie, Ida und Johanna. Ein junger Kaufmann namens Leopold Löffler, Sohn eines Viehhändlers aus Augsburg, verliebte sich bei der Hochzeit der ältesten Reitlinger-Tochter in die jüngste, heiratete sie und zog mit ihr nach München. Johanna Löffler war eine geschickte Schneiderin und nähte ihre elegante Garderobe selbst. Sie und ihr Mann verkauften Stoffe auf den Marktplätzen verschiedener Städte und waren zunächst gemeinsam mit dem Pferdewagen unterwegs. Sie übernahmen das Geschäft der Großmutter und nannten die Firma Löffler & Landauer. Daraus wurde bald ein Kaufhaus, das auch Läden in kleinen Gemeinden belieferte.
Das erste Kind der Löfflers, Emilie, starb 1884 im Alter von zwei Monaten. Die zweite Tochter, im August 1885 geboren, war früh an Typhus erkrankt und behielt eine Behinderung zurück. Ida hatte blaue Augen und blondes Haar und war sehr gutmütig. Sie wurde nicht in eine Schule geschickt, sondern erhielt daheim Privatstunden. Dann saß die sechs Jahre jüngere Marta auf dem Fußboden dabei, hörte aufmerksam zu und lernte allerlei.
Leopold Löffler war das ganze Jahr im Zweispänner unterwegs, auch im Winter. Wenn er nach Hause kam, war das ein großes Ereignis. Am Sonntagmorgen durfte Marta zu ihm ins Bett, aber da las er meist die Zeitung. Marta fühlte sich allein, zu Hause gab es keine Zärtlichkeit, selten eine Bestätigung, kaum ein gutes Wort. Es war aber nicht ihre Art, die Dinge einfach hinzunehmen. Notfalls provozierte sie Reaktionen. So beschuldigte sie ihre sanfte Schwester, sie gestoßen zu haben. Doch als die Mutter jene bestrafen wollte, warf sich Marta dazwischen: »Es hat ja nicht sehr weh getan.« Sie wollte nur gelobt werden und hatte dafür diesen Auftritt inszeniert. Die Mutter sagte es ihr auf den Kopf zu. »Aber wie hast du das herausbekommen?«, fragte Marta. Die Mutter: »Der kleine Vogel hat es mir erzählt.« Nach späteren Untaten kniete Marta vor dem Käfig des Kanarienvogels nieder und bat: »Sag das bitte nicht der Mama!«
Im Juni 1896 starb Martas Schwester Ida an Meningitis. Die Mutter war deprimiert, fühlte sich schuldig. Sie magerte stark ab, war so schmal und dünn, dass der Wind sie hochhob, als er um die Frauenkirche pfiff und in ihre weiten Kleider gefahren war. Marta bog sich vor Lachen, als sie ihre Mutter in die Luft gehen sah.
Die Löfflers wohnten in der zweiten Etage eines vierstöckigen Hauses mit Schlafzimmer, Esszimmer, Salon (auch Malzimmer genannt) und Küche. Als von einer Nachbarwohnung ein Raum hinzukam, erhielt Marta ihr eigenes Zimmer. In der Windenmachergasse standen nur sechs Gebäude, eines davon gehörte der Handelsbank, die später die gegenüberliegenden alten Gebäude aufkaufte und zu einem einzigen Komplex umbauen ließ. Von ihrem Zimmer aus schaute die zehnjährige Marta auf die Baustelle, sah das Haus aus rotem Sandstein allmählich wachsen. Zwei junge Italiener arbeiteten dort als Dekorateure, ein blonder und ein schwarzhaariger. Marta sah zu, wie sie Verzierungen anbrachten, und fragte sich, welchen von beiden sie lieber mochte, konnte sich aber nicht entscheiden und empfand das als tragisch. Es war ihr erster bewusster Ausblick auf die Männerwelt.
Ihre Mutter freundete sich mit einer ehemaligen Hofdame an, die im selben Haus wohnte und ihr zuweilen edles Porzellan schenkte. Die Frauen schwärmten für König Ludwig II., auch wenn dem Märchenkönig längst sein schwachsinniger Bruder Otto nachgefolgt war, an dessen Stelle seit 1886 Prinzregent Luitpold die Amtsgeschäfte führte. Luitpold betrieb eine aktive Förderung der bildenden Kunst, was von den Malern dankbar anerkannt wurde, die er zuweilen in ihren Ateliers besuchte. Nun erst wurde München zur Kunst- und Künstlerstadt, während in Berlin seit 1888 ein eigenwilliger und leicht größenwahnsinniger Kaiser regierte. Bei seinem ersten Besuch an der Isar schrieb Wilhelm II. ins Goldene Buch: »Der Wille des Monarchen ist das höchste Gesetz.« In München galten, besonders in der Kunst, andere Gesetze.
Die Löfflers gehörten zu den Reformjuden, die in Münchens jüdischer Gemeinde die Mehrheit bildeten. Sie hatten eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen, die Mutter aber kochte selbst, denn der Vater legte zumindest daheim Wert auf koschere Küche. Man ging jeden Samstag zur Synagoge, und fast jeden Sonntag gab es ein Familientreffen in einem Restaurant, wo man nicht immer koscher aß. Der Großvater, ein aufgeklärter Mensch und Spinoza-Leser, hatte zu seiner Frau gesagt: »Du musst nicht in den Tempel gehen. Wenn du zu Hause arbeitest, tust du auch etwas für Gott.« Und so hielt es auch noch die nächste Generation. Martas Mutter und deren Schwestern hatten keine Schulbildung bekommen.
Auf der höheren Schule nahm Marta am Religionsunterricht teil. Jeden Sonntagabend bereitete sie sich auf diese Montagsstunden vor, in denen sie etwas Hebräisch und ganze Passagen aus dem Gebetbuch herzusagen lernte, doch ohne Sinn und Zusammenhang. Jüdische Freundinnen hatte sie nur wenige, und in der Schule bekam sie den katholischen Antijudaismus zu spüren. Bei einem Ausflug ins Umland riefen ihr Bauernjungen nach: »Saujüdin, dreckige!« Marta, die sich nicht leicht einschüchtern ließ, rief zurück: »Ihr Sauchristen!« Antwort: »Wollen wir raufen?« Und tatsächlich prügelte sie sich mit ihnen. Die wütende Marta war stärker, als sie von sich selbst glaubte, riss einen Burschen zu Boden, drückte ihr Knie auf seine Brust, was die überraschten Provokateure in die Flucht trieb.
Ein schweres Schicksal, so kam es der jungen Marta vor, hatten die Juden nur anderswo, fern im russischen Osten oder in Frankreich, wo der Armeehauptmann Alfred Dreyfus der Spionage beschuldigt wurde, nur weil er ein Jude war. Ihr Judentum hielten die Löfflers beinahe versteckt, vollzogen die Riten möglichst diskret. Die Mutter genierte sich, wenn der Vater an Pessach laut sang und man die Türen öffnete als Zeichen, dass der Messias willkommen sei. 1903 ereignete sich in der russischen Stadt Kischinjow ein Pogrom. Fünfzig Juden wurden dabei getötet, Hunderte verletzt, viele flohen in den Westen. In der Münchner Synagoge improvisierte der Kantor ein Klagelied, in dem der Name Kischinjow immer wieder vorkam, was bei Marta einen tiefen Eindruck hinterließ. Einige Flüchtlinge gelangten auch nach München. Martas Onkel, ein Bankier, sagte: »Wir wollen diese verdreckten Juden hier nicht haben.« Die zwölfjährige Marta hielt ihm entgegen: »Sie müssen doch schmutzig sein, wenn man sie aus ihrer Heimat vertrieben hat.« Der Onkel erwiderte nichts. Zu Hause aber musste Marta in der Ecke stehen, weil sie Widerworte gegeben hatte. Den Flüchtlingen schenkte man etwas Geld und schickte sie weiter nach Holland. Marta hielt das für ungerecht. Und vor allem: Sie hielt mit ihrer Ansicht nicht hinter dem Berg.
Als sie fünfzehn war, lernte sie auf einem Ball einen selbstbewussten jungen Juden aus dem Osten kennen. Von ihm hörte sie zum ersten Mal, dass sie sich nicht genieren müsse, eine Jüdin zu sein; sie solle vielmehr stolz darauf sein. Wenn sie sich unglücklich fühlte, ging sie in die benachbarte Frauenkirche. Der Innenraum war meist nur schwach beleuchtet. Manchmal übte ein Knabenchor. Sie lauschte dem Gesang und fühlte Trost und Erleichterung. Die gedämpfte Stimmung tat ihr gut. Die Riten und Formen des Gottesdienstes in der Synagoge fand sie streng, der Rabbiner predigte laut und lang, was sie nur einschüchterte.
Ihre Familie besuchte jeden Samstag die Synagoge und achtete die großen Feiertage. Die Hauptsynagoge, die von Reformierten geleitet wurde, lag ganz in der Nähe. Marta und ihre Mutter gingen auch gern zur kleinen Synagoge der orthodoxen Gemeinde, die vor allem von den Familien Fränkel und Feuchtwanger unterstützt wurde. Es gab zwar einen Chor, aber keine Orgel wie bei den Reformierten, und der Rabbi predigte sanftmütiger. Und hier drückte man ihr eine Bibel in die Hand zur eigenständigen Lektüre. Die Atmosphäre war eher wie bei den Katholiken, doch der Raum war dunkel, schlicht und eng. Die Frauen in der Reformsynagoge schwätzten laut, waren eitel, zeigten vor allem ihre neuen Kleider. Bei den Orthodoxen kam Marta eher zur Besinnung, vor allem weil der Betsaal nicht sehr voll war. Später zogen die Löfflers in ein feines Viertel nahe der Isar und der orthodoxen Synagoge. Auf dem Oktoberfest 1904 sah sie ihren ersten Film; eine Art Wochenschau zeigte Das Ende von Jom Kippur. Man sah Mitglieder der Jüdischen Gemeinde München die Treppen der Synagoge hinunterkommen, darunter auch die kleine Marta Löffler.
Interesse für das Judentum war also durchaus geweckt, doch die alte Nähe zur katholischen Kirche hinterließ ebenso ihre Spuren. Ein junger Priester, der an ihrer Schule lehrte und ihr sehr gefiel, lud Marta ein, am katholischen Religionsunterricht teilzunehmen, doch sie scheute davor zurück. Geschichten von Jesus, vor allem aus dessen Kindheit, hörte sie gern. Sie ließ sich von einer Lehrerin in Kirchen mitnehmen, am liebsten zu den Weihnachtskrippen, die, wie alles in München, italienisch geprägt und sehr künstlerisch waren.
Ihre Tochter auf eine öffentliche Schule zu schicken kam für die besorgten Eltern nicht in Frage. Marta besuchte eine Privatschule, in der das Französische im Mittelpunkt stand. Aber auch dort steckte sie sich mit jeder erdenklichen Krankheit an – Scharlach, Masern, Lungenentzündung, und es war jedes Mal gefährlich.
Als Marta das erste Mal den Klassenraum betrat, wusste sie nicht, dass jede Schülerin einen festen Platz hatte. Sie lief im Zimmer umher und brachte dem Lehrer eine Blume. Der aber gab ihr eine Ohrfeige, weil sie nicht still auf ihrer Bank sitzen blieb. Die Schule hieß Siebert-Institut, nach ihrer Besitzerin, einer stets eleganten Dame, die alle Schülerinnen einschüchterte. Zu Marta sagte sie: »Schämst du dich nicht, als Angehörige meiner Schule einen Apfel auf offener Straße zu essen!« Zur Strafe gab es Hiebe auf die Innenfläche der Hand. Schlagstöcke waren durchaus üblich im Klassenzimmer.
Doch Marta verschaffte sich mit ihren guten Leistungen allmählich den Respekt und die Zuneigung der Lehrerinnen – bis zu dem Augenblick, in dem ein sehr schönes Mädchen neu in die Klasse kam. Sie stammte aus einer getauften jüdischen Familie, die von Stuttgart nach München gezogen war. Eine zweispännige Kutsche brachte diese kleine Prinzessin jeden Morgen zur Schule. Nun hatten die tief religiösen Lehrerinnen keinen Blick mehr für Marta, die sich zurückgesetzt fühlte und todunglücklich war. Aber sie lernte, wie wichtig es ist, bei Auftritten Effekt zu machen.
Dass sie ihren Körper kräftigen musste, wusste sie von sich aus. Sie machte ihre Gymnastikübungen zunächst an den Zimmertüren daheim. Nach ihrem zwölften Geburtstag trainierte sie zweimal die Woche in einem Sportclub und besuchte eine Tanzschule. Der Doktor hatte den Eltern geraten, Marta nicht den ganzen Tag allein zu Hause hocken zu lassen. Sie selbst sagte später, sie habe sich als Mädchen nicht diskriminiert gefühlt, weil damals in Bayern niemand auf solche Gedanken kam. Sie sei die beste Gymnastin von München, sodann von Bayern, schließlich von ganz Deutschland geworden, erinnerte sie sich. Nun ja, sie gewann 1905 in München einen Wettbewerb, an dem auch Mädchen aus Berlin und anderen deutschen Städten sowie aus Japan teilgenommen hatten. Für ihre Leistungen zeichnete sie der Prinzregent mit einer Brosche aus, auf der die Turnerdevise »Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei« zu lesen war. Hinter dem Regenten, dem sie Blumen überreichte, stand ein Adjutant mit Federhelm und zwinkerte ihr zu. Ein Jahr später gewann sie beim jährlichen Abturnen einen Tennisschläger und ein Buch über Adalbert Stifter.
Als Martas Trainerin Lisa Fries, eine erfahrene Alpinistin, einen Sturz im Gebirge schwerverletzt überlebte, konnte Marta für ein Jahr deren Rolle als Vorturnerin übernehmen, was für eine Vierzehnjährige eine große Verantwortung bedeutete. Zu ihren Schützlingen gehörte auch Therese Gift, die Gymnastik zutiefst hasste; als Schauspielerin nannte sie sich später Therese Giehse und wurde Brechts erste Mutter Courage.
Im ersten Jahr von Martas Vereinsmitgliedschaft sollte der Club eine Exkursion machen. Eine Freundin sagte ab, sie könne nicht kommen, sie sei zu einer Feier bei Henny Feuchtwanger eingeladen. Ein Mädchen entgegnete: »Ach, diese Dreckjüdin.« Marta, um eine Rauferei nie verlegen, sprang der Älteren und Größeren an die Gurgel, warf sie zu Boden und rief: »Nimm das sofort zurück!« Die andere gab kleinlaut bei, aber Marta hatte sich im Kampf ihre Kette zerrissen, und alle Perlen kullerten auf den Boden. Gemeinsam sammelten die Mädchen sie auf, denn ihre Angst vor den Eltern war noch größer als ihre Wut. Marta hatte die Ehre von Lions Familie verteidigt, lange bevor sie diese kannte.
Die Aufklärung geschah damals meist durch die Hausmädchen. Die älteren Schülerinnen tuschelten vor Marta über ihre Menstruation, wollten auf ihre Nachfragen aber nicht antworten: »Dafür bist du noch zu klein.« Eine Freundin allerdings setzte sich neben sie auf eine dunkle Hintertreppe und erzählte, was sie über die Geheimnisse der Erwachsenen wusste. Marta verstand es nicht genau und wollte lieber ihrer Mutter glauben, die behauptete: Die Kinder bringt der Storch. Sie musste es ja wissen. Einmal sagte die Mutter zu einer kinderreichen Bäuerin, die einen Korb mit Waldbeeren brachte: »Und nun erwarten Sie ein weiteres Kind?« Marta fragte später: »Wie kannst du das wissen? Ist das Kind im Bauch?« Die Mutter verneinte das, und Marta gab sich zufrieden. Einmal aber hörte sie, wie es im Zimmer des Hausmädchens schrie und stöhnte. Die Mutter sagte: »Da ist ein Soldat zu Besuch.« Und Marta dachte nur: »Na, warum nicht?«
Hatte sie das Zeug zu einer Lolita? Der Cousin ihres Vaters, Abraham Landauer, der einst ihre Mutter hatte heiraten wollen und den sie Onkel nannte, saß mit der zehnjährigen Marta auf dem Rücksitz der Kutsche und hielt sehr warm ihre Hand. Sie fühlte, dass es nicht recht war. In seiner physischen Erscheinung stand jener Abraham später Modell für Lions Romangestalt Jud Süß. Der Onkel beriet Martas Vater in juristischen Fragen, seine Frau hielt einen französischsprachigen Konversationszirkel, zu dem sie die junge Marta einlud. Bei solchen Berichten aus ihrem Leben wird man das Gefühl nicht los, dass einem nur die sprichwörtlichen Eisbergspitzen gezeigt werden.
Freundinnen durften Marta zu Hause nicht besuchen, so groß war die Angst der Eltern vor ansteckenden Krankheiten. Trotz aller Vorsicht erkrankte Marta lebensgefährlich an Scharlach. Da kam aus der Schweiz, wo er als Kinderarzt praktizierte, ein Vetter ihrer Mutter angereist, Siegfried Oberndorfer, später Professor und Leiter des Staatlichen Krankenhauses in München. Er trat nicht zum Christentum über und machte doch Karriere – eine Ausnahme in der damaligen Zeit, die ihm viele Neider bescherte. (Ein anderer Vetter der Mutter, Siegfried Lichtenstädter, hätte Finanzminister von Bayern werden können, wäre er bereit gewesen zu konvertieren, aber das tat er nicht.) Die lebensrettende Behandlung beeindruckte Marta so tief, dass sie nun auch Ärztin werden wollte. In ihrer Klasse war die Tochter eines Dentisten, die später in einer Jungenklasse das Abitur machen und studieren konnte. Sie übernahm dann die Praxis ihres Vaters und wurde Martas Zahnärztin. Gern hätte auch Marta studiert und war neidisch auf einen Vetter, der das durfte. Aber ein Studium hätten die Eltern nie erlaubt, auch weil Marta es dann mit jungen Männern zu tun bekommen hätte.
Anna, eine Schwester Siegfried Oberndorfers, die als Kind Polio gehabt hatte und zwergenhaft klein geblieben war, besuchte Marta hin und wieder. Sie war sehr belesen, und Marta lernte viel von ihr, auch das Kochen. Nicht einmal wenn sie am Herd stand, legte Anna ihre Lektüre aus der Hand. Lag Marta krank im Bett, kam sie und erzählte Geschichten aus der griechischen Mythologie. In Annas Gegenwart trank Marta sogar Milch, die sie sonst verabscheute.
Zu Hause gab es nur wenige Bücher. Dem Vater gefiel es gar nicht, dass Marta so viel las. »Wenn ein Mädchen zu viel weiß, findet es keinen Mann«, sagte er und schraubte die Glühbirne aus ihrer Lampe, aber sie las mit der Taschenlampe unter der Bettdecke weiter. Zur verbotenen Lektüre gehörte neben Schiller auch Goethes Faust, in dem bekanntlich eine Unverheiratete geschwängert wird. Eben das geschah Marta später, nutzlose Vorsicht … Die Eltern hatten im Theater eine Loge abonniert, und Marta begleitete sie regelmäßig. Sie sah klassische Stücke, hörte alte und neue Opern. Sie erlebte die Münchner Premieren von Salome, Elektra und Rosenkavalier. Museen besuchte sie nie, die berühmtesten Bilder kannte sie nur von schlichten Reproduktionen. Hingegen war es ein großes Erlebnis, als sie bei einem Maskenball den Maler Franz von Stuck kennenlernte. Erfolgreiche Künstler zu bewundern war eine Schwäche von ihr.
Auf der Straße Fremde anzusprechen galt damals als ungehörig, Marta tat es trotzdem, als sie schon ein »Fräulein« war. Sie sah in Schwabing, wie die Studenten ihre Bilder auf dem Bürgersteig zum Verkauf anboten, und suchte das Gespräch mit ihnen, ließ sich sogar auf Spaziergänge mitnehmen, wusste aber Distanz zu wahren. Sie hielt wenig von allzu schön aussehenden Jungen. Fürs Tanzen und Flirten waren sie in Ordnung, aber tiefere Gefühle fand man nicht bei ihnen. Ihr kamen die jungen Männer meist ziemlich dumm vor, immerhin konnte sie von ihnen dies und jenes lernen.
Fotos aus der Zeit vor 1910 zeigen Marta in eleganten Kleidern und mit großen Hüten, ganz im Stil der Belle Époque. Ein modischer Auftritt kann das Selbstbewusstsein durchaus stärken. Sich selbst schätzte Marta als gutaussehend ein, doch ihrem eigenen Schönheitsideal entsprach sie nicht. Sie fand, sie habe einen Eidechsenkopf und ihr Mund sei zu groß. Sie mochte schwarzes Haar nicht sonderlich, doch ihre Haare schimmerten in bläulichem Schwarz. Ihr Kopf war rundlich, fast oval, die hohe Stirn wurde durch das meist nach hinten gelegte Haar noch betont. Sie hatte stark gerundete Wangen und breite Lippen sowie eine leicht vorspringende Mundpartie. Ihr offener Blick zeigte einen Hauch von Strenge, gemildert durch eine Prise Spott. Auf jeden Fall wusste sie, wie man Eindruck macht, auch wenn sie angeblich nicht verstand, warum sie auf viele Männer so anziehend wirkte. Dass sie Erfolg bei den Männern hatte, verschaffte ihr einen schlechten Ruf. Im Theater wurde sie immer abgepasst. Ihren ersten Kuss erhielt sie mit neunzehn. Man schickte ihr Blumen, Geschenke und Süßigkeiten, das gefiel sogar den Eltern. Als sie schon verheiratet war, schrieb ihr ein ehemaliges Hausmädchen: »Liebes Fräulein Marta, gehen Sie immer noch jeden Abend mit einem anderen Jungen aus?«
Als Marta noch ein Kind war, kämpfte sie auf der Straße mit Jungen, laut schimpfend und fluchend. Da kam ein Mann vorbei, sehr klein, mit weißem wolkigem Haar, blieb stehen und sagte streng: »Ein Mädchen sollte nicht so laut schreien!« Dann ging er weiter, und Marta spielte wie zuvor, aber seinen Kopf und seinen Blick vergaß sie nie. Jahre später sah sie eine Zeichnung auf dem Titelblatt der Zeitschrift Die Jugend: Sie zeigte jenen Mann von damals – und es war Ibsen. Es hieß, er besuche oft ein Café in der Maximilianstraße, nahe dem Königlichen Theater. Sie ging hin, sah ihn am Fenster sitzen und schreiben. Das war der Dichter der Nora, und er wollte nicht, dass Mädchen auf der Straße Lärm machten!
So hat Marta das Erlebnis einem Interviewer erzählt, der ihr widersprach mit Daten aus dem Leben des Dramatikers, die nicht zu ihrer Erinnerung passten. Da wurde sie nachdenklich, Ibsen war es dann doch nicht. Der Fremde hatte ihm nur ähnlich gesehen. Aber vielleicht hatte sie schon damals die Vision: Einst würde ein großer Literat kommen, sie ansehen, mit ihr reden, ihren Wert erkennen. Sein Schicksal ergreift nur, wer es von ferne ahnt.
Morgenroth
»Die Reinheit ihres eirunden Gesichts, die niedrige, schimmernde Stirn, die langen Augen, der üppig vorspringende Mund …«
L. F., Der jüdische Krieg
»Mein Leben begann mit dem Tag, an dem ich Lion das erste Mal traf.« Da Marta Feuchtwanger dies wiederholt gesagt und geschrieben hat, sollte man es nicht leicht abtun. Nur auf dem Umweg über diese Abhängigkeit wurde sie frei, ohne ihre Herkunft verleugnen zu müssen. Nur diese Bindung ermöglichte ihr ein eigenständiges Leben. Doch auch Lions Leben nahm eine andere Richtung nach dieser schicksalhaften Begegnung.
In ihren Memoiren schildert Marta Feuchtwanger die Anfänge ihrer Affäre mit Lion besonders romantisch. Erinnerung ist eine Form der Kreativität. Sie folgt oft dem Wunsch, noch einmal den Anfang zu erleben, der alles Kommende bestimmte, die eine Szene, die entscheidenden Worte. Aber da gibt es Lions Tagebuch, das die Beckmesserei des Biographen herausfordert.
Der Mann, den Marta Löffler kennenlernte, war zunächst ein Gerücht, ein bunter Hund aus der Zeitung, ein Skandalmacher. Er hatte noch nichts geleistet, aber sein Ruf war bereits ramponiert. Sohn reicher Leute, mit seiner Familie verkracht, ein überall verschuldeter Spieler, ein Tausendsassa, ein Mann, der viele Frauen liebte. Hatte so jemand eine Zukunft, bot er eine? Der Fünfundzwanzigjährige lebte von kleinen Artikeln und der Hoffnung auf künftige Schreib-Taten.
Im Jahr 1909 berichteten die Münchner Neuesten Nachrichten, mit einer Auflage von über 100000 damals die größte Tageszeitung in Bayern, von einem Eklat im Fasching. Lion Feuchtwanger hatte mit einigen Freunden den Verein Phoebus gegründet, unter dem diskreten Patronat des Ministers von Crailsheim. Man lud Autoren zu Lesungen ein, Alfred Kerr etwa, der für die Errichtung eines Heinrich-Heine-Denkmals in Hamburg warb. Man las aus eigenen Werken, widmete sich dem Theater und feierte Feste. Ein Unternehmer namens Huber suchte Lion auf und schlug vor, einen großen Ball zu organisieren. Aber kaum hatte das Fest begonnen, rissen die Arbeiter der Dekorationsfirma die Girlanden herunter, weil sie nicht bezahlt worden waren. Der Skandal war da, die namhaften Gäste garantierten ein stadtweites Echo.
Lion war auf einen Schwindler hereingefallen, aber das stellte sich erst Monate später heraus, nach einer quälend langen Untersuchung und einem Prozess. Die Presse machte den Vereinsvorsitzenden Lion Feuchtwanger verantwortlich, das »Margarinebarönchen«, wie ihn der aus Berlin zugereiste Sozialdemokrat Kurt Eisner in der Münchner Post unter Anspielung auf die Margarinefabrik des Vaters nannte. Eisner meinte, dieser reiche Schlingel solle gefälligst seine Arbeiter bezahlen. Schließlich wurde Huber angeklagt und erhielt trotz seines dreisten Auftretens vor Gericht eine Gefängnisstrafe. Später kam er zu Lion und bedrohte ihn mit einem Revolver, doch der schob ihn nur verächtlich beiseite. Lions Ruf aber war beschädigt, der Vater musste für die entstandenen Kosten aufkommen.
Marta hatte bei einer Freundin Lions Schwester Franziska kennengelernt. Sie trieben gemeinsam Sport und luden sich gegenseitig nach Hause ein. Von ihren Brüdern mochte Franziska vor allem Ludwig, genannt Ludschi. Wenn man etwas wissen wolle, müsse man zu Ludschi gehen, nie zu Lion, der sei aufbrausend und hochfahrend, antworte auf Fragen nur: »Das verstehst du eh’ nit.« Ludschi hingegen, ein kluger, ernster Mann, beantwortete geduldig jede Frage.
Mädchenbesuch gab es öfter bei den Feuchtwangers, und manche wird gehofft haben, einen der fünf Feuchtwanger-Buben heiraten zu können. Anfang des Jahres 1910 traf Lion, der nicht mehr bei den Eltern wohnte, seine Schwester Franziska auf der Straße. Diese sagte: »Ich gebe ein Fest mit Musik und Tanz, ich habe dazu eine Freundin eingeladen, Marta Löffler, vielleicht möchtest du sie kennenlernen?« Lion antwortete nur: »Ach, diese Backfische, die sind doch langweilig.« Die Mutter aber bat ihn, an jenem Abend zu kommen, um den Familienzusammenhalt zu bewahren. Sie also spielte Schicksal.
Marta war neugierig auf den schwierigen Jungen, aber der ließ sich zunächst nicht blicken. Ein anderer junger Mann stellte sich ihr vor, eine bleiche, schlaksige Gestalt, verlegen und gutmütig. »Mein Name ist Adolf Hartmann-Trepka, ich bin Erster Geiger beim Hofopernorchester. Leider bin ich ein schlechter Tänzer, aber darf ich Sie zu einem Glas Punsch einladen?« Er durfte. Der Geiger brauchte moralische Unterstützung. »Gehen wir doch an den Tisch dort drüben, da sitzt mein Freund Lion.« Marta schaute auf den schmächtigen, fahrigen Brillenträger. Seine gewölbte Stirn war sehr hoch, kleine Hügel neben seinen Mundwinkeln verliehen ihm ein spöttisches Aussehen. Sie wurde vorgestellt und hatte dabei Herzklopfen. Aber der Bursche sagte nur zu seinem Kameraden: »Jetzt ist ja dein Wunsch erfüllt.« War es nur eine Wette unter Männern? Der Geiger hatte schon eine Weile für Marta geschwärmt, einen Sonntag lang war er heimlich der Familie Löffler im Park nachgegangen.
»Er hat einen guten Geschmack, wie man sieht«, knurrte Lion. Nur nicht schmeicheln schien seine Devise zu sein, lieber raunzen als säuseln. Dann sagte er ungalant: »Ich kenne Sie und mag Sie nicht. Ich sah Sie bei einer Ausstellung und beim Promenadenkonzert. Und ich mag kein schwarzes Haar, sondern nur blondes.« Marta entgegnete schnippisch: »Tut mir leid, aber ich behalte meine Haarfarbe.«
Lion: »Finden Sie es hier nicht langweilig? Diese Mädchen machen zu viel Lärm.«
Marta: »Finde ich nicht.«
Lion: »Wir sollten anderswohin gehen.« Er hatte längst die Regie übernommen, Hartmann-Trepka ließ ihn gewähren. »Gehen wir in eine Weinstube. Dort kann man ja sehen, ob dieses Fräulein Löffler hält, was ihr Äußeres verspricht.«
Marta war neunzehn Jahre alt. Sie war noch nie ohne die Eltern in einem Restaurant gewesen. Und mit Männern hatte sie sich ohnehin nur tagsüber verabredet. Darauf Lion: »Oh, Sie sind bürgerlich!« Es war eine Herausforderung und eine Probe, das hatte Marta längst begriffen. So gingen sie in ein Lokal, und Lion bestellte Wein für alle drei. Marta sagte kein Wort, ließ die beiden anderen reden, denen ihr souveränes Schweigen gefiel.
Es blieb nicht beim Reden. Der Geiger begann, ihre Hände zu küssen. Nun musste sie sich etwas einfallen lassen. »Herr Feuchtwanger, warum beschützen Sie mich nicht vor Ihrem Freund?« Dann lief sie davon. Lion bezahlte in Eile. Die Freunde rannten ihr nach, aber vergebens, die gut trainierte Marta war auch im Ballkleid schneller als sie. Allein kam sie zu Hause an, neugierig auf den weiteren Gang der Dinge.
Lion fand ihren Geburtstag heraus und schickte Parmaveilchen aus Italien, die Ende Januar selten und teuer waren. Bald schickte er ihr auch eine Karte aus Italien. Das fiel zu Hause auf. Bei den Löfflers hieß es nur: Feuchtwanger – der hat doch so einen schlechten Ruf.
Während Lion, vermutlich mit einer Freundin, in Italien war, kurte Marta mit ihren Eltern in einem fränkischen Badeort. Dort gab es eine kleine Liebelei mit einem jungen Mann, der sich aber als seelisch labil erwies, so dass Marta vor ihm beschützt werden musste. Der Vorfall erschreckte sie nachhaltig. Kaum war sie zurück in München, als Lion sie anrief. Er lud sie zu einem Ausflug ins Isartal ein. Es war ein hoher jüdischer Feiertag, erinnerte sich Marta vage. Aber sie wanderten ins Grüne, statt zu fasten und zu beten. Der Glaube aneinander wurde ihre neue Religion. Am Abend folgte sie Lion auf sein spartanisches Zimmer. »Dort begann unsere Ehe«, erzählte sie viele Jahrzehnte später. In Lions Tagebuch nimmt sich die Sache etwas anders aus.
Lion war nicht Martas erste Affäre. Als sie sich schon einige Wochen kannten, gestand sie ihm mit »freundlicher Offenheit«, wie er Ende Oktober 1910 notierte, den Namen und die Adresse eines verflossenen Liebhabers namens Karl Lang, der inzwischen in Paris lebte. Der erste war aber auch Lang nicht. Im August 1911 erzählte sie Lion »mit sehr amüsanter, geschmackvoller und überlegener Amoralität von ihrem ersten Verhältnis mit Sternheim«. Carl Sternheim, der erfolgreiche Dramatiker, war ein großer Frauenheld und vermutlich Martas erste Liebe. Lion notierte es ohne jeden Anflug von Eifersucht.
Diese Episoden aus ihrer Jugend erwähnte Marta später nie. In einem Brief an Kadidja Wedekind vom 14. März 1980 heißt es: »Ich erinnere mich, dass Wedekind in einer geschlossenen Gesellschaft Schloss Wetterstein vorlas. Das war noch, bevor ich Lion kannte. Er war da als Kritiker; auch Sternheim, den ich kannte, sah ich zufällig mit einem Abendcape und Chapeau-Claque in die Vier-Jahreszeiten-Bar gehen, wo die Vorlesung stattfand. Während dieser Vorlesung war ein Erdbeben – fabelhafter Regieeinfall. Der Schlüsselbund am Büffet in meiner Eltern Haus hat lange hin und her geschwankt.« Sternheim besuchte 1909 Faschingsbälle in München; dabei mag ihn Marta kennengelernt haben.
Zu der Zeit, als sie Lion näher kam, den sie zuvor bei der erwähnten Lesung von Frank Wedekind zumindest wahrgenommen hatte, war dieser in mehrere Affären verstrickt. Wir wissen es, weil er über sein Sexualleben sehr genau Buch führte. Am 19. Januar 1910 taucht Marta erstmals in seinem Tagebuch auf: »Abends lang vorbereitete größere Gesellschaft bei uns in der Galeriestraße. Mit Hartmann-Trepka und einem Fräulein Löffler, einer nicht eben gescheiten, aber recht temperamentvollen jungen Jüdin. Sie hernach ins Café geschleppt und schließlich tüchtig abgeküsst.« Da Lion ihm Marta wegnahm, nahm Hartmann-Trepka den Freund beim Kartenspiel aus. Das war eine Art unausgesprochener Pakt. Schon am nächsten Tag schrieb Lion ein Chanson, in dem er Marie, für die er gerade schwärmte, und seine neue Bekanntschaft zu einer Person verdichtete. Ein lyrisches Meisterstück war es nicht.
Fräulein Marta Marie lag kühl und keusch
Im weißen jungfräulichen Bettchen.
Unterm Fenster sang ein verliebter Poet
Ein zirpendes Menuettchen. […]
O kleine Marta Marie!
Dein Haar ist schwärzer als schwärzeste Nacht
Und weißer Dein Hals als von Schwanen.
Dein Busen wie seiden Wellengekos.
Den Rest kann ich leider nur ahnen. […]
Lass Deine Gliedlein nicht ungegrüßt
Der zitternden Sehnsucht entschwinden! […]
Wer ungeküsst und ungekost
Solche Schönheit lässt welken, verderben,
Verdiente besser, so jung er ist,
In aller Blüte zu sterben.
O kleine Marta Marie!
Lion bot das Gedicht der Zeitschrift Jugend an, aber weder dieses noch ein anderes Blatt hat es jemals abgedruckt (anders als Marta behauptete). Bei Marie, einer prüden Katholikin, deren Eltern den Umgang mit einem Juden missbilligten, hatte er übrigens kein Glück, sosehr er sich auch bemühte.
In diesen Wochen erreichte der Phoebus-Skandal seinen Höhepunkt, die Münchner Zeitungen waren voller Schmähungen, es ging um Betrug und Meineid, und zugleich ächzte Lion unter wachsenden Spielschulden; Hartmann-Trepka nahm ihn gnadenlos aus. Außerdem zerschlugen sich alle Hoffnungen auf eine Universitätskarriere. Er wirkte nicht wie jemand, der einer Frau eine Zukunft bieten konnte. Fräulein Löffler schien der schlechte Ruf ihres neuen Freundes nicht abzuschrecken. Sie ging mit ihm Ende Januar zum Maskenfest der Concordia. Ein paar Tage später stürzte Lion auf glattem Boden, brach sich den Unterarm und verpasste deshalb das Faschingswochenende, an dem sich Marta gewiss auch ohne ihn amüsierte.
Im Februar 1910 schrieb Lion die Novelle Die große Passion des Klavierspielers Morgenroth, in der er aus seiner Rivalität mit Hartmann-Trepka (alias Morgenroth) eine Schnurre machte. Marta Löffler heißt hier Marianne Gabler, Lion erscheint als der smarte Rechtsanwalt Ludwig Munk, der der jungen Frau den Hof macht, aber zu feige ist, sie vor einer Horde Zudringlicher zu schützen. Hingegen erweist sich der Klavierspieler Morgenroth, der sie schon lange angeschmachtet hat, als ihr Ritter und Retter. Er sorgt für die Musik bei einem Ball der Gablers, doch als der Musiker zur Belohnung mit der Tochter des Hauses ausgehen darf, verspielt er durch Ungeschick alle Chancen, und sie entschwindet in der Ferne, reist nach Italien, womöglich mit dem Feigling Munk?
Der junge Lion, meinte Marta, hatte nur zwei Freunde, den Sänger Monheimer und den Geiger Hartmann-Trepka, der ihn beim Kartenspielen unablässig betrog. Doch trotz allen Zwistes und heimlicher Rivalität blieben sie Freunde. Marta erinnerte sich auch, dass Hartmann-Trepka ein guter Schwimmer und Taucher, aber ein schlechter Skifahrer war, doch machte sie ausgiebige Bergwanderungen mit ihm. Er war nicht sehr groß, erschien aber sehr kräftig mit seinen breiten Schultern. Auf seine Weise war er schön, wusste sie noch – er muss sie also durchaus beeindruckt haben.
Martas Umgang mit Lion beschränkte sich zunächst auf Telefonate, gelegentliche Spaziergänge und kleine Ausflüge. In seiner Novelle, die er am 19. Februar beendete, war die Phantasie der Realität weit voraus. Seine Spielschulden nahmen in diesen Tagen beängstigende Ausmaße an. Er gewann nur selten, aber das Kartenspielen war eine Sucht, und er wusste es selbst: »Wieder gespielt und verloren. Unerträglich. Wenn mich auch meine chronische finanzielle Misere einigermaßen entschuldigt, so habe ich mir doch das Wort gegeben, nicht mehr zu hasardieren. Ebenso werde ich das ewige Onanieren aufgeben und mehr arbeiten«, heißt es am 30. März 1910. Das Ich ist analytisch klarsichtig, aber das Über-Ich ist arg ohnmächtig. Wenn sich Lion Besserung vornahm, hielten die guten Vorsätze oft nur Stunden. Spiel- und Sexsucht waren unbezwingbar, aber willensschwach kann man ihn trotzdem nicht nennen, zumindest was das Schreiben angeht. Literarische Erfolge blieben aber vorerst aus: Auch die selbstironische Erzählung über den Klavierspieler Morgenroth wurde von den Münchner Neuesten Nachrichten abgelehnt.
Inzwischen hatte Lion ein Zimmer in der Gewürzmühlstraße gemietet, nicht weit vom Elternhaus entfernt. Am 31. März teilte ihm das Landgericht mit, das Verfahren in Sachen Phoebus-Skandal sei eingestellt – Ende eines Alptraums. Am 25. Mai notierte er: »Mit Marta Löffler spazieren gewesen. 2 ¼ Stunden lang. Sie war sehr liebenswürdig, ohne dass es jedoch zu einer ernsthaften Annäherung gekommen wäre.« Alle paar Tage leistete er sich eine Hure, zuweilen übernachtete eine Emmy G. bei ihm, eine Art mütterliche Geliebte. Am 24. Juni verlobte sich Hartmann-Trepka, Marta und Lion waren bei der kleinen Feier anwesend. Als Paar traten sie noch nicht auf, ihr Verhältnis blieb einige Monate geheim, und Lion ärgerte sich über »dreckige Anspielungen« seines Vetters.
Am 4. August notierte Lion: »Mein ganzes Hab und Gut, alle meine Bücher usw. verspielt. Nun aber den festen Entschluss gefasst, keine Karte mehr zu berühren.« Von den dreißig Mark, die er ein paar Tage später erhielt, wurden zwanzig gleich wieder verspielt. Dabei hatte er sich doch hoch und heilig geschworen, und wenn tausend Teufel ihn verlockten, keine Karte mehr anzurühren und auch nicht mehr zu onanieren. Geld ausgeben wolle er nur noch, wenn er mit den beiden Damen ausgehe, die ihn beschäftigten, Marta und Marie. »Meine Vorsätze natürlich nicht gehalten«, hieß es bald.
Spielschulden gehörten zum damaligen Studentenleben – man spielte Poker, Ecarté und Baccarat – ebenso wie die Liebesabenteuer der jungen Herren, die von den Familien stillschweigend geduldet wurden. Zufrieden war Lion nicht mit diesem Leben, dem jede Orientierung zu fehlen schien. Die Verwirrung steigerte sich, als im August 1910 seine Schwester Franziska heiratete. Am 19. August notierte er: »Ernsthaft den Gedanken gefasst, mit einem sehr reichen, hässlichen Mädel mich zu vermählen; ihn aber wieder fallengelassen.« Körperliche Hässlichkeit hat ihn oft beschäftigt, auch in seinem späteren Werk.
Eine Heirat aus Geldnot, die Triebe würde er anderswo befriedigen – es war bittere Selbstironie. Dennoch sprach er mit Marie und mit Hartmann-Trepka und auch mit seiner Mutter über diese Absicht. Eine Lebenswende kündigte sich an, aus innerer wie äußerer Notwendigkeit. Zugleich wollte er Ernst machen mit dem Schreiben und seinen ersten Roman veröffentlichen, doch musste er sich an den Druckkosten beteiligen. Immerhin: »Papa will mir 400 Mark für den Roman geben, Hartmann 100, Hahn 250.« Die beiden letzteren wollten das Geld aber nur leihen, nicht schenken. Wenig später ließ er sich beim Baccarat ausnehmen: »Falschspielern in die Hände gefallen, die, als ich gewinne, mich nicht nur um den Gewinn, sondern auch um einen Teil meines Geldes prellen.« Es war die Komödie eines lächerlichen Mannes. Doch Marta schien das alles nicht zu beirren, falls sie es wusste. Am 1. Oktober notierte Lion: »Mit Marta Löffler nach Grünewald gefahren; geküsst und gekost. Sie war halb ohnmächtig vor Erregung und sehr willfährig.« Das hinderte ihn nicht, noch am selben Abend mit Marie ins Theater zu gehen. Doch die Beziehung zu Marta machte rasch Fortschritte: »Mit Marta, die mir ein sehr liebes Kärtchen schreibt, unerwarteter Weise sehr viel zusammen. Sie folgt mir sogleich auf mein Zimmer und ist sehr willig«, heißt es am 8. Oktober. In den nächsten Wochen wurde die Verbindung enger. Zuweilen geschah es, dass Marie die Treffen störte. Am 3. Dezember stellte Lion fest: Marta öfter da, »die ich wegen ihres offenen, herzlichen, lieben Wesens von Tag zu Tag mehr lieb gewinne; die Sorge, ich möchte von ihr ein Kind bekommen, bedrückt mich kaum.«
Anfang Januar 1911 trübte ein Zwischenfall die junge Romanze. Lion ging mit Marta zum Faschingsball, sie hatte sich ein prachtvolles orientalisches Kostüm geschneidert. Er fand sie hinreißend, kümmerte sich aber nicht genug um sie. Folge: »Marta ging mir mit Bonsels durch; ich war verstimmt, benahm mich aber wohl sehr geschickt.« Der Rheinländer Waldemar Bonsels hatte 1904 in München einen kleinen Verlag gegründet, in dem er vor allem die Werke seiner Freunde, aber auch Schriftsteller wie Heinrich Mann edierte. Nach 1912 erlebte er seinen nachhaltigsten Bucherfolg mit der Biene Maja. Lion Feuchtwanger hatte ihm seinen ersten Roman anvertraut, Der tönerne Gott, der schließlich 1910 erschien, unter finanzieller Beteiligung des Autors, was zu Spannungen und Konflikten führte. Aber was geschah auf jenem Maskenball mit der Biene Marta?
Zunächst einmal hatte Marta sich im Thema geirrt. Angekündigt war ein Dienstbotenball, sie aber hatte das Kostüm einer ägyptischen Sklavin gewählt. Sie trug ein enges Kleid in Grün und Violett, dazu ein goldenes Haarband, Sandalen ohne Socken. Ihr Auftritt machte Furore, aber man ließ sie nicht ein, denn sie war ja nicht als Dienstbotin gekommen. Lion trat hinzu und wollte die Situation klären. Aber da tauchte Waldemar Bonsels auf, gerade als Lion von einer ihm bekannten Aktrice gerufen wurde, die ihn dem Schauspieler Alexander Moissi vorstellen wollte. Lion, der sich als künftiger Theaterautor sah, ließ sich diese Chance nicht entgehen.
Bonsels lud Marta unterdessen in ein Restaurant neben dem Ballsaal ein. Er spendierte Kaviar und Champagner. Er kaufte Blumen und machte ihr Avancen. Ihre Zurückhaltung langweilte ihn bald, und er brachte sie zurück, allerdings über einen dunklen Gang, in dem viele Pärchen schmusten. Auch das konnte Marta nicht beeindrucken; sie suchte Lion, der inzwischen abgetaucht war. Bonsels Freunde taten alles, damit sie sich nicht so schnell fanden. Schließlich entdeckte Marta ihn, er brachte sie nach Hause, blieb ganz kühl, sagte kein Wort, fragte nichts. Bonsels aber hatte die Angewohnheit, ein Kleidungsstück seiner neuesten Eroberung zu präsentieren, und nun zeigte er ein grünes Hemd, das angeblich Marta gehörte. Lion erfuhr davon, es kam zu einer Aussprache, und seitdem, resümierte Marta die Angelegenheit später, herrschte völlige Offenheit zwischen ihnen. Noch Jahrzehnte später kam sie auf diesen Vorfall zu sprechen und leugnete jedes Abenteuer. Aber sie gab nie eine Affäre zu, dementierte insbesondere jene ausdrücklich, die am wahrscheinlichsten waren und von denen andere zu wissen glaubten. Auf Nachfrage sagte sie höchstens: »Nun ja, wir haben beide nicht immer das Rechte getan.« Und lachte.
Zwei Wochen später passierte Lion ein ähnliches Missgeschick, diesmal schnappte ihm sein Vetter Willy Bodenheimer bei einem Ball im Deutschen Theater Marta weg. Und Lion konnte sich bewusst werden, wie viel ihm an ihr lag. Und hatte doch immer wieder mal eine »teure Dirne« oder eine Nacht mit Emmy. Ende März 1911 unternahmen Lion und Marta wieder einen Ausflug ins Isartal. »Marta sehr lieb«, heißt es danach, und es mag jener Ausflug gewesen sein, der ihr besonders im Gedächtnis blieb, auch wenn es kein Feiertag war.
Marta begleitete Lion zu Treffen mit anderen Autoren in das »Fränkische Weinhaus zur Torggelstube«, wie der Künstlertreff neben dem Hofbräuhaus seit 1898 hieß. Dort traf man Frank Wedekind oder Heinrich Mann, aber auch Erich Mühsam und andere Schwabinger Gestalten. Wedekind starb schon 1918 an den Folgen einer Operation. Noch am Vorabend war er bei Feuchtwangers zum Tee gewesen und hatte gesagt, seine Frau solle, wenn sie von der Kur kommt, einen gesunden Mann vorfinden. Besser als ihn lernte Marta seine Witwe Tilly und die beiden Töchter kennen, die er seltsam Anna Pamela und Fanny Kadidja genannt hatte, damit sie einen Namen als Hausfrau und einen als Künstlerin zur Auswahl hätten, je nach ihrer Laufbahn. Mit dem Tod von Wedekind und Franziska zu Reventlow endete 1918 eine ganze Epoche der Münchner Kunst- und Künstlergeschichte.
1911 lud Lion Marta nach Salzburg in die Oper ein. Gespielt wurde Jacques Offenbachs Operette Die schöne Helena in einer Inszenierung von Max Reinhardt. Marta trug einen großen Straußenfederhut, eine sogenannte Pleureuse. Dazu hatte sie sich ein schwarzes Kleid genäht, ging als Einzige mit Schleppe und fiel dadurch sehr auf. Lion strahlte im Glanz seiner Begleiterin, aber Marta glaubte im Rückblick, dass sie beide damals eher lächerlich gewirkt hätten. Man hielt sie für eine ausländische Schauspielerin, und sie war doch nur die Tochter eines Tuchhändlers aus München. Damals aber genoss sie ihren ersten großen Auftritt, erschien als exotische Schönheit. Fremde Eleganz schien sie von Natur aus zu verkörpern, ihr Leben lang, überall, und sie wehrte sich nicht dagegen, sondern sie spielte damit. Was aber war das Geheimnis ihrer Wirkung? Vielleicht dass sie so klug zu schweigen verstand (denn sie sprach ein breites Münchnerisch)? Oder dass sie einfach ein liebendes und kennerisches Verhältnis zu Stoffen, Farben, Kleidern und von ihrer Mutter das Schneidern gelernt hatte? Noch in Los Angeles konnte sie anschaulich von jenem Abend erzählen, wobei sich vielleicht Erinnerungen aus Salzburg und aus München vermischten. Auf der Bühne gab es eine Parodie auf die Reden Kaiser Wilhelms II. Es tanzte eine schlanke Helena, die nichts als ein goldenes Hemd trug. Die ganze menschenvolle Bühne belebte sich zuletzt, alles marschierte im Takt, selbst die monumentale Venusstatue, von der man nur die Beine sah. So hatte es der Zauberer auf der Bühne gewollt. Lion schrieb eine Besprechung der Aufführung und lernte wenig später Max Reinhardt persönlich kennen. Dass sie einmal Schicksalsgefährten, ja beinahe Nachbarn im Exil sein sollten, fern aller Operettenseligkeit, schien völlig undenkbar.
Ein Jahr später, im Sommer 1912, kamen alle Kunstgrößen nach München, man fuhr an den Starnberger See und aß dort Felchen. München schien der Mittelpunkt der Welt zu sein, einer Welt, in der mehr Wert auf ein anständiges Äußeres als auf ein anständiges Inneres gelegt wurde. Politik spielte keine Rolle, Außenpolitik schon gar nicht. Man hörte, dass es anderswo die »Roten« gab. Als linken Politiker kannte Marta vor 1914 nur Erich Mühsam, und der war ein harmloser Anarchist und Gemütsmensch. Wild sah er aus, und so schrieb er auch, doch im persönlichen Umgang war er recht mild. Sein Freund Walter Köhler, der ebenfalls Marta anschmachtete, prophezeite Mühsam, er würde noch am Galgen enden. Köhler endete als Gauleiter.
Die Zeit vor 1914 war eine gemächliche Periode in München. Niemand stellte die Welt in Frage, in der man lebte. Private und öffentliche Beschränkungen wurden erduldet. Die Münchner Juden fühlten sich als Bayern, auch sie liebten Brezeln, Bier und Radi, aber im Allgemeinen betranken sie sich nicht. Die Preußen wurden gehasst, über den Kaiser in Berlin lachte man, fürchtete insgeheim aber, es möge bös mit ihm enden. Auf den Straßen der Stadt sah man oft alkoholisierte Männer, schnell gab es deftige Prügeleien, die Messer saßen locker. Dergleichen berührte die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht. Nur in einigen Feuerköpfen der Schwabinger Boheme schwelten künftige Brände.
Lions Zimmer in der Gewürzmühlstraße war eine schlichte Dachkammer. Im Erdgeschoss befand sich ein kleines Restaurant. Wenn man das Haus betrat, roch es nach Bier und Urin. Stieg man die steile Treppe hoch, wurde es etwas freundlicher und sauberer. Das Zimmer hatte nur ein Fenster und kein fließendes Wasser. Der Nachbar, ein erklärter Antisemit, war vertraglich gezwungen, den anderen Mietern auf der Etage Zugang zum Wasserhahn in seiner Wohnung zu gewähren. Das Zimmer selbst war hell und sonnig. Man sah weit über die Dächer der Stadt.
Bei ihren ersten Besuchen fand Marta die sturmfreie Bude sehr romantisch, sie bewunderte Lions Mut, so unabhängig zu leben. Doch bald mietete er ein anderes Zimmer in der Burgstraße. Das neue Haus hatte am Eingang gotische Bögen. Das Zimmer lag im ersten Stock, war aber nur vom dunklen Hintereingang her zu erreichen. Schräg gegenüber hatte einst Mozart gelebt und Idomeneo komponiert. Unter dem Fenster stand in großen Lettern der Firmenname Wollenweber. Ein Betrunkener grüßte herauf zu Lion, verbeugte sich und rief: »Guten Abend, Herr Wollenweber!« Das war gewissermaßen sein erstes Pseudonym. Dass Lion einmal ein großer Büchersammler werden sollte, war noch nicht ersichtlich. Heinrich Mann pflegte zu sagen, Feuchtwangers ganze Bibliothek bestehe aus einem Reclamheftchen. Um etwas Geld zu verdienen, versuchte sich Lion als Nachhilfelehrer, aber er war zu ungeduldig, hasste die Arbeit, die er als Zeitverlust empfand. Lieber schrieb er Theaterkritiken oder Erzählungen.
Im Oktober 1911 reifte eine Idee heran: eine gemeinsame Italienreise. Marta hatte schon gepackt und einen Zettel für ihre Eltern geschrieben (»Ausflug mit dem Sportverein«), denn eine solche Reise hätten sie nie erlaubt. Aber Lion verdarb alles: Er musste gestehen, dass er das Reisegeld verspielt hatte, statt seine Schulden durch Spielgewinne abzutragen, wie er naiv gehofft hatte. Man sah ihm leicht an, ob er ein gutes oder schlechtes Blatt hatte. Er konnte sich nicht verstellen, und wenn ihm etwas peinlich war, traten Schweißperlen auf seine Oberlippe. War das Verhältnis zwischen Marta und Lion in einer Sackgasse angekommen? So konnte es scheinen. Doch dann überstürzten sich die Ereignisse. Auch in einem langen Leben hat es das Schicksal manchmal eilig.
Feuchtwangers
»Dr. Geyer entstammte einer jüdischen Familie, die die Riten und Gebete hoch in Ehren hielt, und er hatte ein gutes Gedächtnis.«
L. F., Erfolg
Kann man, frei nach Tolstoi, sagen, dass die Feuchtwangers auf ihre ganz spezielle Weise unglücklich waren? Oder liegt es allein an Lions späteren Berichten, dass Marta den Eindruck hatte, er habe sich aus einer lieblosen Umgebung befreien müssen? Die Feuchtwangers – inzwischen ein exemplarischer Forschungsgegenstand – waren zumindest bis 1914 eine eher glückliche Familie mit innerer Stabilität und gesellschaftlichem Erfolg, ihrer bayerischen Heimat seit Jahrhunderten verbunden. Ihr Alltag war von einer jüdisch-orthodoxen Lebenspraxis geprägt, die Marta von zu Hause nicht kannte. Allerdings kam Lion auch in anderen Verhältnissen zur Welt als seine jüdischen Generationsgenossen in Berlin oder in Frankfurt.
München, die »glücklichste Stadtschöpfung Deutschlands«, war lange Zeit eine sehr katholische und das hieß religiös intolerante Stadt gewesen. Nachdem mit Napoleons Hilfe das Königreich Bayern geschaffen worden war, heirateten die ersten beiden Monarchen Prinzessinnen aus protestantischen Dynastien. Gleichwohl gab es im öffentlichen Raum zunächst keinen Platz für andere Religionen. Der Bau der ersten Synagoge wurde 1826 von König Max gefördert, eine protestantische Kirche errichtete man erst fünf Jahre später.
1813, ein Jahr, nachdem im französisch besetzten Deutschland die Judenemanzipation verkündet worden war, erließ man in München eine Regelung, welche die Zahl der ansässigen jüdischen Familien begrenzte und den weiteren Zuzug von frei werdenden Matrikeln oder Ausnahmegenehmigungen abhängig machte. Erst um 1840 kamen jüdische Familien in größerer Zahl aus dem Fränkischen oder dem Badischen in die Stadt, aber auch sie hatten noch mit Einschränkungen zu rechnen. Nach der Reichsgründung 1871 erhielten auch die bayerischen Juden das volle Bürgerrecht.
Man blickte herrlichen Zeiten entgegen. Das Deutsche Reich war geeint, sein Aufstieg war fühlbar und sichtbar, die Lebensbedingungen vereinheitlichten und verbesserten sich. Das bedeutete Chancen für alle bisher Benachteiligten. Zu ihnen gehörten die Juden in Bayern. Sie hatten formal endlich dieselben Rechte wie alle Juden im Deutschen Reich – erlebten aber ähnliche oder gar noch stärkere Beschränkungen. Immerhin konnten sie nun am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die Frage war nur, inwieweit sie den jüdischen Gesetzen und Riten in der modernen Welt treu blieben, in der sich auch die Familienstrukturen veränderten.
Das Königshaus der Wittelsbacher galt als liberal, die Landesregierung hingegen als reaktionär. Die eigentliche politische und kulturelle Macht lag bei der katholischen Kirche, die auch die Presse beherrschte. Offener Antisemitismus wurde nicht so drastisch wie etwa in Berlin vertreten, aber es gab durchaus einige giftige Publikationsorgane wie den Münchner Beobachter (seit 1887), aus dem nach 1918 der Völkische Beobachter hervorging, oder das demagogische Wochenblatt Grobian, das von 1904 bis 1912 erschien.
Erst nach der Spaltung der Münchner Gemeinde im Jahr 1871 unterschied man Liberale (oder Reformjuden) und Orthodoxe (oder Traditionalisten), die sich selbst als schlicht gesetzestreu empfanden und Gottesdienstreformen wie die Einführung einer Orgel oder eines Chors ablehnten. In München waren sie deutlich in der Minderheit, in ganz Deutschland betrug ihre Anzahl etwa zwanzig Prozent aller Juden. Sie richteten eigene Betsäle ein, so 1874 in der Kanalstraße 23. Ein Austritt oder eine Abspaltung war, anders als in Preußen, nicht erlaubt. Man durfte nur einen Religionsverein »zur Förderung der jüdischen Wissenschaft« gründen, genannt Ohel Jakob (Zelt Jakobs). Zu den Trägern dieser Richtung gehörten in München neben den Feuchtwangers und Fränkels noch andere Familien, die wie diese aus Fürth stammten. Als die Einheitsgemeinde 1880 eine große Synagoge baute, verlangten die Orthodoxen ebenfalls ein würdiges Gebäude. 1889 wurde in der Kanalstraße 29 eine eigene Synagoge eingeweiht, was hohe finanzielle Aufwendungen erforderte. Die Adresse der »Kanalsynagoge« änderte sich später durch Straßenumbenennung in Herzog-Rudolf-Straße 3.
Da sich ihnen vor allem Universität und Armee verschlossen, mussten viele jüdische Studenten aus der um 1880 geborenen Generation auf freie Berufe ausweichen. Als Anwalt, Arzt, Händler oder Bankier genossen sie größere Freiheiten und hatten es leichter, die Sabbatruhe einzuhalten. Politisch waren die Münchner Juden reichstreu, aber die bayerischen Belange zählten mehr. Man hatte Hochachtung vor den Wittelsbachern und nahm an deren offiziellen Feiern teil. In der Schule lernten die jüdischen Kinder wie alle anderen: »Bayern ist mein Heimatland, weil ich hier geboren und erzogen wurde.« In der Gründerzeitkrise nach 1873 kam auch in München eine aggressive Judenfeindschaft auf. Dennoch schien die Zukunft verheißungsvoll. Nach 1896 begann eine Zeit wachsenden Wohlstands, die bis 1914 andauerte.
Das Leben der Feuchtwangers war geprägt von den bayerischen Besonderheiten und einem streng religiös bestimmten Alltag. Ihr gesellschaftlicher Aufstieg, ihre säkulare Bildung und kulturellen Interessen erfolgten nicht auf Kosten ihrer jüdischen Tradition. Sie waren erfolgreiche Wirtschaftsbürger, gehörten zum gehobenen Mittelstand, jedoch nicht zur jüdischen Aristokratie der Rothschilds, Warburgs und Mosses.
Die fernen Wurzeln der Familie lagen in dem kleinen mittelfränkischen Ort Feuchtwangen an der Sulzach, der zur Zeit der Karolinger um ein Kloster herum entstanden war und dessen Name auf Fichten verweist, die an einer grünen Lichtung stehen. Im Jahr 1555, nach dem Sieg der Reformation, wurden die seit dem Spätmittelalter ansässigen Juden vertrieben. Drei Brüder zogen mit ihren Familien fort, zwei von ihnen wurden unterwegs vom Mob erschlagen, der dritte erreichte die freie Reichsstadt Fürth, wo es seit 1528 eine jüdische Gemeinde gab. In Nürnberg wurden Juden nicht eingelassen. Bis zu 400 jüdische Familien lebten in Fürth, sie hatten ihre Vertretung im Stadtrat, durften einen Friedhof anlegen, Schulen und Synagogen bauen. Der aus Feuchtwangen Zugewanderte kam in einem Schulgebäude unter, und seine Familie nannte sich deshalb Schulhof, so erzählt es eine mündliche Überlieferung innerhalb der Familie. Der älteste in Fürther Papieren beglaubigte Vorfahr hieß Jaakow Arieh ben Mosche Schulhof, nannte sich aber, als Ende des 18. Jahrhunderts die Entwicklung der Verwaltung die Einführung fester Familiennamen erforderte, Jakob Löw Feuchtwanger. Die ursprüngliche Herkunft war also nicht vergessen. Er starb im Februar 1809. Zu der Zeit gab es in Feuchtwangen wieder eine jüdische Gemeinde, auch Zweige der Feuchtwangers haben dort gelebt. Der hebräische Name Jaakow Arieh wurde jeweils dem ältesten Sohn bei der Bar Mitzwa verliehen. (Auch Lion erhielt ihn.)
Im katholischen Frankreich hatte es der Revolution bedurft, damit Protestanten und Juden die vollen Bürgerrechte erhielten. Diese Entwicklung war aus der Gesellschaft selbst gekommen, und die große Umwälzung gab ihr ein besonderes Gewicht. In Deutschland wurde die »Judenemanzipation« (wie andere Rechtsfortschritte) zur Zeit der napoleonischen Besatzung als Reform von oben vollzogen, was bestimmte »nationale Kräfte«, insbesondere die studentischen Burschenschaften, zu ihrer dauerhaften Ablehnung und Bekämpfung animierte.
Der Aufstieg der jüdischen Familien im 19. Jahrhundert kann als »Einwanderung« in die Gesellschaft angesehen werden, der sie ohnehin angehörten, und wie alle Einwanderer waren sie besonders strebsam. Das als heimlichen