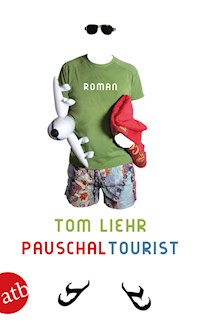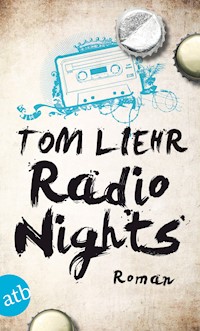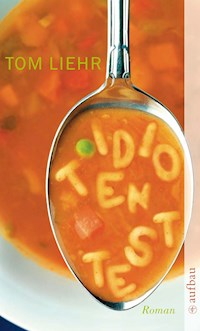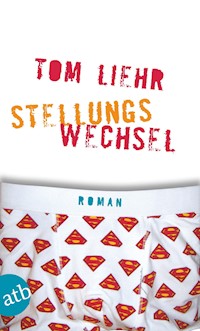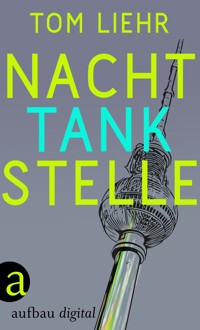9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Niedersachsen, Ende der 70er Jahre: In der Kleinstadt Metting liegt das Pflegeheim Horizont, in dem Tomás aufwächst, weshalb er lange glaubt, dass die meisten Menschen auf der Welt alt oder krank oder beides sind. Toms Papa ist heimlich homosexuell, Toms Mama hält sich an Orangenlikör. Als die für ihre 82 Jahre noch ziemlich attraktive Marieluise ins Heim zieht, erlebt Tom seine erste große Liebe. Die lebenslustige Frau weckt in ihm den Spaß am Lesen und die Begeisterung für Geschichten. Auch 30 Jahre später hat er sie nicht vergessen. Tom hat keinen Kontakt nach Hause, und erfährt nun, dass das heruntergekommene Heim vor dem Aus steht. Jemand muss die Liquidation vorbereiten, Bewohner gibt es nicht mehr - die letzten sind Toms Eltern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tom Liehr
Die Wahrheit über Metting
Roman
Über dieses Buch
Niedersachsen, Ende der 1970er Jahre: In der Kleinstadt Metting liegt das Pflegeheim Horizont, in dem Tomás aufwächst, weshalb er lange glaubt, dass die meisten Menschen auf der Welt alt oder krank oder beides sind. Toms Papa ist heimlich homosexuell, Toms Mama hält sich an Orangenlikör. Als die für ihre 82 Jahre noch ziemlich attraktive Marieluise ins Heim zieht, erlebt Tom seine erste große Liebe. Die lebenslustige Frau weckt in ihm den Spaß am Lesen und die Begeisterung für Geschichten. Auch 30 Jahre später hat er sie nicht vergessen. Tom hat keinen Kontakt nach Hause und erfährt nun, dass das Heim vor dem Aus steht. Jemand muss es abwickeln, Bewohner gibt es nicht mehr – die letzten sind Toms Eltern ...
«Tom Liehr ergründet mit großer Freude die verschlungenen Pfade des Lebens und fördert dabei immer wieder die liebenswert dämlichsten Menschen zutage: uns ...» (Edgar Rai)
Vita
Tom Liehr wurde in Berlin geboren. Seine erste Veröffentlichung war eine Wandzeitung, die er in der siebten Klasse anfertigte, mit dem Namen «Rauhfaser quer». Schon in jungen Jahren schrieb er als freier Journalist für das P.M-Magazin. Doch der eigentliche Startschuss seiner Autorenlaufbahn war 1990 der «Playboy-Literaturwettbewerb» (später «Gratwanderpreis»), bei dem er mit zwei eingesandten Geschichten die Plätze eins und drei belegte. Seitdem hat Tom Liehr elf Romane (unter anderem «Leichtmatrosen», «Nachttankstelle» und «Landeier») und zahlreiche Short Storys veröffentlicht. Daneben hat er als DJ und Rundfunkproduzent gearbeitet und führt seit vielen Jahren ein Unternehmen für Softwareentwicklung. Tom Liehr lebt mit seiner Familie in Berlin.
«Tom Liehr hat ein Händchen für Geschichten. Er erzählt mit Hingabe, leidenschaftlich, mit Liebe zum Detail und emotionalen Wendungen.» (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Heiko Arntz
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Dragon Images/Shutterstock; Enrique Díaz / 7cero/Getty Images
ISBN 978-3-644-00489-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Colin
Nichts hiervon ist wirklich passiert, aber es ist trotzdem die Wahrheit.
Wenn du urteilst, obwohl du nur Meinungen kennst und keine Beweise, dann ist es egal, um welches Vergehen es geht – deines ist das schlimmere.
Teil 1Hinterlassenschaften
Es sind nicht die Orte, es sind immer die Menschen.
(Jan Friesmann)
«Wenn dir der Stecker herausgezogen wird und du verwandelst dich kurz darauf in ein Häufchen Asche, dann ist es auch genau das, was von dir übrig bleibt – nur dieses Häufchen Asche», sagte Marieluise zu mir. «Natürlich gibt es ein paar Dinge, die du zu Lebzeiten angestoßen hast und die noch etwas nachwirken. Aber all das wird nach und nach vergehen. Die Erinnerung an dich stirbt mit den Menschen, die dich gekannt haben, und kaum einer bewirkt so viel, dass die Erinnerung an ihn über mehr als eine Generation hinausreicht. Aber manchmal kann man etwas hinterlassen, das dazu geeignet ist, auch später noch Dinge zu verändern. Sie in die eine oder andere Richtung umzulenken.»
Sie lächelte schmal und legte eine Hand auf die Truhe, die zwischen uns auf dem Tisch stand.
«Ich werde dir das hier hinterlassen. Es enthält ein Geheimnis, ein kleines, amüsantes Geheimnis, dessen Enthüllung aber große Wirkung haben kann. Wenn du das hier irgendwann öffnest, musst du erst ein Rätsel lösen, um hinter dieses Geheimnis zu kommen, und dann noch eines, nämlich die Frage, was du mit diesem Wissen anfangen willst.»
Sie legte mir sanft einen Handrücken an die Wange, weshalb ich nicht widersprach, denn ich wollte weder über ihren Tod reden noch etwas von ihr erben. Ich wollte, dass alles so blieb, wie es war.
«Ich bin mir sicher, dass du das Richtige tun wirst», erklärte sie abschließend, dann nahm sie die große, verzierte Holztruhe vom Tisch und verschloss sie wieder in ihrem Wandschrank.
1.
Meine Mutter, die auf den Namen Ingeborg getauft war, wollte mich Tamás nennen, nach ihrem ungarischen Großvater, aber mein Papa bevorzugte Thomas, was zu jener Zeit eher ein Sammelbegriff als ein Vorname war. Ganze Heerscharen männlicher Kinder hießen so, oder Andreas, Bernd, Michael, Stefan und im schlimmsten Fall Harald. Meine Eltern einigten sich schließlich auf einen Kompromiss und wählten Tomás, also einen Hybriden, unterm Strich aber worst of both worlds, weil der Name einerseits ganz anders geschrieben als ausgesprochen wurde, so ähnlich wie bei der Worcestersoße, die ja eigentlich irgendwie «Wuhsterscheiersoße» heißt, was auch kein Mensch je begreifen wird. Andererseits war auch mein Tomás nur eine Form von Thomas.
Das a in meinem Vornamen wurde durch einen Akut gekennzeichnet und deshalb gedehnt, das s am Ende war im Ungarischen ein sch, und da die Ungarn alle Wörter auf der ersten Silbe betonen, lautete mein Name, wenn er richtig ausgesprochen wurde: «Tohmaasch». Wie froh konnte ich sein, dass mich jedermann quasi ab meiner Geburt schlicht Tom nannte, mit kurzem o, wie im Englischen. Meine Grundschullehrer, die uns nicht mit Kosenamen ansprechen durften, sagten der Einfachheit halber oder weil sie’s nicht besser wussten Thomas zu mir, wodurch ich an meinen offiziellen Vornamen nur erinnert wurde, wenn ich ihn buchstabieren musste, was ich ungerne tat, da kaum jemand wusste, was ein Akut ist – der kleine Schrägstrich nach rechts auf dem a eben, wie der Accent aigu im Französischen.
Bis zu meinem siebten Lebensjahr glaubte ich, dass in allen Häusern auf der ganzen Welt überwiegend sehr alte und kranke Menschen lebten, die auch noch ständig starben. Ich wusste damals noch nicht, dass meine Eltern ein Alten- und Pflegeheim betrieben und leiteten. Genauer gesagt: Es war mir zwar erklärt worden, ich verstand die Bedeutung der Erklärung jedoch nicht. Meinem Vater oblag die Geschäftsführung und meine Mutter führte die kleine Schar Krankenschwestern und Helfer an. Da wir auch im Heim wohnten, glaubte ich, dass alle Menschen so leben würden, wie wir das taten, und ich glaubte außerdem, dass es sehr viel mehr alte und kranke Menschen als jüngere und gesunde gab. Diese Auffassung wurde dadurch bestärkt, dass sich auch in unserer dünn besiedelten Nachbarschaft entweder Rentnerwohnungen oder weitere Altenheime befanden. Das war in unserem kleinen Vorort einfach so, weil man dort billig wohnte, über die Felder einen schönen Ausblick hatte und das massierte Auftreten gerontischer Individuen hier nicht so sehr störte wie in der pittoresken Innenstadt, die aber auch vor allem von verrenteten Touristen besucht wurde. Ich ging damals nicht in einen Kindergarten und hatte keine Freunde in meinem Alter. Natürlich war mir klar, dass es außer mir weitere Kinder und außer den Leuten, die im Altenheim arbeiteten, auch andere Menschen gab, die nicht steinalt waren, aber ich hielt die Geronten eben für die beherrschende Spezies, für die erdrückende Mehrheit der Weltbevölkerung.
Dass ich falschlag, ging mir erst auf, als wir einen Familienurlaub machten, den ersten seit meiner Geburt. Vorher hatten uns höchstens kurze Ausflüge in die nähere Umgebung geführt, an Orte, wo es ebenfalls viele Alte gab, die uns auch meistens begleiteten, jedenfalls jene Bewohner, die noch gehen oder geschoben werden konnten. Ungefähr die Hälfte war schon am Einzugstag bettlägerig.
Dieser Urlaub führte uns nach Menorca, in ein Familienhotel in der Nähe der kleinen Cala Figuera, unweit des Hafens. Wie erstaunt war ich, als wir am Morgen nach der spätnächtlichen Ankunft in einem hübschen, hellen und verblüffend lauten Speisesaal zwischen ungefähr drei Dutzend jungen Paaren mit Kindern in meinem Alter saßen. Ich beobachtete mein Umfeld irritiert und suchte nach den mehrheitlichen Omas und Opas, die hier ja auch sein mussten, aber sie kamen nicht. Als mich meine Mutter fragte, was mich so offensichtlich umtrieb, und ich es ihr erklärte, wurde sie erst sehr ernst, fast ein bisschen traurig, und dann lachte sie laut und lange. So laut, dass andere im Speisesaal aufmerksam wurden und uns interessiert zuschauten – interessiert und freundlich, das prägte sich bei mir ein.
Und dann erklärte mir Mama den Irrtum, versuchte tatsächlich, einem Siebenjährigen zu verdeutlichen, warum die Alten und Pflegebedürftigen in Heime wie das unsere verklappt wurden, wo sie auf den nahen Tod warteten. Ich war völlig erschüttert, obwohl ich nicht ganz verstand, was sie da zu erklären versuchte, aber ich weiß auch noch, dass ich sie zu Tränen rührte, als ich ihr im Anschluss versprach, niemals zuzulassen, dass sie ihre letzten Tage einsam in einem Heim verbringen müsste. Dieses Versprechen fiel mir leicht, denn ich ging ohnehin davon aus, dass meine Mutter niemals alt werden würde. Ich verstand längst noch nicht, dass es von meiner Mutter eine Ausgabe gegeben hatte, die mir ähnelte, was Größe, Alter und Lebensgewohnheiten anging, und ich begriff umgekehrt ebenfalls nicht, dass auch mir das Schicksal bevorstand, zu altern und dann irgendwann zu sterben. Ich hielt das für nahezu ausgeschlossen, nein, mehr noch: Es lag mir als Idee für mein eigenes Leben ferner als diejenige, eines Tages einen Bart zu tragen. Als ich sechs Jahre alt war, hatte mir mein Vater zu demonstrieren versucht, wie man sich rasiert. Er war mit dem summenden Apparat durch mein Gesicht gefahren, aber das lustige Knistern, das zu hören war, wenn er das bei sich tat, blieb aus. Das war seine Art, sich an der Erziehung zu beteiligen. Er gab gelegentlich sein Bestes, nur sein Timing war unter aller Sau. Nicht viel später führte er ein hypernervöses Gespräch mit mir, von dem ich erst Jahre danach verstand, dass es eine Unterhaltung gewesen ist, die meiner Aufklärung dienen sollte, dass es um Sex ging. Er hatte hochkonzentriert und schwitzend vor mir gesessen, immer wieder «zwei Menschen» gesagt, dann den Satz enden lassen, die Stirn in Falten gezogen und mit den Händen gestikuliert, um seltsame, verzweifelte Schiebe- und Stechbewegungen auszuführen. Auf mehreren Blättern Papier hatte er parallel Zeichnungen angefertigt und immer gleich wieder durchgestrichen: eine Art halbiertes U-Boot; eine an einem Ende abgerundete Banane, die aus unerfindlichen Gründen auf der anderen Seite mit einer senkrechten Wand verschmolz; zwei Täler im Querschnitt, an deren Tiefpunkten sich seltsame Markierungen befanden; ein Ypsilon, daneben ein senkrecht stehender Mund; außerdem viele, viele Kreise. Schließlich zwei Bienen, die ich immerhin sofort erkannte. Mein Vater war eigentlich ein begabter Zeichner (das hatte ich von ihm, ich konnte auch recht gut malen), doch was er hier zu zeigen versucht hatte, hatte sich mir damals nicht erschlossen. Am Ende hatte er schnaufend und erschöpft das Wort «Kinder» ausgestoßen, fast klang es nach einem Fluch. Aber immerhin hatte er versucht, seinen Sohn aufzuklären.
Metting-Hasenhügel bildete den südlichen Zipfel von Metting, einer Kleinstadt am Rand der Lüneburger Heide. Der deutsche Dichter Jan Friesmann, der im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert durch seinen Lyrikzyklus Stolze Worte schlagartig berühmt geworden war und Anfang der sechziger Jahre für sein Gesamtwerk sogar den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte, war das prominenteste Kind unserer kleinen Stadt. Er bezeichnete sie kurz vor seinem Tod im Jahr 1968 als den langweiligsten Ort der Welt, ein nichtssagendes Stück Erde, eine intellektuelle Einöde, bewohnt von abstoßenden, unbeschreiblich spießigen Menschen, die den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun hatten, als sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Und er empfahl den Stadtoberen denn auch, auf das Ortsschild des «verdammten Kaffs» das Wort «Hölle» zu schreiben, denn schlimmer als in Metting konnte es nach Friesmanns Meinung auch dort nicht sein.
Trotz dieser stolzen Worte wurde der Dichter ganz offiziell und ziemlich intensiv in Metting verehrt, und man ließ nicht etwa «Hölle» auf die Ortsschilder schreiben, sondern den Zusatz «Friesmann-Stadt»», sodass Besucher mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund begrüßt wurden, die da lautete: «Friesmann-Stadt METTING». Es gab eine Straße, einen Weg, eine Chaussee und einen Platz, außerdem vier Häuser und eine Schule, die nach dem Dichter benannt waren. Darüber hinaus standen zwei bronzene Denkmäler im überschaubaren Zentrum des Städtchens, eines fast vier Meter hoch und auf dem Mettinger Rathauspatz, das andere, etwas kleinere, direkt vor dem Friesmann-Museum, in dem man seinen Kindheitsschreibtisch und andere Möbel aus der Elternwohnung bewundern konnte – Stücke übrigens, deren Authentizität von nicht wenigen Fachleuten angezweifelt wurde. An vielen Häusern hingen Messingschilder, die darauf hinwiesen, was Jan Friesmann mit diesen Gebäuden zu tun gehabt hatte. Es gab Plaketten an Häusern, in denen angeblich sein Kinderarzt, einige Lehrer und irgendwelche Verwandte gelebt hatten. Dem Dichter verdankte Metting nicht unerhebliche Einkünfte, weil ganzjährig Friesmann-Fans als Touristen zu uns kamen, überwiegend ältere Semester, weil Friesmanns Lyrik bei den Jüngeren nicht besonders beliebt war, um es vorsichtig auszudrücken. Die andere Einnahmequelle war die kleine Fabrik eines Fahrzeugpolsterherstellers nördlich von Metting.
Die Grabstätte des prominenten Sohns der Stadt befand sich allerdings nicht auf dem Mettinger Friedhof, sondern in Augsburg, wo Friesmann zuletzt gelebt hatte und auch gestorben war. Er hatte im Übrigen verfügt, dass es keinerlei Ehrungen in seinem Geburtsort geben dürfe. Doch sein Testament war von Friesmanns Witwe erfolgreich angefochten worden. Deshalb wechselte ich im Alter von dreizehn Jahren also auf Mettings «Jan-Friesmann-Gymnasium». Es gab sowieso nur dieses eine in der Stadt. Neben dem Schild mit dem Ortswappen und dem Namen der Schule befand sich eine Tafel, in die eines von Friesmanns berühmtesten Gedichten eingraviert war, «Krieg für Gott», aus dem Jahr 1921:
Krieg für Gott
Da war mal ein Krieg
Bei Mutti, ach so präzise
Ach so blau
Doch der Weg
Nicht bei Mutti, doch im Bett
Der war irr
Nun wurde es hinterlistig
He, Gott!
Und ewig glimmen die Wälder …
Ich verstand nicht, was diese Worte bedeuten sollten. Lyrik war ein Schatz, zu dem mir keine Karte den Weg wies. Aber Dr. Theuert, mein Deutschlehrer ab der siebten Klasse, liebte und verehrte jeden Vers, den Friesmann geschrieben hatte, weshalb er den depressiven Dichter, der am Ende Selbstmord verübt hatte, ständig zitierte und oft thematisierte. Genau genommen war es die einzige Sache, für die sich Dr. Theuert, der immerzu schwarze Kleidung trug, begeistern konnte. Diese Begeisterung manifestierte sich auch in einer euphorischen Friesmann-Biographie, die Theuert unter dem Titel Jan Friesmann – Jahre in Metting im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wodurch es das schmale und unansehnlich ausgestattete Büchlein zwar in jedem Laden der Stadt – von der Apotheke bis zur Zoohandlung – zu kaufen gab, aber nirgendwo sonst in der Republik. Die Touristen jedoch nahmen es gerne mit, zumal jedes Exemplar vom Autor handsigniert war. An der Schule gehörte es allerdings nicht zur Pflichtlektüre, obwohl der Lehrer das immer wieder durchzusetzen versuchte.
Immerhin war er der einzige Pädagoge, der sich wunderte, dass ich Thomas genannt wurde, obwohl mein Name doch so ganz anders geschrieben wurde.
«Das ist ein ungarischer Name, oder?», fragte er eines Tages in der achten Klasse, während er mir mein Hausaufgabenheft zurückgab, das er durchgesehen hatte.
«Mm-mh», antwortete ich und nahm das Heft entgegen, ohne aufzusehen.
«Eine Endung auf s …», sagte er und sann eine Weile vor sich hin, bis er fortfuhr. «Wenn ich nicht irre: stimmloser postalveolarer Frikativ. Ein Zischlaut. Ess-Zeh-Hah im Deutschen, wie in Schule. Aber die deutsche ist auch keine ugrische Sprache.»
«Was ist eine ugrische Sprache?», fragte eine Mitschülerin hinter Theuert und erlöste mich aus der unangenehmen Situation. Das Interesse meines Deutschlehrers wechselte schnell, weil er sich für wenig interessierte, von Jan Friesmann abgesehen. Theuert drehte sich um und beantwortete die Frage, während ich die Vier minus für meinen letzten Aufsatz zur Kenntnis nahm. Weil Theuert grundsätzlich keine Einsen gab, war es rechnerisch eine Drei minus, also ein Grund zur Freude. Der Deutsch- und der Sportunterricht waren die mir besonders verhassten Fächer an der Schule. Sport, weil ich darin eine Niete war. Deutsch wegen Dr. Theuert – und wegen meiner Schreibschwäche. Meiner Legasthenie, wie Theuert das nannte. Genau wie Frau Awusi, meine Klassenlehrerin, doch die lächelte fies, wenn sie es sagte.
Das Alten- und Pflegeheim «Horizont» in Metting-Hasenhügel war ein langgestreckter, kreuzförmiger Bau aus braunroten Ziegeln. In den kurzen Seitenflügeln befanden sich links die Empfangshalle mit Büro-, Freizeit- und Sanitäreinrichtungen und rechts unsere Dreizimmerwohnung. Es gab zudem im hinteren Bereich des Grundstücks, also von der Straße aus nicht sichtbar, eine kleine Kapelle, an die sich eine Garage für die zwei Firmenfahrzeuge und unser privates Auto anschloss. Dorthin ging kaum jemand, nur manchmal meine Mutter, um heimlich eine Zigarette zu rauchen, oder ich mit meinem besten – und einzigen – Freund Filip, um Unsinn auszuhecken. Ganz selten schlichen Angehörige in die kühle, immer etwas dämmrige Kapelle, um dort leise ein Gebet zu sprechen oder sich flüsternd über den Inhalt des Testaments zu unterhalten, weil zwar soeben jemand verschieden war, aber die Trauer die Gier nicht bändigen konnte.
War jemand gestorben, kam sofort ein neuer Bewohner. Einige Neue wurden von ihren Angehörigen gebracht. Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass ein zukünftiger Bewohner im eigenen Auto vorfuhr, das kurz darauf von einem Gebrauchtwagenhändler abgeholt wurde, während der alte Herr weinend daneben stand. Die allermeisten wurden von einem der zwei privaten Mettinger Krankentransportdienste zu uns gefahren, überwiegend vom billigeren der beiden, denn unsere Betreuten erhielten zum Großteil Sozialamtsleistungen, weshalb es auch zehn Doppel-, aber nur vier Einzelzimmer gab. Die Zweibettzimmer waren mit runden Aufklebern mit Gemüsesorten markiert, mit Karotten, Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl, Salat, Tomaten, Paprika, Radieschen und einem langen, weißen Meerrettich, während die vier Einzelzimmer Obst an den Türen hatten, nämlich Bananen, Apfelsinen, Äpfel und Birnen. Warum das so war, wusste ich nicht, aber vielleicht konnten sich die Bewohner Gemüse- und Obstsorten leichter merken als Zahlen. Die Doppelzimmer lagen quasi unterhalb des Querbalkens des «Kreuzes» und hatten etwas kleinere Fenster als die Einzelzimmer, die außerdem über mehr Wohnfläche verfügten. In den Einzelzimmern wohnten Privatpatienten, die mein Vater aber lieber Selbstzahler nannte. Die auf staatliche Unterstützung angewiesenen Bewohner nannte er Sozis.
Die Wagen der Fahrdienste konnte man von weitem kommen sehen, denn das Heim lag am Rand des Vororts, umgeben von Getreidefeldern und nur wenigen anderen Häusern. Die Landstraße, die hier verlief, wurde kurz hinter der Stadtgrenze von einem Kreisverkehr unterbrochen, von dem jedoch keine Straßen abführten. Es gab zwei Ausfahrten, die aber nach wenigen Metern im Nichts endeten – traurige Überbleibsel eines prognostizierten Baubooms, der aber nie eingesetzt hatte. Möglicherweise hatte man Jan Friesmanns langfristige posthume Wirkung ein wenig überschätzt.
Manchmal stand ich an einem der Dachfenster und schaute zum Horizont (dem echten), während ein weißlackierter Mercedes-Benz Sprinter von «Heidetransporte Metting» in den Kreisverkehr hinein- und wieder herausfuhr, mit einer Trage oder einem gesicherten Rollstuhl auf der Transportfläche, auf dem Weg zu unserem Horizont. Einmal hatte ich beobachtet, wie der Transporter auf der ungefähr anderthalb Kilometer langen Strecke, die er vom Kreisverkehr aus noch vor sich hatte, anhielt, ein paar Minuten pausierte und schließlich wendete, bevor das Pflegeheim erreicht war: Der potenzielle Bewohner hatte nicht mehr lange genug gelebt, um sein Zimmer zu beziehen.
An einem besonderen Nachmittag im August schaffte es die neue Bewohnerin aber bis zu uns. Ich saß auf dem Sims eines Dachfensters, was mir eigentlich streng verboten war, doch meine Mutter servierte im Speisesaal den Nachmittagskaffee und mein Vater war mit dem in den Heimfarben rot-lila lackierten VW Polo zu einem Bankgespräch ins Zentrum von Metting gefahren. Das Risiko, erwischt zu werden, war also gering. Hinter mir kochte das Dachgeschoss vor dumpfer Hitze. Ich trug kurze Hosen und ein T-Shirt, meine nackten Beine hingen aus dem Fenster, doch ich vermied es, mit den Füßen die glühendheißen Dachschindeln zu berühren. Ich drückte ein krustiges Wassereis aus dem Plastikschlauch, das längst nach nichts mehr schmeckte, weil ich den Saft schon herausgesaugt hatte. Über den gelben Getreidefeldern flirrte die Luft, ein paar krächzende Dohlen umkreisten die wenigen Baumgruppen, ein einsamer Kondensstreifen verlängerte sich am blassblauen Himmel in Richtung Hannover. Der weiße Sprinter tauchte auf, dicht gefolgt von einem kleinen Lieferwagen, der offenbar dasselbe Ziel hatte. Ein neuer Bewohner mit etwas mehr Gepäck also. Die meisten hatten nur einen oder zwei verschlissene Koffer dabei, neben sich im Laderaum des Sprinters abgestellt. Ich zog die Beine an, drehte mich auf den Pobacken zurück in den Raum, kletterte vorsichtig über die Bretter, die im Dachgeschoss über die Querbalken gelegt worden waren, stieg die Leiter hinab, rannte dann vom ersten ins Erdgeschoss und rief dort nach meiner Mutter. Sie war traditionell diejenige, die Neuankömmlinge begrüßte, sozusagen die Pförtnerin der Friedhofswartehalle.
Ich war knapp dreizehn und lernte an diesem Tag Marieluise Benedickt kennen, die tatsächlich eine Großnichte von Jan Friesmann war, was sie den meisten Menschen gegenüber verheimlichte, mir aber schon ein paar Tage später verriet. Sie war zweiundachtzig Jahre alt, also fast siebenmal so alt wie ich, doch sie wurde meine erste große Liebe.
«Ist das eine Scheißhitze hier drin!», schimpfte sie, als der Fahrer von Heidetransporte Metting die Hecktür des Sprinters öffnete. «Noch zwei Minuten länger, und ich wäre heißgekochte Seniorensuppe.»
Das Wort «Scheiße» hörte man nicht oft von den alten Leuten, und niemals in dieser Lautstärke. Offiziell durfte ich es nicht benutzen, aber wie jeder Junge in meinem Alter führte ich in dieser Hinsicht schon seit Jahren ein Doppelleben. Ich stellte mich im Eingangsbereich auf die nackten Zehenspitzen, denn ich wollte unbedingt die Frau sehen, die zur Begrüßung verbotene Wörter verwendete. Der stark schwitzende Fahrer des Krankentransporters hievte mühevoll eine Rampe ans Heck des Wagens, kletterte hinein und schob kurz darauf einen Rollstuhl heraus, in dem eine winzige, gertenschlanke, grinsende alte Dame saß, die zu ihren blassroten, nackenlangen Haaren eine knallrote Sonnenbrille trug. Die meisten Omis, die man bei uns ablieferte, kamen in fleckigen Hauskleidern oder Kitteln, wozu sie Birkenstocksandalen trugen, während die Opas hellbraune Anzughosen bevorzugten, deren Gürtel etwa in Brusthöhe über taubenblauen Hemden und dunkelblauen Pullundern geschnürt waren. Dazu hatten sie meistens gelöcherte braune Sandalen an und bei Kälte – also in allen Monaten außer Juli und August – beigefarbene Windjacken von C&A. Marieluise Benedickt trug ein gelbes Sommerkleid und an ihren Füßen hellrote Flipflops. Ihre klitzekleinen Fußnägel waren lackiert. Auf den ersten Blick – und auch auf den zweiten, wie sich später zeigte – hatte sie starke Ähnlichkeit mit Maria Persson, der jungen Schauspielerin, die die «Annika» in den Pippi Langstrumpf-Filmen spielte – und die ich sehr süß fand. Nur die Haarfarbe war anders. Sie machte auf mich einen ziemlich fröhlichen Eindruck für eine Passagierin auf der letzten Fahrt. Die Hitze war ihr nicht anzusehen, aber dass die Alten sowieso nicht so stark schwitzten wie die Jungen, wusste ich längst – meistens war das Gegenteil ein Problem, die Dehydration: Sie tranken einfach zu wenig. Doktor Novak sagte, das läge daran, dass sie den Durst nicht mehr bemerkten. Ein Gedanke, der mich manchmal gruselte.
Der dicke und kahlköpfige Fahrer, dessen Kopfhaut glänzte und dessen Hemd unter den Achseln fußballgroß schweißgefleckt war, wuchtete inzwischen laut schnaufend Umzugskisten aus dem Wagen und knallte sie neben die Eingangstür des Heims. Dann machte er Anstalten, einzusteigen und davonzufahren.
«Junger Mann, dafür habe ich Sie nicht bezahlt», sagte Marieluise Benedickt nicht einmal laut, aber in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. «Die Kisten kommen in mein Zimmer, bitte schön. Und zwar pronto.»
Der Fahrer trocknete sich die Kopfkugel mit einer Art Geschirrhandtuch, murmelte etwas, holte eine Sackkarre aus dem Auto und machte sich an die Arbeit.
«Und du, mein kleiner Scheißer? Bist du nicht etwas zu jung für ein Altersheim?»
Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich begriffen hatte, dass sie mich meinte. Ich war irritiert, wollte zuerst «Ich wohne hier nicht» antworten, was aber nicht der Wahrheit entsprochen hätte, denn ich wohnte ja hier, nur anders, als sie hier wohnen würde. Und länger.
«Ich bin der Sohn von Schwester Ingeborg», sagte ich schließlich und griff nach dem Ärmel meiner Mutter. Von den Bewohnern ließ sich Mama Inge nennen. Die alte Dame nickte lächelnd.
«Was ist in den Kartons?», fragte ich. Meine Mutter warf mir einen warnenden Blick zu. Ich betrat ihr Hoheitsgebiet. Die ersten Fragen an die Neuen gehörten ihr, und außerdem die immer gleichen Begrüßungsworte: Herzlich willkommen im Pflegeheim Horizont. Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Diese Formel war eine glatte Lüge, wie mir inzwischen klar war, denn niemand fühlte sich wirklich wohl in einem Heim wie unserem. Aber die Neuankömmlinge lächelten und machten gute Miene zum bösen Spiel. Einmal hatte der teurere der beiden Mettinger Krankentransporte eine dicke, graugesichtige Frau mit schütteren, violetten Haaren gebracht, die auf einer Trage ins Haus gebracht werden musste und die unaufhörlich brüllte: «Ich will nicht in ein Siechenheim! Ich will nicht in einem Siechenheim sterben! Hilfe!» Doch selbst die hatte sich beruhigt, als Mama an ihre Trage getreten war, ihre zitternde Hand genommen und mit fester, aber einfühlsamer Stimme «Willkommen im Pflegeheim Horizont – Sie werden sich bei uns sich wohlfühlen» erklärt hatte.
Menschen mochten es, angelogen zu werden, das hatte ich inzwischen herausgefunden, jedenfalls, wenn es um schlimme Dinge ging.
«Bücher», beantwortete die neue Bewohnerin jetzt meine Frage. «Mein Stoff. Mein Lesefutter.»
«So viele?»
Sie lachte fröhlich. Sie hatte ein sehr schönes, wohlklingendes Lachen. «Die reichen nur für ein paar Wochen. Dann kommt Nachschub. Ich bin eine Perlentaucherin.»
Bevor ich nachfragen konnte, was das zu bedeuten hatte, ergriff Schwester Inge das Wort: «Herzlich willkommen im Pflegeheim Horizont. Sie werden sich bei uns wohlfühlen.»
Die kleine alte Dame zwinkerte und erhob sich beinahe sportlich aus dem Rollstuhl. «Wenn Sie das sagen.»
Tatsächlich enthielten die Kartons Hunderte Taschenbücher, allesamt an der unteren Schnittkante mit Filzstiftstrichen oder Stempeln gekennzeichnet, also Mängelexemplare und Remittenden. Sämtliche Genres waren vertreten, von Liebesromanen über Krimis und Jugend-Abenteuerbücher bis zur Science-Fiction, von der Hochliteratur bis zum Trivialschmarren. Marieluise Benedickt erklärte mir das, während ich ihr half, die Kisten auszupacken und die Bücher stapelweise zu sortieren. Es war nicht nötig, sie in Regale oder Schränke einzuordnen, denn die alte Dame las zwei oder drei davon pro Tag, griff einfach nach dem nächsten, wenn sie eines beendet hatte, das sie achtlos in eine bereitstehende Kiste oder, bei heftigem Missfallen, in den Papierkorb warf. Sie hatte schon als Jugendliche das Schnelllesen erlernt. Als sie nämlich entdeckt hatte, dass das Romanelesen ihre größte Leidenschaft war, hatte sie beschlossen, sich die damals neuen Schnelllesetechniken anzueignen.
«Ich könnte es nicht ertragen, Geschichten langsam erleben zu müssen, weil ich langsam lese.» Sie blickte von einem unschön gestalteten, schmalen Buch auf, dessen Umschlagtext sie studiert hatte. «Nur wenn man etwas auch sehr schnell kann, kann man seine persönliche Geschwindigkeit dafür finden. Sonst bremst man möglicherweise das Erlebnis aus. Ich könnte tausend Wörter pro Minute lesen.» Sie pausierte kurz, zog die Stirn in Falten, in noch mehr Falten. Ihr Gesicht war von ihnen beherrscht, aber ich fand sie trotzdem hübsch, schon an diesem ersten Tag, obwohl oder vielleicht gerade weil ihre Haut so sehr derjenigen von Josefa, meiner Hausschildkröte, ähnelte. Aber es waren vor allem ihre Worte, ihr optimistisches, frisches Auftreten, ihre roten Haare und die Ähnlichkeit mit Maria Persson, die mich faszinierten. «Oder ich konnte das mal.» Sie zwinkerte fröhlich. «Ungefähr ein Dreihundert-Seiten-Roman pro Stunde. Aber so schnell will ich das überhaupt nicht. Also lese ich absichtlich langsamer, als ich eigentlich könnte.» Marieluise Benedickt atmete durch. «Ich bin außerdem auf der Suche.» Sie zeigte auf die vier zerlesenen Bücher, die einen Sonderplatz in einem kleinen Regal hatten, wo sich außerdem ein gerahmtes Schwarzweißbild von ihr selbst befand. Es zeigte sie neben einem Mann stehend, der verschmitzt unter einem breitkrempigen Hut hervorgrinste, ohne dass sein Gesicht zu erkennen war. «Es gibt so ungeheuer viele Bücher, aber nur wenige ungeheuer gute», sagte sie. «Um diese vier zu finden, habe ich mehrere tausend lesen müssen. Es waren Zufallstreffer.» Sie richtete sich ächzend auf, aber es klang wie das Ächzen, das manchmal auch von jüngeren Leuten beim Aufstehen zu hören war. Sie ging zu dem Regal, nahm einen der Romane in die Hand, ein schmales Taschenbuch mit einem unschönen dunkelroten Einband. Alison Wagener, Pale-Gray Heart. Ich las es Jahre später, als es immer noch ein Geheimtipp war – die Autorin verlor diesen Status nie. Eine fulminant erzählte Geschichte von einem kleinen, hochbegabten Mädchen, das von der alleinerziehenden Mutter, die als Gerichtsvollzieherin arbeitet, ziemlich kaltherzig und brutal behandelt wird und das später sein Glück findet, als es eine symbiotisch-liebevolle Beziehung mit einem intelligenzgeminderten jungen Mann eingeht. Besonders beeindruckt hatte mich bei der Hauptfigur, dass sie überhaupt nichts darauf gab, was andere Menschen von ihr und über sie dachten – eine Eigenschaft, die sie mit meiner Freundin verband, weshalb ich das Buch natürlich besonders gerne mochte.
Der deutsche Verlag hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Titel zu übersetzen, und auch an allem anderen gespart. Marieluise Benedickt betrachtete das schmale, hässliche Buch und lächelte. «Das hier habe ich schon dutzendmal gelesen, und es ist immer wieder eine Freude. Ich wünschte, es gäbe einen Buchladen, in dem einem solche Perlen empfohlen werden. Einen Buchhändler, der nur Bücher verkauft, die er selbst liebt. Und der einen guten Geschmack hat.» Sie lächelte versonnen und stellte das zerrupfte Buch zurück ins Regal. «Am besten den gleichen wie ich», ergänzte sie dann.
Irgendwann später führte sie mir das mit dem Schnelllesen einmal vor. Sie verschlang einen Roman in knapp anderthalb Stunden, und ich fragte sie anschließend ab; sie konnte sich tatsächlich an die gesamte Handlung erinnern. Ihr Gedächtnis war ohnehin verblüffend, aber nicht auf die Art, wie sich das bei den anderen Bewohnern darstellte, die sich immer besser an die Vergangenheit zu erinnern schienen, aber die Gegenwart manchmal nach Sekunden schon wieder vergessen hatten.
«Warum sind Sie eigentlich hier? Also, bei uns?», fragte ich sie bei dieser Gelegenheit. Ich wollte ihr damit ein Kompliment machen, weil sie im Vergleich zu den anderen Bewohnern so viel energischer, agiler, gesünder, sogar jünger wirkte. Ihr Alter, diese ungeheuren zweiundachtzig Jahre, konnte ich sowieso nicht einordnen. Die Zahl war willkürlich, absurd, fast schon magisch. Für mein Gefühl hatte Marieluise Benedickt mehr mit meiner Mutter zu tun, die damals achtunddreißig Jahre alt war, als mit den übrigen Bewohnern des Horizonts, die sich im Schnitt am Ende des siebten Lebensjahrzehnts befanden, wie mein Vater mal erklärt hatte. Die Sozis starben allerdings jünger als die Selbstzahler. Vielleicht grämte es sie, dem Sozialamt zur Last zu fallen. Menschen starben aus den seltsamsten Gründen, das wusste ich bereits.
Sie verzog skeptisch das Gesicht, lächelte aber gleich wieder. «Ich bin sehr krank, Junge. Nicht jede Krankheit kann man sehen. Ich habe Diabetes.» Als sie meinen fragenden Gesichtsausdruck sah, erläuterte sie: «Zuckerkrankheit. Und ich habe einen Tumor, den mir keiner mehr operiert.» Dabei strich sie sich mit dem rechten Handrücken über den hinteren Hüftbereich. «Ich schaffe das nicht mehr alleine. Und ich möchte auch nicht alleine sterben.»
«Ich helfe Ihnen», behauptete ich tapfer.
Da strahlte Marieluise Benedickt, genau wie Annika, als Pippi den Süßigkeitenladen leerkaufte, und mein Herz war gestohlen.
Neben den vielen Büchern, die sie im wahrsten Sinne des Wortes konsumierte – weshalb ihr ein örtlicher Buchhändler fast jede Woche eine neue Kiste Nachschub schickte –, war ein anderer Gegenstand in ihrem Besitz von besonderer Bedeutung für mich: eine dunkelgrüne Olivetti-Schreibmaschine, und zwar eine elektrische – eine Lexikon 90. Ein grandios hässliches Trumm von einem Gerät, aber eine Maschine, mit der man viel schneller schreiben konnte als mit mechanischen Schreibmaschinen. An diesem Apparat brachte mir Marieluise später das Zehn-Finger-System bei, ließ mich stundenlang «kalla saal alaska» tippen, eine Wortkombination, die ich nie vergessen sollte – die ersten Wörter, die man mit acht von den zehn Fingern in ASDF-JKLÖ-Grundposition tippen konnte, ohne die Finger von den Tasten zu lösen. Ich machte das, bis ich es beherrschte, ohne darüber nachzudenken, und sogar ein Gespräch mit meiner Lehrerin führen konnte, während ich tippte. Auf der Lexikon tippte ich meine Wörter, stoisch und stundenlang. Zum Beispiel «Hund», ein Wort, das alles in mir mit einem t am Ende schreiben wollte, weil ich nicht begreifen konnte, dass man es mit einem t sprach, aber mit einem d schrieb, und irgendein Mechanismus verhinderte, dass sich die für mich falsch klingende, unlogische Schreibung in mir festsetzte. Also tippte ich das Wort seitenweise, um zu üben, es ohne darüber nachzudenken korrekt zu schreiben. Manchmal, wenn ich nach einer gewissen Zeit aufs Blatt sah, stand da zwanzig-, dreißigmal das Wort in der richtigen, offiziellen Schreibung, aber dann nur noch in meiner, die leider offiziell falsch war. Hundertmal «Hunt». Die vernünftigere Form, für die man eine Fünf bekam.
Als Marieluise Benedickt starb, erbte ich das gute Stück. Ich besitze es heute noch.
2.
Bevor die Räume, in denen wir lebten, in eine Dienstwohnung umgewandelt worden waren, hatten sie als Aufenthalts- und Versorgungsbereich fungiert. Und da das Gebäude nur unterhalb der Räume unterkellert war, die zum Bewohnerbereich gehörten, also auf der Längsachse des Kreuzes lagen, fehlten uns private Abstell- und Hobbyräume. Dafür gab es ein großes Bad, eine noch größere Küche und drei riesige Zimmer, von denen eines formal mir gehörte. Aber tatsächlich nutzte Papa ungefähr ein Drittel davon für seine Modelleisenbahnanlage. Ein Dreizehnjähriger brauchte schließlich keine dreißig Quadratmeter für sich allein. Das meinten jedenfalls meine Eltern.
Die dreigeschossige Fleischmann-H0-Modellbahn war sein Ein und Alles. Sie stank nach Metall, Öl, Lötzinn, Plastikkleber, Elektrizität und diesem Zeug, das man für die Dampfgeneratoren der Loks brauchte. Wenn mein Vater seine Arbeit im Heim getan hatte, polterte er ohne anzuklopfen in mein Zimmer. Er zog den alten Bürodrehstuhl, den er zu diesem Zweck abgezweigt hatte, knatternd aus der Ecke, schob sich eine abgenutzte Schirmmütze in die Haare, damit sie ihn beim Basteln nicht störten, und fing an, zu löten, zu verdrahten, zu verkleben und zu reinigen. Er war geschickt mit den Händen. Im sozialen Bereich war er dafür ein Tollpatsch. Ob ich anwesend war oder nicht, interessierte ihn kaum. Vielleicht versuchte er aber auch, dadurch, dass er mich beim Hereinkommen ignorierte, mir meine Privatsphäre auf etwas originelle Weise zu lassen. Jedenfalls tat er so, als gäbe es zwischen seinem und meinem Bereich nicht nur ein hüfthohes Pressspanregal, sondern eine raumhohe Trennwand. Das misslang allerdings gründlich. Ich kam mir vor, als wäre ich unsichtbar oder wenigstens von geringer Opazität. Ich fühlte mich in meinem großen und aufgrund der Nordseitenlage der Wohnung recht dunklen Zimmer sowieso nicht wohl. Ich wäre gerne in ein winzig kleines Zimmer umgezogen, solange es nur mir und mir allein gehört hätte. Aber außer bei der Modellbahn war mein Vater nicht dazu bereit, Hand anzulegen, weshalb an eine Trennwand im Eigenbau nicht zu denken war.
Ein Problem war, dass mich sein Spielzeug kein bisschen interessierte. Ich fand es unfassbar langweilig, im Kreis fahrenden Zügen zuzuschauen, die sonst keinen Zweck erfüllten. Das eigentliche Problem bestand darin, dass ich mir meiner Ruhe niemals sicher sein konnte. Ich musste jederzeit mit ihm rechnen, während ich mich eigentlich auf die Hausaufgaben konzentrieren, etwas mit Fischertechnik konstruieren oder ein Bild malen wollte. Wenn mein alter Herr irgendwann ab dem späten Nachmittag erwartungsfroh lächelnd hereinkam, den schnarrenden Stuhl aus der Ecke zog und dann den Roten Elch oder das Krokodil fahren ließ – viele Lokomotiven waren nach Tieren benannt –, fühlte ich mich wie der Eindringling. Ich hockte währenddessen im Schneidersitz auf meiner französischen Liege und lernte für die Schule, bis genug Zeit verstrichen war, um das durch seine Anwesenheit noch ungemütlichere Zimmer verlassen zu können, ohne dass er das als direkte Reaktion auf sein Kommen verstanden hätte, was ihn, wie ich annahm, unglücklich gemacht hätte. Manchmal war er so selbstvergessen, so intensiv beim Spielen, dass er anfing, Geräusche zu machen. Er ließ seine Loks tuten, seine kleinen Viking-Autos brummen und er ahmte Unfallgeräusche nach, wenn es zu einer Entgleisung kam. Ich hüstelte dann, um Ruhe einzufordern, woraufhin er sofort still wurde – für eine Weile, bis es dann wieder losging. Manchmal kam mir Josefa zur Hilfe, meine griechische Landschildkröte, die in ihrer Kiste rumorte. Wenn Papa das hörte, hörte er ebenfalls auf mit seinen Geräuschen.
Josefa hatte ich von Herr Kacmarek übernommen, einem sehr dicken, sehr kranken und sehr einsamen Mann, der keine zwei Wochen nach dem Einzug ins Heim gestorben war. Er hatte es tatsächlich geschafft, ein Haustier ins Horizont zu schmuggeln. Eine einmalige Tat bisher. Solche Mitbewohner waren bei uns streng verboten. Mama hatte das beigebraun gepanzerte und halbverhungerte Tier in einem Pappkarton hinter seinen Hemden im schmalen Kleiderschrank entdeckt, und weil Herr Kacmarek keine Verwandten hatte und es in Metting kein Tierheim gab, bot sie mir an, die Testudo hermanni zu übernehmen. Ich fand das Vieh nicht besonders interessant, aber es war anspruchslos und tagaktiv, störte also auch nicht großartig. Manchmal beobachtete ich die Schildkröte, die ich nach der Ehefrau von Herrn Kacmarek benannt hatte, von der ein goldgerahmtes Schwarzweißfoto auf seinem Nachttischchen gestanden hatte. Josefa war auf beneidenswerte Weise mit sich zufrieden. Aber manchmal, wenn ich ihr ein Salatblatt hinhielt, schien sie mich aufmerksam zu betrachten, während sie langsam und genüsslich vor sich hin mümmelte. Und gelegentlich kam es mir sogar vor, als würde mich das Tier – während ihm ein großes Stück Salat seitlich aus dem Maul hing – tatsächlich anlächeln.
Was meinen Vater anging, so war er einfach kein großer Redner. Ich war mir sicher, dass er mich auf seine Weise sehr liebte. Es gelang ihm nur nicht, das auszudrücken und zu kanalisieren. Möglicherweise wartete er ja darauf, dass ich mich neben ihn hockte, ebenfalls eine Schirmmütze aufsetzte und beherzt nach dem Lötkolben griff, um den Wackelkontakt an der Stromschiene zu reparieren, und ich hatte tatsächlich schon darüber nachgedacht, genau das zu tun. Aber die blöde Eisenbahn interessierte mich so unfassbar wenig, dass ich nicht riskieren wollte, fortan dazu verdonnert zu sein, an Nachmittagen und Wochenenden im Kreis fahrenden Zügen, winzigen blinkenden Glühlämpchen, klickenden Weichen, Modellhäuschen aus dem Hause Faller und ebenso bewegungslosen Modellautos beim Nichtstun zuzusehen. Mein Vater wollte jedenfalls nicht mit mir reden, so viel war klar, und stundenlang stumm neben ihm sitzen, das wollte wiederum ich nicht. Also floh ich. Möglicherweise war Papa insgeheim erleichtert, wenn ich mich davonschlich.
Meine Eltern waren beide nicht sehr gesellige Leute, aber jeder auf seine Art. Während mein Vater ganz allgemein ein Problem mit Menschen hatte, musste man das Interesse meiner Mutter irgendwie herausfordern, aber das gelang nur wenigen. In ihrer Freizeit ergänzten sie einander auf diese Weise geradezu perfekt. Nach dem gemeinsamen Abendbrot – Brote, Käse, Wurst, Apfelsaft – saßen sie schweigend nebeneinander vor dem Fernseher, am Samstagabend zusammen mit mir. Am Wochenende trank mein Vater dazu ein, zwei Flaschen Bier, meine Mutter jedoch verbrauchte zusätzlich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend eine Halbliterflasche Orangenlikör der Marke Sonnenstich, die sie manchmal ab dem Sonntagnachmittag mit polnischem Wodka streckte. Außerdem war ihr am Wochenende das Rauchen in der Wohnung gestattet – meine Mutter war zu dieser Zeit eine hingebungsvolle Raucherin. Sie verbrauchte an Samstagen und Sonntagen jeweils drei Schachteln, rauchte sogar beim Kochen, in der Badewanne (Samstage waren Badetage, wir teilten uns das Wasser, und ich musste als Letzter hinein, durfte aber eine Handbreit Heißwasser dazulassen) und auf der Toilette. Man konnte jederzeit erschnuppern, wo in der Wohnung sie sich gerade befand, und bei gutem Licht war es an der unterschiedlichen Trübheit der Raumluft zu erkennen. Unter der Woche schaffte sie es, weitgehend auf Zigaretten zu verzichten. Wenn der Drang allzu stark wurde, verzog sie sich in die kleine Kapelle hinten auf dem Grundstück, um rasch eine HB zu inhalieren. Auf diese Weise waren beide Refugien, über die ich auf dem Grundstück verfügte, immerzu akut bedroht. Denn entweder kam mein Vater einfach in mein Zimmer, um mit seiner Eisenbahn zu spielen, oder meine Mutter schob mit der Schulter die Kapellentür auf, während sie schon dabei war, hastig die Fluppe anzustecken. Ich hatte nirgendwo meine Ruhe, und ich war fast dreizehn, also in einem Alter, in dem man begann, eine gewisse Privatsphäre zu schätzen, umso mehr, seit Marieluise Benedickt zu den Bewohnern des Horizonts gehörte und mir ziemlich viel Aufmerksamkeit schenkte.
Wenn ich an Marieluise dachte, überkam mich ein wohliges Gefühl, gepaart mit einem sehr seltsamen Kribbeln im Hüftbereich. Meine erste Erektion hatte ich natürlich schon Jahre zuvor gehabt, aber jetzt entdeckte ich, was es damit genau auf sich hatte – und wie man sie wieder loswurde, verbunden mit einer verblüffend angenehmen Körperwahrnehmung, aber auch einem durchaus irritierenden Flüssigkeitsabgang, der mich beim ersten Mal maßlos erschreckte. Ein von Marieluise – allerdings nicht zu diesem Zweck – überlassener Roman klärte mich halbwegs über die Hintergründe auf, und ab da wichste ich wie ein Weltmeister, unterbrochen lediglich von zwei sehr schmerzhaften Vorhautentzündungen, die mit heftigen Schwellungen einhergingen. Allerdings musste ich die Nächte abwarten, weil zu allen anderen Zeiten mit spontanen Besuchen zu rechnen war. Ich verbrauchte ziemlich viel Klopapier in dieser Phase.
Mama und Papa gingen mit den Bewohnern des Horizonts aufmerksam und liebenswürdig um, aber außerhalb des Heimes schienen sie sich kaum für Menschen (und auch nicht besonders füreinander) zu interessieren. Sie fuhren alle zwei Wochen am Sonntagabend auf ihren Klapprädern ins einzige Wirtshaus von Metting-Hasenhügel, um dort Königsberger Klopse zu essen und dazu einen Krug Mettingbräu zu trinken, was ihr gesamtes gesellschaftliches Engagement zusammenfasste, denn ansonsten gingen sie selten aus. Sie redeten nicht viel und hatten keine Hobbys, abgesehen von der Raucherei meiner Mutter und der Modelleisenbahnnarretei meines Vaters und einem weiteren, sehr obskuren Faible meines Erzeugers – seiner Vorliebe für Wurstwasser. Sein Opa hatte ihm das immer zu trinken gegeben, wahrscheinlich, wie mir mein Vater gestand, um den wenig geliebten Enkel zu ärgern, wenn dieser zur Aufsicht bei ihm deponiert worden war. Mein Uropa mampfte schmatzend die knackigen Wiener aus der Dose und überließ dem Enkel die Flüssigkeit. Aber der kleine Mann gewöhnte sich an den süßsäuerlichen, nach Ferment müffelnden Geschmack und fand daran Gefallen, weil Geschmack, wie er mir später erzählte, keine genetisch bedingte oder körperliche Sache ist, sondern eben eine der Gewöhnung. Und so hatte sich die Neckerei meines Uropas in etwas verwandelt, das die Aufenthalte bei dem ruppigen Alten reizvoller machte. Die Tat hatte sich gegen den Täter gekehrt.
Nur meinem Vater zuliebe gab es bei uns sehr oft Kartoffel- oder Erbsensuppe mit Würstchen, aber die Würste aßen meistens Mama und ich. Papa konnte es kaum abwarten, das Wurstwasser aus der Dose oder dem Glas zu trinken, kalt oder warm. Er mochte sogar das Wurstwasser, das nach dem Erhitzen der Würste im Topf übrigblieb. Diese eigenartige Geschmacksverwirrung faszinierte mich so sehr, dass ich es auch probierte – und anschließend eine Weile kotzend über der Kloschüssel hing. Meine Mutter verzog das Gesicht, wenn sie ihn beim Wurstwassertrinken sah, aber es störte sie nicht ausreichend, um zu protestieren. Protestiert wurde überhaupt nie in unserem Haus. Wir duldeten einander auf ruhige Weise. Niemand wurde je laut, und ich wurde auch nie geschlagen.
Mein Vater hatte einen einzigen guten Bekannten. Jockel war in seinem Alter und ebenfalls ein Kleinzugfetischist. Sie hatten sich über die Freundschaftsgesuche in einer Modelleisenbahner-Zeitschrift kennengelernt. Zum Leidwesen meines Vaters lebte Jockel in einem Ort namens Marbrunn in Franken, also über fünfhundert Eisenbahnkilometer entfernt, weshalb sie am Wochenende lange Telefonate führten, für die sich mein Vater ins Büro zurückzog. In natura sahen sie sich nur selten. Sie schickten einander Briefe, die außerdem Fotos ihrer Anlagen oder von neuerworbenen Waggons und Zeitungsausschnitte enthielten, auf denen Modellbahnen zu sehen waren. Alle zwei, drei Monate kam Jockel zu uns übers Wochenende zu Besuch. Er war wie mein Vater hager, grobknochig und groß, dunkelhaarig und schnauzbärtig – sie ähnelten einander sehr. Jockel, dessen Vorname eigentlich Jürgen lautete, war etwas jünger als mein Vater, der Gerald hieß und im Frühsommer seinen zweiundvierzigsten Geburtstag gefeiert hatte.
Der September in jenem Jahr war kaum kühler als der August, und selbst in den Nächten blieb es heiß. Mein dunkles, großes Zimmer erwies sich jetzt als vorteilhaft, denn auch am Tag war es vergleichsweise kühl darin. Trotzdem lag ich in dieser Freitagnacht nackt auf der Bettdecke, dachte an Marieluise Benedickt – und außerdem darüber nach, ob es ernsthafte gesundheitliche Schäden verursachen würde, wenn ich schon wieder Hand an mich legte, obwohl ich das zuletzt vor einer Viertelstunde getan hatte und mein schlaffes Glied allmählich einer kleinen, schwerverletzten Gewürzgurke ähnelte.
Jockel war zu Besuch, seit dem späten Nachmittag, und natürlich waren beide Männer, mein Vater und er, gleich nach Jockels Eintreffen in mein Zimmer gekommen, um sich gegenseitig über die neuesten Entwicklungen bei den jeweiligen Anlagen zu informieren – an solchen Wochenenden verbrachte ich wenig Zeit in meinem eigenen Zimmer. Papa hatte während der vergangenen Wochen den Schattenbahnhof im ersten Untergeschoss seiner kleinen Welt stark ausgebaut und präsentierte das jetzt stolz. Ich hörte von ihm das Wort «Gleisharfe», das mir irgendwie gefiel. Ich fand es auch schön, ihn so begeistert reden zu hören, denn sonst schwieg er ja, wenn er bei mir im Zimmer war. Jockel hatte zwei seltene Loks mitgebracht, die er kürzlich erworben hatte und denen die beiden Männer ehrfürchtig dabei zusahen, wie sie summend im Kreis fuhren. Ich ließ sie nach einer halben Stunde allein, die Hausaufgaben zu Montag waren gemacht und draußen war es sowieso schöner.
Marieluise hatte sich von einem der Helfer einen Liegestuhl in den Garten bringen lassen, der jetzt hinter dem Heim auf der Wiese zwischen Haus und Garage stand. Am Bewohnertrakt gab es außerdem eine überdachte, graue Zementterrasse, auf der einige der rüstigeren Alten im Schatten um einen Blechtisch saßen und schwer atmend in ihre Teetassen starrten. Meine Freundin ließ ein Bein seitlich über den Liegestuhlrahmen baumeln, ihre Füße waren nackt. Auf eine solche Idee wäre kein anderer Heimbewohner je gekommen. Offenbar verlor man mit dem Alter nicht nur den Durst, sondern man wurde auch extrem lichtempfindlich. Marieluise trug ein schwarzes Band im Haar und einen hellblauen Hosenanzug. Ihr wahres Alter wurde erst halbwegs sichtbar, wenn man ihr näher kam. Ich fand sie aus jeder Entfernung attraktiv.
Natürlich las sie. Zurzeit einen Roman von Horst H. Baselik, von dem in ihren Remittenden-Kisten Dutzende Bücher zu finden waren. Der deutsche Autor veröffentlichte einen Bestseller nach dem andern. Einen davon hatte ich auch schon gelesen, einen Abenteuerroman über zwei Ehepaare, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel strandeten, dort dann ums Überleben und um die Liebe kämpften. Baseliks Sprache war leicht verständlich und die Geschichte spannend, aber Marieluise rümpfte die Nase, als sie mich jetzt bemerkte und von der Lektüre aufsah.
«Schund», erklärte sie lächelnd. «Gut gemachter Schund zwar, aber Schund. Und in jedem zweiten Roman gibt es einen Flugzeugabsturz in der Südsee.»
Ich widersprach nicht. Ich war nicht dazu in der Lage, Marieluise Benedickt zu widersprechen. Sie legte sich das Buch auf den Bauch, ich hockte mich neben den Liegestuhl.
«Na, Tom, mein Schöner. Hat dich der Papa wieder aus dem Zimmer vertrieben?»
Ich nickte und spürte, wie ich gleichzeitig errötete. An ihre Komplimente musste ich mich erst noch gewöhnen. Sie lächelte und nahm meine Hand. Ich erstarrte und sah mich dann kurz um.
«Meinst du, man spricht bereits über uns?», säuselte sie fröhlich. Ich fühlte mich ertappt und wurde wahrscheinlich noch farbiger. Trotzdem versuchte ich mich an einem Lächeln. Sie ließ meine Hand los.
«Papa hat Besuch», sagte ich und erklärte kurz, wer mit meinem Vater in meinem Zimmer zugange war.
«So, so», sagte sie und grinste. Dann beugte sie sich zur Seite und hob ein Buch vom Boden. «Das hier ist etwas für dich, glaube ich. Probier’s mal.»
Es war Das Sternennetz von Bob M. Feinten, einem amerikanischen Autor. Science-Fiction, eher für Jugendliche. Ich las nicht viel und nicht immer gerne. Ich mochte Geschichten, aber das Lesen fiel mir schwer. Es strengte mich an, die Buchstaben tanzten vor meinen Augen, vor allem die Buchstaben, die ich anders und anderswo eingesetzt hätte. Aber wenn Marieluise mich dazu aufforderte, blieb mir nichts anderes übrig.
«Du musst viel lesen», sagte sie. «Bis du nicht mehr merkst, dass du es tust.»
«Okay», versprach ich und stand auf.
Im selben Moment kam Mutter in den Garten.
Sie klatschte in die Hände. «Es ist Zeit, meine Damen und Herren.» Offiziell durften die Bewohner des Horizonts tun und lassen, was sie wollten, weil sie oder das Sozialamt für Unterkunft, Kost und Pflege bezahlten und sie freiwillig hier waren, aber noch offizieller gab das Heim in Person meiner Mutter den Tagesablauf rigide vor. Und den meisten Alten gefiel das so.
«Es ist Zeit», wiederholte Marieluise Benedickt lächelnd.
Ich las an diesem Abend zwischen den Selbstbefriedigungsetappen fast das erste Drittel von Das Sternennetz. Nach einem wie immer holprigen Einstieg geriet ich in den Sog der Geschichte. Das Buch war ungeheuer spannend, phantasievoll und der Held ähnelte mir sogar ein bisschen. Bob M. Feinten erzählte von einem schlaksigen, eigenbrötlerischen, dreizehn Jahre alten amerikanischen Jungen, der von Außerirdischen gekidnappt wird, weil er eine besondere Eigenschaft hat – er kann das sagenhafte Sternennetz steuern, das viele Planeten verbindet und den bedrohten, freundlichen Aliens zur Flucht vor ihren fiesen, tödlichen Gegnern verhelfen kann. Der Junge namens Wilbur entdeckt die tollsten Welten, findet Freunde und erlebt mit ihnen aufregende Abenteuer.
Mir gefiel der Roman so sehr, dass ich am nächsten Morgen beschloss, meinen Freund Filip zu besuchen, um ihm von diesem großartigen Buch zu berichten. Wir tauschten unsere wenigen sozialen oder kulturellen Erlebnisse immer so schnell wie möglich aus.
Es war kühler geworden und nieselte aus einem kartongrauen Himmel. Ich verabschiedete mich von meinen Eltern und Papas Besuch, fütterte Josefa, zog meine Öljacke an und radelte los. In Metting-Hasenhügel war sowieso nie viel los, aber an leicht verregneten Samstagvormittagen war der Vorort praktisch eine Geisterstadt. Als ich die Hälfte des Weges bis zum nutzlosen Kreisverkehr hinter mich gebracht hatte, wurde es plötzlich dunkler und etwas kälter. Dann blitzte und donnerte es zweimal kurz nacheinander sehr laut. Es würde jeden Moment ein mordsmäßiges Gewitter geben. Ich hielt an und blickte zum Himmel, der inzwischen von einer geschlossenen, dunkelgrauen und sehr kompakten Wolkendecke beherrscht wurde. Am Horizont ging die Bewölkung bereits ins Schwarzbläuliche über. In Comics stand diese Farbe für die drohende Ankunft des wirklich, wirklich Bösen.
Kurzentschlossen drehte ich um und trat ordentlich in die Pedale. Die Entscheidung hatte ich keine Sekunde zu früh getroffen, denn als ich das Heim betrat, donnerte es in unmittelbarer Nähe markerschütternd – und dann setzte Regen ein, der von einem Moment zum nächsten so stark wurde, dass ich die Straße hinter mir nicht mehr sehen konnte.
In der Wohnung roch es nicht nach frischem Rauch, also war meine Mutter ausgegangen, wahrscheinlich zum Einkaufen. Ich hängte meine Öljacke an die düstere Garderobe im Flur, holte mir ein Glas Milch aus der Küche und ging zu meinem Zimmer. Das Gewitter hatte inzwischen richtig losgelegt, es donnerte in kurzen Abständen, dazu hatte heftiger Wind eingesetzt, und der Regen trommelte gegen die Scheiben und das flache Dach. In den Räumen war es dadurch auf seltsame Weise zugleich recht laut und sehr leise, aber welche Geräusche auch immer die beiden Männer bei ihrer Betätigung machten, ich hörte sie nicht gleich, als ich die Tür zu meinem Zimmer aufschob und eigentlich mit dem Milchglas in der einen und dem Buch in der anderen Hand hineinbalancieren wollte.
Denn mein Zimmer war nicht leer.
Es war auf der falschen Seite nicht leer.
Und auf die falsche Art.