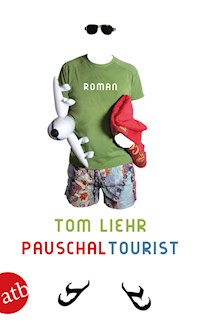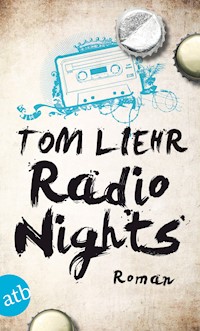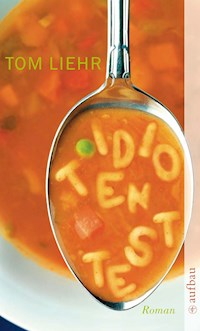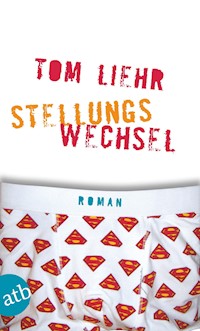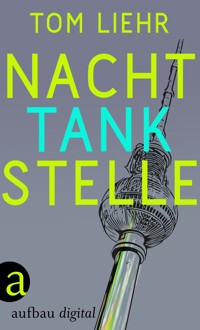
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Uwe Fiedler ist 38, chronisch migränekrank und ein netter Langweiler. Sein Leben ist eine einzige Übergangslösung, die Karriere stagniert auf niedrigstdenkbarem Niveau: Er schiebt Nachtschichten an einer Tankstelle. Weil es praktisch ist und sich so ergeben hat, lebt Uwe noch mit seiner Exfreundin zusammen. Die will das nicht mehr und zwingt Uwe überraschend, seine Komfortzone zu verlassen. Erschüttert und wohnungssuchend lernt er zwei Menschen kennen, die sein Leben noch gründlicher ändern: Jessy, die mysteriöse Tresenkraft einer Neuköllner Gardinenkneipe, und Matuschek, ein Hedonist sondergleichen. In Jessy verliebt Uwe sich, Matuschek wird sein Mentor – und leider auch ziemlich schnell sein Rivale ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Uwe Fiedler ist 38, chronisch migränekrank und ein netter Langweiler. Sein Leben ist eine einzige Übergangslösung, die Karriere stagniert auf niedrigstdenkbarem Niveau: Er schiebt Nachtschichten an einer Tankstelle. Weil es praktisch ist und sich so ergeben hat, lebt Uwe noch mit seiner Exfreundin zusammen. Die will das nicht mehr und zwingt Uwe überraschend, seine Komfortzone zu verlassen. Erschüttert und wohnungssuchend lernt er zwei Menschen kennen, die sein Leben noch gründlicher ändern: Jessy, die mysteriöse Tresenkraft einer Neuköllner Gardinenkneipe, und Matuschek, ein Hedonist sondergleichen. In Jessy verliebt Uwe sich, Matuschek wird sein Mentor – und leider auch ziemlich schnell sein Rivale.
Über Tom Liehr
Tom Liehr war Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Seit 1998 Besitzer eines Software-Unternehmens. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane »Radio Nights«, »Idiotentest«, »Stellungswechsel«, »Geisterfahrer«, »Pauschaltourist«, »Sommerhit«, »Leichtmatrosen« und »Freitags bei Paolo« lieferbar.
Mehr Informationen zum Autor unter www.tomliehr.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tom Liehr
Nachttankstelle
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zweiter Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Thanks
Impressum
Für Elisabeth
Nur weil du paranoid bist, ist noch lange nicht gesagt, dass man es nicht auf dich abgesehen hat.
Will Self
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zweiter Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Thanks
Impressum
Erster Teil
Eins
Die vermutlich seltsamste Erfahrung, die ich während meiner überwiegend nächtlichen Arbeit an der Tankstelle machen durfte, fand tagsüber statt, an einem Wochenende, und nicht im Verkaufsraum der Tankstelle, sondern in einem sogenannten Wellnesshotel in Brandenburg – einem riesigen Schuppen mit Seezugang, Pornokanälen im Fernsehen und muffeligem Personal. Es handelte sich um ein Seminar, das der Konzern für die Tankstellenpächter veranstaltete und bei dem es darum ging, die Verkaufsräume der Tankstellenshops zu optimieren. Stundenlang referierten Konzernmitarbeiter, die im mittleren Management festhingen und schwitzend darauf hofften, ins höhere Management aufzusteigen, vor ihren PowerPoint-Präsentationen davon, wo man Schokoriegel, Chipstüten und Sechserträger zu platzieren hätte, damit sie von Leuten gekauft wurden, die eigentlich keine Schokoriegel, Chipstüten oder Sechserträger kaufen wollten. Die Referenten, die allesamt Doktortitel besaßen, warfen mit Scheinanglizismen, merkwürdigen Termini und vermutlich ad hoc erfundenen Neologismen um sich, um uns, die Pächter, davon zu überzeugen, dass man sich Gedanken darüber machte, wie wir unsere Umsätze steigern könnten. An Benzin verdienten wir eben kaum etwas – der Konzern dafür umso mehr – , und die Häuptlinge wollten uns glauben machen, dass unser Wohlergehen jemandem in den Chefetagen am Herzen lag. Was natürlich nicht stimmte. In meinem Fall war das völlig egal, denn ich war selbst überhaupt kein Tankstellenpächter, sondern im Auftrag und unter dem Namen meines Chefs dort, der diese Veranstaltungen – und eigentlich jeden Kontakt mit Menschen – verabscheute und mich deshalb für hundert Euro extra pro Tag zu diesen Seminaren schickte, von denen er zwei pro Jahr zu besuchen hatte, um seinen »Excelsior-Status« zu behalten.
Inwiefern sich dieser Status von anderen unterschied, wusste ich nicht genau, lernte aber an jenem Wochenende, dass es noch mindestens vier weitere gab, darunter »Classic«, was nicht weniger bedeutete, als absolut nichtswürdig zu sein. »Classic«-Pächter waren beim Seminar unschwer daran erkennbar, dass sie sehr dünn gefüllte Plastiktüten mit Konzerngoodies erhielten, ihre teuren Drinks an der Hotelbar selbst bezahlen mussten und nicht, wie etwa die »Excelsior«-Pächter, per Daimler-Kleinbus am ersten Abend in den zwanzig Kilometer entfernten Landpuff geschippert wurden. Dort saß ich biertrinkend am Tresen, bis um vier Uhr morgens der Kleinbus die befriedigten Edelpächter wieder abholte, die, von mir abgesehen, allesamt ohne Skrupel »auf Zimmer« marschiert waren – Ehering hin oder her – , und schwätzte mit einer sehr interessanten, aber auch tendenzdepressiven Dame jenseits der vierzig, die das Geschehen organisierte, über bezahlten Sex, Frauen- und Männerschicksale, wobei ich versuchte, nicht in ihren gewagten Ausschnitt zu linsen, was ich aber nicht immer vermeiden konnte. Als ich, wieder daheim, Ulrike vom Wochenende erzählte, erwog ich kurz, sie anzulügen und einfach zu behaupten, auch Sex gehabt zu haben, aber das wäre zu billig gewesen und passte nicht zu mir, obwohl es mir die sehr vorübergehende Befriedigung verschafft hätte, nach unserem Beziehungsende wenigstens in einem Punkt die Nase vorn zu haben. Denn es gelang Rieke ebenso wenig wie mir, die soziale Lethargie zu überwinden und neue Freundes- und Bekanntenkreise zu erschließen. Ob sie das wirklich wollte oder nicht, war mir ohnehin ein Rätsel.
Das Absurdeste an diesem Wochenende waren aber weder das unaufhörliche Bullshit-Bingo der Manager noch die Nacht im Bordell (zu meiner Ehrenrettung: Ich hatte bis zur Ankunft im Puff nicht gewusst, wo die Reise hinging), sondern die Erkenntnis, das selbst popelige Tankstellen Orte der Manipulation waren, deren Gestaltung gewieften Konzepten folgte, die einfache, unschuldige Menschen dazu bringen sollten, Scheiß zu kaufen, obwohl sie nur Diesel oder Super in ihre Twingos, Fabias oder Smarts füllen wollten. Ich empfand das als so deprimierend, dass ich, während ich in der letzten Reihe des Auditoriums saß und mir mit meinen geliebten Q-tips in den Ohren herumfuhrwerkte, ernsthaft darüber nachdachte, den schlecht bezahlten, allerdings meistens angenehmen Job gegen unbezahlte Samaritertätigkeiten in einem afrikanischen Schwellenland einzutauschen. Einer dieser Typen, ein verschwitzter Endzwanziger, dem sein teurer Anzug nicht passte, schwadronierte unaufhörlich davon, dass wir – die Pächter – es wären, die »diese Welt« gestalteten, indem wir Chipstüten nach oben und Tampons nach unten stellten (»Die Frauen, die Tampons brauchen, würden sie auch finden, wenn sie vergraben wären. Tampons sind Selfselling-Products.«). Ich fand es einfach nicht okay, die Welt, diese Welt dadurch zu beeinflussen, dass man frittierte, gesalzene Kartoffelscheiben mit Wattestopfen vertauschte. Diese Welt sollte sich mit anderen Dingen befassen, fand ich, und keineswegs damit, ohnehin fettleibigen Twingo-Fahrern auch noch Chips und Dosencola aufzuschwatzen.
Gut, ich machte diesen Job ohnehin nur, um die Zeit bis zum Abschluss meiner Magisterarbeit zu finanzieren. Diese Zeit betrug nun schon sieben Jahre, was natürlich vor allem daran lag, dass ich wenig, eigentlich aber fast nie an der Arbeit schrieb, doch immerhin war im vierten Jahr mein betreuender Dozent gestorben, wodurch ich gefühlt letztlich erst drei Jahre arbeitete, denn der Wechsel hatte mich dazu gezwungen, die Konzepte neu zu formulieren, die Thematik zu adaptieren und mir ziemlich grundsätzliche Gedanken darüber zu machen, ob ich überhaupt den Magister machen wollte. Auch dieser Prozess war noch nicht gänzlich abgeschlossen. Immerhin gab es einen, für den das tatsächlich galt, nämlich die Beziehung zu Ulrike, die gerne Rieke genannt wurde und bereits als Assistenzärztin arbeitete, obwohl wir zeitgleich angefangen hatten zu studieren. Unsere Beziehung hatte zehn Jahre hinter sich, davon zwei ziemlich gute – natürlich die am Anfang – und acht, in denen wir es beide nicht übers Herz gebracht hatten, dem jeweils anderen zu erklären, dass die Luft längst raus war, sich eigentlich aber nie so richtig drinnen befunden hatte. Rieke war mäßig attraktiv, prinzipiell recht liebenswert und sehr intelligent, zu meinem zweifelhaften Glück ebenso entscheidungsscheu wie ich – und exakt so an mich geraten wie ich an sie, nämlich zufällig und ohne jede Leidenschaft. Wir hatten uns gelangweilt und eher nachlässig nach jemandem gesucht, der ein Mindestmaß an gesicherter Abweichung von der Langeweile bot. Das hatte anfangs funktioniert, ohne je Begeisterung auszulösen, und dann hatten wir uns so sehr daran gewöhnt, dass Alternativen gleich welcher Art zu spekulativ wurden. Als Rieke einen mittelmäßig bekannten Popstar – den Schlagersänger Marius Goldstein, dessen Name mir allerdings nichts sagte – in der Ambulanz verarztete und er sie anschließend um ihre Mailadresse bat, endete die Beziehung, zwar nicht dadurch, dass Rieke in eine neue mit dem Popstar eintrat, der sich nicht meldete, sondern aufgrund ihrer Erkenntnis, überraschenderweise doch noch marktfähig zu sein, wie sie es nannte (ich hatte diese Angelegenheit bis dahin nie als Markt begriffen). Das Beziehungsendgespräch war kurz, wir wollten Freunde bleiben, die wir eigentlich nie gewesen waren, und lebten weiter zusammen in der gemeinsamen Wohnung, weil der Popstar keine Mail schrieb und wir beide Besseres zu tun hatten, als einen bequemen Status quo gegen einen ungewissen Status quoquo einzutauschen.
Eigentlich war das Gespräch sogar recht amüsant. Ulrike sah mich länger nachdenklich an, nachdem wir festgestellt hatten, dass es besser wäre, damit aufzuhören, so zu tun, als würden wir noch etwas füreinander empfinden, und dann sagte sie: »Ich musste mir übrigens am Anfang deinen Schnauzer wegdenken. Den fand ich widerlich.«
»Ich eigentlich auch, aber mir fallen Trennungen schwer. Immerhin ist er ja längst weg.«
Sie lächelte. »Und deine Haarfarbe. Dieses Graublond. Oder dein schmales Gesicht, das zuweilen etwas hart wirkt. Ich habe dann oft an Brad Pitt gedacht.«
Ich stutzte. Prominentennamen blieben mir nie lange im Gedächtnis, aber dieser sagte mir etwas. »12 Monkeys« hatte ich sieben- oder achtmal angeschaut, ohne den Film je wirklich verstanden zu haben. Bei »Donnie Darko« hatte ich es mindestens zwei Dutzend Male versucht, aber da spielte Pitt nicht mit.
»Der hat doch eine ziemlich seltsame Gesichtsform«, merkte ich an. »So ein bisschen neandertalermäßig.«
Rieke nickte. »Ich finde ihn trotzdem attraktiv.«
»Deine Haarfarbe mochte ich übrigens auch nie so richtig. Nicht rot, aber auch nicht richtig unrot. Außerdem sind deine Haare irgendwie … ich weiß nicht. Struppig. Nein, nicht struppig. Hart. Manchmal fast strohig.«
»Kompakt«, sagte sie.
Ich nickte. »Und deine Brustwarzen. Ich weiß, viele Männer mögen sehr große Brustwarzen. Aber mich …«
»Törnen sie ab?«, half Rieke aus.
»Kann man so sagen.« Riekes Brustwarzen sahen aus wie Spiegeleier.
»Dieser Leberfleck, den du da an der Hüfte hast, dieser leicht erhabene«, fuhr sie fort.
»Ich denke schon seit Jahren darüber nach, den entfernen zu lassen.« Das gehörte zu den vielen Dingen, über die ich seit Jahren nachdachte. Das mochte ich, lange über konkrete Dinge nachdenken.
»Scheußlich. Ich habe jedes Mal eine Gänsehaut bekommen, wenn ich ihn aus Versehen berührt habe.« Rieke schnaufte fröhlich. »Und wie du deinen Kopf hältst. Du schiebst ihn so seltsam vor, fast wie ein Geier. Als würdest du versuchen, mit dem Kopf zuerst irgendwo anzukommen.«
»Und du bist oft nicht richtig feucht geworden. Eher ein wenig klebrig.«
»Was vielleicht an dir gelegen hat.«
»Kann sein. Aber warum hast du dann nicht einfach ›Jetzt nicht!‹ gesagt?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich dich mag. Dir nicht weh tun wollte.« Sie pausierte kurz, nahm einen Schluck Rotwein. »Sex ist ein sehr kompliziertes Szenario. Man kann es jemandem sagen, wenn er mal nicht so gut aussieht oder ein bisschen riecht oder so. Wenn es ums Vögeln geht, riskiert man sofort gravierende Verletzungen. Die Schmerzschwelle ist niedriger.«
Ich nickte, auch, weil sie das Wort »Vögeln« zum ersten Mal seit Jahren benutzte, und stellte mir vor, Rieke hätte ab und an Dinge wie »Du machst mich gerade nicht an« oder »Hey, ich will ihn einfach nicht in mir haben« gesagt. Natürlich hätte ich sofort bei mir nach Fehlern gesucht. Meistens wurde ich dort ja auch fündig.
»Das war nett von dir«, erklärte ich deshalb, meinte es aber nur teilweise.
»Von dir ja auch. Ich habe schon gemerkt, wenn du eigentlich nicht wolltest.«
»Ich auch«, gab ich zu.
»Du hast immer so ein besonders konzentriertes Gesicht gemacht. Vielleicht hast du dir andere Frauen vorgestellt.«
»So wie du dir andere Männer, ja.« Allerdings hatte ich nie an spezielle Frauen gedacht, sondern eher an Situationen.
»Es ist kompliziert«, sagte sie abermals, dann lachte sie befreit. Nach ein paar Sekunden stimmte ich ein.
»Es ist vorbei«, sagte ich.
»Vorbei«, wiederholte sie.
Wir umarmten uns und drückten uns lange. Es war eine wohltuende Berührung, so ganz ohne all die Implikationen.
»Ich fand deinen Namen auch immer ein bisschen unattraktiv«, erklärte sie. »Uwe.«
»Ulrike ist aber auch nicht viel besser.«
»U und U«, sagten wir gleichzeitig. Und dann, wieder lachend: »Das Double-You.« Wie auf unserem Anrufbeantworter, als wir noch einen besessen hatten, und einen gemeinsamen Telefonanschluss. Danach wurde ich kurz melancholisch, aber wirklich nur kurz.
»Deinen Humor«, sagte Ulrike noch. »Den habe ich immer gemocht.«
Zwischen »immer« und »gemocht« hatte sie eine kleine, fast nicht bemerkbare Pause gemacht, also hatte sie vielleicht »geliebt« sagen wollen. Ich musste schmunzeln, als mir das auffiel, andererseits hörte ich dieses Lob zwar häufiger, fand mich selbst aber nicht sehr humorig. Jedenfalls versuchte ich nicht, witzig zu sein. Menschen, die das taten, die pausenlos nach Pointen suchten und auch Opfer in Kauf nahmen, um andere zu unterhalten, mochte ich überhaupt nicht.
Ich kaufte Wurst, Gemüse und natürlich meine geliebten Q-tips, Rieke Brot, Kaffee und den ganzen Rest, wir schauten gemeinsam »Tatort«, schliefen aber getrennt (Ulrike im Doppelbett und ich auf dem Klappsofa im Wohnzimmer) und lösten – als einzige faktische Markierung des Beziehungsendes – das gemeinschaftliche Konto auf, mehr technische Gemeinsamkeiten gab es längst nicht mehr, vom Schild an der Tür und dem Mietvertrag abgesehen. Wir kochten seltener zusammen und suchten Kontakt zu Bekannten, die nicht mit uns als Paar befreundet waren, was nicht viel weniger langweilig war als die Alternative. Tatsächlich geschah einfach nichts, außer dass wir nicht mehr alle drei Monate unbefriedigenden Sex miteinander hatten. Immerhin hatten wir beide bis zum Schluss versucht, dieses Ritual mit einer gewissen Achtsamkeit und Würde auszustatten, es nicht auf einen Termin zu reduzieren, den man absolvierte, um erneut die Frist anzutreten, aber das misslang zumeist. Wir waren sexuell irgendwie von Anfang an nicht kompatibel. Rieke war erschütternd passiv im Bett, zeigte nie an, was sie mochte und was nicht, reagierte aber immer unterschiedlich – mal kiekste sie, wenn ich mit der Zunge an ihrem Kitzler herumwurschtelte, mal blieb sie in der gleichen Situation steif und still wie ein tiefgekühltes Fischstäbchen. Meine Bemühungen, das sanft zu thematisieren, versandeten wie der Inhalt eines Buddelförmchens in der Sahara. Vor Rieke hatte ich Sex gemocht und auch hin und wieder das Gefühl gehabt, ihn zur Zufriedenheit meiner jeweiligen Partnerin zu praktizieren, aber über die zehn Jahre hinweg erstarben sowohl dieses Gefühl als auch die Erinnerungen daran, was mich letztlich zu der Schlussfolgerung führte, schlecht im Bett zu sein und das auch auf ewig zu bleiben. Über die Folgen für mein Selbstbewusstsein dachte ich irgendwann nicht mehr nach.
Eigentlich, zugegeben, dachte ich generell wenig über solche eher abstrakten Probleme nach. An meinem achtunddreißigsten Geburtstag, den wir zusammen mit gemeinsamen und getrennten Bekannten feierten, die allesamt nicht begriffen, dass wir kein Paar mehr waren (weil es einfach keine erkennbaren Indizien dafür gab), erschlug mich die Erkenntnis, plötzlich achtunddreißig zu sein, wie es eine zentnerschwere Steinplatte mit einer Ameise tut, ohne dass die Ameise eine Chance hat, der Steinplatte adäquat entgegenzutreten. Ich hätte genauso gut fünfzig, siebzig oder neunzig werden können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Schlimmer noch als diese Erkenntnis – die Hälfte ist definitiv vorüber – aber war die Perspektivlosigkeit der ganzen Sache. Zehn Jahre hatte ich mit Ulrike verbracht, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wo das hinführen sollte, und als es zu nichts mehr führte, kam mir plötzlich mein gesamtes Leben ziemlich scheiße vor. Nein, eigentlich nicht scheiße, sondern vakuumesk. Scheiße stinkt wenigstens und hat eine gewisse Konsistenz, mein Leben war geruchlos und besaß die Dichte von Helium.
Aber es war vorbei. Wir lebten miteinander, ohne unsere Leben zu teilen, und man hatte mich eines existenziellen Aspekts beraubt, der mich vor allem davon abgelenkt hatte, dass es keine anderen Aspekte gab. Mein Magister – übrigens in Kunstpädagogik und Psychologie – war jedenfalls keiner, zumal inzwischen erstens die Frist ablief, in der ich diesen Abschluss überhaupt noch bekommen könnte, ich mich zweitens für beide Gebiete ohnehin kaum interessierte und drittens nicht wusste, was ich mit dem Abschluss anfangen sollte. Kunstpädagogik und Psychologie. Man könnte genauso gut Albanisch und Planwirtschaft studieren. Ein paar Kommilitonen, die ich allerdings immer seltener traf, nannten solche Abschlüsse »Master Hartz Four«.
An diesem denkwürdigen Mittwochmorgen, Rieke hatte die gemeinsame Wohnung längst in Richtung Ambulanz-Frühschicht verlassen, lag eine »Morgenpost« auf dem Frühstückstisch, neben den – immer noch liebevoll drapierten – beiden Toasts, dem Nutellaglas, meinem Kaffeebecher und der Butterschale. Sie hatte die Seite mit den Wohnungsanzeigen aufgeschlagen und eine Haftnotiz mit der Aufschrift »Schau’s dir einfach mal an.U.« draufgeklebt. Wie so oft, wenn ich Haftnotizen sah, wünschte ich mir, einmal selbst eine dieser simplen und großartigen Erfindungen zu machen, die die Welt, diese Welt, zwar nicht auf den Kopf stellten, ihr aber etwas gaben, ohne denen, die diese Erfindung nutzten, allzu viel dafür abzuverlangen. Ich liebte Haftnotizen. Es gab einige solcher Dinge, die ich wirklich sehr, sehr mochte. Fernbedienungen für Fernseher – Fernseher selbst demgegenüber fand ich eigentlich nicht so toll. Zentralverriegelungen an Autos: Geil. Oder Heckscheibenwischer. Ich verstand nicht, warum der Mensch, der Frontscheibenwischer entwickelt hatte, nicht sofort auf die Idee gekommen war, auch welche hinten am Auto anzubringen, und nahm an, dass es seinerzeit vielleicht einfach noch keine Heckscheiben gab. Ich fand Höschenwindeln (und übrigens auch Tampons) einfach phantastisch, obwohl ich kein Kind hatte und auch keines plante, weder mit Rieke noch mit einer anderen Frau (Monatsblutungen bekam ich natürlich auch keine). Und Kugelschreiber. Briefkästen. Kippfenster. Solche Sachen. Akkuschrauber. Akkuschrauber hielt ich für legitime Gottesbeweise. Bei meinen eher seltenen Versuchen, mich handwerklich zu betätigen, gaben mir Akkuschrauber das Gefühl, der Aufgabe gewachsen zu sein.
Und nun klebte da dieser gelbe Zettel, über »Mietwohnungen – Angebote«. Ich strich Butter auf die präzise uwekonform getoasteten Scheiben – ich mochte Toast kalt, schon etwas durchgehärtet, und nur am Rand goldbraun – , verteilte die haselnussgroße Flocke Haselnusscreme darauf und studierte einige der Anzeigen. Meine letzte Wohnungssuche lag sehr lange zurück. Rieke hatte die gemeinsame Wohnung ausgewählt, begutachtet und mir anschließend den Mietvertrag vorgelegt. Ich erinnerte mich nicht mehr daran, wie das genau ablief, meinte, hin und wieder in langen Schlangen angestanden zu haben, um mir Dreckslöcher anzuschauen, für die sich händeringend Großfamilien bewarben, die darin höchstens gestapelt Platz gefunden hätten. Aber das war in den frühen Neunzigern gewesen oder so. Möglich, dass es inzwischen schlimmer war. Ich fand den Gedanken unattraktiv, es auszuprobieren. Ich wollte mich nicht verändern. Veränderung bedeutet, dass man Halbgutes für Ungewisses opfert.
Dennoch strich ich, eher dem Zufallsprinzip folgend, ein paar Wohnungen an, nachdem ich gedanklich mein Budget überschlagen hatte. Rieke hatte wohlhabende Eltern, die sie unaufhörlich bezuschussten, und sie verdiente bereits ordentlich Geld, sehr viel mehr als ich an der Tankstelle, wo ich offiziell Minijobber war und die Sonderschichten – fünfzig Prozent der Arbeitszeit – in bar bezahlt bekam, neun Euro pro Stunde, was mir permanent ein schlechtes Gewissen und panische Angst vor dem Finanzamt verursachte, das ich für nicht weniger als allmächtig hielt. Dadurch hatte ich achthundert Tacken pro Monat, zuzüglich BaföG, das ich wunderbarerweise – als Darlehen – noch bekam, ohne zu wissen, warum überhaupt, und einer seltsamen Rente, die ich dem frühen Tod meines Vaters zu verdanken hatte. Unterm Strich knapp tausendeinhundert Euro. Eine Wohnung in Neukölln, anderthalb Zimmer, zweiter Stock, Vorderhaus, zentralbeheizt, ohne Balkon, Laminatboden, war für fünfhundert warm im Angebot, also rief ich an. Einfach so. Noch während ich dem Freizeichen lauschte, fand ich mich überraschend entscheidungsfreudig für einen Mittwochmorgen, der sich üblicherweise kaum von irgendeinem andern Morgen unterschied. Höchstens von Sonntagmorgen, weil ich samstags nach der Nachtschicht noch irgendwo trinken ging und sonntagabends nicht arbeiten musste. Trinkengehen und Ausschlafen mochte ich, aber ich mochte auch, das nur einmal pro Woche zu tun. Sonst wäre ich längst Alkoholiker. Biertrinken löste in mir oft den Wunsch aus, nie wieder damit aufzuhören.
»Kauzig«, sagte eine Altmännerstimme.
»Fiedler«, antwortete ich und musste ein Lachen unterdrücken, denn ich fand es amüsant, einen Nachnamen zu tragen, der zugleich ein Adjektiv ist.
»Ja«, sagte Kauzig.
»Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige an.«
»Heute Abend um neun, oder die Wohnung ist weg. Sie haben eine Minute«, erklärte Kauzig.
»Was?«, fragte ich zurück.
»Jetzt haben Sie nur noch fünfundfünfzig Sekunden.«
»Bin um neun da.«
Ich stand um drei Minuten vor neun in der Neuköllner Weisestraße vor der angegebenen Hausnummer. Viel war nicht zu erkennen, denn es war Oktober und dunkel, um mich herum suchten Menschen in PKW aus der unteren Mittelklasse oder der oberen Unterklasse oder irgendeiner uninteressanten Scheißklasse nach Parkplätzen, die es hier kaum gab. Im Erdgeschoss des Nachbarhauses siedelte eine Kneipe, gegenüber ein Spätkauf, drum herum befanden sich sehr ähnlich aussehende, fünfstöckige Mietshäuser. Es roch nach Herbst und dem Dung von Neukölln. Ich kannte den Bezirk, weil Tante Gertrud hier gewohnt hatte, bis vor drei Jahren, als sie sich, zweiundsiebzigjährig und mit einer unguten Diagnose konfrontiert, aus dem dritten Stock gestürzt hatte, um fortan, mit Krebs und Querschnittslähmung, in einem Heim, das eigentlich ein Hospiz war, dahinzuvegetieren. Ich nahm mir vor, Tante Gertrud mal wieder zu besuchen, als eine mir bekannte Altmännerstimme fragte:
»Fiedler?«
»Jo«, antwortete ich automatisch.
»Dann mal los«, sagte Herr Kauzig. Er war verblüffend jung, vielleicht Mitte fünfzig, aber dick und klein, schloss die quietschende Haustür auf, schaltete die schwachbrüstige Flurbeleuchtung ein und stolperte mir voran in den zweiten Stock. Kauzig trug Sandalen, dazu weiße Tennissocken, Jogginghosen und darüber offenbar einen blau-weiß gestreiften Bademantel. Während er die Treppe hochstieg, erklang dazu das Gerassel eines großen Schlüsselbundes, das er in der rechten Hand trug. Möglich, dass Kauzig sämtliche Häuser in der Straße gehörten.
Die Wohnungstür war schwergängig, der Geruch in der dahinterliegenden Wohnung, die so schwach beleuchtet war wie das Treppenhaus, irgendwie indifferent, diffus. Muff, sicher Schimmel, Reinigungsmittel. Der Vormieter hatte gerne mit Knoblauch gekocht und ein Aquarium besessen. Ich trat nahe an die Tapete heran und konnte dennoch kein Muster erkennen. Es gab einen kleinen Wohnraum mit zwei hohen, aber schmalen Fenstern, ein noch kleineres Schlafzimmer mit nur einem hohen, schmalen Fenster, eine winzige Küche ganz ohne Fenster und ein schlauchförmiges Kabuff, in dem sich ein Miniwaschbecken, ein seitlich angebrachtes Hängeklo und eine winzige Duschtasse ohne Vorhang oder Ähnliches befanden. An seinem jenseitigen Ende gab es einen Schacht – vermutlich über der Speisekammer – , der zu einem kleinen Fenster führte, das man mit einer langen Metallstange öffnen und schließen könnte.
»Bezugsfertig«, stellte Kauzig fest.
»Denkbar«, antwortete ich und versuchte herauszufinden, ob es sich bei dem Material unter meinen Füßen um Auslegeware, verschlissene Teppiche oder doch nur vergessene Zeitungen handelte. Jedenfalls war es kein Laminat.
»Ein Schnäppchen«, sagte Kauzig. »Die Gegend boomt.«
»Absolut.« Im Schlafzimmer hing ein Kruzifix an der Wand. Ich stellte mir einen knoblauchessenden, christlichen Aquaristiker vor, der hier kürzlich im Alter von hundert plus an Schimmelvergiftung gestorben war.
»Wir können gleich den Vertrag machen.«
»Absolut«, wiederholte ich, schritt mutig ins Badezimmer und betätigte die Klospülung. Ein seltsames Geräusch erklang, ansonsten tat sich nichts.
»Das wird natürlich noch gemacht.«
»Natürlich.«
»Haben Sie Verdienstbescheide? Die Bestätigung Ihres vorigen Vermieters, dass Sie die Miete immer pünktlich bezahlt haben? Eine Schufa-Auskunft?«
»Jederzeit«, behauptete ich. Schufa-Auskunft? Welche Hölle musste man aufsuchen, um die zu erhalten?
»Drei Kaltmieten Kaution. Sparbuch. Keine dieser Kautionskassen, keine Bürgschaften. Am liebsten Bares.«
»Klar.«
»Und? Wollen Sie?«
Ich ging in die Knie und schob meine Hand über den Fußboden. Vielleicht handelte es sich tatsächlich um Auslegeware, aber irgendwas blieb an meinen Händen kleben. Ich strich es an meiner Hose ab.
»Habe ich Bedenkzeit?«
Kauzig sah auf die Uhr. »Zwölf Stunden. Ab jetzt.«
Dann schob er mich aus der Wohnung, schloss ab und sprang erstaunlich behände die Treppen herunter. Im Leben würde ich keine fünfhundert Euro monatlich dafür bezahlen, dieses Loch zu bewohnen. Keine vierhundert, keine dreihundert, keine zweihundert, keine hundert, keine null Euro. Eher würde ich noch jahrelang dabei zusehen, wie Rieke auf eine Nachricht ihres Popstars wartete. Der sie seltsamerweise um die Mailadresse gebeten hatte. Bei jeder entsprechenden Gelegenheit mühte ich mich damit ab, das Ätt-Zeichen zu malen, und es misslang mir immer. Ich hätte sie um ihre Mobilfunknummer gebeten. Aber ich war ja auch kein Schlagersänger, den man kennen konnte, wenn man wollte. Ich war Uwe Fiedler, der einen blöden Namen, eine blöde Haarfarbe und einen erhabenen Leberfleck hatte, der an einer Tankstelle arbeitete, seine Magisterarbeit vor sich herschob und versuchte, sich auf die Vorteile des Prinzips »Stagnation« zu konzentrieren. Dessen beste – einzig gute – Zeit fast zwanzig Jahre zurücklag, als er für ein paar Monate Schlagzeuger der mittelerfolgreichen Punkband Lädsda Ville gewesen war.
Draußen fühlte ich mich irgendwie unwirsch und nicht dazu in der Lage, zur U-Bahn zu marschieren und den Heimweg zu finden. Ich betrachtete die Häuserfassaden und dann die Kneipenbeschilderung links von mir. »Nette’s Ecke« hieß die Pinte im benachbarten Erdgeschoss, obwohl sie sich nicht an einer Ecke befand. Das stimmte mich empathisch, also drückte ich die quietschende Holztür auf und stand Sekunden später in einem rauchnebeligen Raum. Obwohl ich das Rauchen an und für sich eher ablehnte, mochte ich den Geruch von Zigaretten, wofür ich keine Erklärung hatte. Bonnie Tyler sang von der totalen Herzeklipse, mit zusammengekniffenen Augen konnte ich ein paar Männer am Tresen erkennen, den ich also ansteuerte, um auf einem wackeligen Hocker Platz zu nehmen und abzuwarten, was nunmehr geschehen würde. Was geschah, war mir seit der siebten Schulklasse nicht mehr passiert, als ich Christiane Filz zum ersten Mal gesehen hatte – das Mädchen, von dem ich damals angenommen hatte, dass ich mein gesamtes Leben mit ihr verbringen wollte, und auch die ganze Zeit danach, falls es eine solche gab. Christiane Filz markierte bis zu diesem Moment das absolute und unerreichbare Ideal für mich, denn für Christiane Filz existierte ich damals und vermutlich auch heute noch nicht, sie dafür umso mehr in meiner Wahrnehmung. Fünf Jahre hatte ich hauptsächlich mit Versuchen verbracht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, was mich in sehr viele peinliche Situationen, ihr aber keinen einzigen Schritt nähergebracht hatte. Christiane Filz küsste den sportlichen Ingo aus der Neunten und ließ sich gerüchteweise vom baumlangen Norbert aus der Nebenklasse die Brüste befummeln, aber Uwe Fiedler interessierte sie ebenso wenig wie die Gülle auf den Feldern hinter der Schule. Letztlich fand ich es bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie schön, eine Christiane Filz in meinem Kopf zu lieben, aber dann trat ebendiese Erscheinung aus dem Raum hinter dem Tresen, kam zwei Schritte auf mich zu, musterte mich kurz und völlig desinteressiert, um dann »Was darf’s sein?« zu fragen. Ich hätte gerne einiges geantwortet, beließ es aber vorerst bei der Bitte um ein Bier. Was wohl aus Christiane Filz geworden war? Sie hatte Richterin oder Rechtsanwältin werden wollen, und vermutlich hätte ich im Netz etwas über sie gefunden, obwohl sie sehr wahrscheinlich nicht mehr Filz hieß, sondern von und zu Gerstenfeld oder so – oder irgendwas mit einem Doppelnamen, wie die meisten Juristen. Aber ich unterließ die diesbezüglichen Versuche, weil der Traum schön war, wie er war. Gewesen war. Bis jetzt.
Da mich die Erscheinung ignorierte, wie sie das offenkundig mit allem tat, das nicht unmittelbar mit ihrem Job zu tun hatte, konzentrierte ich mich während der folgenden zwei Stunden darauf, den Gesprächen meiner Tresennachbarn zu lauschen. Dadurch fand ich immerhin heraus, dass die Frau Jessy hieß oder genannt wurde, und außerdem, dass sich der FC – welcher auch immer – auf dem absteigenden Ast befand, dass alles immer teurer wurde und das Leben grundsätzlich ziemlich scheiße war. Die Gästefluktuation in Nette’s Ecke war nicht sehr hoch. Es schien mir, als würden diese mittelalten und durchschnittlichen Männer um mich herum am frühen Abend einkehren, um dann bis zum Feierabend durchzuhalten, woraufhin sie wieder anfingen, sich auf den nächsten Abend zu freuen, aber nicht sehr, sondern eher so, wie man sich über einen Sitzplatz in der überfüllten und stinkenden U-Bahn freut. Was mich verblüffte, war, dass sie die hübsche Jessy kaum beachteten, es aber ein großes Hallo gab, als gegen halb elf eine ältere Dame eintraf, die ziemlich verlebt aussah, kaputte Zähne hatte und einen übelriechenden Hund mitbrachte, was man trotz des Qualms wahrnehmen konnte, und die von den sieben, manchmal acht, manchmal sechs Männern am Tresen unaufhörlich und offenbar im Rahmen eines seltsamen Wettbewerbs zu einem Drink nach dem anderen eingeladen wurde. Diese Frau hieß Rita und genoss das Geschehen sichtlich. Ich beobachtete Jessy und bekam das Gefühl, dass sich eine Panzerglasscheibe zwischen ihr und uns befand.
Sie war vielleicht Mitte, Ende zwanzig, sehr schlank und fast so groß wie ich, also über eins achtzig, hatte lange, dunkelbraune Haare und ein etwas längliches, jedoch sehr schönes Gesicht, wie ich fand. Sie war nicht geschminkt, was ihre dunklen Augen betonte, trug die Haare zu einem Zopf gebunden, hatte eine enge Bluse und einen kurzen Rock an, wodurch man ihre schönen, langen Beine sehen konnte, die in durchsichtige Strumpfhosen gehüllt waren. Die Turnschuhe ließen Jessy jünger erscheinen, wenn man nur den unteren Teil ihres Körpers ansah, aber aus etwas größerer Entfernung entstand durch die Sneakers ein irgendwie unstimmiges Bild. Jessys Gesichtsausdruck war monoton, nämlich völlig emotionslos, und sie hob oder senkte die Stimme nicht, wenn sie etwas sagte oder fragte, ganz egal, wie stark die Hintergrund- und Umgebungsgeräusche waren: Sie forderte Konzentration ein.
»Und du?«, krähte mir eine Frauenstimme – die von Rita – ins Ohr, während ich Jessy beobachtete, die Gläser ausspülte, mit sehr routinierten, effizienten Bewegungen, ohne dass sie der Tätigkeit besondere Aufmerksamkeit widmete.
»Bitte?«, fragte ich zurück und lehnte mich weg. Rita hatte mir ins Ohr gespuckt.
»Von dir gibt’s nichts oder nicht?«
»Wofür?«
Jetzt hatte ich ihre Hand auf der Schulter, eine sich bewegende Hand, die etwas wie Massage versuchte. Eine Hand, auf der ich Altersflecken und Falten sah.
»Du bist ein Hübscher«, behauptete Rita.
»Danke«, sagte ich. Vermutlich hatte sie sogar recht, quasi im Kontext.
»Wir sollten was zusammen trinken. Ich bin die Rita.«
»Ich weiß«, antwortete ich.
In diesem Augenblick lehnte sich Jessy vor, aber nur ein ganz klein wenig, kaum zu bemerken. Sie lächelte. Ein derart seltsames Lächeln hatte ich noch nie gesehen. So muss ein Selbstmordattentäter lächeln, im Moment der Bombenzündung, dachte ich.
»Rita, ich habe dir gesagt, dass ich dich hinauswerfe, wenn du nicht damit aufhörst, die Gäste zu belästigen.«
»Belästige ich dich?«, fragte mich Rita lautstark, obwohl der Abstand zwischen ihr und mir im Zentimeterbereich lag, da sie ihn nach meinem Wegrücken gleich wieder verkürzt hatte, und spuckte mir dabei abermals ins Ohr. Ich steckte den rechten Zeigefinger hinein und bemühte mich, den Speichel zu beseitigen. Ich wischte den Finger an der Hose ab, versuchte mich an einem Schmunzeln in Ritas Richtung und nickte dann langsam und möglichst freundlich.
In diesem Augenblick hörte die Musik auf, es war plötzlich sehr still in Nette’s Ecke. Rita musterte mich, dann nickte sie ebenfalls, lächelnd, und sie zog sich etwas zurück.
»Das hier«, sagte sie und drehte ihren Kopf ein wenig. »Das hier, lieber Freund, hast du noch vor dir. Also sei nicht so arrogant.«
Ich deutete ein Kopfschütteln an. »Arroganz liegt mir fern. Es ehrt mich auch sehr, dass Sie den Kontakt zu mir suchen. Ich bin jedoch an derlei zur Zeit nicht interessiert.«
Rita öffnete den Mund, schloss ihn und öffnete ihn abermals. »Was bist du denn für einer?«, krakeelte sie anschließend. »Es ehrt mich auch sehr. Du sprichst genau wie die da.« Sie ließ ihren Kopf leicht in Richtung Zapfanlage schlenkern.
»Halt die Fresse, Rita«, sagte Jessy, was wie einstudiert klang. »Sonst schmeiße ich dich raus. Ich sage das nicht noch einmal.«
Rita zuckte zusammen, sah zu mir, zur Bedienung, zu den Herren um uns herum, die das Geschehen fasziniert beobachteten. Dann hob sie beide Hände.
»Ist ja schon gut. Ich muss ja nicht mit jedem trinken.«
»Genau«, sagte ich lächelnd. »Zuweilen liegt der eigentliche Genuss im Verzicht.«
»Was?«
»Halt die Fresse, Rita«, wiederholte Jessy, wobei sie ein frisches Bier vor mir abstellte. »Geht aufs Haus«, sagte sie. Und dann, nach einer kurzen Pause: »Ich heiße Jessica.«
Da die Frage »Und du?« mitschwang, antwortete ich: »Uwe. Leider.«
»Wieso leider? Ist doch okay. Namen bedeuten sowieso nichts.« Dabei lächelte sie wieder, oder zeigte eine Mimik, die einem menschlichen Lächeln wenigstens ziemlich nahekam. Etwas stimmte nicht mit dieser Frau.
Ich schwieg, erstens, weil ich nicht ihrer Meinung war, denn ich hielt Namen für Etiketten, deren Inhaltsbeschreibung man sich nach und nach anpasste, ganz automatisch und völlig unvermeidbar. Aus einem Harald würde nie jemand werden, den andere »besonders cool« nennen, und ein Jens würde es nie zum Popstar bringen. Aus Haralds wurden stellvertretende Filialleiter von Banken und aus Jensen wurden höchstens Proktologen. Als Uwe war man irgendwo dazwischen. Zweitens und vor allem jedoch war ich von einer Sekunde zur anderen von der Vorstellung gefangen, Jessy könnte in diesem Augenblick dabei sein, mich auf ihre originelle Art anzumachen. Diese Vorstellung war faszinierend und äußerst erregend. Deshalb konzentrierte ich mich auf das Bierglas und seinen Inhalt. »Stimmt schon«, nuschelte ich noch, mich an die Frage erinnernd und direkten Blickkontakt mit Jessy meidend.
Eine weitere Gruppe mittelalter, durchschnittlicher Männer betrat Nette’s Ecke und okkupierte einen runden Tisch, wo man umgehend Skatutensilien sortierte, Runden orderte, ohne sich zum Tresen umzudrehen, und also Jessica beschäftigte. Einzig Rita schaffte es, kurz die Aufmerksamkeit der Skatspieler auf sich zu ziehen, weil sie »Hier ist es so trocken« in deren Richtung krähte.
Ich holte mein Smartphone aus der Tasche, schlenzte mit einer, wie ich meinte, lässigen Daumenbewegung den Freigabecode auf den Touchscreen und tat fortan so, als wäre wichtig, was ich da machte. In meiner Mailbox tummelten sich die Spammer, bei Facebook, Googleplus und Twitter betrieb man, wie üblich, verschärften Kommunikationsnihilismus. Während ich mir die belanglosen Nachrichten und »Statusmeldungen« durchlas, was ich immer sehr akribisch tat, spürte ich, wie die beruhigende Wirkung dieser Tätigkeit einsetzte. Die Tatsache, dass Millionen Menschen Kommunikation rein um der Kommunikation willen betrieben, sich also der Kommunikation völlig unterordneten, stimmte mich stets auf seltsame Weise zuversichtlich. Ich verstand das Konzept zwar nach wie vor nicht, und ich hielt mich auch damit zurück, aktiv einzugreifen, aber die Wirkung dieser Belanglosigkeitenbörsen verebbte nie. Menschen saßen vor Computern, oft vor mobilen Computern, die sie verwendeten, während sie anderen Menschen gegenübersaßen, und teilten mit, was sie taten (etwa anderen Menschen gegenübersitzen) und warum. Unabhängig davon, dass diese Systeme dafür geschaffen waren, etwas über Leute zu verraten, taten sie das auch unmittelbar. Ich empfand es als angenehm, zu wissen, dass vielen Menschen so unwichtige Dinge so wichtig sein konnten, weil es das Tier in ihnen schlafen ließ. Die wichtigste Aufgabe des Konstrukts, das wir »Zivilisation« nennen, besteht darin, das Tier im Menschen schlafen zu lassen. Wenn ich so oft wie möglich klickend Beifall spendete, trug ich vielleicht dazu bei, diese Leute von schädlichen Tätigkeiten abzulenken. Redete ich mir jedenfalls ein.
So verging eine Stunde, vielleicht sogar zwei. Jessy stellte mir gelegentlich ein neues Bier hin und musterte mich dabei mit einem tatsächlich leicht ironischen Blick, die Skatspieler reizten lautstark und donnerten Karten auf den Tisch, als würde das die Kartenwerte erhöhen, und die Runde um Rita schob die Verantwortung für den nächsten Ritadrink von einem zum anderen. Jessica zapfte, auf Facebook meldeten Mitbürger, mit denen ich »befreundet« war, dass sie heute achthundert Meter im Park gerannt waren oder die neue Höschenwindelnwerbung und den letzten »Tatort« besonders blöd fanden. Ich klickte auf »Gefällt mir«, wann immer mir die Möglichkeit geboten wurde, und fühlte mich als Teil von irgendwas. Zwei- oder dreimal sah ich, dass Rieke eine Meldung gepostet hatte, die letzte verkündete, dass ihre Nachtschicht nunmehr endete, was mir auch gefiel, obwohl ich nicht verstand, wem sie das verkündete. Mir jedenfalls nicht, denn ich verwendete für all diese Dienste das Pseudonym »Frank Meier«, womit ich einer von mehreren Hundert war, was weder Ulrike noch andere Bekannte zu stören schien, denn alle bestätigten meine Freundschaftsattacken unter diesem Pseudonym fast ohne Verzögerung. Das taten auch wildfremde Menschen, denen ich über die verschiedenen Systeme algorithmengenerierte Anfragen zukommen ließ, wodurch ich immer tiefer in die solideren Regionen der Netzwerke geriet. Meine Profile wurden vom unscharfen Foto eines ehemaligen Soap-Schauspielers geschmückt, das ich irgendwo kopiert und anschließend verfremdet hatte, und die sonstigen Angaben zu meiner virtuellen Person – etwa über kulturelle Interessen – entstammten diversen Bestenlisten oder waren einfach der oberste Eintrag der entsprechenden Auswahl.
Während dieser Beschäftigung verdrängte ich jeden Gedanken daran, dass Jessica möglicherweise versucht hatte oder immer noch dabei war, mich anzumachen. Ich ging dreimal aufs Klo und sah dort sehr lange in den Spiegel. Spiegel mochte ich eigentlich nicht, weil man darin nie wirklich sich selbst sah, sondern oft nur, was man sehen wollte. Dennoch meinte ich nach jedem Spiegelcheck, im Vergleich zur sonstigen Nette’s-Ecke-Population im Vorteil zu sein, was diese Jessicasache betraf. Wahrscheinlich aber gab es überhaupt keine Jessicasache.
Plötzlich war es zwei Uhr morgens.
Jessy läutete die letzte Runde ein, nahm Bestellungen entgegen, nickte mir – vielsagend? – zu und machte sich daran, die Kaffeemaschine zu reinigen. Zwischen meiner letzten Bestellung und ihrer Ausführung klickte ich zweiundfünfzigmal auf »Gefällt mir« und gefiel mir dabei.
Sie hatte sich selbst ein Bier gezapft und prostete mir zu.
»Und du? Was machst du jetzt?«, fragte sie.
»Schlafen gehen«, schlug ich vor.
»Gute Idee«, sagte sie und lächelte wieder. »Wohnst du in der Nähe?«
»Noch nicht.«
»Aber ich.«
Ich nickte langsam und ließ die Botschaft bei mir ankommen. Im gleichen Augenblick verengte sich mein Sichtfeld.
»Scheiße«, sagte ich langsam und musste mich bereits darauf konzentrieren, ein so einfaches Wort zu sagen. »Kannst du mir bitte ein Taxi rufen?«
Zwei
Eine nicht therapierbare chronische Erkrankung ist wie ein Charaktermerkmal: Sie ist da und bleibt es auch, Punkt. Menschen, die daran leiden, können sich davon keine Auszeit nehmen, sie haben kein normales Zweitleben ohne Erkrankung, sondern nur dieses eine mit. Ihr Schicksal ist untrennbar mit der Krankheit verbunden, was man manchmal vergisst oder verdrängt, wenn man es mit solchen Menschen zu tun hat, sie sieht oder erlebt, dabei geht es den Betroffenen genau umgekehrt: Sie haben vergessen, wie es wirklich ist, ohne Krankheit zu sein. Dieser Zustand der Krankheitsfreiheit entwickelt sich allmählich zu einem diffusen Traum, zu einer Lebensbeschreibung, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Es ist unmöglich, die Krankheit abzustreifen, und sei es auch nur für ein paar Minuten. Man kann sich lediglich daran gewöhnen – und versuchen, seine Erfüllung abseits davon zu finden. Wer sehr viel Glück hat, leidet, wie ich, nur an einer unregelmäßig ihre Symptome zeigenden chronischen Erkrankung, wodurch ich zwar leidensfreie Zeiten kannte, in diesen aber häufig Panik vor Krankheitsattacken hatte, die jederzeit auftreten konnten.
Ich hatte eine chronische Migräne, die vermutlich genetisch bedingt war. Ha, nur eine Migräne!, höre ich da schon die Spötter rufen, aber das Scheißwort für diese Scheißkrankheit ist nicht umsonst so scheiße, als hätte sich irgendein Grieche in der Vorzeit den Namen für eine besonders doofe und nutzlose Göttin ausgedacht: Migräne, die unansehnliche, außereheliche Halbtochter der Mnemosyne, Göttin der Defäkation und des Stuhlbluts, gezeugt bei der Kopulation mit einer dumpfgrauen männlichen Teichunke.
Ich hasste sie.
Gut, sie war keine tödliche Bedrohung, und meistens war ich frei von Symptomen.
Aber ich hasste sie trotzdem.
Meine Migräneanfälle kündigten sich ungefähr eine Stunde vor ihrer Klimax dadurch an, dass sich mein Sichtfeld von außen nach innen langsam verengte und die Farbwahrnehmung plötzlich nicht mehr stimmte – aus Gelb wurde ein helles Grün, Blautöne begannen, ins Lilafarbene zu tendieren, woraus kurz vor dem eigentlichen Anfall fast reine Schwarzweißsicht wurde, durchzogen von wabernden, konzentrischen Kreisen, als würde ich auf eine reflektierende Wasseroberfläche blicken, in die gerade ein Stein geworfen worden war. Zeitgleich schien alles um mich herum lauter zu werden, was vor allem höhere Tonlagen anbetraf. Nach dieser Ouvertüre setzte ein drückender Kopfschmerz ein, halbseitig – immer nur links – , der schnell stärker wurde und auch noch beim tausendsten Mal den Wunsch auslöste, mir selbst den Schädel aufzusägen und die linke Gehirnhälfte herauszureißen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es schlimmeren Schmerz geben könnte. Aber Schmerz ist ja ohnehin nur subjektive Signalinterpretation, wie mein Arzt zu erklären pflegte, also erstens nicht vergleichbar. Zweitens blieb ein Rätsel. Mein Neurologe – ich mochte diese Wendung, »mein Neurologe« – sagte gerne »erstens« und nie »zweitens«. Dr. Peter war ein herziger schwuler Mittsechziger, der unaufhörlich Mentholpastillen lutschte, um gegen seinen Mundgeruch anzukämpfen, und der während längerer Untersuchungen von seinem Lieblingsthema schwätzte, nämlich Campingurlaub. Dr. Peter besaß ein riesiges Wohnmobil, mit dem er, seine beiden Labradorrüden, ein Kater namens Apate und ein Hundert-Liter-Süßwasseraquarium schon ganz Europa, das nördliche Afrika und halb Asien bereist hatten. Dr. Peter kannte beinahe jeden Campingplatz westlich des Urals. Ich beneidete ihn ein wenig darum, sich auf zwei Gebieten – Neurologie und Campingurlaub – so gut auszukennen, denn ich konnte nicht einmal auf ein Fachgebiet verweisen.
In der Stunde vor dem eigentlichen Anfall, manchmal etwas mehr, oft etwas weniger, hatte ich Zeit, mir ein paar Ibus oder Thomapyrins oder beides einzuwerfen und schnellstmöglich nach Hause zu eilen, wo mir nichts blieb, als den Schub in einem dunklen, ruhigen Raum in leiser Qual abzuwarten. War ich irgendwo unterwegs, ging es darum, rasch ein Taxi aufzutreiben, denn ein Auto konnte ich dann nicht mehr steuern, geschweige denn, mich dem Dschungel des öffentlichen Nahverkehrs aussetzen, um anschließend Hotel- oder Schlafzimmer abzudunkeln, alle Kommunikationsendgeräte abzuschalten, noch etwas Aspirin zu nehmen und still zu leiden, für einen Zeitraum, dessen Länge ich immer erst danach erfuhr, denn während der Anfälle fehlte mir jedes Zeitgefühl. Dr. Peter hatte mir hin und wieder härtere Präparate verschrieben, darunter auch Betablocker, aber deren Nebenwirkungen verängstigten mich. Aussicht auf Heilung gab es nicht. Immerhin, behauptete Dr. Peter unermüdlich, könnte erstens völlig unvorhersehbar Besserung eintreten. Solche Fälle seien ausgiebig dokumentiert. Ich hoffte darauf, auch Eingang in solch ein Dokument zu finden. Die Vorstellung, keine chronische Migräne mehr zu haben, schien mir paradiesischer als jede andere.
Etwas hatte sich immerhin gebessert, seit ich bei Dr. Peter in Behandlung war. Ich wusste nicht nur sehr viel mehr über Zeltplätze, Fäkalientanks, Anhängerlasten, Gaskocher und solche Dinge, die ich sicherlich irgendwann nutzbringend verwenden könnte, obwohl mich diese Form der Freizeitgestaltung kaum reizte – er hatte mich auch im Hinblick auf die Erkrankung mit wertvollen Tipps ausgestattet. Sein wichtigster hatte gelautet: »Erstens. Meiden Sie Stress.«
Mein Leben war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr stresslastig, von der Arbeit abgesehen. Vor der Tankstelle, also in der Zeit von Dr. Peters Tippgabe, hatte ich in einem Callcenter gearbeitet, als vermeintlicher Hotlinemitarbeiter von insgesamt vier Softwarefirmen, die Finanzbuchhaltungsprogramme und ähnliches Zeug herstellten, sich aber keinen eigenen Kundenservice leisten konnten oder wollten. Als Mitglied der Farbengruppe meldete ich mich abwechselnd – je nach Ziel des Anrufers – mit den Namen Schwarze, Rote, Blaue oder Grüning. Es gab außerdem noch die Handwerkergruppe (Schreiner, Tischler, Schrauber, Bauer), die Monarchengruppe (König, Kaiser, Prinz, Herzog), die Gartengruppe (Baume, Blume, Strauch, Erdmann), eine Tiergruppe (Adler, Löwe, Bär und Rehberg) und wunderbarerweise die Musikergruppe (Trommler, Sänger, Flöter und – leider – Geiger, aber nicht Fiedler), zu der ich eigentlich gehört hätte, aber es gefiel mir, meinen richtigen Namen nicht verwenden zu müssen. Meistens meldete ich mich mit »Schwarze«, denn die Programme des fraglichen Herstellers waren offenbar äußerst fehleranfällig und schwer zu bedienen. Gesehen hatte ich sie nie. Unsere ersten beiden Fragen hatten standardmäßig zu lauten: »Haben Sie in die Dokumentation geschaut?«, und »Läuft bei Ihnen die aktuellste Version der Software?«. Verneinte der Anrufer eine dieser beiden Fragen, was häufig geschah, zumal der Anbieter, für den Herr Schwarze scheinbar arbeitete, praktisch im Tagesrhythmus Updates veröffentlichte, wurde er gebeten, eben ins Handbuch zu schauen oder die Software zu aktualisieren. In allen anderen Fällen bekam er eine sogenannte »Ticketnummer«, unter der sich angeblich bald ein Techniker melden würde. Das geschah aber frühestens nach dem dritten Anruf. Dass es bei den vorigen Malen nicht klappte, hatten wir im Telefonat Computerfehlern zuzuschreiben.
Unsere Gesprächspartner waren oft sehr ungehalten und beschimpften uns regelmäßig. Einige schienen es sogar für die Hauptaufgabe der Hotline zu halten, sich Beschimpfungen anzuhören, übrigens nicht selten sehr persönlicher Art. Man mutmaßte am Telefon über meine allgemeine, technische oder mentale Kompetenz, über mein Aussehen oder mein soziales Umfeld, unterstellte mir beispielsweise Fettleibigkeit oder Obdachlosigkeit. Es war mir verboten, darauf zu reagieren, stattdessen hatte ich stoisch nach schriftlicher Anweisung zu handeln, zudem schleppte ich wohl Altlasten mit mir herum, von denen ich nichts wusste, denn ich war in der Chronologie des Callcenters bereits der siebte Schwarze. Vermutlich war es dieser Punkt, der mich stresste, denn im Callcenter begannen oft Migräneanfälle, ungefähr zwei pro Monat.
Die Arbeit in der Tankstelle, die ich nach Dr. Peters Tipp annahm, war zwar schlechter bezahlt, aber abgesehen von Jugendlichen, die das Jugendschutzgesetz auszuhebeln versuchten, ein paar Dieben und den üblichen Alkoholikern war sie durchaus friedlich, vor allem nachts, wenn ich die Tür zum Shop absperren und mit den Kunden über eine Gegensprechanlage kommunizieren konnte, woraufhin ich ihnen dann ihre Bifis, Zigarettenschachteln, Wodkaflaschen und das Wechselgeld über ein Schubladensystem zukommen ließ. Wenn kein Kunde kam, las ich in den Magazinen, deren Vielfältigkeit mich verblüffte. Allein zum Thema »Camping« gab es ein gutes Dutzend, die ich ausgiebig studierte, um mit Dr. Peter, während er wieder einmal meine Gehirnströme maß, fachsimpeln zu können. Außerdem las ich viel über Aquaristik. In Dr. Peters mobilem Süßwasseraquarium schwammen zwar nur gebärfreudige Guppys und ein paar Neons, aber er hörte nach meinem Gefühl gerne zu, wenn ich ihn über Neuerungen bei der Filtertechnik und per Smartphone fernsteuerbare Temperaturregler informierte. Im Gegenzug schlug er mir vor, auch ein Aquarium zu kaufen, da das eine nachweisbar beruhigende Wirkung hätte. Diesem Tipp folgte ich allerdings nicht, denn Ulrikes Eltern besaßen ebenfalls ein großes Süßwasseraquarium, dessen unangenehmer Fäulnisgeruch alle anderen Aromen im Haus überdeckte. Einige Male hatte ich mich, während wir Riekes Eltern besuchten, minutenlang vor das Aquarium gesetzt und die Fische beobachtet, daran aber nichts Beruhigendes gefunden. Die armen Viecher, die offenbar unaufhörlich einen Ausweg suchten, deprimierten mich eher.
Leider reichte der Jobwechsel nicht aus, um die Migräne ganz und gar kaltzustellen. Die Anzahl der Anfälle reduzierte sich zwar drastisch, aber ich lernte, dass Stress viele Erscheinungsformen kennt. Konflikte jeglicher Art standen ganz oben auf meiner persönlichen Liste. Besonders unangenehm und migräneträchtig war es für mich, jemandem etwas zu schulden. Trafen Rechnungen ein, setzte ich mich sofort hin und füllte eine Überweisung aus, die ich spätestens am nächsten Tag in den Briefkasten meiner Bankfiliale warf. Ich wollte niemand sein, der anderen Probleme bereitet; schon Gedanken daran stimmten mich missmutig und verursachten ein Gefühl der Wertlosigkeit. Ebenso wenig mochte ich es, Systemen ausgesetzt zu sein, die mir etwas unterstellten, etwa den Personenkontrollen an Flughäfen. Während der gemeinsamen zehn Jahre hatten Ulrike und ich ganze zwei Flugreisen absolviert, insgesamt vier Migräneanfälle auf meiner Liste, zwei beim Hinflug und zwei beim Rückflug. Schon das Betreten der Abfertigungshallen versetzte mich in Panik, und je näher ich dem würdelosen Abtasten kam, dessen Botschaft lautete: »Wir vertrauen Ihnen nicht und unterstellen Ihnen das Schlimmste«, umso größer wurde sie. Einzig Riekes Gegenwart war es zu verdanken gewesen, dass die Reisen nicht im Chaos geendet hatten. Vor Ort – Spanien, Italien – hatte es mir recht gut gefallen.
Eine Bankkarte besaß und verwendete ich nur, weil es inzwischen faktisch alternativlos war; die Banken dünnten ihre Filialnetze bis zur Homöopathie aus. Ich besaß eine Baseballkappe ausschließlich zu diesem Zweck, also um mich vor den Blicken der omnipräsenten Überwachungskameras zu schützen, während ich Geldautomaten bediente und mich, über das Display gebeugt, beim Eingeben der Geheimzahl mehrfach vertippte, weil ich es nicht erwarten konnte, den Aufnahmebereich der Kameras wieder zu verlassen.
Und jetzt saß ich abermals im Taxi, blinzelte ununterbrochen, kaute Ibuprofentabletten, um sie anschließend trocken herunterzuschlucken, und dachte an Jessica, die mich, wenn ich das noch richtig wahrgenommen hatte, mit einem sehr, sehr merkwürdigen Blick verabschiedet hatte. Ich hockte hinten und sah zwischen den Vordersitzen hindurch auf die Straße. Der Taxifahrer musterte mich im Rückspiegel. Ich wusste nicht, ob ich ihm das Fahrziel genau genug genannt hatte, aber es war mir nicht mehr möglich, das zu überprüfen. Nachtlichter huschten vorbei, der Straßenbelag glänzte, ich wünschte mich in noch intensivere Dunkelheit und Ruhe, aber der Taxifahrer hörte lautstark einen Nachrichtensender, ohne dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, ihn darum zu bitten, das Radio auszuschalten. Wir erreichten das Ziel, ich reichte mein Portemonnaie nach vorne, was der Mann wohl mit einem Satz quittierte, in dem das Wort »Säufer« vorkam, ich stieg aus, fiel hin, kämpfte mich durch die Haustür und hoch in den dritten Stock, wo mir nach einigen Minuten erfolgloser Versuche, das winzige Schloss mit dem riesigen Schlüssel zu öffnen, Rieke aufmachte, mich unterhakte und in mein Zimmer schleppte. Dort fiel das Gewicht eines Mondes auf meinen Schädel und knipste mich einfach aus.
Als ich wieder zu mir kam, war mein erster Gedanke, dass ich unbedingt die Wohnung in der Weisestraße mieten müsste.
Drei
Mein Chef hieß Dietrich Langmann, war Ende fünfzig und ein lupenreiner Menschenhasser. Er war recht groß und ein wenig grobschlächtig, hatte schmutzig graue, schüttere Haare und einen breiten, fleischigen Mund, der von Inseln stoppeliger, zigarrengelbgrauer Barthaare umgeben war, die weder zu wachsen noch je geschnitten zu werden schienen. An der linken Stirnseite besaß Langmann ein flächiges, erhabenes Muttermal in der Form von Albanien. Er trug hellbraune Anzüge mit Weste, dazu hellbraune Hemden und Ledersandalen mit Lochmuster. Dietrich Langmann ging und stand immer ein wenig vorgebeugt, und er lachte niemals.
Neben mir gab es an der Tankstelle selbst zwei weitere Angestellte, außerdem arbeiteten zwei ungarischstämmige Männer in der kleinen, schmierigen Werkstatt, die zum Betrieb gehörte und sich neben dem Verkaufsraum befand, weshalb die Luft dort meistens eine Kopfnote aus Schmierölaromen aufwies, verbunden mit dem Altmännergeruch von Langmanns billigen Zigarren, die er heimlich im Büro hinter dem Shop rauchte, vor allem, wenn er soeben ein erfolgreiches Geschäft hinter sich gebracht hatte. Die Ungarn waren überwiegend damit beschäftigt, den Fahrzeugen der zumeist recht alten Menschen, die ihre Autos Langmann für Inspektionen und Kleinreparaturen anvertrauten, die Reifen abzunehmen und gegen gleiche, aber sehr viel ältere Versionen auszutauschen, die sie von einem Schrottplatz holten, welcher wiederum einem Spezi von Langmann gehörte, der ihm wie ein zweieiiger Zwilling ähnelte. Es hätte mich nicht überrascht, zu erfahren, dass die beiden im selben Stasigefängnis als Aufseher tätig gewesen waren.
Übergab mein Chef dann das vermeintlich reparierte oder inspizierte Fahrzeug an den Kunden, stellte er sich daneben, setzte ein Stirnrunzeln auf und merkte an, dass er mit diesen »Glatzen« keinen Kilometer mehr fahren würde. Daraufhin kauften die Kunden dann ihre eigenen Reifen als gute gebrauchte zurück. Das Prinzip funktionierte faktisch ausnahmslos.
Für Langmann waren alle Frauen Fotzen und alle Männer Ziegenficker, was auch für sein Personal galt. Nicht selten trat er an den Kassentresen, hinter dem ich saß, und merkte an, dass »die Fotze an der vier Diesel tankt, obwohl ihre Schüssel ein Benziner ist«, dass »der dusselige Ziegenficker mit dem BMW das ganze Wasser vorbeigießt« oder dass »die Ziegenficker in der Werkstatt schon wieder Drogen nehmen«. Sehr wahrscheinlich wurde ich in meiner Abwesenheit also auch so genannt. Mein Chef redete zum Glück nicht viel und ließ sich unterm Strich auch selten an der Tankstelle blicken, und wenn er es tat, schloss er sich in seinem Büro ein, das für sämtliche Mitarbeiter Sperrgebiet war (er nannte das »Noggoärrja« – seine englische Aussprache war nicht sehr gut) und in Langmanns Abwesenheit verriegelt blieb. Die beiden Mechaniker, deren Namen ich nicht kannte, beherrschten das Reifenwechselgeschäft perfekt ohne ihn, wobei sie wahrscheinlich einen Gutteil der Einnahmen in die eigene Tasche steckten, denn ich bonierte solche Maßnahmen in der Regel nicht. Den Kunden, die ihre eigenen Reifen kauften, wurde zumeist angeboten, die »Schnäppchen«, die man zufällig gerade auf Lager hätte, cash und ohne Fragen zum Eh-Kah weiterzugeben, wenn die Käufer auf Rechnungen verzichteten. Dieser »Einkaufspreis« lag nur marginal unter dem, den wir für einen Satz fabrikneuer Reifen berechnet hätten. Auch dieses Angebot wurde fast ohne Ausnahme angenommen, zu Langmanns Vorteil, denn letztlich hätte es Belege für den Ankauf der »guten gebrauchten« geben müssen, aber dieser Ankauf existierte ja überhaupt nicht.
Wenn ich im Shop saß und dabei zusah, wie ein Muttchen konsterniert neben ihrem Uralt-Polo stand und nickend den Ausführungen Langmanns lauschte, um anschließend ihr schmales Rentengeld für bereits erworbenes Eigentum hinzublättern, hatte ich ein so schlechtes Gewissen, dass ich Migräneanfälle befürchten musste. Ich schämte mich unendlich dafür, Bestandteil dieses Geschäftsmodells zu sein, von dem ich zu meiner Entschuldigung erst im zweiten Monat erfahren hatte, und auch noch die Scheinchen zu akzeptieren, die mir Langmann für die illegale Mehrarbeit zusteckte. Allerdings hatte ich keine Wahl, denn ebenfalls im zweiten Monat, als mir der Chef zum zweiten Mal ein paar Scheine übergab, sagte er: »Fiedler, bei der ersten Geldübergabe lief die Videoüberwachung mit. Sie sind damit offiziell und nachweisbar Steuerbetrüger. Maximal fünf Jahre Knast, zwischen lauter Ziegenfickern, die gerne auch mal Studenten rannehmen. Vergessen Sie das nie. Ich baue auf Ihre Loyalität.«
Ich vergaß es nicht, ganz im Gegenteil. Mit der Zeit schaffte ich es zwar, die Angst davor zu verdrängen, dass ein Sonderkommando der Steuerfahndung in Ulrikes und meine Wohnung einfallen und mich in Handschellen abführen würde, aber die Gewissheit, Langmanns zweifelhaftem gutem Willen ausgeliefert zu sein, blieb eine ständige Belastung, eine lauernde Bedrohung wie meine Migräne. Natürlich verursachte seine unsubtile Eröffnung auch direkt einen Anfall, und ich musste sogar ein paar unbezahlte Urlaubstage nehmen, um anschließend wieder auf die Beine zu kommen; ärztliche Atteste für »solchen Firlefanz wie Kopfschmerzen« akzeptierte Langmann einfach nicht. Danach gelang es mir, das mögliche Ungemach relativ weit hinten in meinem Bewusstsein einzusortieren. Dabei half es mir, dass ich den Job an der Tankstelle eigentlich sehr mochte, von den Betrügereien und Dietrich Langmann abgesehen, natürlich. Ich begegnete dort vielen Menschen, darunter auch einigen sehr netten, durfte hilfsbereit sein und nahm die Dankbarkeit gerne entgegen. Ich wechselte Scheibenwischerblätter, half beim Tanken, maß Reifenluftdrücke und Ölstände, hielt Türen auf und trug kleine Tüten mit überteuerten Konserven, gekauft vor allem von älteren Menschen, die die langen Öffnungszeiten der Supermärkte noch nicht mitbekommen hatten, zu alten, aber sehr gepflegten Autos, wo ich sie in blitzsaubere Kofferräume lud. Nicht wenige dieser älteren Kunden informierte ich trotz schlechten Gewissens meinem Chef gegenüber, dass die Lidl-Filiale im nahe gelegenen U-Bahnhof sogar samstags bis Mitternacht geöffnet wäre, außerdem am Sonntagvormittag.
Der Unterschied zum Callcenter hätte nicht größer sein können. Während ich dort quasi unaufhörlich beschimpft worden war, gab man mir hier sogar Trinkgeld, lächelte mich an und nannte mich »netter junger Mann«. Natürlich wusste ich, dass für die älteren Damen alles ein junger Mann war, was noch ohne Rollator vorankam, aber ich genoss es trotzdem sehr. Ich flirtete ohne Hintergedanken mit jungen Frauen, scherzte mit den Kunden, empfahl Zeitschriften und führte viel Smalltalk zu den Themen, aus denen die Presse Schlagzeilen gemacht hatte. Und des Nachts hatte ich so wenig zu tun, dass es mir manchmal peinlich war, dafür auch noch bezahlt zu werden. Wie hatte Franz Kafka, den ich ziemlich verehrte, mal geschrieben? »Mein Dienst ist lächerlich und kläglich leicht. Ich weiß nicht, wofür ich das Geld bekomme.«