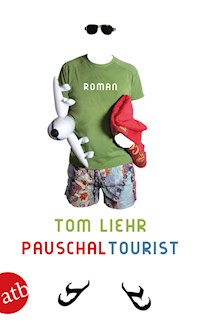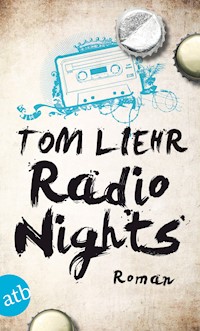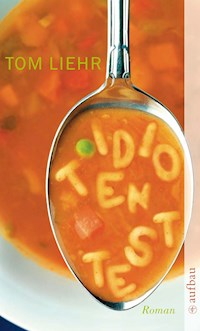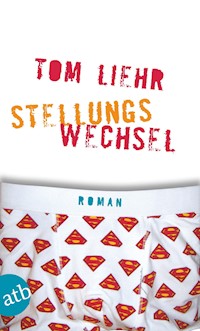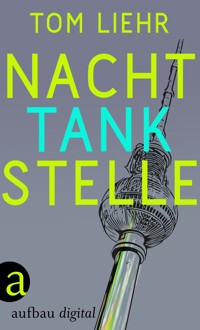Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben – zu kurz, um davor wegzulaufen...
Als Ex-DJ Tim Köhrey endlich zu sich kommt, ist es fast zu spät – Berlin ist weit weg, die große Liebe längst vorbei, und seine Zukunftsaussichten sind trübe: Provinzleben, Reihenhaus, zerrüttete Ehe. Er kehrt zurück in die pulsierende Hauptstadt und sucht nach dem Glück seiner Jugend ...
Eine rasante Geschichte über verpasste Chancen, Liebe, Freundschaft, Musik und die goldenen Achtziger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Liehr
Geisterfahrer
Roman
Aufbau-Verlag
[Menü]
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0234-5ISBN PDF 978-3-8412-2234-3ISBN Printausgabe 978-3-7466-2182-5
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie Erstausgabe erschien 2008 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke derAufbau Verlag GmbH & Co. KGCopyright © 2008 by Tom Liehr
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung gold, Anke Fesel und Kai Dieterichunter Verwendung eines Fotos von Julius Steffens/bobsairport
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Eins 1974 –1984
Prolog
1. Haarausfall
2. Fliege
3. Streife
4. Erbe
5. Transit
6. Mauer
7. Wichsen
8. Schüttelfrost
9. Fahrerflucht
10. Lippenstift
11. Tapes
12. Disco
13. Kino
14. Sommer
15. Übergänge
16. Wäsche
17. Verrat
Zwei 1989
1. Agenten
2. Chateau
3. Hurenherzen
4. Phantomschmerz
5. Präfixe
6. Dreier
7. Überraschungsbesuch
8. Flucht
9. Provinz
10. Schlager
11. Reihenhaus
Zweieinhalb
Zeitumstellung
Drei
1. Fernsehen
2. Sonntag
3. Wichsen II
4. Enthüllungen
5. A2
6. Anwälte
7. Flashback
8. Open Air
9. Telefonate
10. Egel
11. Hepatitis
12. Splatter
13. Auflegen
14. Fickscheiße
15. Rückkehr
16. Retro
Dreieinhalb
Epilog
Anmerkungen
Was wurde aus …
Credits
[Menü]
|7|Eins
1974 –1984
|9|Prolog
In einer Samstagnacht im September 1974 fuhr ein fast fabrikneuer, senffarbener VW-Golf S auf der Bundesautobahn 2, vom Kreuz Hannover-Ost kommend, mit etwa 160 Stundenkilometern an der Ausfahrt Lehrte vorbei. Der Wagen wurde plötzlich so stark abgebremst, dass Reifenabrieb auf der Fahrbahn verblieb, und hielt mit zwei Rädern dies- und zwei Rädern jenseits der Standstreifenmarkierung. Da es auf vier Uhr morgens zuging, war so gut wie kein Verkehr auf der Strecke. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein; die verpasste Ausfahrt Lehrte lag etwa 500 Meter hinter dem Fahrzeug. Der Wagen wurde so stark beschleunigt, wie dies im Rückwärtsgang eben möglich war. Der Fahrer eines in diesem Moment auf der Überholspur mit knapp 200 Stundenkilometern vorbeirasenden Porsche 911 beobachtete, wie der Golf zwischen rechter Fahrbahn und Standspur stark hin und her schlingerte. Offenbar hatte der Fahrer des Wagens Mühe, die Kontrolle über das schnell rückwärtsfahrende Auto zu behalten. Der Porschefahrer hupte, wurde aber nicht wahrgenommen. Er hielt an der nächsten Notrufsäule und alarmierte die Polizei.
Kurz bevor der Kleinwagen die Ausfahrt erreichte, traf dort, ebenfalls vom Kreuz Hannover-Ost kommend, ein unbeladener, zweistöckiger Sattelschlepper ein, der sich auf dem Weg zum Volkswagenwerk befand. Der Fahrer des LKW sah den Golf sehr spät, weil er eine angeregte Diskussion per CB-Funk führte, und glaubte erst nicht, tatsächlich ein rückwärtsfahrendes Fahrzeug vor sich zu haben. Dann bremste er stark, aber es war bereits zu spät. Die Aufprallgeschwindigkeit betrug insgesamt noch etwa 85 Stundenkilometer, bei einem Masseverhältnis von ungefähr fünfzehn zu eins.
|10|Die Insassen des senffarbenen Golfs, der durch den Zusammenstoß auf zwei Drittel seiner ursprünglichen Länge zusammengestaucht und über die rechte Leitplanke katapultiert wurde, waren sofort tot. Der Fahrer des Lastwagens erlitt beidseitig komplizierte Brüche im Unterschenkelbereich sowie eine starke Gehirnerschütterung, sein Fahrzeug wurde vergleichsweise gering beschädigt. Im Volkswagen hatte sich ein Ehepaar befunden, der Mann zweiunddreißig Jahre alt, die Frau achtundzwanzig. Bei ihm wurden posthum 2,4 Promille Blutalkohol festgestellt, bei ihr immerhin noch 1,5 Promille. Sie kamen von einer Feier bei Freunden in Hannover-Langenhagen, denen sie versichert hatten, sie würden nur ihre Sachen aus dem Auto holen und sich dann ein Taxi rufen.
Die Eheleute hießen Rolf und Sabine Köhrey und waren meine Eltern.
Der Nummer-eins-Hit in Deutschland an diesem Tag war »Rock Your Baby« von George McCrae.
|11|1. Haarausfall
Ich war am Todestag meiner Eltern sechs Jahre alt. Wir wohnten in einer Reihenhaussiedlung in Lehrte. Am späten Nachmittag hatten sie mich zur Nachbarin gebracht, die ich »Tante Ina« nennen musste und in deren Wohnung es stark nach Zigarettenqualm roch. Ich hatte meine Matchboxautos mitgebracht und auf dem Wohnzimmerteppich gespielt, der voller Hundehaare war, weil Tante Ina zwei Collies besaß, die Haarausfall hatten, wie ich annahm. Papa jedenfalls hatte welchen und redete andauernd darüber; in der Duschtasse lagen manchmal Büschel seiner dunkelblonden Locken. Ich schob die gelbweißgrauen Hundehaare zu kleinen Hügeln zusammen und umkurvte sie mit meinen Lieblingsautos, einem roten Chevrolet mit Flügeln an der Heckklappe und einem VW-Käfer, dessen Lack schon stark zerkratzt war. Als Tante Ina den Ton am Fernseher ausschaltete und eine Zigarette in den Berg drückte, der aus dem Aschenbecher emporragte, um mir mitzuteilen, dass es Zeit fürs Bett wäre, nahm ich den Feuerwehrwagen mit der abgebrochenen Leiter und ließ ihn in den Chevy krachen.
»Poing!«, rief ich.
Tante Ina sah mir beim Zähneputzen zu, dann musste ich mich in ihr Ehebett legen, das auf einer Seite eine tiefe Kuhle hatte, in die ich mich immer rollen ließ. Ina war geschieden. Ihr Bett roch auch nach Rauch und nach etwas Anderem, etwas Süßlichem, Fauligem, Fleischigem, das ich nicht kannte und das mich ein bisschen ekelte.
Als sie mich weckte, war es draußen noch dunkel, und das war ungewöhnlich. Tante Ina schlief im Wohnzimmer, wenn ich bei ihr war, und meine Eltern holten mich immer erst am nächsten |12|Vormittag ab; meistens wurde ich vor Ina wach. Sie sah zerzaust aus, über dem Haar trug sie eine Art Badekappe aus Frischhaltefolie, durch die man Lockenwickler sehen konnte. Im Flur waren Menschen, ich hörte Männerstimmen.
Ina flüsterte: »Tim, du musst aufstehen. Es ist etwas Schreckliches passiert.«
Ich nickte und kletterte aus der Kuhle. Ich nahm an, dass es brennen würde. Mama und Papa unterhielten sich oft darüber, wie gefährlich es sei, dass Tante Ina so stark und auch noch im Bett rauchen würde und dass sie sich sicherlich irgendwann mal die »Bude über dem Kopf anzünden« würde, was sie allerdings nicht davon abhielt, mich in ihre Obhut zu geben. Ich nahm den roten Plastikkoffer mit den Matchboxautos, der neben dem Bett stand, und ging im Pyjama in den Flur. Den Schlafanzug mochte ich, er war mit Donald-Duck-Figuren bedruckt.
Aber im Flur standen keine Feuerwehrmänner, sondern Polizisten. Feuerwehrmänner hatten Helme, diese Männer trugen Mützen zu ihren schwarzen Hosen und blauen Uniformjacken.
»Ist das der Kleine?«, fragte einer von ihnen und beugte sich zu mir herunter. Ina nickte nur, sie hatte Tränen in den Augen, aber es roch nicht nach Rauch, nur ganz normal nach kaltem Zigarettenqualm.
»Er muss sich anziehen. Wir nehmen ihn mit.«
»Was ist denn?«, fragte ich – und brach spontan in Tränen aus, denn plötzlich hatte ich Angst. Die Polizei holte mich, also hatte ich etwas verbrochen. Nur was? Hatte mich Stefan angezeigt, den ich gestern »Doofi« genannt hatte? War doch herausgekommen, dass wir das Markstück, das wir im Sandkasten des Kindergartens gefunden hatten, unter uns aufgeteilt hatten, statt es abzugeben? Welches meiner schlimmen Verbrechen brachte mich jetzt ins Gefängnis?
Ich kam nicht ins Gefängnis, sondern in die Obhut einer sehr netten Psychologin, die mir sanft zu erklären versuchte, dass |13|meine Eltern tödlich verunglückt waren. Ich war erleichtert. Ich hatte schon mehrfach mitbekommen, wie Menschen im Fernsehen gestorben waren, aber wenige Tage später wieder auftauchten. Kekse-Opa, der Vater meiner Mutter, war zwar vor einigen Monaten gestorben und bisher nicht wieder zu uns gekommen, aber ich war sicher, dass er das früher oder später tun würde. Ich war so erleichtert, nicht ins Gefängnis zu kommen, dass ich der Psychologin die Sache mit dem Markstück gestand. Sie lächelte und strich mir über die Haare. Ich nahm an, dass das ein gutes Zeichen war.
|14|2. Fliege
Wenige Wochen später holte mich ein fremdes Ehepaar aus dem eigentlich recht netten Heim ab. Ich hatte rasch Freunde gefunden, und es war interessant, in einem kleinen Schlafsaal mit zwanzig anderen Kindern zu übernachten, aber ich rechnete jeden Tag damit, dass meine gestorbenen Eltern erschienen und mich wieder nach Hause nahmen. Oder wenigstens Kekse-Opa. Andere Verwandte hatte ich nicht, soweit ich wusste.
Stattdessen kamen Jens und Ute.
»Das sind deine Pflegeeltern. Sie kümmern sich ab jetzt um dich«, sagte die nette Psychologin, die mich auch schon in der Nacht des Unfalls betreut hatte. Dass es einen Unfall gegeben hatte, hatte ich verstanden. Auf der Autobahn. Ein großer LKW war in das Auto meiner Eltern gerast. Ich hatte nur den Feuerwehrwagen mit der abgebrochenen Leiter, aber ein gelbes Auto, das dem funkelnagelneuen Golf meiner Eltern ziemlich ähnlich sah, also stellte ich den Unfall mit dem Feuerwehrwagen nach. Ich kniete auf dem Linoleumboden, drehte mich auf meinen Knien und ließ das größere, rote Auto dem gelben Wagen folgen. Irgendwann holte es das kleinere Auto ein, weil ich den rechten Arm schneller bewegte.
»Poing!«, rief ich dann und ließ beide Autos in den Händen durch die Luft fliegen. Meine Knie brannten ein wenig von diesem Spiel.
Jens war ein sehr blasser, dünner, nicht sonderlich großer Mann mit rötlichen Haaren, die auf der Mitte des Kopfes einen Hautkreis freiließen, und einem Vollbart. Ich fand, er sah sehr alt aus, aber nicht so alt wie Kekse-Opa, der auch einen Vollbart hatte und dessen Haare nach Zigarren stanken. Ute sah meiner Mutter ähnlich; |15|ihr Haar war kurz und graublond, ihre Nase spitz und ihr Mund sehr schmal. Beide hatten braune Augen, die Augen von Jens waren ganz klein, wie bei einem Meerschweinchen. Wir hatten mal ein Meerschweinchen gehabt, ein dreifarbiges Rosettenmeerschwein, aber das war eines Tages einfach verschwunden. »Wir haben es freigelassen«, hatte Mama gesagt.
»Da werden sich Frank und Mark aber freuen«, sagte Jens, nahm mich bei der Hand und führte mich zu einem blauen Auto, dessen Marke ich nicht kannte. Ute ging uns hinterher.
»Was ist das für ein Auto?«, fragte ich.
»Willst du nicht wissen, wer Frank und Mark sind?«, fragte Ute.
»Warum?«, fragte ich zurück und wiederholte meine Frage an Jens.
»Das ist ein BMW«, erklärte er, wobei er zum ersten Mal und auch nur kurz lächelte, strich mit der rechten Hand über das Autodach, öffnete die Beifahrertür und ließ mich nach hinten klettern. Es roch nach Leder. Mama hatte von Papa ein teures Lederportemonnaie zu Weihnachten bekommen, und Mama hatte darauf bestanden, dass ich ebenfalls daran roch.
»Was ist Leder?«, hatte ich am nächsten Tag Stefan gefragt, den Kindergärtner. Er hatte gelächelt. »Die Haut von toten Kühen«, hatte er geantwortet. Das fand ich irgendwie gruselig, ein Portemonnaie aus Haut. »Kann man auch aus Menschenhaut so was machen?« Stefan hatte gelacht. »Könnte man schon. Aber man darf das nicht.«
Ute legte die Tasche, in der sich meine Sachen befanden, in den Kofferraum, ich nahm den Koffer mit den Matchboxautos mit ins Auto, und dann fuhren wir los.
»Was ist mit meinen Eltern? Wann kommen sie zurück?«, wollte ich wissen. Jens sagte nichts, Ute drehte sich vom Beifahrersitz zu mir um und sah mich traurig an. Dann wiederholte sie die seltsame Bemerkung über Frank und Mark, die ich beide überhaupt nicht kannte.
|16|Frank und Mark waren die Söhne von Jens und Ute, Frank war sieben, also ein Jahr älter als ich, Mark vier. Sie standen in der Tür der Wohnung, die im vierten Stock lag. Frank hatte eine dicke Brille auf. Seine Augen waren hinter den Gläsern fast so klein wie die von Jens.
»Habt ihr keinen Garten?«, fragte ich, nachdem mir meine Pflegebrüder die Wohnung gezeigt hatten. Frank schüttelte den Kopf. »Aber im Hof ist ein Spielplatz.«
Es dauerte ungefähr ein halbes Jahr, bis ich begriff, dass meine Eltern endgültig nicht mehr zurückkommen würden. Weil ich immer wieder darauf bestand, dass die gestorbenen Menschen im Fernsehen ja früher oder später auch wieder auftauchten, erklärte mir Ute irgendwann den Unterschied zwischen Schauspielern und echten Menschen. Tatsächlich aber war es Frank, der mir die Sache verdeutlichte. Trotz seiner Sehschwäche hatte Frank ein ziemlich gutes Reaktionsvermögen, und so fing er eines Nachmittags in unserem Zimmer eine Fliege. Er hielt mir die Faust ans Ohr, ich hörte das Summen des Insekts. Dann schlug er mit der sich öffnenden Hand auf die Platte des Kiefernholzschreibtisches. Er zeigte auf die zermatschte Fliege, deren Flügel und Beine verdreht waren und deren Körper keine erkennbare Form mehr hatte. Anschließend fasste er sie am nach hinten gebogenen Flügel, wobei sie einen winzigkleinen, schillernden Fleck auf der Schreibtischoberfläche hinterließ, an dem ein abgerissenes Bein kleben blieb, und legte sie in mein bestes Matchboxauto, einen Bugatti, das kein Dach hatte.
»Die Fliege ist tot. Matsch. So sehen deine Eltern auch aus. Nichts mehr zu machen.«
Frank war so wortkarg wie sein Vater, aber es war ihnen beiden gemein, dass ihre Botschaften leicht erfassbar waren, und diese Botschaft verstand ich fast sofort. Ich nahm das Auto mit der toten, zermatschten Fliege und setzte mich auf mein Bett, das unterste |17|in dem Dreistockbett, in dem über mir Mark und ganz oben Frank schliefen. Ich hielt den Wagen in den Händen und pustete auf das tote Insekt; die Flügel flatterten ein bisschen, aber ich erkannte, dass da nichts mehr zu machen war – so wie Frank gesagt hatte. Dann stellte ich das Auto auf mein Nachtschränkchen. Am nächsten Morgen war die Fliege immer noch tot, und als ich am Abend nachsah, war sie für immer verschwunden.
|18|3. Streife
Mein Pflegevater Jens, der eigentlich viel jünger war, als er aussah, hatte vier Leidenschaften. Eine davon war sein BMW, der die Familie viel – zu viel – Geld kostete und der, wie ich später erfuhr, einer der Gründe dafür gewesen war, dass sie meine Pflegschaft übernommen hatten, wenn auch nicht der Hauptgrund. Außerdem gab es da den Schrebergarten im Südosten von Hannover, der sommers wie winters an jedem Wochenende aufgesucht, gehegt, gepflegt und den Bestimmungen entsprechend akkurat gestutzt, gemäht und entunkrautet wurde; immerhin hatte Jens einen nicht unwichtigen Posten im Vorstand des Kleingärtnervereins inne, einen Job, der seiner vierten Leidenschaft sehr entgegenkam. Auf dem etwa hundert Quadratmeter großen Grundstück verbrachte die Familie nicht nur die Wochenenden, sondern auch den Urlaub. Bis zu unserem Umzug nach Berlin kam ich deshalb niemals aus Hannover heraus. »Deutschland ist hier so schön wie woanders auch, wozu also irgendwo hinfahren? Außerdem gibt es das Fernsehen«, sagte Jens, und damit hatte es sich. Fernsehen war seine dritte Leidenschaft; er liebte Krimiserien und vor allem »Der Kommissar« mit Erik Ode und später dann »Derrick«. Zwar schimpfte er bei jeder zweiten Szene, sagte Dinge wie: »Das würde ein Polizist niemals so machen« oder: »Im Gerichtssaal sitzt der Verteidiger links vom Richter«, aber er öffnete den Mund ehrfürchtig beim Erklingen der Vorspannmelodie und schloss ihn erst wieder, wenn der Abspann eingeblendet wurde. Danach sah er nickend in die Runde, vergewisserte sich, dass wir ebenso andächtig zugesehen und gelauscht hatten, jedenfalls ab der Zeit, ab der wir abends bis kurz nach neun fernsehen durften, und dann trank er sein freitagabendliches Bier aus, das einzige, das er sich überhaupt |19|genehmigte, rülpste leise hinter vorgehaltener Hand, nickte abermals und stand auf, um eine »Schlussrunde« zu gehen, wie er es nannte. Er trat dann in den Flur, zog seine Wildlederstiefel und die Regenjacke an, nahm seinen Notizblock, einen Kugelschreiber, die Kodak-Instamatic-Kleinbildkamera und ging Streife. Ute folgte ihm in den Flur und sagte: »Sei vorsichtig!«
Jens arbeitete in der Justizvollzugsanstalt Hannover. Er und Ute schwiegen sich, wenn wir fragten, darüber aus, was genau er in der JVA tat, aber sie gaben uns das Gefühl, ohne Jens würde Niedersachsen vor kriminellen Schurken ersticken. So oder so, es genügte Jens nicht, je nach Schicht tagsüber oder auch mal in der Nacht dafür zu sorgen, dass die Mörder und Halunken hinter Schloss und Riegel kamen oder blieben, er lebte diese Leidenschaft, seine vierte, auch in der Freizeit aus.
Jens’ Lieblingssatz war: »Das ist illegal.« Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr, als mich ein Deutschlehrer aufklärte, sprach ich es wie Jens und alle anderen in der Familie aus: ill-egal. Mir war also lange nicht bewusst, dass es dabei nicht um eine Variante des Wörtchens egal ging.
»Das ist illegal«, sagte Jens und legte einen erbarmungslosen Gesichtsausdruck auf, wenn wir nach der Schokolade griffen, obwohl Ute bereits dabei war, das Abendessen zu kochen, und seine Mimik ließ keine Fragen offen. Die gleiche Formulierung benutzte er, wenn er in der Nachbarschaft seine Runden drehte und auf jemanden traf, der sein Auto parkte, ohne die fünf Meter Abstand zur Einmündung einzuhalten – Jens hatte stets ein ausziehbares Bandmaß dabei –, der seinen Hund auf den Gehsteig kacken ließ, der in der Schrebergartenkolonie außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten Laub verbrannte, der mit seiner Hecke die vorgeschriebenen eins fünfundzwanzig Meter Maximalhöhe überschritt. In solchen Fällen kannte Jens keine Gnade. Er schoss ein Foto mit seiner Kleinbildkamera und notierte auf dem A5-Block alle Beweise, deren er habhaft werden konnte. Ab und zu gingen wir mit |20|ihm, und ich entwickelte beinharte Ehrfurcht vor dem, was mein Pflegevater da tat. Wenn er einen Rechtsbruch sah, schritt er ein, und zwar beweissichernd. Er sprach den Delinquenten nicht an, obwohl sehr viele Leute, denen wir in entsprechenden Situationen begegneten, mit ihm zu disputieren versuchten. Das ignorierte er einfach. Manchmal wurden sie sogar handgreiflich.
»Ich bin kein Richter«, erklärte er uns, gelegentlich auch den Leuten, die eine Diskussion anzustrengen versuchten. »Ich habe nicht darüber zu urteilen, was mit diesen Verdächtigen geschehen soll. Ich sichere nur die Beweise. Urteilen sollen dann andere.«
Er ließ sich nie auf Diskussionen mit den Haltern scheißfreudiger Hunde oder den Besitzern vermeintlich widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge vor Feuerwehreinfahrten oder Bordsteinabsenkungen ein; »Bordsteinabsenkung« war eine Zeitlang mein Lieblingswort. Er tat, als wären sie überhaupt nicht vorhanden, jenseits des Verstoßes.
»In der Justiz hat jeder seine Position«, sagte er kryptisch. »Jedes Rädchen muss wissen, wohin im Getriebe es gehört.« Nach solch einem für seine Verhältnisse vor Eloquenz übersprudelnden Satz schrieb er wieder Kennzeichen auf und fotografierte Hund und Halter, zuweilen gegen ernsthaften Widerstand. Wenn eine Situation zu eskalieren drohte, brüllte Jens: »Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben!« Der täglich größer werdende Kreis auf seinem Kopf verfärbte sich dann rot, Schweißperlen traten auf seine Stirn, seine Miniaugen wurden noch schmaler. Jens war kein sehr emotionaler Mensch, wie das gesamte Familienleben ziemlich an einem Mangel an Herzlichkeit litt, euphemistisch gesagt. Ich erlebte nie, dass meine Pflegeeltern Frank und Mark herzten, in den Arm nahmen oder gar küssten. Eine gewisse Distanziertheit hing über allem, was in unserer Dreizimmerwohnung geschah. Streicheln über den Kopf angesichts eines guten Zeugnisses war die zärtlichste Geste, die ich bei dieser Familie je erlebte.
|21|Einmal in der Woche marschierte Jens auf die Polizeiwache und gab das Material ab. Es waren Listen, dicke Umschläge mit Fotos, Aufzeichnungen aller kleinen Vergehen, die bei uns in der Nachbarschaft begangen wurden, und das waren verdammt viele. Manchmal, wenn wir mit ihm unterwegs waren, musste er einen von uns nach Hause schicken, um einen neuen Film für die Kamera zu holen, oder ein weiteres Notizbuch.
»Um diese Zeit darf man nicht den Rasen mähen. Los, Frank, wir haben nicht viel Zeit«, sagte er, ohne von seiner Armbanduhr aufzusehen, und schon spurtete mein Pflegebruder los, um einen neuen Kleinbildfilm zu holen.
»Was passiert mit diesen Leuten?«, fragte Frank einmal, als er keuchend zurückkam, während wir von der anderen Straßenseite jemanden beim Ölwechsel beobachteten.
»Sie bekommen ihre gerechte Strafe«, sagte Jens, dabei nickte er, wie er nickte, wenn Erik Ode mit zwingender Argumentation den Neffen der verstorbenen Erbtante als Täter überführte. Und er lächelte. Jens lächelte nicht oft.
»Kommen sie ins Gefängnis?«, fragte ich, und ich dachte dabei an die eine Mark, die wir nicht zurückgegeben hatten. Das übereilt der Psychologin gegenüber abgegebene Geständnis verfolgte mich immer noch, mehr sogar, seit ich Bestandteil dieser gesetzesliebenden Familie war. Von denen kannte noch keiner die Verbrechen meiner Kindheit.
»Das kann passieren«, sagte Jens nickend. »Wer ein Verbrechen begeht, der kommt ins Gefängnis. Dafür sind Gefängnisse da. Wir nennen sie Justizvollzugsanstalten.« Ich schauderte, merkte mir das Wort »Justizvollzugsanstalt« und hoffte, meine sich rotglühend anfühlenden Ohren würden mich nicht verraten.
»Du bekommst deine gerechte Strafe«, war eine Formulierung, die sehr bedrohlich in unseren Ohren klang und die wir genau deshalb, ohne sie vollständig zu begreifen, beim Spielen auch oft benutzten. Im Hof des siebenstöckigen Hauses war Frank der |22|Cowboy, ich der Indianer und der arme kleine Mark immer die Squaw. Frank nahm alle Arten von Spiel sehr ernst, und er vermied es, mit uns Dinge zu unternehmen, die ihn dazu nötigten, seine dicke Brille abzunehmen; deshalb spielten wir auch nie mit anderen Kindern. Der drei Jahre jüngere Mark stand im Schatten seines großen Bruders, den er auf eine seltsame Art zu fürchten schien, obwohl ich niemals Gewalt zwischen den beiden erlebte; es schien eher eine freiwillige Unterordnung zu sein. Ich war etwas wie ein Freund, kein Familienmitglied, aber ich hatte meine klare Position in der Hierarchie – gerade noch über Mark. Weder Frank noch Mark oder gar Jens und Ute nannten mich jemals Bruder oder Sohn, wie ich auch immer, wenn ich versehentlich etwas Derartiges sagte, sofort korrigiert wurde. In problematischen Situationen benutzen Jens und Ute meinen Nachnamen, den sie dann besonders betonten:
»Tim Köhrey, das ist jetzt unangemessen«, sagten sie, den Nachnamen laut hervorhebend. Und irgendwann übernahmen Frank und Mark das auch, schließlich hießen sie anders.
»Tim Köhrey, du bist gefangen!«, rief Frank, kam um den Baumstamm herum, hinter dem ich mich versteckt hatte, und zielte mit der Knallplättchenpistole auf meine Stirn. Nie aufs Herz, immer auf die Stirn.
|23|4. Erbe
In den nächsten vier, fünf Jahren bekamen wir gelegentlich Besuch von fremden Paaren, die zuerst mit Jens und Ute und anschließend mit mir sprachen – meistens nur sehr kurz. Die Leute saßen nebeneinander auf der Couch im Wohnzimmer, ich gegenüber auf dem Sessel, von dem aus Jens abends fernsah, er und nur er. Sie fragten mich Dinge wie: »Gehst du gerne in die Schule?« oder: »Was ist dein Lieblingsspiel? Magst du Tiere?«, wobei sie sich gegenseitig die Hände drückten, ab und zu merkwürdige Blicke wechselten.
»Was sind das für Leute?«, fragte ich Ute nach dem zweiten Besuch dieser Art.
»Paare, die ein Kind adoptieren möchten«, sagte sie. »Aber du bist ihnen zu alt.«
»Zu alt wofür?«
»Das weiß ich auch nicht. Sie wollen jüngere Kinder.«
An meinem zwölften Geburtstag ging Jens mit mir in den Keller und zeigte auf vier Umzugskisten, die in einer Ecke des muffigen Kabuffs gestapelt waren. »Das ist von deinem Vater. Ich denke, du bist alt genug, es zu bekommen.« Er gab mir das Vorhängeschloss und den Schlüssel, der immer noch darin steckte, und ließ mich allein in dem kleinen Raum, der durch Maschendraht von den Nachbarkellern abgetrennt war und von einer lichtschwachen Baulampe beleuchtet wurde. In allen vier Ecken hingen dunkle, dicke Spinnenweben, der Boden war feucht.
In den Kisten befanden sich Schallplatten, in der Hauptsache Singles, massenweise davon. Die unterste Kiste enthielt die Anlage meines Vaters, zwei Plattenspieler, einen Verstärker, zwei selbstgebaute Regalboxen und eine fahlweiße Apparatur von der Größe |24|eines Schuhkartons, die in der Hauptsache aus einer Anzahl Buchsen und zwei Drehreglern bestand, die in das Sperrholz eingelassen waren. Ich schleppte die Anlage und einen Teil der Singles nach oben und fand schließlich heraus, was es mit dem weißen Kistchen auf sich hatte – es war ein Mischpult Marke Eigenbau. Man musste die beiden Plattenspieler mit dem Mischpult und das Pult mit dem Verstärker verbinden, und dann konnte man die Schallplatten, die sich auf den beiden Tellern drehten, miteinander abmischen. Es dauerte eine Weile und brauchte, wie so oft, eine zündende Erklärung von Frank, um hinter den Sinn des Ganzen zu kommen. Bis ich irgendwie verstand: Mein Papa war eine Art Ur-Discjockey gewesen. Das war fast ein Musiker.
Nach meiner Erinnerung hatte er einen Bürojob gehabt, aber welchen genau, das wusste ich nicht. Manchmal brachte er mir stapelweise Formulare mit nach Hause, weil ich kleiner Furz alte Akten über alles liebte und stundenlang die wichtig aussehenden Formulare mit Krakeleien überzog, die außer mir niemand verstand. Meine Mama betrieb eine Art Kosmetikstudio im Wohnzimmer. »Kosmetik« war eines der ersten komplizierteren Wörter, die ich früh aussprechen konnte. Nachmittag für Nachmittag kamen Nachbarinnen in unser Haus, um sich von Mama schminken und maniküren zu lassen. Das Wort »Maniküre« gefiel mir auch gut.
»Du erbst außerdem etwas Geld, aber erst, wenn du achtzehn bist«, sagte Ute, als wir im Wohnzimmer meinen Geburtstagskuchen anschnitten, einen Butterkuchen von Meyer, der mit Zucker bestreut war. »Die anderen Sachen sind verkauft worden.« Was etwas Geld bedeutete, wusste ich nicht. Etwas Geld, das waren für mich zu diesem Zeitpunkt neunzig Pfennige, viel Geld vielleicht fünf oder zehn Mark.
Das waren nicht die einzigen Überraschungen des Tages.
»Wir ziehen nach Berlin um«, eröffnete Jens, kurz bevor es in die Betten ging. »Nächsten Monat. Ich bin versetzt worden.«
|25|Als ich Frank sehr viel später wiedertraf, lange nach meinem Ausscheiden aus der Familie, erzählte er mir, dass die Verantwortlichen in der JVA Hannover die Nase voll gehabt hatten von den Sheriffallüren meines Ziehvaters und seinem damit notwendig gewordenen häufigen Auftreten als Zeuge bei belanglosen Gerichtsverhandlungen – zuweilen mehrmals pro Woche. Außerdem hatte er seine Kollegen überwacht und sie bei Regelübertretungen angezeigt. Man hatte sich seiner entledigt.
Zwei Wochen nach dieser Eröffnung holten wir Jens zum ersten und letzten Mal von der JVA ab – Frank, Mark und ich. Es sollte eine Überraschung sein, und wir wollten endlich herausfinden, welche unglaublich wichtige Stellung er im Gefängnis innehatte, von der aus er an eine noch wichtigere und nach Berlin, wo auch immer das lag, abberufen worden war. »Er ist Direktor«, hatte Frank beschlossen. »Er foltert die Gefangenen, damit sie Geständnisse ablegen«, mutmaßte Mark. Wir hatten keine Ahnung, welche Jobs es in einer Justizvollzugsanstalt gab. Wärter, natürlich. Aber Jens konnte kein einfacher Wärter sein.
Wir umkreisten das weitläufige Gelände zweimal, bis wir endlich den Mut fanden, zur Pförtnerloge am Eingang zu gehen. Und da saß er dann auch schon, mit einer Mütze auf dem Kopf und durch ein Loch in der Fensterscheibe starrend, Jens, der Landlord der Hannoveraner Vororte. Er war der Pförtner. Als er uns sah, nahm sein Gesicht einen gequälten Ausdruck an. Ich glaube, er hat uns diesen Überraschungsbesuch niemals verziehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!