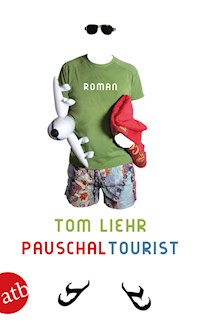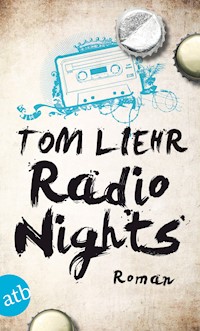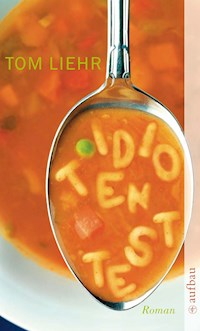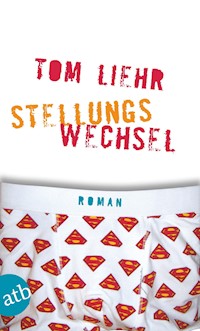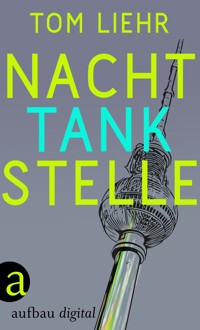10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lieben – verlieren – lieben. Marie und Clemens haben sich in der Millenniumsnacht 2000 kennen und lieben gelernt. Seither pflegen sie ein Ritual: Freitags treffen sie sich immer bei ihrem Lieblingsitaliener – bei Paolo. Und sie schwören sich: Wenn es irgendwann in ihrer Beziehung nicht mehr knistert, wollen sie es beenden. Nach zwanzig Jahren ist es dann so weit: Sie beschließen, getrennte Leben zu leben, müssen aber bald erkennen, was für ein Wagnis sie eingegangen sind. Denn bei aller gefühlten Freiheit bleibt die Frage: Wie sieht ein erfülltes Leben voller Liebe und Zufriedenheit denn wirklich aus? Eine Lebens- und Liebesgeschichte, voller Witz, Präzision und Warmherzigkeit, aber auch ein kluger Roman über die Freiheit der Kunst und die Balance zwischen Karriere- und Gefühlswelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als sich Marie de Bruijn und Clemens Freitag auf einer langweiligen Millenniums-Silvesterparty kennenlernen, ist es eine schicksalhafte Begegnung. Die pragmatische, kluge und attraktive angehende Juristin und der hübsche, etwas schüchterne Systementwickler mit dem parodistischen Talent werden an diesem Abend quasi zum Jahrtausendpaar. Bei Paolo, in dem kleinen italienischen Restaurant, in das sie von der schrecklichen Party fliehen, küssen sie sich zum ersten Mal. Und beide haben sofort das Gefühl: Das hier könnte für immer sein. Einundzwanzig Jahre und genau tausend Freitage später. Marie und Clemens sind seit zwanzig Jahren verheiratet; Marie hat Clemens‘ Nachnamen angenommen, weshalb sie nun Marie Freitag heißt. Zu Beginn ihrer Beziehung haben sie sich geschworen, dass sie es beenden werden, wenn ihre Liebe in Routine erstarrt, und dieser Tag scheint nun gekommen. Marie und Clemens beschließen, sich zu trennen, auch, um das zu tun, was sie sich lange versagt haben – und begreifen bald, wie schwierig und herausfordernd das Leben ohne den anderen ist.
Über Tom Liehr
Tom Liehr war Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane »Radio Nights«, »Idiotentest«, »Stellungswechsel«, »Geisterfahrer«, »Pauschaltourist«, »Sommerhit« und »Leichtmatrosen« lieferbar.
Mehr Informationen zum Autor unter www.tomliehr.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tom Liehr
Freitags bei Paolo
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Widmung
Teil 1: — Tausend Freitage
Der letzte Freitag des Jahrtausends
Freitag, morgens — Tag eins
Freitags Nachbarn
Bollo Freitag
Freitags Antrag
Freitags nie
Freitags Kindergarten
Freitags Urlaub
Freitags Samstag
Frag Freitag
Ausnahmefreitage
Endlich Freitag
Freitags Abend
Freitags Herausforderung
Freitags Parteitag
Normale Freitage
Freitag, der Dreizehnte
Freitags bei Paolo
Teil 2: — Zehn Freitage
Rufe aus der Vergangenheit
Häuser und Wohnungen
Lüneburg, eins
Lüneburg, zwei
Lüneburg, drei
Heimkehr
Scheißesturm
Kompromisse
Weiße Mäuse
Keine Herzchen
Epilog eins: — Ein Jahr später
Epilog zwei: — Fünfzehn Jahre später
Epilog drei: — Noch ein Jahr später
Was wurde aus ...
Und ausserdem:
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
What If This Is All The Love You Ever Get?
Songtitel auf dem Album »Wildness« (2018)
der Band Snow Patrol
Warum soll’s uns auch anders gehen Als dem Rest der Welt Nach dem ersten »Ich liebe Dich« Sind die Tage gezählt
»Straße« von Rio Reiser, auf »Himmel und Hölle« (1995) Möbius Records
Für meinen Freund Thommy, obwohl er ein Fischdieb ist.
Oder weil.
Ja, weil.
Teil 1:
Tausend Freitage
Der letzte Freitag des Jahrtausends
Von allen Silvesterpartys, die es in Berlin zum Anlass des bevorstehenden Jahrtausendwechsels gab, war Clemens auf die langweiligste geraten. Das lag keineswegs daran, dass es zu wenige Angebote gegeben hätte – es waren im Gegenteil eher zu viele gewesen. Wenn er es sich hätte aussuchen können, und eigentlich hätte er es sich aussuchen können, dann wäre er mit seinem besten Freund Teddy am Abend dieses Freitags nach Mitte gefahren, wo in irgendeinem extrem angesagten Club eine gigantische Party stattfand, für die Teddy wunderbarerweise VIP-Karten hatte. Dort hätten sie getanzt und getrunken, gefeiert und geflirtet, von Freitagabend bis Sonntag früh, denn dieses einmalige Silvester eröffnete nicht nur ein neues Jahr, Jahrhundert und Jahrtausend, sondern mündete auch noch in ein Wochenende. Sie wären am Sonntagabend völlig geschafft, aber glücklich und ohne jeden Zweifel um mehrere neue Bekanntschaften reicher heimgegangen. Denn so lief das immer, wenn Clemens und Teddy unterwegs waren: Die weiblichen Menschen kamen auf sie zu, weil sie magnetisch von Clemens angezogen wurden, und Teddy war es, der sie dazu brachte, bei ihnen zu bleiben.
Aber vor zwei Wochen hatten ihn Judith und Karl eingeladen, hatten in ihrem Büro vor ihm gestanden wie Kinder, die
beim Scheißebauen erwischt worden waren, hatten ihn mit traurigen Augen angeschaut und im Chor gefragt: »Aber du, lieber Clemens, du kommst doch zu unserer Millenniumsparty?« Obwohl sie es nicht ausgesprochen hatten, war da ein »wenigstens« – wenigstens du kommst doch – zwischen den anderen Worten zu hören gewesen, verbunden mit der Botschaft, es würde in erster Linie von ihm abhängen, ob die Party ein Erfolg oder Desaster werden würde, aber die Katastrophe stünde von vorneherein fest, käme er überhaupt nicht. Mit solchen Situationen konnte Clemens nicht gut umgehen, denn er ertrug das Gefühl nicht, derjenige zu sein, der jemandem den Spaß verdarb, vor allem, wenn sich diese Person besonders viel Mühe gegeben hatte. Deshalb sagte er zu häufig Ja, weil er Menschen gegenüber, die er sehr mochte, ein schlechter Lügner war und weil er beim Ausreden kläglich versagte. Und weil er die Person unmöglich kränken konnte, die sich da besonders viel Mühe gegeben hatte. Die Enttäuschung und Traurigkeit, die er sonst stellvertretend empfand, schaffte ihn tagelang.
Er kannte Judith und Karl seit sechs Jahren, als sie ihren ersten Laden eröffnet und für ihr Geschäft eine Software gesucht hatten. Über persönliche Empfehlungen waren sie an ihn geraten, und jetzt, mit der dritten neu eröffneten Filiale von MBF – Meine BioFarm bildete das von ihm geschaffene Warenwirtschaftssystem das Herz der Logistik des Biolebensmittel-Discounters, der auf dem besten Weg war, ein richtiger kleiner Konzern zu werden. Die beiden hatten Clemens schon bei ihrer ersten Begegnung das Du angeboten, aber nicht, weil das bei ihnen so üblich war, sondern weil sie seine Freundschaft aktiv suchten, um ihn an sich zu binden. Er mochte die beiden durchaus auch. Sie waren ihm sympathisch, und er fand sie auf ihre Weise originell, er mochte ihr Geschäftskonzept, und sie waren gute Kunden von ihm, aber die Entscheidung, diese Einladung anzunehmen, hatte er, seit er im Büro der beiden »Ja, klar, gerne« auf Judiths Frage genuschelt hatte, mehrere Dutzend Male bereut. Nicht zuletzt in dem Moment, als ihm an diesem besonderen Freitagabend eine heillos overdresste und überschminkte Hausherrin die Tür zur gewaltigen Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedenau geöffnet, sich umgedreht und in die Wohnung hinter sich »Jetzt kann es losgehen, unser lieber Clemens ist da!« gerufen hatte.
Judith war mit bemerkenswertem Abstand die unattraktivste Person, die Clemens kannte. Sie sah aus wie eine keimende Kartoffel, auf die ein Kind mit Filzer ein Frauengesicht gemalt und an der es anschließend aus Kugelschreiberfedern eine Lockenfrisur montiert hatte. Das hinderte die Gute allerdings nicht daran, sich selbst für eine unwiderstehliche Charmegranate auf zwei Beinen zu halten. Judith war, wenn sie nicht gerade Geschäfte machte, worin sie meistens brillierte, überwiegend damit beschäftigt, männlichen Singles aller Altersgruppen und Körperqualitäten nachzustellen, und es spielte keine Rolle, ob Karl, ihr Gatte, zufällig anwesend war oder nicht. Fotos von Karl wiederum hätten in Lexika neben der Erklärung zum Wort »unscheinbar« gepasst. Wann immer Clemens die beiden getroffen hatte, fiel es ihm anschließend schwer, sich an irgendetwas zu erinnern, das Karl gesagt oder getan hatte, wie er ausgesehen hatte oder gekleidet gewesen war, und eigentlich war Clemens’ Menschen- und Gesichtergedächtnis exzellent. Auf der Straße vor dem Büro hatte er Karl schon einige Male erst in letzter Sekunde erkannt. Der unscheinbare Mann war der Rahmen um Judith, er war derjenige, der ihr Bild begrenzte und stabilisierte, und in dieser Rolle schien er sich absolut zu genügen.
Er war Judith zögernd in die Dachgeschosswohnung gefolgt, eine sehr geräumige, aber auf kostspielige Art nüchtern eingerichtete 300‑Quadratmeter-Festung in diesem – seiner Meinung nach – schönsten Teil Westberlins, einer bürgerlichen, friedlichen, echt hübschen und dennoch zentralen Ecke der Stadt, gerade noch akzeptabel, wenn man einen ökosozialen Hintergrund hatte. Das hallengroße Wohnzimmer wurde von vier riesigen Sofas beherrscht, die um eine Gruppe von Couchtischen angeordnet waren, die nach Trödel und Patina aussahen, aber, wie Clemens wusste, erst vor zwei Jahre angefertigt worden waren. Auf den Sofas saßen die Gäste – insgesamt zwölf Leute, die überwiegend recht erwartungsvoll zu Clemens aufsahen, der eine Hand zum Gruß hob und »Hallo!« sagte, sich aber wegwünschte, möglichst in diesen Club in Mitte oder wenigstens in eine Gardinenkneipe im hinteren Kreuzberg. Aus den versteckten Highend-Boxen erklang weinerlicher Siebzigerjahre-Folk, und auf den Tischen blubberten vier Fonduesets vor sich hin. Es roch so intensiv wie kurz vor Feierabend in einer Käserei. Clemens fand all diese nur zu Silvester praktizierten, geselligen Miteinander-Futter-Zubereitungs-Varianten wie Raclette oder Fondue fast so schrecklich wie Tierorgane im Essen, doch er beschloss in diesem Moment, seinen Gastgebern gegenüber so zu tun, als wäre das hier die Verwirklichung eines Traums. Und er setzte ein strahlendes Lächeln auf.
Er hatte zudem jemanden entdeckt.
Leider gelang es ihm nicht, in ihrer Nähe einen Platz zu finden, aber er schaffte es, sie während der folgenden zweieinhalb Stunden unauffällig zu beobachten und zwei, drei Mal ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Die junge Frau, die seine Aufmerksamkeit erregte, hatte zu denjenigen gehört, die ihn nicht wie einen lange vermissten Angehörigen begrüßt hatten, und auch später war sie eher damit befasst, ironisch-schmunzelnd das Interieur der Wohnung zu betrachten (etwa diese eigenartige Fruchtbarkeitsstatue aus dunklem Holz, die auf dem Kamin stand, oder die schreckliche naive Malerei an der Fensterwand, die Karl zu verantworten hatte), als sich aktiv am vor sich hin mäandernden Geschehen zu beteiligen, das aus dem Einstippen von Weißbrot in Käsetunke, viel Rotwein, dem Austausch von politischen und kulturellen Allgemeinplätzen und einer erschütternden Musikauswahl – Punk, Folk, Schlager – bestand. Sie reagierte jedoch überaus höflich und freundlich, wenn sie angesprochen wurde, schenkte jedem, der sich mit ihr unterhielt, volle Aufmerksamkeit und vermittelte das Gefühl, erfreut, nachgerade begeistert von ausgerechnet genau diesem Gespräch zu sein. Clemens ertappte sie allerdings dabei, wie sie, wenn das Gegenüber wieder wegschaute, die Augen verdrehte, die Stirn runzelte oder ein fassungsloses Kopfschütteln andeutete. Als sie das zum ersten Mal tat, musste er lachen. Sie sah ihn in diesem Augenblick an und verstand sein Lachen offenbar, denn sie lächelte nickend und deutete ein entschuldigendes Schulterzucken an, das er mit der gleichen Geste beantwortete. Dabei versuchte er, so nett dreinzuschauen, wie ihm möglich war, aber Clemens’ Fähigkeiten waren in dieser Hinsicht begrenzt. Wenn jemand ein Foto von ihm zu machen versuchte, auf dem er lächelte und entspannt aussah, dann gelang das nur, wenn Clemens nicht wusste, dass er fotografiert wurde. Auf allen Fotos, bei denen diese Voraussetzung nicht erfüllt gewesen war, zog er die grausigsten Grimassen – anders war das seltsamerweise nur, wenn er gerade Publikum hatte.
Die Frau, deren Namen er noch nicht kannte – Judiths Vorstoß, sich zuerst mit Kennenlernspielen zu befassen, hatte keine Mehrheit gefunden –, war ungefähr in seinem Alter, schätzte er, aber ihrer Aussprache zufolge war sie keine gebürtige Berlinerin. Er tippte auf den nördlichen Raum. Sie war dunkelhaarig, grünäugig – extrem grünäugig –, schmal, fast filigran, jedoch sportlich und wirkte sehr gepflegt. Jede ihrer eher sparsamen, eleganten Bewegungen verwies auf ein überdurchschnittlich gutes Körpergefühl. Wenn sie angesprochen wurde, war sie schlagartig präsent, aber wenn sie sich langweilte, und das geschah im Verlauf dieses Abends häufiger, ging sie vollständig auf Stand-by. Bis eine Stunde vor Mitternacht hatte er immer noch nicht herausgefunden, wie sie hieß und in welchem Verhältnis sie zu Judith und Karl stand, dafür wusste er das fast vom gesamten Rest der sehr langweiligen und vollständig partyuntauglichen Gesellschaft. Er war sich allerdings sicher, dass die Frau nach dem Jahreswechsel diese Fete so schnell, wie es die Höflichkeit zuließ, verlassen würde. Clemens würde natürlich bleiben, weil alles andere eine Enttäuschung der Gastgeber zur Folge hätte.
Um kurz nach elf erhob sich Karl. Seine Stimme war wie er selbst – wie ein gleichmäßiges, leises Pfeifgeräusch, das eine Maschine im Dauerbetrieb verursachte, ohne deutliche Betonung und einlullend. Aber er sprach einfach drauflos, und da er das selten tat, kompensierte das den ermüdenden Effekt manchmal.
»Wir alle haben uns auch Gedanken über Why-Two-Kay gemacht«, erklärte er fast feierlich. Einige Gäste sahen sich fragend an, einige nickten, als hätten sie darauf schon gewartet. »Über den Millennium-Bug. Abstürzende Computer überall, explodierende Kraftwerke, außer Kontrolle geratene Technik, implodierende Aktienkurse. Niemand weiß, was um Mitternacht genau geschehen wird.« Er hatte versucht, das Wort »niemand« zu betonen, aber stattdessen lediglich noch piepsiger gesprochen.
Judith schenkte Biosekt ein. Ein paar Gäste standen auf, aber alle lauschten gebannt auf das, was der opake Gastgeber zu erzählen hatte.
»Wir möchte euch deshalb anbieten, gemeinsam mit uns unseren Schutzraum zu nutzen.« Bei diesen Worten breitete er die Arme aus, wollte wohl wie ein Guru wirken, der seine Jünger empfing, aber eigentlich sah er nur wie ein erwachsener Albatros aus, der immer noch nicht fliegen gelernt hatte und um Starthilfe bat. »Wir haben in der Mitte der Wohnung einen befestigten Raum, der eine eigene Luftversorgung hat und abgeschirmt ist, der wie ein Faradayscher Käfig wirkt und uns im Notfall für einige Stunden sicheren Unterschlupf bieten würde. Wir können den Jahreswechsel dort verbringen und abwarten, was geschieht.«
Clemens war erst verblüfft, wollte dann laut loslachen, was er sich jedoch verkniff, da zu seiner Überraschung niemand sonst lachte und er sich nicht lächerlich machen wollte. Aber er zog sein Mobiltelefon aus der Hosentasche, ein Siemens S25, das modernste Gerät, das es gab – mit Farbdisplay, Softmodem und Dual-Band-GSM. Doch er hatte es nicht herausgeholt, um damit anzugeben, sondern klickerte eine Kurznachricht herbei. Dann hielt er das Telefon hoch.
»Bei allem Respekt, meine lieben Freunde«, sagte er laut auf Bayerisch und mit der Stimme von Franz Josef Strauß, dem legendären bayerischen Ministerpräsidenten und konservativen Hardliner. Das gewährleistete ihm in diesem Umfeld die sofortige Aufmerksamkeit. Die Runde war schlagartig still, wobei ihn Judith und Karl anstarrten, als hätte er gerade ein Menschenopfer gebracht. Die Stimme von Strauß in diesen Räumen, wie konnte man nur! Aber Clemens fühlte sich sicherer, wenn er sein parodistisches Talent nutzte, und außerdem war ihm nicht entgangen, dass die grünäugige Frau strahlte und ihn aufmerksam beobachtete. »Ich habe einen Freund in Japan, er heißt Hiro«, fuhr er fort, allmählich zu seiner richtigen Stimme wechselnd. »Dort wurde vor über sieben Stunden der Jahreswechsel begangen. Hier, schaut. Hiro hat mir vor fünf Stunden eine Kurznachricht geschickt. Er grüßt von einer fröhlichen Party.«
»Eine Kurznachricht?«, fragte Ursula, die Steuerberaterin.
»Eine SMS«, sagte der Mann, der neben Judith saß – Uve, der im Umland mehrere Höfe hatte und MBF mit Rindfleisch belieferte. »Er hat gesimst.«
»Na ja«, sagte Clemens und legte den Kopf schief. »SMS bedeutet Short Message Service, also Kurznachrichtensystem. Man verschickt aber nicht ein ganzes System, sondern nur einzelne Nachrichten. Er hätte also höchstens eine Short Message, also eine SM schicken können.«
Die grünäugige Frau lachte herzlich, was Clemens kurz irritierte, bis er zu verstehen glaubte, worüber sie lachte. Judith sagte: »Unser Programmierer ist manchmal ein bisschen pedantisch«, wobei sie grinste, und einige Gäste kicherten. Clemens verzog das Gesicht. Er war kein armseliger Programmierer, sondern ein Systementwickler. Und er war ganz sicher nicht pedantisch. Und er war auch nicht ihr Programmierer.
»Japan ist ein hoch technisiertes Land«, fuhr er fort. »Und was ist passiert?« Er pausierte kurz, aber alle starrten ihn nur schweigend an. »Alle Kraftwerke laufen noch, es gibt keine Katastrophen und keine Ausfälle. Sogar das Kurznachrichtensystem funktioniert nach wie vor.« Die Frau zwinkerte ihm zu, und jetzt war er sicher, dass sie auf seiner Seite war, sich möglicherweise sogar für ihn interessierte, was ihn in leichte Euphorie versetzte. »Wenn wirklich Software von der Problematik betroffen sein sollte, dann nur in sehr kleinem Maßstab. Branchenlösungen, die aus den Achtzigern stammen, so etwas. Wenn es etwas zu befürchten gäbe, dann hätten wir aus den Ländern, in denen der Jahreswechsel bereits stattgefunden hat, davon gehört.« Er wies zum Rückprojektions-Großbildfernseher, der stumm geschaltet in einer Ecke lief und Bilder vom Brandenburger Tor in Berlin zeigte, wo sich beinahe eine halbe Million Menschen versammelt hatten. »Aber dann wäre auch diese Sendung da längst unterbrochen worden.«
Judith räusperte sich und lächelte wie eine Lehrerin, die einem Kind zugehört hatte, das sich soeben bei einem Vortrag besonders viel Mühe gegeben, aber das Thema leider verfehlt hatte. »Danke für deine Anmerkungen, lieber Clemens«, sagte sie. »Wir alle wissen das zu schätzen.« Einige der anderen Gäste nickten, möglicherweise hielten sie das für einen besonderen Partygag, der ihnen gerade von Clemens versalzen wurde.
Er wollte etwas antworten, seine Ausführungen untermauern, fing aber den Blick der hinreißenden jungen Frau auf, die ihn fest mit ihren grünen Augen ansah und mimisch »Nein, das lohnt sich nicht« formulierte. Er spürte ein starkes Kribbeln. Dieses schimmernde, intensive Augengrün ließ ihn an eine leere Weinflasche denken, die auf einem Fensterbrett stand und von hinten von der Sonne angestrahlt wurde. Er verspürte den völlig irrationalen, aber starken Wunsch, mit dieser Frau ab sofort sein Leben zu verbringen, doch er ahnte gleichzeitig, dass ihn die Erfüllung dieses Wunsches in permanente Eifersucht versetzen würde. Unvorstellbar, von ihr nicht fasziniert zu sein, fand er. Sie war, wie er in diesem Augenblick meinte, die mit Abstand interessanteste Frau, die er je getroffen hatte, und inmitten dieser merkwürdigen Silvestergesellschaft war sie wie ein mehrkarätiger Edelstein auf einer selbst gestrickten Pudelmütze.
»Wer nicht mit in den Schutzraum möchte, kann gerne hier sitzen bleiben, die Aussicht genießen und auf uns warten«, sagte Karl, wobei er zu den riesigen Dachfenstern zeigte, die in zwei halbkreisförmigen Gauben einen atemberaubenden Blick auf die Teile der Stadt zuließen, die noch aus dem Nebel der vielen verfrüht gezündeten Feuerwerkskörper ragten. Clemens sah die anderen an, die sich wiederum gegenseitig ansahen. Judith nahm ihr Glas und ging vor. »Folgt mir«, sagte sie. Und zu Clemens’ großer Verblüffung folgten ihr alle, trotteten dem Paar hinterher, als gäbe es keine andere Wahl. Nur er selbst und die grünäugige Frau blieben. Im Durchgang zum Flur drehte sich Karl zu ihnen um. »Habt ihr keine Angst?«, fragte er stirnrunzelnd. Er schien ehrlich besorgt zu sein, weshalb Clemens augenblicklich den Wunsch verspürte, doch noch aufzustehen und sich mit ihm, Judith und den elf anderen Gestalten in diesen wirklich bescheuerten Schutzraum zu pferchen, damit sich Karl keine Sorgen mehr um ihn machte, aber dann fing er abermals den Blick der Frau auf, die lächelnd in Richtung des Gastgebers mit dem Kopf schüttelte. »Uns wird schon nichts passieren, lieber Karl«, sagte sie. »Und danke für das Angebot. Ich bin absolut sicher, dass es nichts zu befürchten gibt.« Sie wandte sich an Clemens. »Oder?« Clemens konnte nur nicken, also zuckte Karl die Schultern und ging davon. Ein paar Sekunden später kehrte er zurück und starrte die beiden an. »Wirklich nicht?«, fragte er.
Sie schüttelten synchron die Köpfe.
Karl nickte und war schon im Begriff, sich wieder abzuwenden, aber dann sagte er lächelnd: »Ihr seid einzeln schon der Hammer, aber so nebeneinander, alle beide … großer Gott.« Dabei strich er sich mit der flachen Hand durchs schüttere Haar, zwinkerte mit einem Auge und zockelte in Richtung Schutzraum davon.
»Ein Schutzraum, im sechsten Stock«, sagte sie, als der Gastgeber verschwunden war. »Unglaublich.« Sie nahm ihr Weinglas vom Tisch, dann fiel ihr offenbar etwas ein, und sie stellte es wieder ab. »Ich bin übrigens Marie.« Sie hielt ihm eine schlanke, perfekt manikürte und äußerst schöne Hand entgegen.
»Clemens.« Er schüttelte die Hand und musste sich zwingen, sie wieder loszulassen. Dann prosteten sie sich zu, was sich gut anfühlte, aber er hatte trotzdem leichte Gewissensbisse, weil er nicht mitgegangen war.
»Willst du doch noch hinterher?«, fragte sie schmunzelnd.
»Nein, natürlich nicht. Aber ich bin sehr ungerne unhöflich.«
»Wenn Höflichkeit zur Dummheit wird, ist es okay, unhöflich zu sein.« Sie lehnte sich auf dem Sofa zurück und schlug die Beine übereinander. Dabei musterte sie Clemens, der sich zwingen musste, die Beine nicht anzustarren. »Du siehst nicht wie die Leute aus, mit denen sich Judith und Karl normalerweise umgeben.«
»Du auch nicht«, sagte er und freute sich unbändig über das Kompliment. »Woher kennst du sie?«
Sie seufzte. »Wir sind im gleichen Kreisverband, und ich will bald für das Abgeordnetenhaus kandidieren. Die beiden unterstützen mich.«
»Welche Partei?«
»Im Ernst?«
Clemens nickte.
»Die Pfundis, natürlich«, erklärte sie, beinahe feierlich. »Ich bin dort engagiert, weil ich Umweltschutz für das wichtigste Thema der Gegenwart halte, und Judith und Karl …«
»Profitieren auch von der Partei und von dir«, beendete er den Satz. Marie nickte und sah auf die Uhr.
»Und was machen wir beiden Schönen jetzt?«, fragte sie, aber es war eigentlich eine Feststellung. »Es sind noch fast vierzig Minuten bis Mitternacht, und wie ich die Bagage einschätze, kommen die frühestens um eins wieder aus ihrem Kabuff. Willst du so lange hier sitzen bleiben? Und anschließend weiter klebriges Käsefondue mampfen?« Sie beugte sich über einen Topf; Karl hatte natürlich alle Brenner gelöscht. »Es hat schon eine Haut.«
Wenn ich dich dabei anschauen darf, esse ich sogar davon, dachte Clemens. Er wiegte den Kopf hin und her; das konnte er gut, solche diffusen Gesten. Je nachdem ging das als Kopfschütteln oder Nicken durch. »Wir können doch nicht einfach von der Party verschwinden«, sagte er zögerlich, aber er nahm an, dass ihn sein Grinsen verriet.
»Welche Party?« Marie zog eine Augenbraue hoch.
»Stimmt auch wieder.«
»Ein paar Straßen weiter, keine zwei Minuten von hier, gibt es ein kleines italienisches Restaurant.« Sie stellte ihr Weinglas ab und stand auf. »Da findet eine private Silvesterfeier statt, zu der ich eingeladen bin. Hast du Lust auf Pasta und Prosecco statt Biosekt, Schlager und Schutzraum?« Marie beugte sich zu ihm herunter. »Ich möchte ungerne alleine gehen.« Sie zwinkerte. »Und ich könnte es mir nicht verzeihen, dich hier sitzen zu lassen.«
Clemens’ Ohrläppchen fingen Feuer.
Obwohl die einzigen Geräusche von der Stereoanlage und vom nur leicht schallgedämpften Feuerwerk draußen kamen, schlichen sie durch den Flur und in die geräumige Diele, wo sie erst nach ihren Klamotten suchen mussten. Clemens zog die Tür vorsichtig hinter ihnen ins Schloss und hatte dabei Gewissensbisse. Er wusste, dass es keineswegs unhöflich war, wegzugehen, denn schließlich hatte man sie beide alleine gelassen, aber so war er nun einmal gestrickt. Doch das war schnell wieder vergessen.
Wie kleine Kinder sprangen sie laut polternd ab dem fünften Stockwerk die Treppen hinunter, und als sie schließlich die große Altbautür hinter sich ins Schloss fallen hörten, mussten beide lachen.
»Nicht zu fassen«, sagte sie. »Flucht von einer Millenniumsparty.«
»Ich war schon auf besseren bei weniger spektakulären Jahreszahlen.« Er kam sich ein wenig schäbig vor, als er das sagte.
»Aber hallo. Komm!« Marie nahm seine Hand und zog ihn zu einem roten Smart, der ein paar Meter weiter am Straßenrand geparkt war. Wenige Minuten später stellte sie das Auto vor einem Restaurant ab, das Paolo hieß. Es war ein kleiner Eckladen, der bescheiden und gemütlich aussah. Der Schriftzug über der Tür wirkte gleichzeitig zurückhaltend und einladend.
»Warst du hier schon?«, fragte er.
Marie schüttelte den Kopf. »Sieht nett aus«, sagte sie, ohne ihn dabei anzusehen.
Bevor sie das kleine Restaurant betraten, aus dem Musik und Gelächter zu hören war, atmete Clemens tief durch. Es roch nach Schwefel und Regen, die neblige Luft war erfüllt vom Pochen der überall explodierenden Knallkörper, und zum ersten Mal an diesem Tag hatte er tatsächlich das Gefühl, dass dies ein besonderer Tag werden könnte.
Es war turbulent und voll im Gastraum, es duftete nach Essen, Kerzen, Rauch, Alkohol und zu vielen Menschen. Aber Clemens fühlte sich sofort deutlich wohler als in der nüchternen Dachwohnung zwischen den paranoiden Biokäsefondueessern. Marie zog ihn an der Hand zum Tresen, hinter dem drei gut gelaunte Kellner hin und her wuselten, und nur Sekunden später stießen sie mit Prosecco an. Dann scharten sich mehrere Gäste um Marie, offenbar Jurastudenten kurz vor dem Staatsexamen, wie sie selbst, und während Clemens am Getränk nippte und die entspannte Atmosphäre aufnahm, spürte er leichte Eifersuchtsstiche. Die jungen Männer buhlten um Maries Aufmerksamkeit, aber Marie erweckte den Eindruck, das nicht einmal zu bemerken.
Minuten später begann der Countdown, das Geschrei um Mitternacht war groß, und sie fielen sich allesamt um den Hals. Nicht wenige versuchten, von Marie geküsst zu werden, während Clemens seinerseits zwei, drei Frauen freundlich, aber bestimmt abwehren musste, die aus ihren Neujahrsglückwünschen etwas mehr zu machen versuchten, mit Zungeneinsatz und Händen an seinen Oberschenkeln. Dann verlor er Marie aus den Augen, es waren doch viel mehr Menschen in dem kleinen Restaurant, als er zuerst vermutet hatte, und zu seiner Enttäuschung wurde er von der Menge nach draußen geschoben, wo man versuchte, etwas vom Feuerwerk am Brandenburger Tor zu sehen, aber eigentlich nur in einen mit Lichtflecken gesprenkelten, kompakten Nebel glotzte, der kaum Sicht bis zur anderen Straßenseite erlaubte. Es war der lauteste Nebel, den Clemens je erlebt hatte. Und das Brandenburger Tor war sowieso viel zu weit weg, um etwas von dort zu erkennen. Er hätte nicht einmal sagen können, in welcher Richtung es sich genau befand, aber eigentlich war ihm das auch egal. Er sah sich suchend um, war frustriert, weil zwar Frauen in seiner Nähe seinen Blick suchten, jedoch nicht die, die er wirklich anschauen wollte.
Dann stand sie plötzlich vor ihm, machte ein freudiges Geräusch, so ein mädchenhaftes Kieksen, ließ ihren Becher fallen und nahm seine beiden Hände. »Wir haben noch nicht, oder?«, fragte sie strahlend, das Gesicht gerötet, und als er lächelnd den Kopf schüttelte, stieg Marie auf die Zehenspitzen und küsste ihn.
Sie küssten sich sehr lange. Als sie lächelnd nach Luft schnappten, sagte Marie: »Schon als du in die Wohnung gekommen bist, dachte ich: Neben dem würde ich gerne einmal aufwachen.«
Clemens’ Herz setzte aus, einerseits vor Freude. Andererseits …
»Nur einmal?«, fragte er gegen.
Marie brummte etwas, kicherte und zog ihn wieder an sich. Es war ein sensationelles Gefühl, eines, das sich so unglaublich richtig anfühlte, sozusagen die emotionale Perfektion. Als sie sich etwas atemlos voneinander trennten, sah er, dass die Leute, die um sie herum standen, nicht zum Himmel schauten, sondern zu ihnen. »Ihr seid echt das Paar des Jahrtausends«, brüllte eine Frau gegen den Lärm, und sie lächelte dabei. Die anderen um sie herum nickten.
»Wenn ihr das sagt«, erklärte Marie fröhlich.
Freitag, morgens
Tag eins
Es war schon fast elf, als Marie zum Joggen aufbrach, aber Clemens lag noch in ihrem Bett und schlief. Er atmete ruhig, machte fast kein hörbares Geräusch, wirkte äußerst entspannt. Sie hatte ihn betrachtet, erst vor dem Aufstehen und dann, während sie sich leise anzog. Und sie hatte dabei lächeln müssen, nicht nur über seine Hand, die mit der Handfläche nach oben auf der Bettdecke lag, als würde er etwas erwarten. Es war sicher nicht der beste Sex ihres Lebens gewesen, vor allem das erste von den beiden Malen, die sie es in der vergangenen Nacht – oder eigentlich schon am frühen Morgen – getan hatten, aber sie hatte sich noch nie nach dem Sex so gut gefühlt wie an diesem Ersten Ersten im Jahr zweitausend.
Der alte Mann, der immer im Park auf der Bank am Spielplatz saß und auf die Kinder wartete, war schon da, obwohl es Neujahr war und die meisten heute vermutlich erst am Nachmittag kämen, wenn überhaupt, denn das Wetter lockte nicht nach draußen. Die Temperatur lag bei wenig über null Grad, und es nieselte aus einem trüben Himmel. Der Mann, der vielleicht fünfundsiebzig war, hockte in seinem hellgrauen Trenchcoat auf der abgeschabten Bank, neben sich die Tupperbox mit Apfelschnitzen, von denen er hin und wieder einen nahm und langsam aß, aber wenn ein Kind kam und höflich fragte, war er spendabel. Das hatte Marie schon mehrfach beobachten können. Ganz erstaunlich, dachte sie jedes Mal, wenn sie am Spielplatz vorbeijoggte, dass die übereifrigen Mütter – es gab kaum Väter hier – das duldeten. Vor zwei Jahren hatte es große Aufregung um diesen Ort gegeben, weil einige Frauen meinten, die hölzerne Märchenfigur, die einen Zwerg darstellte und neben den Schaukeln stand, hätte eine zu deutliche Ausbeulung in der Hose und würde ihre Kinder sexuell irritieren. Inzwischen stand die Figur anderswo. Marie hatte den lustigen Zwerg gemocht. Aber die schratige Hexe hatte die Aufregungen überlebt, obwohl sie, wie Marie fand, in mancherlei Hinsicht viel anstößiger war. Wenn sich nur eine der Frauen das in den Kopf setzte, wäre diese Figur vermutlich auch bald weg. Und irgendwann würde es auch den alten Mann erwischen. Es gab kaum etwas Gnadenloseres als selbstgerechte Mütter. Sie lächelte bei dem Gedanken. Mutter sein, das war allerdings nichts, das in ihrer Lebensplanung vorkam, und wenn sie an ihre eigene Mutter dachte, musste sie staunen, dass sie, Marie, es trotz dieser Mutter geschafft hatte, ein recht okayer Mensch zu werden. Gut, ein ziemlich prima Mensch sogar.
Sie trabte gemächlich vor sich hin, wollte nur ein bisschen auf Touren kommen, vielleicht irgendwo Brötchen kaufen und dann zu diesem netten Jungen zurückkehren, der so gut zu ihrem Bett passte. Bei diesem Gedanken musste sie lächeln, trotz des Nieselns, der leichten Alkoholkopfschmerzen und der Tatsache, dass ihr MD‑Walkman vor einigen Minuten den Geist aufgegeben hatte, weil sie vergessen hatte, die Akkus zu wechseln. Schade, denn auf ihr Lieblingsalbum Songs for Polarbears hätte sie jetzt große Lust gehabt. Sie sog die immer noch etwas verbrannt riechende, kühle Luft ein, blinzelte das leichte Pochen im Hinterkopf weg und dachte an die vergangene Nacht.
Er hatte sich beim ersten Mal so ungeheure Mühe gegeben, nichts falsch zu machen, dass der Versuch beinahe auf halber Strecke versandet wäre, und Marie hatte an sich halten müssen, um nicht loszulachen, was beim ersten Sex einfach keine gute Idee war, ganz egal, wie viel Empathie es zwischen ihnen gab. Dann hatten sie noch eine Flasche Wein aufgemacht und sich entspannt; er hatte zwar immer noch versucht, ihr nach allen Regeln der Kunst ein gutes Gefühl zu verschaffen, aber es hatte beinahe geklappt, und auch wenn sie nicht in explosiven multiplen Orgasmen gekommen war, was, wie Marie annahm, ohnehin ein eher seltenes Phänomen war, hatte sie sich sehr gut gefühlt.
Sie war erstaunt, wie gut sie sein Aussehen visualisieren konnte, denn ihr Gesichtergedächtnis war weniger gut, selbst bei Menschen, die sie sehr interessierten oder regelmäßig traf. Aber sie konnte jetzt Clemens’ kantiges, zweitagebärtiges Gesicht vor sich sehen, die wasserhellen Blauaugen, das markante Kinn, die krause, leicht gelockte Frisur, den schlanken Oberkörper, der nackt etwas weniger sportlich aussah, als sie erwartet hatte. Sie lächelte wieder, beschleunigte ein bisschen und hielt auf eine Filiale von Bäckman zu, der Industrieteig-Fertigbackkette, die Judith und Karl so hassten. Im Namenszug war das C wie die Pacman-Figur geformt. Es gab sogar eine Warteschlange, weil kaum ein anderer Laden offen hatte.
Nach dem Einkauf blieb sie einen Moment draußen stehen und überlegte, Khaled anzurufen, ihren besten Freund, den sie seit der Grundschule kannte. Khaled, der Räuber, der sie seit ein paar Jahren Pumalady nannte. Und mit dem nie etwas passieren würde, weil er eben ein Räuber war, aber sie keine Beute, außerdem missfiel ihr sein dick aufgetragener Machismo, und er war schlicht nicht ihr Typ (und umgekehrt). Marie zog das Telefon aus der Tasche. Das Gefühl, dass an diesem Tag etwas Besonderes passierte, war sehr stark, und sie musste darüber sprechen – nicht, um anzugeben, sondern um es in der Realität zu verankern. Aber es war erst kurz vor zwölf am allerersten Neujahrstag des neuen Jahrtausends. Wie sie Khaled kannte, würde er heute bis zum späten Nachmittag schlafen. Das galt vermutlich auch für ihre WG‑Mitbewohnerin Donna, die wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie ihr zweitbester Freund war. Marie wusste nicht einmal, wie früh oder spät es gerade in Kanada war, wo die junge, robuste Frau ihre äußerst wohlhabende Familie über die Feiertage und den Jahreswechsel besuchte. Früher, oder? Die Sonne ging zuerst im Osten auf, Kanada lag im Westen, vermutlich war dort also noch tiefe Nacht. Aber so nett Donna auf ihre burschikose Weise auch war, sie war sowieso nicht die Person, mit der Marie jetzt hätte sprechen wollen. Dafür gab es noch nicht genug Vertrauen zwischen ihnen, und Donna hatte auch immer ein bisschen stinkstiefelig reagiert, wenn Marie ihr am Frühstückstisch oder abends bei einem gemeinsamen Glas Wein von nächtlichen Eroberungen erzählt hatte. Sie steckte das Telefon wieder in die Hosentasche und trabte heim.
Auf dem Rückweg kamen ihr mehrere Frauen einzeln entgegen, Frauen in den Vierzigern, die alleine mit ihren Hunden Gassi gingen, überwiegend mit Mischlingen, in dieser handlichen Größe mitten zwischen Zwergpudel und Schäferhund. Den Frauen war anzusehen, dass sie keineswegs das kleinere Streichholz gezogen hatten an diesem Neujahrstag, sondern dass sie alleine unterwegs waren, weil sie alleine waren. Auf der kurzen Strecke bis nach Hause zählte Marie sechs solcher Begegnungen. Die Frauen waren auf schlichte Weise elegant-sportlich gekleidet, hatten allesamt praktische, aber unscheinbare Frisuren, waren nur wenig geschminkt, und sie trugen diese einsame Traurigkeit vor sich her, wie sie ihre trotzigen Hunde hinter sich herzogen. Marie, die über zwanzig Jahre jünger war und die von einer wirklich netten neuen Bekanntschaft zu Hause im warmen Bett erwartet wurde, empfand Mitgefühl. Aber dann war da noch etwas.
Sie sah sich plötzlich selbst in genau der gleichen Position. Sie konnte Marie de Bruijn sehen, mit vierundvierzig, einem Border Terrier an der Leine, dem Mobiltelefon in der Hosentasche, auf Vibration gestellt, damit sie einen Anruf sofort spüren könnte, einen von diesen wenigen wirklich privaten Anrufen, die an einem Sonntag hereinkämen. Sie wäre in der Woche natürlich stark eingespannt, als Anwältin gefragt und beliebt, wahrscheinlich wäre sie auch politisch aktiv, und sie hätte zwar einen großen Freundeskreis, aber einen zugleich sehr distanzierten, eher also einen Bekanntenkreis. Weil all ihre Freunde in Beziehungen stecken würden und das von anderen auch erwarteten, vor allem aber, weil es nicht ihre Art war, Verbindlichkeit und Nähe zuzulassen. Was nicht nur daran lag, dass ihre Eltern versucht hatten, sie von Festlegungen und folgenreichen Entscheidungen im zwischenmenschlichen Bereich abzuhalten, sondern vor allem daran, dass sie das einfach nicht beherrschte, diesen energischen, verbindenden Schritt aufeinander zu. Dieses Verschenken von Vertrauen. Sie dachte an ihre Mutter und was die wohl dazu sagen würde, dass sich die Tochter, die eine so rollenfremde und emanzipatorische und konfliktpädagogische Kindheit hatte verbringen dürfen, Gedanken darüber machte, welchen Einfluss die Tatsache, ob sie in einer festen Beziehung stecken würde oder nicht, auf ihre zukünftige Lebensqualität haben würde. Wahrscheinlich würde sie ihren sehr runden und kraushaarigen Kopf schütteln, auf dem irgendeine sehr originelle Kopfbedeckung schwankte, und sich dann wieder etwas Wichtigerem zuwenden, wie sie das immer getan hatte.
Marie bemerkte, dass sie stehen geblieben war, sie musste kurz lächeln, dachte dann an Clemens, und sofort wurde die leichte Melancholie von Freude verdrängt. Sie griff die Brötchentüte etwas fester und rannte das letzte Stück.
Als sie die Wohnung betrat, roch es nach frischem Kaffee und außerdem nach Pancakes, aber Maries Mitbewohnerin Donna, die nichts anderes frühstückte, war ja in Vancouver. Tatsächlich hatte Clemens den winzigen Küchentisch gedeckt, und an die kleine Vase mit der einzelnen Margerite – Marie liebte diese Blumen, schon seit ihrer Kindheit, als sie sie noch »Riesen-Gänseblümchen« genannt hatte – hatte er das Polaroidfoto gelehnt, das Paolo, der Inhaber des Restaurants, vor dem Aufbruch von ihnen gemacht hatte, begleitet vom begeisterten »Was für ein wunderschönes Paar!«, das er durchs Ristorante hatte schallen lassen. Clemens sprang auf, als Marie in die Küche kam, aber dann wusste er offenbar nicht weiter. Sie machte zwei Schritte auf ihn zu und küsste ihn. Dann schob sie ihn ein Stück von sich und wies auf den Teller, auf dem sich die dampfenden Pfannkuchen stapelten.
»Du hast Pancakes gemacht?«
Er grinste. »Du hast Ahornsirup im Regal. Es gibt nur eine einzige Verwendung für Ahornsirup.«
Sie lächelte und wollte schon den Mund öffnen, um das Missverständnis aufzuklären. Sie hatte Clemens noch nicht davon erzählt, dass sie diese Wohnung nicht alleine bewohnte, und es rührte sie ganz enorm, welche Gedanken er sich gemacht hatte und welche Freude er dabei empfand, sie auf diese Weise zu überraschen, dabei aß sie Pancakes nicht übermäßig gerne. Manchmal nahm sie sich einen, während Donna ganze Stapel davon zum Frühstück verschlang und mit literweise Frischmilch herunterspülte, aber frische Brötchen mit einer ordentlichen Portion Leberwurst mochte sie deutlich lieber.
Doch sie entschloss sich, nichts zu sagen. »Das ist sehr süß von dir«, meinte sie stattdessen lächelnd. »Aber ich habe Brötchen gekauft.« Sie hielt die Papiertüte mit dem Bäckman-Logo hoch.
»Die essen wir zum Abendbrot«, erwiderte er mit großer Selbstverständlichkeit. Dann zog er die Augenbrauen zusammen. »Aber du hast keinen Tee im Haus, nur Kaffee und sehr viel Milch. Ich trinke nicht so gerne Kaffee.« Er verzog das Gesicht. »Oder Milch.«
Marie ignorierte das mit dem Tee und der Milch. »Zum Abendbrot?«, fragte sie.
Er sah verunsichert auf die Uhr. »Ist ja nicht mehr so lange hin.« Dabei errötete er.
Später erinnerte sich Marie an diesen Moment als denjenigen, in dem sie sich in Clemens Freitag verliebt hatte. Bis über beide Ohren und noch einige Gigameter darüber hinaus.
Freitags Nachbarn
»Wow«, sagte Marie und meinte das auch so. Sie stand mit Clemens vor dem Eingang des Hauses in der Rheinuferstraße 17 und betrachtete die wirklich hübsche Fassade. Das Gründerzeithaus mit seinen vier Stockwerken und der kürzlich ausgebauten Dachetage war hellgrau angestrichen, aber die Ornamentierung und die Einsäumungen der Loggien hatte man, passend zu den Fensterrahmen, weiß hervorgehoben. Die oben abgerundete Eingangstür war breit und aus dunkelbraunem, schwerem Holz, das glänzend poliert war. Es gab eine gewaltige Klinke und ein flächiges Klingelbrett aus Messing. Links von dieser Tür befand sich eine weitere, deutlich kleinere, aber sehr ähnliche Tür, die zur Bar namens Dr. Met im linken Erdgeschoss führte. Über dem großen Fenster, dessen untere Hälfte mit einer hellen Gardine blickdicht gestaltet war, hing der dezente Schriftzug, daneben verriet ein beleuchtbares, aber jetzt unbeleuchtetes Schild die Biermarke, die es am Hahn gab. Es war vierzehn Uhr dreißig an einem sehr kalten Samstag Anfang November. Die Bäume entlang der Rheinuferstraße streckten ihre dunklen, blattlosen Äste in einen milchiggrauen Himmel.
Clemens und Marie legten die Köpfe synchron in die Nacken, ihre Atemwolken stiegen nebeneinander auf. Oben rechts, im vierten Stock, befand sich die Wohnung, die sie sich gleich anschauen würden. Marie meinte, anhand der Fenster zu erkennen, dass sie vollständig geräumt war, dass sie also, wie die Maklerin am Telefon versprochen hatte, zügig einziehen könnten, sollte ihnen die Unterkunft gefallen. Auch diese Wohnung hatte eine breite Loggia mit einem Halbrund nach oben hin, aber es gäbe auch noch einen Balkon auf der Rückseite, zum Innenhof des Ensembles, das dieses Haus mit einem weiteren, sehr ähnlichen links und einem angestaubt wirkenden Eckhaus auf der anderen Seite bildete. Dort waren in der braungrauen, schmutzigen Fassade sogar noch ein paar Weltkriegs-Einschusskrater zu sehen. Marie konnte sich gut vorstellen, in dieser Loggia zu sitzen, Kaffee zu trinken, an ihrem Computer zu arbeiten und hin und wieder über die Dächer der anderen Häuser zu blicken.
»Friedenau ist der kleinste Ortsteil Berlins«, dozierte Clemens. »Aber der am dichtesten besiedelte.« Er drehte sich zur schmalen Straße um, wo die Mittelklasseautos Stoßstange an Stoßstange standen, und nirgendwo war eine Lücke zu sehen, nicht einmal direkt gegenüber, an einer auf der Fahrbahn frisch markierten Stelle, neben der ein blaues Schild mit einem stilisierten, weißen Rollstuhl aufgestellt war. »Gut möglich, dass es hier ein Problem mit den Parkplätzen gibt.« Auf dem Behindertenparkplatz stand ein Kleinlieferwagen mit einem Essen-auf-Rädern-Schriftzug auf der Seitenfläche. Die Illustration über dem Schriftzug zeigte eine grinsende, weißhaarige Frau, die einen Teller mit Rouladen, Rotkohl und Klößen in die Höhe hielt, als würde sie damit beim Diskurswerfen antreten. Es sah jedenfalls eher aus, als würde sie das Essen fröhlich wegwerfen, statt sich auf die Verspeisung zu freuen.
»Eigentlich braucht man in Berlin keinen PKW«, sagte Marie. Woher er all dieses Zeug immer weiß, dachte sie dabei, und obwohl er im Grunde ironisch war, hatte der Gedanke auch eine bewundernde Komponente. Ohne Clemens an der Seite hätte sie sich im Leben nicht dafür interessiert, wie viele Leute in Friedenau wohnten. Von keinem der drei Orte, an denen sie bisher gelebt hatte, wusste sie das. Sie hätte es nicht einmal schätzen können.
»Wenn man es nicht eilig hat, dann nicht«, stimmte er grinsend zu. »Und wenn einem die eigene Gesundheit egal ist. Oder man nie schwere Einkäufe zu transportieren hat. Oder den Bezirk nie verlässt.« Er kicherte. »Oder das Haus.«
»Aus dir wird kein Umweltschützer mehr.« Marie seufzte, lächelte jedoch dabei.
»Ich bin ein Umweltschützer«, widersprach er. »Aber es gibt zwischen totalem Verzicht und ausschweifendem Luxus jede Menge Abstufungen.«
»Sie müssen die Freitags sein!«, behauptete in diesem Moment von rechts eine tiefe Frauenstimme. Sie drehten gleichzeitig ihre Köpfe und sahen eine Mittvierzigerin energisch auf sie zuhalten, die ein graublau kariertes Kostüm trug, das Marie an die eigene Großmutter väterlicherseits erinnerte, die den Kosenamen Eumchen getragen hatte, obwohl nichts an der ruppigen, unfreundlichen Frau irgendeine Verniedlichung gerechtfertigt hätte. Den Eindruck, den die Maklerin machte, verstärkte der strenge Dutt, zu dem ihre dunklen, stumpf wirkenden Haare frisiert waren. Die Frau war ziemlich blass, und sie hatte zum schwarzen Kajalstrich über den Augen einen dunkelroten Lippenstift aufgetragen, der die an Weißheit grenzende Blässe noch verstärkte. Marie musste an Gruften und bluttrinkende Untote denken. Als die Frau jetzt ganz unvampirisch zu lächeln begann, war sie etwas enttäuscht, dass die Eckzähne im Oberkiefer normal groß aussahen.
»Müssen wir«, bestätigte Clemens, obwohl sie überhaupt nicht verheiratet waren, und streckte die Hand aus. Marie war froh, dass er nicht gleich mit einer Parodie eröffnet hatte. Immerhin war der Berliner Wohnungsmarkt vor allem im ehemaligen Westteil zurzeit zwar ziemlich entspannt, aber Marie wollte nicht, dass die Maklerin darüber entschied, ob sie die Wohnung bekämen oder nicht, sondern sie selbst.
»Ich bin Sabine Böttcher«, sagte die Frau. Und dann, zu Marie, ihr die Hand entgegenstreckend: »Wir haben telefoniert.«
Marie nickte, schüttelte die Hand und verkniff sich ironische Erwiderungen. Sie mochte Ironie und Lakonie, aber sie wusste auch, wann sie damit haushalten musste.
»Na dann«, sagte Sabine Böttcher. »Wenn Sie Fragen haben, nur zu. Das Haus stammt aus dem Jahr 1897 und ist kürzlich sehr aufwendig restauriert worden, innen wie außen.« Sie zog die Stirn kurz kraus. »Bis auf die Fenster, aber fragen Sie mich bitte nicht, warum – möglicherweise waren die Mittel aufgebraucht. Die Dachetage ist ausgebaut worden und wird in knapp zwei Monaten bezogen.« Sie hob die Hände, wies dann mit der rechten auf den Bereich über der leer stehenden Wohnung im vierten Stock. »Sie bekämen also Nachbarn über sich. Das mag nicht jeder.«
Wir sind nicht jeder, wollte Marie sagen, verkniff sich allerdings auch das.
Als sie den Hausflur betraten, wusste Marie sofort, dass sie in diesem Haus wohnen wollte, zusammen mit Clemens. Vielleicht nicht für immer, aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, war dieses Haus genau richtig, das erkannte sie, ohne die Wohnung gesehen zu haben. Die breite, holzparkettierte und mit einem roten Teppich belegte Treppe hatte ein hölzernes Geländer, dessen Säulen wie zwei fußseitig übereinanderstehende Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren gedrechselt waren. Die Briefkästen im Eingangsbereich rechts waren wie das Klingelbrett draußen aus poliertem Messing, der Boden war im Schachbrettmuster gefliest. Es wirkte schon hier unten so hübsch und wohnlich, dass es oben nur mindestens genauso schön sein konnte. Und das Haus war kaum fünfhundert Meter vom Paolo entfernt. Zweimal links und dann durch den kleinen Park, keine fünf Minuten. Es wäre auch noch ein recht schöner Weg, dachte Marie. Selbst bei solchem Wetter wie heute.
Die Maklerin zeigte nach links, auf eine schlichte Wohnungseingangstür. »Hier ist der Hintereingang zur Bar. Manchmal gibt es etwas Lieferverkehr, aber das ist meistens schnell vorbei. Der Inhaber wohnt in der Wohnung darüber, im ersten Stock. Meines Wissens gibt es keine Familie mit Kindern im Haus, von den Krauses abgesehen, die die Dachwohnung beziehen werden. Aber für die Wohnung im Parterre rechts …« Sie wies auf die Tür. »… hat sich eine türkische Familie beworben.«
Marie musterte ihr Gesicht, doch Sabine Böttcher kommentierte diese Information, von der sie gemeint hatte, sie sei besonders erwähnenswert, nicht mimisch.
»Kommen Sie«, bat sie stattdessen.
Die Treppe ächzte leise, während die Maklerin voranging, Marie folgte, und Clemens kam hinterdrein. Marie wusste, dass Clemens, der ganz hibbelig vor Neugierde war und am liebsten schon eine Stunde vor dem Besichtigungstermin hier gewesen wäre, nur deshalb hinter ihr die Treppe hochstieg, damit er ihr Hinterteil betrachten konnte, weil er ihr Hinterteil beim Treppensteigen einfach hinreißend fand, wie er zu betonen nie müde wurde, und sie musste bei dem Gedanken daran lächeln. Sie kannten sich noch kein ganzes Jahr, aber Marie wusste über ihren … Freund schon viel mehr als über alle anderen Menschen, die sie im Laufe ihres Lebens kennengelernt hatte. Sie drehte sich kurz um und erwischte seinen Blick. »Wusste ich’s doch«, sagte sie liebevoll, und Clemens strahlte. Aber er heftete seinen Blick sofort wieder auf ihren Hintern. »Geh weiter«, befahl er sanft. »In Bewegung ist er unfassbarerweise noch schöner.«
Die Wohnung war ein Traum. Marie musste vor Aufregung tief durchatmen, als sie zu dritt in der geräumigen Diele standen. Hundertzehn Quadratmeter, abgezogene Fußböden, hohe, weiß gestrichene, helle Räume, überall Stuck, die geräumige Loggia, hinten ein Balkon, dazu ein modernes, nicht allzu großes Bad, dafür eine große Küche mit viel Gestaltungsspielraum – und all das zu einem bezahlbaren Tarif. Marie fühlte sich in ihrer positiven Vorahnung bestätigt. Selbst die Vorratskammer hinter der Küche begeisterte sie, sie fand die kleinen Metallkörbchen vor dem Milchglasfenster zum Hof hin richtig neckisch (sie dachte dieses Wort tatsächlich, obwohl sie es normalerweise nicht benutzte) und stellte sich vor, darin Kräuter zu ziehen. Sie folgten der Maklerin zum Abschluss der Besichtigungsrunde in das kleinere der zwei Schlafzimmer, die beide zum Hof wiesen und Türen zum lang gestreckten Balkon hatten. Als sie den Balkon betraten, war sich Marie so sicher, wie man nur sein konnte. Der Hof wurde von einer großen Linde beherrscht, die selbst jetzt, ohne Blätter, beeindruckend wirkte. Es gab die klassische Teppichklopfstange, deren Metall dunkel und abgewetzt war, zwei Gartenbänke am Stamm der Linde und ordentlich winterfest gemachte Beete an den Abgängen zu den Kellern. Marie fiel es nicht schwer, sich diesen Hof im Frühling vorzustellen, wenn die Sonne durch das milde, frühe Grün der Blätter scheinen würde. Clemens drückte ihre Hand, als sie ins Schlafzimmer zurückkehrten. Sabine Böttcher hatte die Arme vor der Brust verschränkt und grinste. Sie wusste, dass sie längst gewonnen hatte, das war ihr anzusehen.
In diesem Moment donnerte es über ihnen. Eine Frau schrie einige Worte – einen Befehl, eine Ermahnung, einen Fluch –, aber es war nicht zu verstehen, was sie genau schrie. Es war allerdings deutlich zu bemerken, dass die Frau wütend war, mit massiver Tendenz zu cholerischen Anfällen. Das Donnern stoppte, dann pochte es zweimal – jemand hatte aufgestampft, aber eine kleinere Person als die, die das Donnern verursacht hatte. Der Blick der Maklerin flackerte kurz. »Krauses haben schon die Schlüssel für ihre Wohnung. Es hört sich an, als wäre die Trittschalldämmung noch nicht verlegt.« Sie versuchte ein Lächeln, schaffte es allerdings nicht ganz.
»Krauses«, sagte Clemens und legte den Kopf in den Nacken.
»Sie sind die einzigen Eigentümer. Der Rest des Hauses gehört der WoBoWAG. Es ist aber keine weitere Umwandlung geplant.«
»Bei den derzeitigen Zinsen wäre das auch der Wahnsinn«, sagte Marie.
»Aber hallo«, erwiderte die Maklerin nickend. Aber hallo. Diese Phrase verbreitete sich derzeit schnell.
»Wir nehmen die Wohnung«, sagte Clemens und drückte Maries Hand fest. Sie spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten, wie ihre Kopfhaut plötzlich spannte, wie etwas ihre Unterarme überzog, aber sie konnte bloß nicken. Er hatte lediglich ihren stumm gefassten gemeinsamen Beschluss verkündet. Wir werden hier zusammenwohnen, dachte Marie. Clemens und ich. Ich und Clemens. Wir werden hier schlafen und kochen und frühstücken und arbeiten und Liebe machen und streiten und darauf warten, dass das Badezimmer frei wird, und uns versöhnen und was weiß ich noch alles. Ich möchte unbedingt, dass es sofort anfängt. Gleich. Jetzt.
Es donnerte abermals vom Dachgeschoss herunter. Dieses Mal war auch zu verstehen, was die Frau brüllte, denn sie gab sich wirklich Mühe, sehr, sehr laut zu sein. »Paul, ich reiße dir den Schädel ab, wenn du nicht sofort damit aufhörst!« Dann knallte etwas, aber das konnte kein Knallen von einer Hand gewesen sein, die ein Gesicht getroffen hatte, redete sich Marie ein. Allerdings setzte jetzt lautes Heulen eines Kindes ein, das sofort wieder aufhörte, weil die Frau abermals etwas schrie, jedoch wieder unverständlich.
»Wir nehmen sie trotzdem«, sagte Marie.
Sabine Böttcher sah auf die Uhr. »Wir können uns übermorgen treffen, um die Verträge zu machen. Ich muss jetzt leider weiter, ich habe gleich bei einem Hausverkauf in Lankwitz vier Interessenten. Möchten Sie noch einen Moment hierbleiben?«
Clemens und Marie nickten gleichzeitig und grinsten dabei. Vielleicht probieren wir kurz ein Schlafzimmer aus, das geht auch ohne Möbel, dachte Marie. Bevor sie mit Clemens zusammengekommen war, hatte sie mit nicht wenigen Männern Sex gehabt, vielleicht sogar mit mehr als drei Dutzend, grob überschlagen, aber nur mit einer Handvoll davon häufiger als ein einziges Mal. Es hatte sie nie wirklich zufriedengestellt, es war ihr immer wie eine Leistungsschau vorgekommen, wie verdammter Sport, und zugleich wie etwas, bei dem es emotional nur um einen – ihn – selbst ging. Mit Clemens war das ganz anders, ob bei einem Quickie oder abendfüllendem Geschlechtsverkehr – es ging um sie beide, um sie beide gleichzeitig und um diese Zeit, nicht um das Ergebnis oder um Erektionsstärken, Feuchtigkeitsgrade, die Anzahl der Orgasmen oder so etwas. Sex mit Clemens war wie ein Heraustreten aus der Zeit und der Welt und körperlich sowieso ohne Vergleich.
»Okay, Sie müssen nur die Tür zuziehen. Ist ja quasi schon Ihre Wohnung.« Sie wandte sich zur Eingangstür, drehte sich dann aber noch einmal zurück. »Das ist keine Maklerphrase. Sie sind ein tolles, wirklich bemerkenswertes Paar. Ich kann mir keine besseren Bewohner für diese schöne Wohnung vorstellen.« Dann hüstelte Sabine Böttcher, die tatsächlich ein ganz kleines bisschen rot geworden war, machte auf dem Absatz kehrt und hastete davon.
Eine Viertelstunde später öffneten sie die Tür zum Treppenhaus, obwohl sie gerne noch geblieben, am liebsten sogar gleich eingezogen wären. Sie hatten schon die Aufstellplätze für die Möbel und die Zimmerverteilung und die Wandfarben und die Küchenausstattung geplant. Über ihnen klackte im gleichen Moment ein Türschloss. Ein rhythmisches Poltergeräusch kündigte das Kind an, das die Treppen heruntersprang und beinahe an ihnen vorbeigerauscht wäre.
»Hallo, Paul«, sagte Marie.
Der etwa zehn Jahre alte Junge blieb wie angenagelt stehen und starrte Marie an. Auf seiner linken Wange war eine leichte Rötung zu sehen, und eine kleine Schramme in der Mitte der roten Fläche ließ vermuten, dass Frau Krause mit der rechten Hand zugeschlagen hatte, an der sich vermutlich der Ehering befand.
»Wer sind Sie denn?«, fragte der schmale, blauäugige Junge, der kurze, schwarze Haare hatte. Schüchternheit und Neugierde kämpften erkennbar in ihm, und er wusste nicht, ob er den Kopf gesenkt halten sollte, woran er nach Maries Eindruck gewöhnt war, oder ob er ihnen in die Gesichter schauen durfte.
»Wir sind Marie und Clemens. Wir ziehen hier bald ein.«
Ein Lächeln huschte über das Kindergesicht. Aber er traute sich nicht, die Fragen zu stellen, die offensichtlich in ihm drängten: Seid ihr nett? Darf ich euch mal besuchen? Habt ihr Kinder?
»Alles okay bei dir, Paul?«, fragte Marie.
»Woher wissen Sie, wie ich heiße?«, fragte der Junge gegen. Dabei tastete er nach seiner Wange.