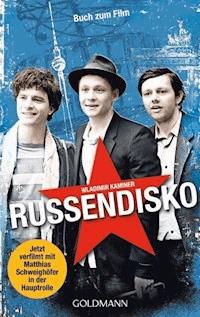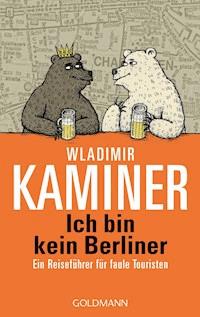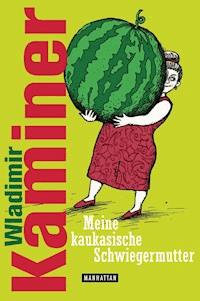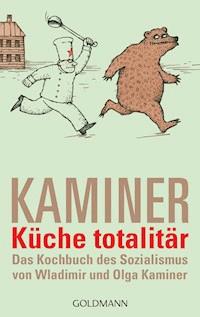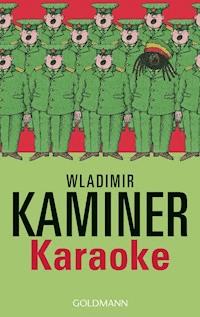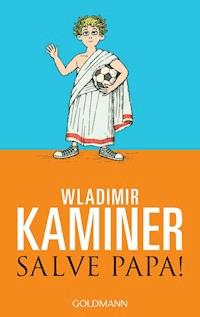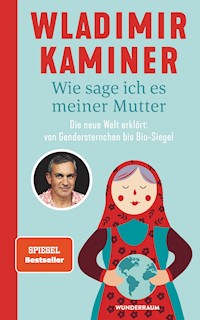15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch des SPIEGEL-Bestsellerautors – mit Lesevergnügen-Garantie!
Deutschland steht kopf, und Wladimir Kaminer macht daraus Geschichten mit Humor und Hintersinn ...
Wladimir Kaminer hat Deutschland auf zahllosen Reisen bis in den letzten Winkel erkundet. Doch plötzlich erkennt er Land und Leute kaum wieder – der schön geordnete Alltag steht plötzlich kopf. Statt das Verrückte im normalen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der alles verrückt ist: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen sollen. Da braucht man jemanden, der einen zwischendurch zum Lachen bringt. Mit Wladimir Kaminer als Reisebegleiter durch dieses neue Deutschland ist eine große Portion Humor garantiert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Wladimir Kaminer hat auf seinen zahllosen Reisen Deutschland genau kennengelernt. Doch plötzlich erkennt er Land und Leute kaum wieder. Der geordnete Alltag steht kopf, und statt das Verrückte im normalen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der alles verrückt ist. Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine plötzlich veränderte Welt weisen sollen. Da braucht man jemanden, der einen zwischendurch zum Lachen bringt. Mit Wladimir Kaminer als Reisebegleiter durch dieses neue Deutschland ist das auf jeden Fall garantiert …
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wunderraum-Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Originalveröffentlichung September 2021
Copyright © 2021 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München
Coverillustration: Ruth Botzenhardt,
www.rubo-illustration.de
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26824-4V001
www.wunderraum-verlag.de
Das Virus zwingt uns still zu stehen.
Das ist die Rücksicht vor dem Tod,
Die Elend lässt zu hohen Jahren kommen.
Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel,
Des Mächtigen Druck, des Stolzen Misshandlungen,
Den Übermut der Ämter und die Schmach?
Seine Geduld, sie wird sich lohnen.
Hamlet, frei nach Shakespeare
Inhalt
Kontaktpersonen der Kategorie II in ihrer natürlichen Nahfeldexposition
Notizen aus dem Risikogebiet
Der Wellenbrecher kommt
Rettet die Weihnachtsmänner
Besser sag dich niemals los von Bettelsack und Kerkers Schloss
Das härteste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg
57 Haselnüsse für Aschenbrödel
Der Markt der momentanen Möglichkeiten
Gran Canaria
Mit neunzig fliegen wir zum Mars
Der große Impfkrieg ist im Kommen
Die Eier der Freiheit
Im Würgegriff der Supermutante
Die erste Impfung
Unsere Zivilisation
Das Corona-Wörterbuch
Kontaktpersonen der Kategorie II in ihrer natürlichen Nahfeldexposition
»Wer hat das geschrieben?«, rief meine Tochter aus dem Bad. »Eine künstliche Intelligenz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas Langweiliges und Ödes von einem Menschen aus Fleisch und Blut verfasst wurde, einem Menschen mit Herz und Seele! Und mit Bart!«
Nicole las Das Kapital von Karl Marx in der Badewanne. Sie hatte es bei Dussmann im Sonderangebot gekauft, Ledereinband, kleine Schrift, 768 dünne Seiten, die permanent nass wurden. Das Buch war eigentlich für eine Kommunisten-Freundin als Geburtstagsgeschenk gedacht, aber dann hatte Nicole beschlossen, es erst einmal selbst zu lesen, obwohl sie bereits einen Stapel ungelesener dicker Bücher von ihren Freunden zu ihrem eigenen Geburtstag bekommen hatte: über die Herrschaft der alten weißen Männer, über die Zukunft, die weiblich war, und über Black Lives Matter. Lauter Diskurse, die junge Herzen heute höherschlagen ließen.
Fast alle aus dem Freundeskreis meiner Tochter hatten im September Geburtstag, als wären sie nicht von guten Eltern, sondern vom Weihnachtsmann. Nicole selbst sollte in diesem September 24 Jahre alt werden, aber die große Party war ausgefallen. Wegen Corona. Einige Freunde hatten Angst, andere mussten in Quarantäne. »Ich bleibe 23«, sagte Nicole, »wegen Corona fällt sowieso alles aus.« Sie hatte ihre Bachelor-Arbeit fertig geschrieben und sich für ein Masterstudium in Ethnologie immatrikuliert, doch den Master gab es dieses Jahr nur als Onlineangebot. Wer brauchte den Master in einem Onlinesemester? Also schimpfte sie über Karl Marx und ging in einer russischen Bar kellnern. Seit ein paar Wochen hatten sie dort einen neuen russischen Koch, der wie Karl Marx aussah, nur glatt rasiert.
»Du weißt doch, Papa, in jedem alten russischen Film gibt es diesen einen Typen, der die ganze Zeit schweigend am Tisch sitzt, melancholisch in die Ferne schaut und eine Zigarette nach der anderen raucht. Das ist unser neuer Koch!«, erzählte mir Nicole. Der alte war wegen Corona ausgefallen. Es war ja so viel ausgefallen. Die Menschen hatten entweder Angst oder Fieber, oder sie wurden vom Gesundheitsamt in eine zweiwöchige Quarantäne gesteckt, weil sie von jemandem, den sie gar nicht kannten, als Kontaktpersonen identifiziert worden waren.
»Sag nichts Schlechtes über Karl Marx!«, rief ich zurück. »Der ist in meinen Augen ein Prophet. Er hat vorausgesehen, dass der Kapitalismus eine Sackgasse ist und uns alle irgendwann zugrunde richtet. Er hat sogar Corona vorausgesehen, wie sonst wäre sein prachtvoller Schnurrbart zu erklären? Der Schnurrbart ist ein natürlicher Gesichtsschutz gegen Infektionen. Deine eigenen Viren bleiben darin stecken, und die fremden verlaufen sich darin. Deswegen haben die Polen so wenig Infizierte, weil so viele von ihnen Bart tragen.«
An der Ostsee waren im August in Heringsdorf alle Partys ausgefallen, während die Polen gleich um die Ecke völlig atemlos durch die Nacht feierten. Die deutsche Jugend lief also jeden Abend zum Tanzen über die Grenze nach Paprotno.
»Ein Bart schützt doch nicht vor Viren, er ist eher ein Virenfänger und -behälter!«, widersprach mir die Tochter. »Im Bart bleibt alles stecken. Die Polen haben wenig Infizierte, weil sie einfach weniger testen. Und Karl Marx hatte keine Ahnung von Corona. Er hat bestimmt als Kind nie vom Weihnachtsmann Besuch bekommen, weil ihm seine Eltern diese Weihnachtsmannlüge ersparen wollten. Das hat ihn sehr gekränkt, denn jedes Kind braucht etwas Geheimnisvolles, woran es glauben kann. Dieses Kindheitstrauma wollte er später mit überflüssigem Haarwuchs überwinden. Er wollte sein eigener Weihnachtsmann sein«, meinte Nicole.
»Na gut«, sagte ich, »oft sind es eben die Möchtegern-Weihnachtsmänner, die kommen, um uns zu warnen. Und er hat die Menschen gewarnt, der Kapitalismus sei ein System, das auf Ausbeutung und Versklavung aufgebaut ist, das Geld nur des Geldes wegen produziert und dem sich keiner entziehen kann. Es wird unter seiner eigenen Last, dem Elend, der Knechtung und Ausbeutung, die es hervorbringt, einstürzen und uns allen um die Bärte fliegen. Alle wissen das, alle nicken zustimmend und machen trotzdem weiter, noch einmal und noch einmal, bis ihnen das Geld ausgeht oder sie sterben. Und dann kommen die Nächsten und machen genauso weiter. Auch jetzt in der Corona-Zeit beschäftigten sich die meisten mit der Frage, wann sie zu ihrem alten Leben zurückkehren und endlich wieder so weitermachen können wie vorher, als wäre nichts gewesen. Nur das interessiert sie.«
Das Land bereitete sich gerade auf die zweite Welle vor. Die Bundeskanzlerin forderte die Einführung einer bundesweiten Warnampel und ein härteres Eingreifen in das innerstädtische Partyleben. Wenn es so weitergehe wie bisher, hätten wir zu Weihnachten 20 000 Infizierte täglich, warnte sie. Die Aussagen der Politiker klangen widersprüchlich. »Wir sehen Licht am Ende des Tunnels«, sagten sie: Die zweite Welle sei zwar unausweichlich und sogar bereits da, wir könnten sie aber verhindern, obwohl wir bereits mittendrin wären und nichts Gescheites dagegen unternehmen könnten. Auf uns warteten ein paar ruhige Monate. München ohne Oktoberfest, Weihnachten ohne Märkte, Karneval ohne Umzüge, der russische Impfstoff Sputnik »Los geht’s« V und ein langes glückliches Leben im Homeoffice.
Die Russen prahlten bereits seit Wochen mit ihrem neuen Impfstoff. Sie impften alles und jeden. Vor allem waren sie darauf scharf, namhafte ausländische Gäste mit ihrem Vakzin zu beglücken. Gérard Depardieu hatte als Mitglied der Risikogruppe sofort eine ganze Kiste davon nach Hause geliefert bekommen. Angeblich hatten sich auch der Schauspieler Steven Seagal und der Italiener Prodi dieses Sputnik spritzen lassen. Prodi meinte später in einem Interview, eine Woche nach der Impfung hätte er plötzlich Russisch verstehen und Putin toll finden können. Böse Zungen hatten schon früher erzählt, die russische Führung wolle mit diesem Impfstoff das heikle Problem der Präsidentschaftswiederwahl 2024 ein für alle Mal lösen. Man munkelte, jeder, der sich auf die Impfung einließe, würde sie alle drei Jahre erneuern müssen, und zwar mit exakt demselben Stoff. Den würden sie aber nur bekommen, wenn sie den Präsidenten unterstützten. Es wäre für den Kreml eine enorme Erleichterung, die Wahl nicht mehr manipulieren zu müssen, sondern die Menschen wie in demokratischen Ländern einfach frei wählen zu lassen. Sollte doch jeder selbst entscheiden: Wollte er Putin oder einen qualvollen Tod. So erklärte der Volksmund die Großzügigkeit des Staates bei der Impfstoffverteilung.
Meine Herbstlesereise war nicht gänzlich ausgefallen, denn jede Stadt hatte sich bemüht, ein eigenes Hygienekonzept zu entwickeln. In den riesigen Stadthallen, in denen früher Tausende zusammen gefeiert hatten, durften jetzt nur noch 200 Menschen gemütlich beisammensitzen, mit gebührendem Abstand und Maske, versteht sich. Jeder hatte Platz für fünf und musste seinem Nächsten nicht auf die Glatze niesen. Nach dem Lockdown im Frühling waren die Kulturmotoren wieder ein wenig angesprungen, doch das Kulturauto blieb immer wieder stehen. Es war allen klar, dass jede Veranstaltung die letzte sein konnte. Es reichte ja schon, wenn einer hustete – schon war Schluss mit lustig.
In Lamspringe musste ich zwei Lesungen hintereinander abhalten, weil die Anzahl der verkauften Karten nicht mit dem Hygienekonzept des Schafstalls in Einklang zu bringen war. In Bad Elster wurde ich zu meiner eigenen Verwunderung zum Ehrenkünstler des König Albert Theaters ernannt, ich bekam einen Blumenstrauß und eine Urkunde. Seit vielen Jahren veranstaltete ich in diesem wunderschönen Theater schon Lesungen, war aber noch nie zum Ehrenkünstler ernannt worden. Wahrscheinlich lag es daran, dass sich nur ganz wenige Künstler trauten, im Jahr der Pandemie auf die Bühne zu gehen. In Hamburg hatte ich einen Auftritt in der berühmten Elbphilharmonie, dem neuen Hamburger Wahrzeichen von unsäglicher Schönheit und Eleganz. Die Wände im Saal waren von innen etwas provokativ mit erotischen halbkugeligen Tälern dekoriert, was die Menschen zum permanenten Anfassen der Wände animierte. An jenem Abend sollte ich Geschichten zum Thema Musik lesen und eine Russendisko veranstalten, die aber natürlich ins Wasser fiel. Wegen Corona. Also tanzte ich allein auf der Bühne, erzählte und las Musikgeschichten vor.
Die Hygienemaßnahmen in der Elbphilharmonie waren weitaus schärfer als in den ländlichen Gegenden. Man durfte nicht zu zweit in den Fahrstuhl steigen, mein Manager durfte die Garderobe nicht betreten, ich selbst sollte meine Maske erst auf der Bühne abnehmen und wegen der Schmierinfektionsgefahr möglichst nichts anfassen. Bereits bei der Tonprobe kam es zu einem Problem.
»Sie haben den Mikrofonständer angefasst«, sagte die nette Gastgeberin zu mir. »Jetzt dürfen ihn unsere Techniker nicht mehr berühren. Sie müssen nun allein mit dem Stativ zurechtkommen. Schaffen Sie das?«
Diese Strenge war aus der Not geboren, es war nämlich allen klar: Wir hatten nur eine Chance, bis der erste Zuhörer nieste. Danach würde die Philharmonie sofort geschlossen, und das Hamburger Wahrzeichen von Schönheit und Eleganz müsste eine zweiwöchige Zigarettenpause einlegen. Schnell weg hier, dachte ich.
Mein nächster Termin war zum Glück jenseits der verseuchten Großstädte auf dem Land in Nordrhein-Westfalen. Dort hatte ich in der Orangerie eines Wellnesshotels mit großem Park und viel frischer Luft eine Lesung. Alles an dieser Anlage wirkte jungfräulich gesund. Der Park prahlte mit allen Farben des Herbstes, nicht umsonst zählt er zu den schönsten Parkanlagen Deutschlands. Die Besitzerin hatte mich persönlich mit dem Auto vom kleinen Bahnhof abgeholt, sie trug ein schickes Kleid und außerdem eine Maske, um mich zu schützen. Es hieß ja immer, Masken schützten nur die anderen, nicht aber den Träger. In Russland sagten die Maskenkenner, es käme vielmehr darauf an, wie man sie trage: Setzte man sie nämlich verkehrt herum mit der Außenseite nach innen auf, würde sie den Maskenträger schützen, sein Gegenüber aber nicht. Richtig sicher wäre es daher, zwei Masken übereinander zu tragen – eine nach innen und eine nach außen gerichtet. Aber das machte keiner. Die Hotelbesitzerin trug ihre Maske jedenfalls ganz klassisch. Wie nett, dachte ich und fragte sie, wie es eigentlich mit Corona in ihrer Gegend aussehe.
»Gott sei Dank ist hier alles ganz locker«, erzählte sie. »Die Menschen haben Platz und können problemlos ausreichend Abstand zueinander halten. Wir waren lange Zeit sogar komplett Corona-frei, bis auf einen einzigen Fall, meinen Sohn.« Der junge Mann war von Leichtsinn und Neugierde getrieben zu einer verseuchten Open-Air-Veranstaltung nach Österreich gefahren und gesund und munter, wenn auch etwas gelangweilt, zurückgekommen. Zwei Tage später erreichte ihn die Nachricht, jemand, der auf diesem Festival mitgetanzt habe, sei positiv getestet worden. Also war der Sohn bei bester Gesundheit zum Arzt in die Klinik neben dem Hotel gegangen und hatte sich testen lassen. Er war ebenfalls positiv und ging für zwei Wochen in Quarantäne. Die Besitzerin und ihre ganze Familie mussten sich ebenfalls testen lassen, sie waren alle negativ. Es war ja auch ein großes Haus, und sie hatten sich nicht allzu doll umarmt. Der junge Mann hatte keine Symptome, keinen Husten und kein Fieber, rein gar nichts. Als er sich nach zwei Wochen noch einmal testen ließ, war das Ergebnis negativ, und die Orangerie des Hotels durfte weiter wie geplant ihre Veranstaltungen durchführen.
Es war ein schöner Abend in der Orangerie. Ich stand mit sicherem Abstand zum Publikum auf der Bühne, die Besitzerin saß zusammen mit ihrem Sohn in der ersten Reihe, alle freuten sich.
Am nächsten Tag fuhr ich nach Sachsen. Auf dem Weg nach Pirna bekam ich von meinem Tourmanager die Nachricht, die Hotelbesitzerin habe sich irgendwie schlapp gefühlt, sich aus bloßer Vorsicht noch einmal testen lassen und sei positiv.
»Das ist nun mal so. Das ist unser Berufsrisiko«, schrieb mir der Kollege. »Sie hat dich als Kontaktperson angegeben, du wirst also bestimmt gleich von deinem Gesundheitsamt angerufen. Bereite dich auf die Quarantäne vor. Das ist wohl nicht anders zu regeln.«
Dabei war es mir gerade so gut gegangen! Ich hatte dieses Reiseleben, meine Auftritte, das Publikum in der Zeit davor sehr vermisst. Ich hatte doch so viel vor! Schwetzingen, München, Wiesbaden! Und jetzt sollte ich das alles sein lassen und wieder nach Hause zurückkriechen? Nein, ich würde nicht in Quarantäne gehen, ich konnte doch nicht mein ganzes Leben hinschmeißen, nur weil jemand sich zu viele Sorgen machte. Ich war bereit, dieses Risiko einzugehen, es war schließlich mein Leben.
»Es geht aber nicht nur um dein Leben, sondern um das Leben anderer Menschen, die du in Gefahr bringst!«, konterte der Kollege. »Willst du wirklich riskieren, als Superspreader durch Deutschland zu ziehen und eine Spur des Hustens und des Todes in den Kulturhäusern des Landes zu hinterlassen? Viele deiner Leserinnen und Leser gehören zur Risikogruppe! Denk an sie! Außerdem wird dich das Gesundheitsamt über kurz oder lang sowieso kriegen. Sie haben jetzt Bundeswehrsoldaten zu Hilfe bekommen, die womöglich sogar das Recht haben, auf dich zu schießen!« Dazu schickte er mir eine frische Nachricht, gerade eben aus dem Netz gefischt: angeblich eine gesetzliche Verordnung, die lautete:
»Gelingt dem Infizierten dennoch die Flucht, darf die zuständige Behörde diesen im Rahmen des Verwaltungszwangs mit Gewalt wieder in Gewahrsam nehmen und in Quarantäne unterbringen. Als letzte Möglichkeit darf sogar von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden, da die Ansteckungsgefahr für eine Vielzahl von Personen so hoch ist, dass es zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung geboten sein kann, flüchtige Patienten unschädlich zu machen.«
Meine Tochter entlarvte diese Horrormeldung sofort als Fake News. Aber bis dahin dachte ich: Leck mich am Arsch, sie werden mich erschießen. Sie werden mich jagen und finden, eines Tages, am Rande des Teutoburger Waldes oder in der sächsischen Prärie am Ufer der Elbe. In meiner Fantasie hatte das Gesundheitsamt Pankow bereits Kopfjäger losgeschickt, die hinter mir her waren. Sie würden meinem Terminkalender folgen und eiskalt aus der Hüfte schießen. Der Film in meinem Kopf war ein wilder Western. Darin lag ich im Hinterhof eines provinziellen Kulturhauses, atemlos, mit fünf Kugeln in der Brust, posthum bei der Obduktion negativ auf Corona getestet, in einem Krieg des Staates gegen das Virus sinnlos zwischen die Fronten geraten.
Oh Mann, was für ein Tod, dachte ich und rief sofort beim Gesundheitsamt Pankow an. »Hallo, hier ist Wladimir Kaminer, pfeifen Sie bitte Ihre Kopfjäger zurück, ich möchte mich stellen!«
»Ach, Herr Kaminer, schön, dass Sie anrufen!«, grüßte mich die freundliche Mitarbeiterin. »Ich möchte Ihnen sagen, Ihr Buch über das Rotkäppchen, das auf dem Balkon raucht, ist ja der Hammer. Wir haben sehr gelacht, im Ordnungsamt. Sie müssen unbedingt mal eine Lesung bei uns machen.«
»Überhaupt kein Problem«, sagte ich. »Aber sagen Sie bitte, bin ich jetzt beim Ordnungsamt gelandet? Ich wollte eigentlich das Gesundheitsamt anrufen.«
»Amt ist Amt, Herr Kaminer. Wir sind jetzt alle Gesundheitsamt, wir helfen den Kollegen.«
»Gut. Okay.« Ich war etwas verwirrt. »Wann wollen wir die Lesung denn machen? Ich könnte in zwei Wochen kommen, sobald ich aus der Quarantäne raus bin.«
»Na, warten Sie erst mal ab«, sagte die freundliche Stimme. »Wir haben hier eine Meldung vom Gesundheitsamt Höxter bekommen. Sie wurden von einer Hotelbesitzerin als Kontaktperson angegeben. Sagen Sie mir ehrlich: Wie nahe sind Sie ihr gekommen?«
Ich erzählte die ganze Wahrheit, nämlich, dass wir im Auto tatsächlich beide vorne gesessen hatten, aber dass das Fenster offen und die Dame maskiert gewesen war.
»Stand sie während Ihrer Lesung mit Ihnen auf der Bühne?«, wollte die Beamtin wissen.
»Nein, um Gottes willen. Sie saß mitten im Publikum in der ersten Reihe, weit entfernt von der Bühne neben ihrem Sohn. Und sie trug die ganze Zeit eine Maske.«
»Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich muss das mit meinem Chef klären«, sagte die Beamtin. »Bleiben Sie, wo Sie sind, und halten Sie Abstand zu anderen Menschen. Von wo aus telefonieren Sie eigentlich gerade, Herr Kaminer? Wo befinden Sie sich im Moment?«
»Ich bin in Deutschland, in Pirna, am Ufer der Elbe. Ich sitze in einem Café mit einem Matjesbrötchen in der Hand. Neben mir sitzt ein älteres Ehepaar in ungefähr zwei Metern Entfernung. Sie trinken Kaffee ohne Maske. Darf ich das Brötchen jetzt aufessen, oder muss ich sofort hier weg?«
»Bleiben Sie, wo Sie sind, wir rufen Sie zurück!«, sagte die Gesundheitsfrau vom Ordnungsamt und legte auf.
Ich konnte nicht weiteressen, ich hatte keinen Appetit mehr. Da wird gerade über mein Leben entschieden, dachte ich, stand auf, ging ans Ufer und lief elbabwärts. Eine Stunde später wurde ich als Person zweiten Kontaktgrades eingestuft und musste nicht in Quarantäne.
»Sie sollten aber sehr vorsichtig sein und anderen Menschen nicht zu nahe kommen«, meinte die Beamtin.
»Mach ich, versprochen!«, rief ich. Ich durfte sogar weiter auf die Bühne, ich musste nur immer eine Flasche mit Desinfektionsmittel und eine Maske dabeihaben.
Trotzdem landete ich am Ende der Woche wieder zu Hause in Brandenburg und wusste nicht, was tun. Die meisten Veranstaltungen waren ausgefallen, und zum Angeln hatte ich keine Lust. Alle wussten, dass die Fische 2020 nicht anbissen. Und Pilze würde es in diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht geben. Wegen Corona. Außerdem war es zu trocken, fast den ganzen Sommer war kein Niederschlag gefallen. Erst Mitte September hatte es angefangen zu regnen. Es schüttete ununterbrochen drei Tage und drei Nächte lang. Nur tagsüber, wenn der Regen kurz Mittagspause machte, kam die Sonne für fünf Minuten heraus und wärmte die nasse Erde ein wenig. Dann versteckte sie sich sofort wieder hinter dunklen Wolken, die wie aufgeblasene Euter einer Kuh aussahen, die seit drei Monaten niemand gemolken hatte.
Den größten Teil des Herbstes verbrachte ich im Bett. Der wahre Zauber des Lebens entfaltet sich ohnehin am besten im Schlaf. Ich träumte von wilden Verfolgungsjagden mit den Gesandten des Gesundheitsamtes. Sie suchten mich in Kneipen auf und schossen aus der Hüfte auf mich, während ich sie mit Exemplaren der Taschenbuchausgabe von Rotkäppchen raucht auf dem Balkon bewarf.
Eines Nachts riss mich ein lauter Knall aus dem Bett. Es hörte sich an, als wäre ein schweres Tier auf dem nassen Dach ausgerutscht und mit lautem Stöhnen in den Schornstein gefallen. Jetzt lag dieses Etwas hinter der Lüftungsklappe und atmete leise. Ich hatte keinen Schlüssel für die Lüftungsklappe. Wer oder was könnte das bloß sein?, überlegte ich. Ein Waschbär? Ein Marder? Vielleicht war es der Weihnachtsmann vom letzten Jahr? Womöglich hatte er es wegen Corona nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft, bevor alle Grenzen geschlossen worden waren. Jetzt hatte er Husten, konnte keinen negativen Test vorlegen und wollte bei mir in Brandenburg das Ende der Pandemie abwarten. Aber was hatte ihn bloß aufs Dach getrieben?
»Hallo? Hören Sie mich?«, sagte ich laut und deutlich Richtung Lüftungsklappe. »Ich hoffe, Sie haben sich nicht verletzt!« Es kam keine Antwort, nur unverständliches Murren. »Wir haben erst den 24. September. Sie sind zu früh! Kommen Sie in drei Monaten wieder! Am besten mit einem Hygienekonzept – und vergessen Sie Ihre Maske nicht!«, sagte ich und ging leichten Herzens wieder ins Bett.
Notizen aus dem Risikogebiet
»Beginnen Sie Ihren Tag mit einem herrlich frischen Genießer-Vitalfrühstück vom Buffet« stand auf dem Schild neben der Hotelrezeption. Das war leichter gesagt als getan. Während der Corona-Pandemie gaben sich die Hotels große Mühe, neue Ernährungskonzepte auszuarbeiten, um das Virus nicht gleich zum Frühstück mit zu servieren. Die Hoteliers wollten herausfinden, ob es möglich war, die Gäste niveauvoll zu bedienen und gleichzeitig die von den Landesregierungen vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Der viel gelobte deutsche Föderalismus hatte auch die Hoteldirektionen erfasst. Genau wie die Landesregierungen waren auch sie der Meinung, nur in ihrem Haus könne ein perfekter Plan für ein pandemiekompatibles Genießerfrühstück entstehen.
An der Schwelle zur zweiten Welle habe ich alle Frühstückskonzepte ausprobiert. In einem schicken Hotel in Heidelberg beispielsweise sollte jeder Gast am Tisch auf einen Zettel schreiben, was auch immer er zum Frühstück haben wollte: »Wir erfüllen jeden Wunsch!«, versprach die Küche. Die Gäste nahmen diese Aufgabe sehr ernst. Wie es sich für ein Volk der Dichter und Denker gehörte, schrieben sie, nein, sie dichteten sich ein Frühstück zusammen, jeder nach seiner Art. Manchmal fehlten jemandem die Worte, dann hielt er oder sie kurz inne, strich das Aufgeschriebene durch und begann aufs Neue. Die Gäste entwarfen das beste Frühstück der Welt und ließen dabei ihre ganze Fantasie spielen. Am Ende aber bekamen doch alle das Gleiche: ein Ei, ein wenig Schinken, Käse und Brot.
In einem Hotel in München mussten die Gäste außer Masken auch Handschuhe tragen und sie vor jedem Gang zum Buffet wechseln. In den glatten Einweghandschuhen rutschte ihnen allerdings das Essen aus der Hand. Und da die Türen zur Straße hin offen waren, um eine bessere Lüftung zu gewährleisten, riss außerdem der Wind die Handschuhe von Tischen und Böden. Wie kleine silberne Fledermäuse flatterten sie durch die Luft.
Die Kellner im Restaurant sahen aus wie Pflegekräfte in einem Seuchenkrankenhaus. Sie trugen Corona-Schutzanzüge, die mich an meine Armeezeit erinnerten. Damals übten wir jungen sowjetischen Soldaten in ähnlichen Gummikostümen die Abwehr eines Chemiewaffen-Einsatzes der amerikanischen Streitkräfte. Natürlich glaubte niemand von uns, die Amerikaner könnten tatsächlich angreifen. Wir hatten ihre Soldaten in Hollywood-Filmen gesehen, es ging ihnen gut. Sie hatten mehr als genug zu essen, trugen schicke Uniformen, hatten geile Fahrzeuge und eindrucksvolle Waffen. Man musste als Amerikaner einen Vollknall haben, um solch eine wertvolle Ausrüstung für unsere trostlose Gegend zu verschwenden. Vor einem Angriff der Amerikaner hatten wir also keine Angst. Aber wir hatten große Angst vor unseren Schutzanzügen. Bei der Übung musste jeder in zehn Sekunden in seine Ausrüstung schlüpfen. Das Gummikostüm hatte allerdings abertausend Knöpfe, Verschlüsse und Abdecker. Einmal falsch zugeknöpft, kam man aus dem Kokon ohne fremde Hilfe nicht wieder heraus. Ich hatte ihn einmal im Stress falsch herum angezogen und konnte mich weder gegen chemische Waffen noch gegen meine eigenen Kameraden wehren, die mich von allen Seiten schubsten.
Das Genießer-Vitalfrühstück in Wiesbaden übertraf alles bisher Dagewesene. Das hessische Frühstücksbuffet wurde ausgesprochen reichhaltig aufgetragen, man durfte ihm bloß nicht zu nahe kommen. Jeder Gast musste dem Kellner aus sicherer Entfernung zurufen, was er auf seinem Teller haben wollte. Es bildete sich eine lange Schlange quer durch den Speisesaal. Die meisten nuschelten etwas Unverständliches in ihre Maske hinein, und auch die Kellner trugen selbstverständlich einen Mund-Nasen-Schutz. Sie konnten die Gäste nicht verstehen und sich nicht auf deren Bestellungen konzentrieren. Mir war schon früher aufgefallen, dass Menschen, wenn sie andauernd Masken tragen, nicht nur schlechter sprachen, sie hörten, sahen und dachten auch schlechter. Viele Genießer erwiesen sich obendrein als extrem kurzsichtig, sie konnten aus zwei Metern Entfernung das Essen auf den Tabletts nicht richtig erkennen. Vor allem aber wussten sie nicht, wie das hieß, was sie auf ihrem Teller haben wollten. Das machte die Zusammensetzung jedes Frühstückstellers zu einer Qual.
»Ich möchte bitte von diesem Rosigen da eine Scheibe – nein, nicht diese Scheibe, die andere, die zweite von unten. Ist das Käse oder Fisch?«
»Was wollen Sie?«, fragte der Kellner. »Einen Käsefisch? Das habe isch nisch.«
Ich langweilte mich in der Schlange zur Essensausgabe. Auf großen Monitoren an der Wand liefen Nachrichten ohne Ton. CNN, BBC, NTV, auf allen Kanälen sah man den amerikanischen Präsidenten, der hektisch durch die Gegend trampelte. »Donald und Melania Trump haben sich mit Corona infiziert«, lauteten die Untertitel. Der frisch Infizierte hatte anscheinend nicht vor, sich krankschreiben zu lassen und ins warme Bett zu schlüpfen. Er rannte von einem Bildschirm zum anderen, gestikulierte, schickte Luftküsschen oder schaute mit starrem Blick nach vorne, der Ungewissheit entgegen. Seine Haare, für die er letztes Jahr laut seiner Steuererklärung 70 000 Dollar ausgegeben hatte, standen senkrecht nach oben.
»Der amerikanische Präsident kann jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes nicht klein beigeben, er macht weiter wie geplant«, sagten die Kommentatoren lautlos und zeigten, wie Trump vor dem Weißen Haus tanzte. Er winkte nach allen Seiten, grüßte sein Wahlvolk, schüttelte Hände, kniff einem Sicherheitsoffizier in die Wange und schrie die Journalisten an. Der Ton war aus, aber man kannte seine Art und konnte ihn auch ohne Ton sofort verstehen:
»Mir geht es fantastisch!«, japste Trump. »Mir geht es hervorragend! Das Virus und ich, wir können wunderbar zusammenarbeiten. Es fühlt sich großartig an! Ich habe mich noch nie so gesund und fit gefühlt! Und dieses Gefühl möchte ich mit allen Amerikanern teilen, ich stecke euch alle an! Ihr werdet es alle bekommen! Demokraten und Republikaner, Schwarze und Weiße, Frauen und Männer, niemand wird leer ausgehen. Und die Chinesen werden uns für diesen Trip teuer bezahlen, sie werden sich hundert Jahre nur von ihren niesenden Fledermäusen ernähren, dafür sorge ich als Präsident der Vereinigten Staaten! Wählt mich jetzt!«
So ähnlich argumentierte Trump und lief an unserer schweigenden, atemschutzmaskierten Wiesbadener Schlange zur Essensaufgabe vorbei, von Monitor zu Monitor, von Bildschirm zu Bildschirm. Seine ebenfalls infizierte Frau Melania eilte ihm in High Heels und mit einer Packung Taschentücher in der Hand hinterher.
Ich hatte in Wiesbaden das erste Konzert mit meiner Band. Es war eine große Herausforderung, live vor einem Publikum zu singen ohne musikalisches Gehör und ohne Stimme, außerdem vergaß ich laufend den Text. Unsere pandemische Corona-Band »Kaminer & Die Antikörpers« stand zum ersten Mal auf der Bühne, und wir hatten auch nur einmal vor dem Konzert geprobt. Zum Glück waren nicht viele Zuhörer da. Die Veranstalter hatten nur achtzig Karten verkaufen dürfen, und die waren schnell weg gewesen.
»Ihr seid genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen«, sagte der Veranstalter zu uns. »Einen Tag später wäre das Konzert nicht mehr über die Bühne gegangen, denn ab heute ist Berlin Risikogebiet. Wir hätten euch dann nicht mehr beherbergen dürfen.«
Die zweite Welle rollte mit erstaunlicher Wucht über Deutschland und spülte dabei auch einige neue Redewendungen ins Land. Das »Beherbergungsverbot« war zum Unwort des Herbstes geworden. Städte mit mehr als fünfzig Infizierten pro 100 000 Einwohnern in einer Woche wurden zu Risikogebieten erklärt, ihre Einwohner durften sich nirgendwo in Deutschland ein Hotelzimmer nehmen. Wir hatten in Wiesbaden also Glück. Gleich nach dem Frühstück setzten wir uns ins Auto und zogen uns in unser über alles geliebtes Risikogebiet zurück.
Dort verwandelte sich der von den Meteorologen versprochene Dreitageregen in eine Regenwoche. Die Berliner Straßen waren leer, nur ab und zu traf man auf nasse Köter, die ihre Besitzer an Leinen hinter sich herzogen. Die meisten Menschen saßen zu Hause und warteten ab, was kam. Nur Politiker, Länderchefs, Parlamentarier und Virologen trafen sich beinahe jeden Tag und besprachen neue, noch konsequentere Maßnahmen, um den Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Das Virus forderte ständig weitere Opfergaben, und die Menschen wussten langsam nicht mehr so recht, was sie diesem Ungeheuer noch alles in den Rachen schieben sollten. Worauf könnten wir noch verzichten? Alkoholverbot nach 23.00 Uhr, Straßensperren, Restaurantschließungen nach 22.00 Uhr … Die Spätverkaufsläden würden alle draufgehen, wenn sie nach Mitternacht kein Bier mehr verkaufen durften. Der Berliner Bürgermeister wandte sich mit einer gefühlvollen Rede an die Hauptstadtbewohner:
»Wer der Meinung ist, die wichtigste Aufgabe eines Menschen bestehe darin, um drei Uhr nachts auf der Straße oder in einem Spätiladen Bierflaschen zu leeren, in dessen Leben läuft etwas falsch«, sagte der Bürgermeister im Radio. Plötzlich hatte ich unheimlich Lust, auf ein Bier in einen Späti zu gehen. Ich machte mich auf den Weg zu meinem Lieblingsladen, wo der Fußballprofi Mustafa, auch Musa genannt, hinterm Tresen stand. Musa erzählte oft und gerne von seinem früheren Leben. Er will nämlich früher mit Podolski zusammen in der deutschen Nationalmannschaft gespielt haben. Wenn alles gut gegangen wäre, hätte er richtig viel Geld verdienen können, aber das Schicksal war gegen ihn. Nach einem schweren Unfall musste er dem Profifußball den Rücken kehren und hat jetzt einen Späti in Prenzlauer Berg.
Ich persönlich neige dazu, jedem zu glauben, der mir eine tolle Geschichte erzählt. Allerdings kann ich mich nicht dafür verbürgen, dass der Mann die Wahrheit sagt. Ich bin kein großer Fußballfan und kann diese Angaben nicht überprüfen. Zumindest hängen an den Wänden seines Ladens Fotos, die ihn mit Podolski zusammen zeigen, dabei hält unser Mustafa einen Fußball in der Hand. Von meinen Kindern, die hier auch gerne auf ein Bier einkehren, weiß ich, dass sich auch die großen Fußballliebhaber, die bereits in der 8. Klasse alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft als Sticker in ihren Alben hatten, nicht an den Mann erinnern. Doch jetzt als erwachsene Menschen geben sie plötzlich gerne damit an, ihn zu kennen. »Hey, du, Mustafa! Dich kenne ich doch, hast du nicht damals mit Podolski gespielt?«, sagen sie zu dem Späti-Mann und bekommen von ihm dafür immer ein Bier umsonst.
»Wir müssen das Infektionsgeschehen in Deutschland positiv beeinflussen und das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser schützen«, hatte der Bürgermeister gesagt. »Dafür werden wir härtere Maßnahmen ergreifen.«
»Na, bist du gut geschützt?«, fragte ich Mustafa. »Bleibst du auf, oder machst du zu?«
»Ja, sehr gut geschützt!«, nickte er, dann schüttelte er den Kopf und lachte.
Die Politiker gaben sich Mühe, sie wollten uns alle retten. Doch je heftiger man unser Leben schützte, desto belangloser wurde es. In vielen Bundesländern hatten im Oktober die Herbstferien begonnen, und die Eltern dachten, wenn sie schon mit ihren Kindern nicht ins verseuchte Ausland fahren durften, könnten sie zumindest irgendwo in Deutschland einen Kurzurlaub machen. Doch Deutschland entwickelte Risikogebiete wie eine Gürtelrose – jeden Tag kamen neue Stellen dazu. Die Stimmung war wie beim Pferderennen: »Frankfurt holt Berlin ein«, titelten die Zeitungen, »Stuttgart zieht langsam nach«, »Noch eine türkische Hochzeit, und Köln ist im Risikogebiet angekommen«.
Lustigerweise riss meine herbstliche »Rotkäppchen«-Lesetour nicht ab. Ich sprang von einem Ort zum nächsten und schaffte es immer gerade noch, die jeweilige Stadt zu verlassen, bevor sie zum neuen Risikogebiet wurde. Als ich beim Literaturfestival in Essen ankam, wurde ich als verseuchter Risikoberliner von den Einheimischen gehänselt. Am nächsten Morgen überschritt aber Essen ebenfalls die obere Infektionsgrenze. »Willkommen im Risikogebiet!«, gratulierte ich beim Frühstück den Kollegen und machte mich sofort auf den Weg zur nächsten Station. Ich dachte, wenn ich nur von einem Risikogebiet ins nächste reiste und die wenigen risikofreien Gebiete mied, würde ich die bundesweite virologische Situation nicht sonderlich beeinflussen. Ich dachte, irgendwann würden wir alle in einen Stall gebracht, aber solange es lief, würde ich weiterreisen und ernten, was noch da war: ein wenig Applaus, ein Lächeln, ein paar Euros. Noch waren Menschen mutig genug, um Karten für die Veranstaltungen zu kaufen. Erst wenn keiner mehr zu einer Lesung kam, brauchte ich auch nicht weiterzufahren.
Doch das eigentliche Problem mit Lesungen in Risikogebieten war nicht das mangelnde Publikum, sondern umgekehrt die zu große Nachfrage. Kaum stiegen die Infektionszahlen, wurde sofort die Zahl der genehmigten Klubbesucher reduziert. Einmal fuhr ich mit dem letzten Zug um 22.15 Uhr von Leipzig nach Berlin. In den Wagen saßen nur Kollegen: Comedians, Schauspieler, Sängerinnen und Fernsehfuzzis, die alle dienstlich in Leipzig bei irgendwelchen Talkshows als Gäste zu tun gehabt hatten und wegen des Beherbergungsverbots nicht mehr dort übernachten durften. Der Schaffner war begeistert, mit einem solchen Promizug nach Berlin zu fahren. Andere zahlten dickes Geld, um solche Menschen aus der Ferne zu sehen, und er hatte sie alle auf einmal im Bordbistro. Es gab zwar coronabedingt nichts zu trinken und nichts zu essen, dafür bekamen die Promis jede Menge Werbekekse der Deutschen Bahn auf den Tisch geschüttet.
Ein berühmter deutscher Kabarettist erzählte im Zug, er habe bereits vor Corona 2000 Karten für die Kölnarena verkauft. Nun durften aber nur 500 Personen hinein. Er musste die verkauften Karten trotzdem abarbeiten. »Okay«, sagte der Künstler, »wir haben eine Notsituation. Ich tue es zwar nicht gern, aber ausnahmsweise werde ich mein Programm dann eben vier Mal auf die Bühne bringen.« Kaum hatte er das gesagt, bewegten sich die Zahlen erneut nach oben, und es durften ab sofort nur noch 400 Gäste zur selben Zeit in der Arena zusammenkommen. »Ist ja gut«, stimmte der Künstler zu, »wenn ich schon beschlossen habe, vier Mal aufzutreten, kann ich es auch ein fünftes Mal tun.« Ein paar Hochzeiten später durften nur noch 200 Personen rein. Der Kabarettist müsste also zehn Mal hintereinander spielen, um die 2000 verkauften Karten abzuarbeiten. »Leckt mich am Arsch«, sagte der Künstler und kündigte alle seine Events und Auftritte vorsichtshalber bis August des folgenden Jahres.
Mir kann so etwas eigentlich nicht passieren, ich bin mit kleinem Publikum zufrieden, dachte ich und versuchte, mich nach Möglichkeit weniger mit dem Zug und mehr mit dem Auto zu bewegen und mich dabei nicht zu weit von meinem heimischen Risikogebiet zu entfernen. Falls ich keine Übernachtung bekommen konnte, hatte ich dann noch die Option, nachts nach Hause zu fahren. Zur Not konnte ich mich auch nach Nordbrandenburg ins Sommerhaus schleichen. Die Brandenburger standen dank ihrer natürlichen sozialen Distanz von 500 Metern ganz unten auf der Infektionstabelle, gaben sich jedoch als gesetzestreue Bürger manchmal übertrieben ordnungslieb und verpetzten die Besucher aus dem Risikogebiet Berlin an die Polizei.
Überhaupt haben die Deutschen großen Respekt vor dem Gesetz, auch wenn sie damit nicht immer einverstanden sind. Denn Ordnung muss sein. Warum eine Familie mit Kindern im verseuchten Berlin bleiben musste, in einem Wochenendhaus in Brandenburg aber nicht übernachten durfte, das verstand keiner. Doch es wurde penibel auf die Einhaltung des Gesetzes geachtet. Ein Fall in Neuruppin sorgte besonders für Aufsehen. Dort hatte eine Berliner Familie in ihrem Ferienhaus am Waldrand übernachtet, ohne jemanden zu stören. Sie wurde von den Nachbarn entdeckt und der Polizei ausgeliefert. Die Familie wurde des Nichteinhaltens des Beherbergungsverbotes beschuldigt und musste das Ferienhaus verlassen, sobald die Kinder wach wurden.