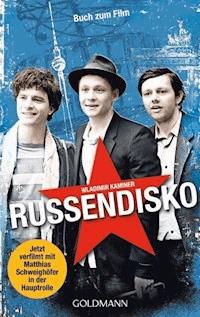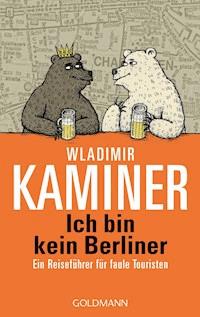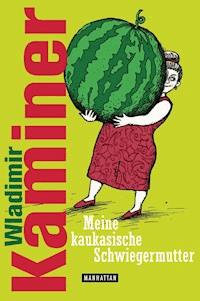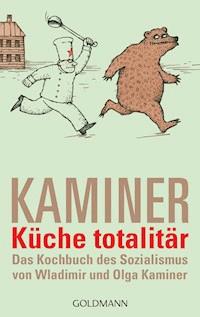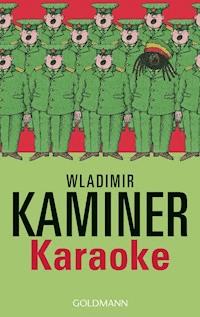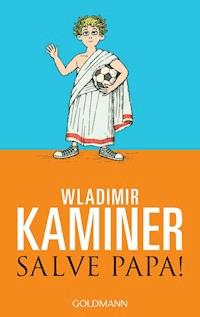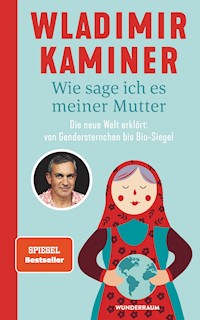16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch des SPIEGEL-Bestsellerautors: Geschichten über die verbindende Kraft des Essens und die Schokoladenseiten unserer Nachbarn.
Kaum jemand ist so neugierig auf seine Nachbarn wie Wladimir Kaminer. Egal ob es um einzelne Menschen oder ganze Länder geht. Und wie könnte man einander besser kennenlernen als beim gemeinsamen Essen? Ist man zu Gast an fremden Tischen, verleibt man sich nicht nur die Kultur der anderen ein, man erfährt auch deren Träume, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen. Auf seinen Reisen durch Europa nascht Wladimir Kaminer von den Tellern Portugals ebenso wie aus den Honigtöpfchen Bulgariens, er trinkt den Wein der Republik Moldau und tunkt den Löffel in die Töpfe Serbiens. Vor allem aber kommt er mit den Menschen ins Gespräch und taucht tief in deren Geschichte und Geschichten ein. Seine Streifzüge zeigen ein Europa, das so vielfältig, bunt und überraschend ist wie seine Speisen.
»Der fabelhafte Schriftsteller Wladimir Kaminer ist das, was manche vermeintliche und selbst ernannte Brückenbauer gerne wären, ein echter Brückenbauer nämlich.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Kaum jemand ist so neugierig auf seine Nachbarn wie Wladimir Kaminer. Egal ob es um einzelne Menschen oder ganze Länder geht. Und wie könnte man einander besser kennenlernen als beim gemeinsamen Essen? Ist man zu Gast an fremden Tischen, verleibt man sich nicht nur die Kultur der anderen ein, man erfährt auch deren Träume, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen. Auf seinen Reisen durch Europa nascht Wladimir Kaminer von den Tellern Portugals ebenso wie aus den Honigtöpfchen Bulgariens, er trinkt den Wein der Republik Moldau und tunkt den Löffel in die Töpfe Serbiens. Vor allem aber kommt er mit den Menschen ins Gespräch und taucht tief in deren Geschichte und Geschichten ein. Seine Streifzüge zeigen ein Europa, das so vielfältig, bunt und überraschend ist wie seine Speisen …
Autor
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalveröffentlichung August 2024
Copyright © 2024 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München unter Verwendung eines Autorenfotos von Dominik Butzmann
AB · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30802-5V001
www.wunderraum-verlag.de
Inhalt
Was uns verbindet: Kohl und Pinkel, Bier und Schnaps
Im Weinkeller des idealen moldawischen Bauern
Tomaten im Honigparadies
Belgrader Mesenterki
Georgiens flüssige Küche
Trinkspruch »Der traurige Frosch«
Trinkspruch auf die richtige Frau
Trinkspruch über die richtigen Freunde
Trinkspruch über das Haus meiner Träume
Trinkspruch über die Jugend
Schweizer Aromat
Tote Oma und Löwenzahn
Meerkohl in Marinade
Portugiesische Fischsuppe
Isländische Schweineohren
Omas Vergossenes
Prager Wodka-Sandwich
Im Ofen gebackener Zackenbarsch
Die besten Mici der Stadt
Tiramisu im alten Rom
Was uns verbindet: Kohl und Pinkel, Bier und Schnaps
Wir beschimpfen uns gegenseitig als Egoistenbande, dabei beschuldigt jeder den anderen, er würde nur an sich denken und dadurch unseren Planeten zugrunde richten. Angeblich halten neunzig Prozent aller Menschen neunzig Prozent aller Menschen für gefühllose Egoisten. Das geht mathematisch nicht auf, ist aber als Überzeugung stark verbreitet. Die Menschen wollen einerseits so wenig wie möglich miteinander zu tun haben, meiden große Versammlungen, fahren nicht gern in einer überfüllten Straßenbahn, bestellen ihre Einkäufe online, schauen sich zu Hause Filme an, um nicht ins Kino gehen zu müssen, und treiben allein vor dem Bildschirm Yoga, statt mit Freunden Fußball zu spielen. Sie holen sich eine Yogamatte ins Zimmer und machen den »herabschauenden Hund«, wobei sie zwischen ihren eigenen Beinen durchblinzeln. Würde ein echter Hund so etwas tun, würde er höchstwahrscheinlich einen anderen Hund hinter sich sehen. Doch auf der kleinen Yogamatte zu Hause gibt es nur für einen Hund Platz – dich selbst.
Kinder bekommen bereits in zartem Alter beigebracht, dass sie nicht mit Fremden reden sollen, sondern nur mit Bekannten und Verwandten. Obwohl Bekannte und Verwandte immer dasselbe erzählen und auf Dauer nicht zu ertragen sind. Viel spannender wäre es für Kinder, mit Fremden zu reden, denn was die sagen, weiß man vorher nicht. Vielleicht sagen die Fremden etwas Gescheites. Kinder, die nie mit Fremden geredet haben, entwickeln später eine Soziophobie. Daher können viele Menschen auch als Erwachsene nicht mit Fremden kommunizieren. Stattdessen reden die einen bevorzugt mit sich selbst, die anderen nur mit einer künstlichen Intelligenz. Die natürliche ist ihnen zu blöd, sie trauen nur den Algorithmen.
Andererseits laufen wir Menschen permanent in Herden mit. Wir machen jede Straßenbahn voll, stehen einander bei Konzerten und Festivals auf den Füßen, verkleiden uns an Karneval als Kaninchen und wackeln selbstlos bei CSD-Paraden synchron mit dem Hintern. Wir brauchen die anderen, um Quatsch zu machen, niemand will allein auf der Straße mit dem Hintern wackeln. Wie funktioniert diese Mischung aus Selbstlosigkeit und Selbstbezogenheit? Gibt es einen Ausgang aus dieser Egoismus-Sackgasse, und sind nicht alle Lebewesen eigentlich solidarische Egoisten? Was ist mit den Waschbären, was ist mit den Tauben?
Amseln sind zum Beispiel viel größere Egoisten als wir. Ich weiß, wovon ich rede, ich beobachte sie nämlich seit drei Jahren, in denen sie regelmäßig im Aschenbecher auf meinem Balkon in Berlin brüten. Selbst ihre eigenen Kinder erfahren Elternliebe nur in geringem Maß. Die Betreuung des Nachwuchses geht ruckzuck: Zwei Wochen auf dem Ei sitzen, dann ein bis zwei Wochen feste Kindernahrung im Nest verabreichen und dann tschüss auf Nimmerwiedersehen: Die kleinen Amseln werden einfach von ihren Eltern aus dem Nest geschubst. Innerhalb kürzester Zeit müssen sie selbstständig fliegen lernen, andernfalls werden sie bei uns auf dem Hof von der Nachbarskatze Sandra aufgefangen und sofort als Speise in die natürliche Nahrungskette eingebunden.
Die meisten Amseln bestehen die harte Prüfung. Sie werden quasi im Flug erwachsen und kreisen fröhlich in dreißig Metern Höhe über den Dächern, kacken auf Sandra, auf den Hof und auf meinen Balkon, der einst ihr Kinderheim war, ihre vertraute Heimat, ihr Nest. Ihren Eltern gegenüber zeigen sie keine Gefühle. Sie erkennen sie nicht einmal, wenn sie neben ihnen auf dem Baum sitzen. Den Eltern sind sie ebenfalls völlig egal.
Wir Menschen hingegen schreiben dicke Wälzer über die richtige Erziehung, die mit den ersten Bewegungen des Kindes im Bauch der Mutter beginnen soll. Ich habe vor einiger Zeit in einem Ratgeber über glückliche Schwangerschaft gelesen, die mentale Verbindung mit dem Kind sei besonders wichtig. »Wissen Sie, wann Sie die ersten Bewegungen Ihres Kindes gespürt haben?«, fragte die Autorin ihre Leser. Ich wusste es sehr wohl. Ich habe die erste Bewegung meines Kindes gespürt, als es mit 24 Jahren endlich aus der elterlichen Wohnung auszog und sich ein Zimmer mietete. Davor haben wir uns alles geteilt und einander prima verstanden.
Im Vergleich zu Amseln sind wir Menschen vorbildliche soziale Wesen. Das liegt daran, dass wir alle unfertig auf die Welt kommen. Man darf uns nicht einfach so vom Balkon schubsen. Wir können uns jahrelang nicht selbstständig bewegen, krabbeln nur herum, werden von den Älteren hin und her getragen, in den Urlaub mitgeschleppt, an- und ausgezogen und im Kinderwagen herumgefahren. Der Dauer unserer Kindheit sind keine natürlichen Grenzen gesetzt. Oft sehe ich Nachwuchs, der kaum noch in den Kinderwagen passt und trotzdem weiterhin gefahren wird. Möglicherweise ist das Kind darin eingeklemmt, und die Eltern bekommen es mit bloßen Händen nicht mehr heraus, beschweren sich aber auch nicht darüber. Sie nehmen ihren Kinderwagen mit zum Joggen ins Stadion, zum Einkaufen oder ins Café und fahren damit bis an die Ostsee. Diese Kinderwagen sind auch größer und bequemer als früher, und sie halten länger. Manchmal dauert es eben dreißig Jahre, bis die sogenannten »Kinder« auf eigenen Beinen stehen, wie man so schön auf Deutsch sagt.
Hätte das jemand meinen Amseln erzählt, wären sie vor Lachen vom Balkon gefallen. Zumindest wissen unsere Kinder die Großzügigkeit ihrer Eltern zu schätzen. Neugeborene erkennen als Erstes die Gesichter anderer Menschen. Sie wissen auch um ihre Abhängigkeit für die nächsten dreißig Jahre und lassen sich mit ihrer Entwicklung Zeit. Wenn es sein muss, verstellen sie sich sogar und benehmen sich extra niedlich. Sie produzieren komische Geräusche, lutschen an ihren Fingern und lächeln die Erwachsenen an, um ihnen zu gefallen, damit sie gefüttert werden.
Sie wissen aber auch, dass diese Verstellung auf Dauer nicht funktioniert, und ändern daher alle fünf bis zehn Jahre ihre Anpassungsstrategien, um nicht geschubst zu werden. Sie kündigen an, sie wollten Künstler werden oder zuerst einmal die Welt kennenlernen. Gleichzeitig suchen sie nach einer Alternative zum elterlichen Haushalt, nach passender Gesellschaft, einem Kollektiv, das sie weitertragen könnte. Denn nur gemeinsam können wir uns entfalten, in der Einsamkeit verdorren und degradieren wir. Wir sind Weltmeister darin, Solidarität mit Fremden zu entwickeln, nach gemeinsamen Interessen zu suchen und eine Zukunft mit anderen zusammen zu gestalten. Darin sehe ich ein Paradox. Entstehung und Fortentwicklung des Menschen erfolgen in zwei Prozessen, die sich gegenseitig ausschließen: Abgrenzung und Zusammenkunft. Letzteres ist anstrengend. Wir beherrschen es wunderbar, einander aus dem Weg zu gehen. Viel schwieriger wird es, eine Zusammenkunft zu organisieren. Denn auch in der Menge, bei einem Konzert, einer Party, in der Straßenbahn, nackt im Liebesbett oder im Kaninchenkostüm während des Karnevals fühlen sich die Menschen oft allein. Physische Nähe gibt uns nicht immer das Gefühl, am gleichen Strang mit anderen zu ziehen.
Aus meiner Sicht eignet sich nur eine Situation perfekt für eine Zusammenkunft: eine gemeinsame Mahlzeit. Denn egal wie die Umstände unseres Lebens sind, ob wir gut oder schlecht drauf sind, in Deutschland oder in Guatemala leben, jung oder alt sind, links oder rechts, an Gott oder an den Urknall glauben, wir alle haben eines gemeinsam: Wir essen. Wir tun es jeden Tag, manche von uns sogar mehrmals am Tag. Morgens, nachmittags und abends lassen wir es uns schmecken und das gern in Gesellschaft. Egal wo ich hinfahre, überall sehe ich Menschen zusammen an einem Tisch sitzen und auf die Teller der Nachbarn schauen. Betrachtet man die Bilder einer beliebigen Gemäldegalerie in Europa oder besucht eine Ausstellung, egal aus welchem Jahrhundert, sieht man sie überall: große gedeckte Tische und Menschen, die an diesen Tischen zusammensitzen, essen und trinken.
Auch die christliche Kultur ist ohne Abendmahl nicht zu denken. An seinem letzten Abend vor der Kreuzigung entschied sich Jesus bekannterweise für ein letztes Geschäftsessen mit Freunden und Kollegen. Diese dreizehn Mann bei Tisch sind das berühmteste Bildmotiv des Abendlandes, ein Essen, das auf unzähligen Gemälden verewigt wurde. Heute fotografieren die Menschen ihr Essen so lustvoll, als wäre es ihr letztes, und teilen diese Bilder tausendfach in sozialen Netzwerken mit jenen Fremden, mit denen sie als Kinder nicht sprechen durften. Angeblich gibt es in der digitalen Welt zehn Mal mehr Bilder von Essen als von den Menschen selbst. Sollten Außerirdische irgendwann in ferner Zukunft anhand unserer digitalen Hinterlassenschaften unsere Zivilisation kennenlernen, werden sie denken, der Planet sei in erster Linie von Spiegeleiern und belegten Brötchen bewohnt gewesen.
Beim Essen lassen wir gerne alle Hemmungen fallen und kommen leichter mit Fremden ins Gespräch, beim Trinken führen wir vertrauliche Unterhaltungen. Mit Messer und Gabel in der Hand oder auch mit Stäbchen lernen wir, uns selbst zu offenbaren und den anderen zuzuhören. Als Buchautor, Geschichtenerzähler und Filmemacher bin ich in etlichen Ländern unseres Kontinents mit Fremden essen gegangen. Ich habe für das deutsche Kulturfernsehen Filme über die Frage gedreht, was die Menschen wo essen und warum. Dabei spielte die Qualität des Essens eine untergeordnete Rolle. Ich wollte vor allem die Menschen verstehen, die Länder kosten, mit fremden Kulturen ins Gespräch kommen. Am besten klappte das, wenn die Gastgeber einem etwas servieren, das ihnen selbst besonders wertvoll erscheint, was ihnen schmeckt. Die Frage, ob es dem Gast auch schmeckt, ist dabei nebensächlich. Das Geheimnis eines gelungenen Essens ist einfach: Man muss den Koch loben, nicht wählerisch sein und keine übertriebenen Erwartungen haben.
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Esser weiß ich, dass die Menschen gern wählerisch tun und sich als Gourmets aufspielen. Die einen stehen auf exotische Speisen, den anderen schmecken nur die Buletten ihrer Oma, doch in Wahrheit essen sie alles. Wenn sie auf etwas Unbekanntes stoßen, schauen sie als Erstes, ob es schmeckt. Und was sie nicht zerkauen, das schlucken sie einfach hinunter wie eine Auster. Sie wollen in der Küche etwas Neues erfinden, gleichzeitig das Alte bewahren und mit ihrem Essen angeben. Die Gastronomie ist noch anfälliger für Modeerscheinungen als die Bekleidungsbranche. Mal werden Insekten als gesunde Lebensmittel zugelassen, mal suchen junge Köche nach dem perfekten Fleischersatz aus Sojagranulat. Ganz besonders liebenswürdige Kassler-Kandidaten werden im Süden nach neuester Mode vor dem Schlachten heftig gestreichelt, während ich im Norden Brandenburgs beinahe ständig über freilaufende Bioprodukte wie Enten, Gänse und Chickenwings stolpere. Gleichzeitig mangelt es in Deutschland nicht an exotischen Experimenten dekadenter Küchenchefs. In noblen Restaurants sind gepökelte Nachtigallenzungen und Rogensalate vom Fliegenden Fisch keine Überraschung mehr. Doch eigentlich ist die volkstümliche deutsche Küche recht übersichtlich. Sie steht seit eh und je auf zwei stabilen Säulen: Wurst und Bier. Und daran ist nicht zu rütteln.
Bier wird überall in Deutschland gebraut, und trotz des Reinheitsgebots gibt es hier mehr als fünftausend Sorten. Gerade im Süden, in dem bekannten Königreich, dessen Flagge auf etlichen Bierflaschen zu sehen ist, habe ich mich schon oft im Biersortenwald verlaufen und die Orientierung verloren. Wer kann schon den Unterschied zwischen einem Weißbier, das gar nicht weiß ist, und trübem Weizenbier nachvollziehen? Und was die Wurst betrifft: Die wird in Deutschland wirklich in jeder Stadt neu erfunden und anders gemacht – kurz und lang, dick und dünn, mit und ohne Darm. Doch die Art, wie die Menschen ihr Bier trinken und ihre Würste essen, ist höchst unterschiedlich.
Die Bayern haben bekanntlich den Biergarten erfunden, einen Treffpunkt des Volkes. Während in einem japanischen Garten Steine zum Wachsen ausgelegt und in einem französischen Kanten und Ecken gepflegt werden, stehen in einem bayerischen Biergarten Bierkrüge auf den Tischen. Es wird im Freien wild und laut, aber stets in Maßen gegossen und genossen, eine Mass pro halbe Stunde. Schon als junger Mann hatte ich mich gewundert, wie es die Bayern schafften, so viel Flüssigkeit so schnell zu vertilgen. Sie werden offenbar mit dieser Gabe geboren. Doch wie jede Gabe bedarf auch diese ständigen Trainings, deswegen sind die Biergärten mit angeschlossenen Bierkellern hier ganzjährig geöffnet, und die Einheimischen trainieren bereits beim Frühstück, indem sie mit einem Quartel oder einem Spruz in den Tag starten.
Ganz anders im Norden. Dort gehen die Menschen wetterbedingt in die Kantine. Zuerst laufen sie bis zur völligen Erschöpfung mit einem Bollerwagen, der mit Schnäpsen vollgeladen ist, durch die Kohlfelder, egal ob es regnet oder schneit, um dann in der warmen Kantine schnell den gewünschten Zustand der absoluten Entspannung zu erreichen. Jeder Fremde wird hier zum Freund, und aus der Tischnachbarschaft entsteht die Seelenverwandtschaft.
Ich bin selbst einmal mehreren Gruppen im Kreis Oldenburg nachgelaufen und war überrascht von der Trinkfestigkeit und Ausdauer des Nordens. Die Menschen kreisten die ganze Zeit um die Gaststätte, ihre Lieblingskantine, herum, wobei man alle dreißig Meter stehen blieb und einen Kurzen trank, bevor man weiterging. Auf diese Weise tranken sich die Bewohner aus dem Kreis Oldenburg Lust und Appetit an. Man hätte sie nach diesem Spaziergang mit rohen Haferflocken füttern können, dachte ich, sie wären für jede Speise dankbar gewesen. Doch in Wahrheit wartete ihre berühmte heimatliche Delikatesse auf sie: Grünkohl mit Pinkel. Nach dem langen Aufenthalt an der kalten Luft, von Schnäpsen und Aquavit begleitet, stürzten die Menschen in die warme Kantine und wurden prompt betrunken.
Ich glaube, viele von ihnen hätten ihren Grünkohl mit Pinkel in nüchternem Zustand gar nicht gegessen. Es wurden sowieso nur diejenigen zu Tisch gebeten, die mit leerem Wagen vom Feld zurückgekommen waren, verriet mir der Koch, der sich große Mühe gab, etwa sechzig Kilo leicht gefrorenen Grünkohl nach alter Tradition bis auf die letzten Vitamine zu verkochen, um ihn besser verdaulich zu machen. Es waren an diesem Abend 250 Gäste erwartet worden, und in der Tat füllte sich die Kantine schnell. Nur einige wenige hatten es nicht geschafft, sie waren mit ihrem Bollerwagen auf der Landstraße stehen geblieben. Dafür bekamen diejenigen, die zuerst eintrafen, die größeren Portionen.
Der verkochte dunkle Grünkohl hatte erstaunliche Ähnlichkeit mit der Mooslandschaft Islands im Frühling, nur dass Würste statt Steine auf dem Teller lagen. Unter anderem die berühmte Spezialität, die fette Pinkelwurst, die ihr Fett in diesem Island auspinkelte – daher auch der Name. Alle fanden die Speise besonders gelungen, ich wusste jedoch nicht, wie sie ungelungen schmecken würde, und schwieg höflich.
Der Koch versuchte mehrmals, mir das Geheimnis des Erfolgs zu erklären. Da ich aber vorher schon mit mehreren Kohl- und Pinkelgruppen einen oder zwei Schnäpse auf ex getrunken hatte, konnte ich mich schwer auf die Erläuterungen konzentrieren. Der Grünkohl, so erklärte der Koch, dürfe nicht zu schlotzig oder nicht zu scholzig sein, sondern genau schlotzig-scholzig genug, eben nach dem Geheimrezept der Gaststätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was schlotzig bedeutete, ich war mir auch nicht sicher, wie das Wort wirklich hieß, vielleicht hatte der Koch auch »schnolzig« gesagt, aber ich nickte für alle Fälle verständnisvoll. Und wie sie am Ende alle getanzt und eine Grünkohlkönigin gekürt haben! Die Königin verlor später auf dem Weg zur Toilette ihre Krone. Wir haben alle zusammen nach ihr gesucht, danach haben wir dann die Königin gesucht, die in einer Ecke eingeschlafen war. Mit einem Wort, der Abend und alle Gäste einzeln waren insgesamt schon sehr schlotzig. Oder scholzig. Oder schnolzig.
Im Weinkeller des idealen moldawischen Bauern
Die Häuser in der Altstadt von Kischinau waren aus alten porösen Steinen gebaut mit leicht rosigem Anstrich. Sie sahen aus wie angebratene Schaumzuckersteine, die jeden Moment in der Sonne dahinschmelzen und sich wie Puderzucker zerstreuen konnten. Ich war in die Republik Moldau zu einer Deutschlehrertagung eingeladen und bekam von den Gastgebern eine gediegene Stadtführung bei knalligem Sonnenschein organisiert.
»Früher war hier ein Meer«, erzählte mir meine moldawische Begleiterin, die Deutschlehrerin Natali. Das große sarmatische Meer hatte sich einst über die gesamte sarmatische Tiefebene von Wien bis Kiew ausgebreitet. Doch vor elf Millionen Jahren verschwand das Wasser plötzlich infolge eines sarmatischen Aussterbeereignisses, und alle Meeresbewohner mussten sich anpassen, also eine neue Existenzgrundlage unter veränderten Lebensbedingungen finden. Die Muscheln pressten sich damals also in den Sand und wurden zu Steinen. Sie bildeten als Muschelgestein das perfekte Baumaterial, aus dem später die Stadt Kischinau errichtet wurde. Die Meeresalgen wiederum verwandelten sich in Weinreben, denn nichts gedeiht auf diesem trockenen Boden besser als Wein. Und die Fische des verschwundenen Meeres haben sich wahrscheinlich in Moldawier verwandelt, dachte ich. Die seltenen Fußgänger hatten tatsächlich runde fischige Augen und bewegten sich langsam und entspannt mit halb geöffnetem Mund wie Fische im Aquarium, was allerdings der Hitze geschuldet war. Die Sonne knallte gnadenlos auf den ausgetrockneten Boden des längst verschwundenen Meeres, aber die Geschichte war so plausibel wie logisch: Die ehemaligen Fische hatten sich Häuser aus Muschelgestein gebaut, pflegten ihre Weinreben und gründeten letztlich die Republik Moldau mit der Hauptstadt Kischinau.
Durch den Abbau des Muschelgesteins waren unter der Republik zahllose Tunnel entstanden, die sich perfekt zur Weinlagerung eigneten. Diese unterirdischen Weintunnel, der längste angeblich 200 Kilometer lang, wurden in Reiseführern als größte Sehenswürdigkeit der Republik gepriesen: Man könne sogar mit dem Auto hineinfahren und eine spritzige Tour durch alle Jahrgänge machen, man bräuchte nur einen Fahrer mit moldawischem Führerschein. Sogar unterirdische Übernachtungen seien möglich.
Ich konnte mir gut vorstellen, dass eine solche Touristenattraktion in Westeuropa auf Interesse stoßen würde: »Kreuzfahrten waren gestern – genießen Sie zwei Monate in den Weintunneln der Republik Moldau inklusive anschließender Alkoholentgiftung«, so stellte ich mir den passenden Werbeslogan vor. Doch die Touristen mieden das Land. Es galt offiziell als das unbeliebteste Reiseziel Europas und wurde im Internet als »armes osteuropäisches Land ohne Zugang zum Meer« beschrieben, eingeklemmt zwischen der Ukraine und Rumänien.
»Pro Jahr besuchen weniger Menschen die Republik Moldau als das kleine Liechtenstein, obwohl ganz Liechtenstein in einen moldawischen Weinkeller passen würde«, erzählte mir der Kellner Grigorij bei einer Rieslingverkostung im Fischrestaurant Schwarzes Meer. Ich hatte nämlich schnell keine Lust mehr auf Stadtführungen und unterirdische Tunnel, zumal es in Moldau auch oberirdisch reichlich guten Wein gab. Das Restaurant Schwarzes Meer war selbst erst vor Kurzem ans sarmatische Meer gezogen mit all seinen Fischen, Köchen und Kellnern, die vor dem Krieg aus Odessa geflüchtet waren. Der Krieg war hier nicht weit, zwei Stunden Autofahrt von Odessa entfernt, und die berühmte ukrainische Stadt am Schwarzen Meer wurde regelmäßig mit russischen Raketen beschossen. Meine Mutter in Berlin hatte sich große Sorgen gemacht, als sie erfuhr, wo ich hinfuhr.
»Wie bitte? Du fliegst nach Moldawien? Dort in der Nähe ist Krieg, das ist gefährlich! Niemand fliegt jetzt nach Moldawien, du wirst bestimmt allein im Flugzeug sitzen.«
Ich wollte diese Reise aber unbedingt machen. Das ganze Jahr zuvor hatten wir im Schatten des Krieges und der Angst verbracht. Der Schatten war größer als der Krieg. Ein Hotelbesitzer in Kreuzberg hatte mir erzählt, dass eine Gruppe amerikanischer Touristen ihren Ausflug nach Berlin und das Hotel gecancelt hatte, weil die deutsche Hauptstadt für sie zu nahe an der Front zu liegen schien.
Ich hatte große Mühe, einen Flug nach Kischinau zu finden. Nur wenige Fluggesellschaften flogen die Republik Moldawien an. Die moldawischen waren aus Korruptionsgründen chronisch pleite und hatten kein Geld für Sprit, und die ausländischen Gesellschaften hatten Angst vor dem Krieg. Die einzige Fluggesellschaft, die mutig und direkt von Berlin nach Kischinau flog, hieß FlyOne, was ich mit »Flieg allein« übersetzte. Ich kannte die Gesellschaft »Flieg allein« nicht und recherchierte im Netz. Laut Wikipedia bestand die Flotte von FlyOne aus einer Maschine. Das passt alles gut zusammen, dachte ich. Wahrscheinlich hat Mama recht, ich werde der einzige Passagier sein. Doch die Maschine war ausgebucht. Links und rechts von mir saßen junge Damen, die in Familienangelegenheiten nach Kischinau flogen. Eine wollte zum Begräbnis ihres Vaters, eine andere flog zum Hochzeitstag ihrer Eltern. Die Crew stammte aus Jordanien, die Stewardessen trugen Kopftücher, die Notausgänge waren arabisch beschriftet.
Kaum in Moldawien angekommen, wurde ich von einem längst vergessenen Gefühl erfasst, einem Gefühl der Nostalgie, der Sehnsucht nach früheren Zeiten, ich roch nämlich buchstäblich überall meine alte Heimat. Kein Wunder: Früher hatte das ganze Gebiet zum kommunistischen Imperium gehört, zur Sowjetunion, dem größten Land der Welt. Auf der eurasischen Platte hatte sie sich von Brest bis nach Kamtschatka über ein Sechstel der Erde ausgebreitet. Vor mehr als dreißig Jahren verschwand die Sowjetunion dann plötzlich infolge des kommunistischen Aussterbeereignisses. Alle Sowjetbewohner mussten sich daraufhin an neue Lebensweisen anpassen und eine neue Existenzgrundlage unter veränderten Lebensbedingungen finden.
In der Sowjetunion war die Moldawische Sozialistische Sowjetrepublik hauptsächlich für die Produktion von Tomaten, Erdbeeren und billigem Portwein zuständig gewesen. Die russischen Imperialisten hatten einen eigenartigen Weingeschmack, sie mochten knallige Weine, die viel Zucker und viel Alkohol beinhalteten und einen ausgewachsenen Kommunisten in wenigen Minuten zum Umkippen bringen konnten. Die Moldawier selbst bevorzugten eigentlich von jeher die feinen leichten Hausweine, hatten allerdings Angst vor den Russen und trauten sich daher nicht, das laut auszusprechen. So erklärten es mir zumindest die moldawischen Deutschlehrerinnen.
Zu Sowjetzeiten hatten hier alle Moldawisch, Russisch und eine weitere Fremdsprache in der Schule gelernt. Erst nach Auflösung der Sowjetunion und dem Fall des Eisernen Vorgangs stellten sie fest, dass sie die ganze Zeit Rumänisch miteinander gesprochen hatten. Heute halten sich alle Moldawier ohne Ausnahmen für bilingual. Selbst wenn sie Russisch vergessen und nie eine Fremdsprache gelernt haben, können sie noch immer Moldawisch und Rumänisch, was ihnen einen Grund gibt, stolz auf die eigene Sprachleistung zu sein. Die Tatsache, dass es sich bei beidem um dieselbe Sprache handelt, wird ausgeblendet.