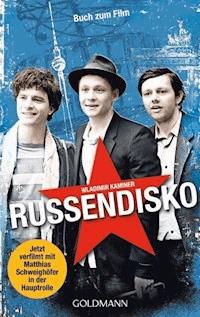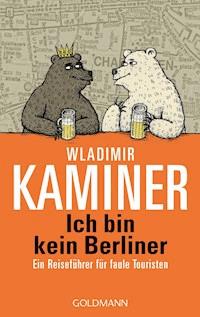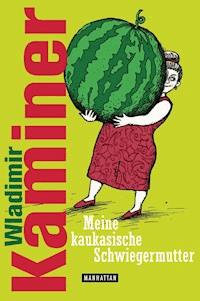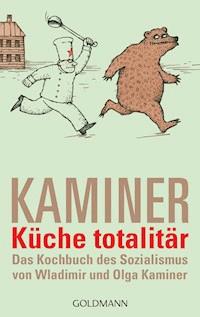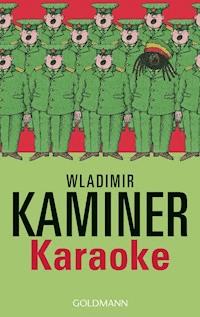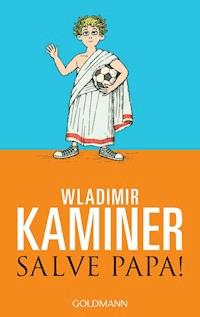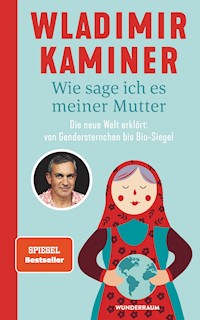
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neue Familiengeschichten des großen SPIEGEL-Bestsellerautors
Wladimir Kaminers Mutter versteht die Welt nicht mehr. Ihre Enkel ziehen vegane Rühreier einer ordentlichen Bulette vor, den früher so geliebten Zoo wollen sie als Ort der Tierquälerei abschaffen, und sogar Omas umweltfreundliche elektrische Fliegenklatsche wird kritisiert. Lange ersehnte Flugreisen gelten plötzlich als böse, und selbst das Internet-Rezept für Gurkensalat hat seine Unschuld verloren. Zeigt es doch, dass ein hinterhältiger Algorithmus steuert, welche Informationen man bekommt. Im Fall von Wladimir Kaminers Mutter sind das eher Kochtipps als Aufrufe zum Klimastreik. Und so leben Oma und Enkel zunehmend auf verschiedenen Planeten. Wladimir Kaminer gibt sein Bestes, seiner Mutter diese neue Welt zu erklären und mit Humor und wechselseitigem Verständnis zwischen den Generationen zu vermitteln - von Biofleisch bis Gendersternchen.
»Der fabelhafte Schriftsteller Wladimir Kaminer ist das, was manche vermeintliche und selbst ernannte Brückenbauer gerne wären, ein echter Brückenbauer nämlich.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Wladimir Kaminers Mutter versteht die Welt nicht mehr. Ihre Enkel ziehen vegane Rühreier einer ordentlichen Bulette vor, den einst geliebten Zoo wollen sie als Ort der Tierquälerei abschaffen, und lange ersehnte Flugreisen gelten plötzlich als böse. Selbst das Internet-Rezept für Gurkensalat hat seine Unschuld verloren. Zeigt es doch, dass ein hinterhältiger Algorithmus steuert, welche Informationen man bekommt. Im Fall von Wladimir Kaminers Mutter sind das eher Kochtipps als Aufrufe zum Klimastreik. Und so leben Oma und Enkel zunehmend auf verschiedenen Planeten. Wladimir Kaminer gibt sein Bestes, seiner Mutter diese neue Welt zu erklären und mit Humor und wechselseitigem Verständnis zwischen den Generationen zu vermitteln – von Biofleisch bis Gendersternchen …
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wunderraum-Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Originalveröffentlichung September 2022
Copyright © 2022 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Konzeption: buxdesign | München
Coverillustration: Ruth Botzenhardt,
www.rubo-illustration.de
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29558-5V001
www.wunderraum-verlag.de
Inhalt
Ökologische Gerechtigkeit auf dem Raucherbalkon
Das Bankett wird verschoben
Unser Kandidat
Scheitern genießen
Das Problem mit der Einsamkeit
Die Gurkensalate der Apokalypse
Die Welt von morgen schon heute
Zum 3. Oktober
Wanderlust
Mama, wir gehen
Im früheren Leben
Im Gendernebel
Vom Kosmos geküsst
Schöne neue Welt
Tanzlustbarkeiten am Ende der Klarheit
Pelmeni
Zeitfensterputzen vor dem Späti
Am letzten Tag des Jahres
Das Jahr des Tigers im Zeichen des Frosches
Der Krieg am Mittwoch
Der schiefe Reiter
Ökologische Gerechtigkeit auf dem Raucherbalkon
Der Sommer war sehr heiß geraten. Bei diesen Temperaturen verwandelte sich die Biomülltonne in unserem Hinterhof in eine Fruchtfliegenproduktionsstätte, und die lästigen Tierchen flogen, ohne um Erlaubnis zu fragen, zu Hunderten durch die geöffnete Balkontür in unsere Küche: Vorderhaus erster Stock, Küchenbalkon zum Hof raus. »Willkommen seist du, neues freches Leben«, dachte die Katze meiner Mutter. Sie freute sich erst über die Ankömmlinge und ging auf die Jagd nach ihnen, machte dann aber schon nach einer Viertelstunde schlapp. Die Katze fühlte sich überfordert. Sie war nicht mehr die Jüngste und obendrein von der Hitze etwas faul und langsam geworden. Bis sie eine Fliege gefangen hatte, waren schon drei Dutzend neue im Anflug. Also kaufte Mama im Pfennigland eine elektrische Insektenklatsche namens Olympia für 4,99 und zog damit sofort den Zorn der Enkelkinder auf sich. Das Verhalten der Oma verstoße gegen die Grundsätze der ökologischen Gerechtigkeit, behaupteten sie.
Meine Mutter wunderte sich sehr darüber, dass man Fliegen nicht elektrisch töten durfte. Gefühlt stand sie doch perfekt im Einklang mit dem Zeitgeist: Man kochte inzwischen elektrisch, fuhr elektrisch Fahrrad, warum also sollte man nicht auch Fliegen elektrisch erledigen und die lästigen Biofliegen aus der Biotonne mit einer Bioklatsche verfolgen? »Alles bio oder was?«, fragte Mama nach.
Ich hatte Schwierigkeiten, es ihr zu erklären. Natürlich war dieses überentwickelte Umweltbewusstsein der jungen Generation eine Folge der Pandemie. Wir Menschen trugen als Umweltzerstörer die Schuld für die Verbreitung der tödlichen Viren, für Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzewellen. Wir hatten alles versaut und wurden nun dafür bestraft. Wir durften keine dicken Autos mehr fahren, kein billiges Fleisch mehr essen, und statt des Sandmännchens summte jeden Abend Karl Lauterbach im Fernsehen. »Egal, was wir tun«, erzählte uns der Miesepeter Karl, »die nächsten achtzig Jahre sind für den Arsch.«
Die Schuldgefühle der Natur gegenüber und die Angst, noch mehr kaputt zu machen, traf alle Altersgruppen außer der leichtsinnigen Generation achtzig plus, die einfach unbeschwert weiter vor sich hinlebte. Sie wusste, wie schnell achtzig Jahre vorbeiflutschten, und lehnte die Aufforderung ab, den Planeten zu retten. Das hieße ja, nicht mehr zu reisen und nicht mehr zu grillen, nur damit in achtzig Jahren die überfluteten Niederlande wieder trocken gepumpt werden konnten. »Who the fuck is Niederlande?«, dachten die Älteren insgeheim.
Die Jüngeren nahmen sich das Umweltproblem jedoch sehr zu Herzen. Sie waren schwer damit beschäftigt, nur durch die Nase zu atmen, um weniger CO2 auszustoßen, der Müll wurde sorgfältiger denn je getrennt, und »Kurzstreckenflug« war zu einem Schimpfwort geworden. Meine Kinder suchten in ihrer Umgebung ständig nach Umweltsündern, fanden aber niemanden außer ihrer Oma, die ständig vergaß, ihre Klimaanlage auszuschalten. Sie solle den Ventilator nicht den ganzen Tag laufen und die Biofliegen in Ruhe lassen, meinten die Kinder.
Das ältere Enkelkind hatte außerdem aus der Uni das Konzept der ökologischen Gerechtigkeit mit nach Hause gebracht. Es hatte ein dickes Buch zu dem Thema gelesen, möglicherweise sogar zwei, und fing bald an, danach zu predigen: Der Mensch verhalte sich widernatürlich, sagte das Kind: »Wir müssen eine ökologisch gerechte Welt schaffen!« Wir. Bei uns in der Wohnung. Im ersten Stock und bei dreißig Grad im Schatten, mit Balkon zum Hinterhof und tausend Biofliegen im Anmarsch.
Die ökologisch gerechte Welt drückte uns schwer auf den Magen. Sie sah vor, dass alle dasselbe Recht auf Leben hatten, egal ob Käfer, Fliegen oder Menschen. Wir mussten allen Wesen ihren ganz eigenen Wert einräumen, ohne jeglichen Nutzungsanspruch. Nur dann konnten wir zu Tieren und Pflanzen jene korrekte soziale Beziehung entwickeln, die uns selbst wieder in die Natur eingliederte und zu einer friedlichen Symbiose mit der Außenwelt finden ließ, klärte uns das Kind auf. Wir nickten schweigend und schauten den Biofliegen zu, wie sie uns von unserem Balkon zu verdrängen versuchten. À la guerre comme à la guerre, wie die Franzosen sagen.
Eigentlich hatte die Naturinvasion schon mit den Viren begonnen. Zuerst drängten sie die Menschen von der Straße. Und während wir isoliert und unter Hausarrest von der Welt ausgeschlossen waren, eroberte sich die Natur Stück für Stück unsere mit viel Liebe und Mühe aufgebauten Großstädte zurück und nahm sie in Besitz. Füchse liefen bei Rot über die Kreuzung, ohne Angst, überfahren zu werden. Krähen und Tauben enteigneten die Klappstühle der geschlossenen Außengastronomie und schissen sie voll, und bei vielen Abfalltonnen im Grunewald übernahmen Wildschweine die Mülltrennung. Noch nie da gewesene weiße und blaue Blümchen blühten mitten auf der Fahrbahn aus den Rissen im Asphalt.
Doch kaum sanken die Inzidenzen, starteten die Menschen sofort eine Gegenoffensive. Sie wollten ihre sozialen Räume zurückgewinnen, vor allem die Klappstühle der Außengastronomie. Sie drängten die Natur wieder aus der Stadt, sie sollte dorthin verschwinden, wo sie hergekommen war, nach Brandenburg in den Wald. Doch die Natur zeigte sich zäher als gedacht, sie wollte nicht aufgeben. Nachdem sie einmal Blut geleckt hatte, heulte die Natur nachts vor unseren Fenstern, sie summte und zwitscherte und kletterte auf die Balkone und die Hausfassaden hoch. Den halben Sommer konnte ich nicht schlafen, so heiter verpaarten sich die Singvögel auf dem Hof und veranstalteten dabei auf dem überdachten Mülltonnenplatz ein polyfonisches Konzert in Überlänge. Da konnte Wagner seine ganzen Meistersinger gleich zurück nach Nürnberg schicken. Morgens knallte dann ab sechs Uhr früh die Sonne durch die Fenster, und kaum machte man sie auf, hatte man sofort die Meistersinger in voller Lautstärke und die Fliegen aus der Biomülltonne in der Küche. Machte man die Fenster zu, erwärmte sich die Wohnung auf unerträgliche Temperaturen.
Einmal waren wir vor der Hitze an einen See geflohen und drei Tage nicht zu Hause gewesen, schon hatte jemand ein Nest auf unserem Küchenbalkon gebaut. Ein richtiges Vogelnest mit einem kleinen blauen Ei darin und einer Amsel darauf. Es war unser Raucherbalkon. Die Familienmitglieder nutzten ihn, um in Ruhe eine Zigarette zu rauchen und an einem Glas Wein zu nippen. Im Sommer blieben wir gerne länger auf dem Balkon sitzen, es war dann der schönste Ort der ganzen Wohnung. Nun war er zu einer Krippe geworden. Der freche Vogel hatte sein Nest direkt im großen Aschenbecher gebaut, sein neues Zuhause passte perfekt hinein. Nun saß das Weibchen mit offenem Schnabel da und blickte uns aus runden Augen streng an, als wollte es sagen: »Rauchen tötet. Ab jetzt wird hier nicht mehr gequalmt. Wir wollen nämlich neues Leben aus eurer alten Asche entstehen lassen, hier in diesem Aschenbecher.« Abends kam das Männchen vorbei, und Mutti flog kurz weg, um sich ein wenig die Flügel zu vertreten. Papa setzte sich ins Nest und legte augenscheinlich noch weitere Eier dazu, denn am nächsten Tag zählten wir bereits vier.
Wir waren alle gespannt, und vor allem die Katze meiner Mutter wartete mit Ungeduld auf das neue Leben. Mit dem Einzug der Vögel in den Aschenbecher veränderte sich aber auch unser Alltag. Keiner aus der Familie wagte es, in Anwesenheit des ungeborenen Lebens und direkt vor dem Schnabel der jungen Mutter zu paffen. Unsere erwachsenen Kinder lästerten über uns. »Freut ihr euch schon auf den Nachwuchs? Wie wollt ihr die Kleinen denn nennen? Vielleicht nach euren Zigarettenmarken – R1, R2, R3?« Drei Tage später lagen fünf Eier im Aschenbecher. Wir recherchierten im Internet und fanden heraus: Zwei Wochen sollte es bis zum Schlüpfen dauern, dann noch zwei Wochen feste Kindernahrung im Nest, damit die R1-en zu Kräften kommen und unseren Balkon endlich verlassen konnten.
Am Ende schlüpften nur aus zweien der fünf Eier tatsächlich Küken, die restlichen drei hatten es sich anders überlegt. Anscheinend wussten sie, dass mit unserer Welt etwas nicht stimmte. Die Nichtgeschlüpften wurden von ihren Eltern sorgfältig entsorgt, dann begann die Fütterung. R1 und R2 erwiesen sich als unglaublich hungrige Bestien, sie hatten rund um die Uhr Appetit. Und obwohl wir dank der Biotonne eigentlich genug Fruchtfliegen hatten, die ihnen fast direkt in den Schnabel flogen, wirkten die Eltern überfordert. Dafür begeisterte sich meine Mutter sehr für den Nachwuchs. Sie vergaß ihre Katze und verbrachte jeden Tag viel Zeit auf dem Balkon, um die Küken wachsen zu sehen. Von ihrem eigenen Fütterinstinkt gelenkt, wollte sie die jungen Eltern bei der Nahrungsbeschaffung unterstützen. Sie holte ihre Elektroklatsche und half den Amseln nach Kräften bei der Fliegenjagd. Laut den Erkenntnissen aus dem Internet waren tatsächlich ausgerechnet diese Fliegen und nicht etwa Würmer das beste Essen für die kleinen Amseln. Also bekamen R1 und R2 ihre Fliegen teilweise roh von ihren Eltern und teilweise leicht angeschmort von meiner Mutter. Gemeinsam schafften sie es, die jungen Vögel innerhalb einer Woche auf die Größe einer Zigarrenschachtel zu füttern. Sie konnten sogar schon selbstständig fliegen.
Meine Mutter war von dieser Erfahrung sehr angetan und fühlte sich mit ihrer Fliegenklatsche als Teil einer erstrebenswerten natürlichen Symbiose ganz im Sinne der ökologischen Gerechtigkeit. Sie meinte, sie habe das Konzept jetzt verstanden. Noch lange danach wollte sie in jeder Amsel auf dem Hof R1 oder R2 wiedererkannt haben und winkte ihnen mit der Klatsche. »Ja«, sagte sie, »natürlich sehen alle Amseln gleich aus. Bis auf diese zwei.«
Das Bankett wird verschoben
»Eine klassische Menüreihenfolge sollte wie eine musikalische Komposition aufgebaut sein! Oder, besser noch, wie die Entwicklung eines Menschen: Jeder Gang ist wie ein Lebensabschnitt. Es fängt leicht an, wird mit der Zeit etwas üppiger und schwerer und erreicht seinen Höhepunkt mit dem Dessert, einer kleinen, feinen Süßigkeit«, erklärte der Lieblingsfernsehkoch meiner Mutter in der russischen Sendung Seelenkochen.
Mama sah sich die Sendung gerne an, während sie Chickenwings in der Mikrowelle warm machte. Eigentlich kochte meine Mutter gern, aber sie fand kaum Mitesser für ihre kulinarischen Kreationen. Ihre beste Freundin Tante Inge kam zwar jede Woche vorbei, doch auch sie wollte nur Chickenwings. Die galten früher als Kindersnack, waren aber inzwischen zur Lieblingsdelikatesse der alten Garde geworden.
Tante Inge kam immer sonntags, um sich mit Mama zusammen im Fernsehen alte Ballettaufführungen anzusehen, und zwar eigentlich immer dieselbe: die Bolschoi-Inszenierung von Schwanensee aus dem Jahr 1973 in Schwarz-Weiß-Aufzeichnung. Tante Inge litt an Alzheimer und war außerdem aufgrund ihres viel zu schnell vorbeigerauschten Lebens depressiv. Ihre Antidepressiva sorgten zwar dafür, dass sie zäh und optimistisch blieb, aber als Nebenwirkung bescherten sie ihr Halluzinationen. Immer wieder sprangen ihr aus dem Fernseher Schwäne entgegen und setzten sich auf ihre Schulter. Tante Inge wusste, dass sie nicht echt waren. Sie verscheuchte das halluzinogene Geflügel und schaute mutig weiter Ballett.
»Ich würde so gern ein Vier-Gänge-Menü zubereiten mit Suppe und Buletten, aber für wen kann ich noch kochen?«, seufzte meine Mutter und fragte mich, ob ich vielleicht Buletten mochte. Ich schaue mir mit den beiden Frauen gerne einmal die Bolschoi-Inszenierung an, aber Buletten mochte ich auch nicht. »Balletten statt Buletten!«, sagte ich. »Lass uns mal eine Kochpause machen, Mama.« In jenem Sommer sah es ohnehin so aus, als würden wir selbst gekocht. Der Weltklimarat hatte im Auftrag der UNO eine 1300 Seiten dicke Studie über die Folgen der globalen Erwärmung mit fünf möglichen Zukunftsszenarien veröffentlicht, eines düsterer als das andere. Nur die Reihenfolge stand noch nicht fest. Entweder wurden wir zuerst angebraten, dann überflutet und erstickt oder umgekehrt.
»Du kannst ja deine Enkel zum Essen einladen«, witzelte Tante Inge. Sie wusste, dass die Enkel niemals zum Essen zu ihrer Oma kamen. Das eine Enkelkind jobbte selbst als Koch in einem Bio-Café, wo es veganes Rührei zubereitete. Das andere Kind aß nur Fleisch von glücklich verstorbenen Tieren. So befahl es der Zeitgeist. Es war unmöglich geworden, die Enkel zum Essen einzuladen. Kaum fing Mama an mit »Komm vorbei, ich habe ganz tolle Buletten gemacht nach dem alten Rezept meiner Oma, also deiner Ururgroßmutter, die sind so saftig und schön, da ist überhaupt kein Fleisch drin, nur Hühnchen!«, fingen die Kinder sofort an, dieselben Bewegungen zu machen wie Tante Inge, wenn sie das TV-Geflügel von ihrer Schulter verscheuchte. Die Enkelkinder wussten Omas Gerichte nicht zu schätzen. Vor allem verstörte sie, dass Oma ihr Fleisch zu Billigpreisen bei großen Discountern kaufte.
»Wie oft habe ich es dir schon gesagt, Oma!«, hob der vegane Rühreihersteller den Zeigefinger. »Was du bei diesen Discountern kaufst, ist kein Fleisch und kein Fisch. Das sind Überreste gefolterter und übel zugerichteter Lebewesen. Hast du eine Ahnung, was ein Schwein über sich ergehen lassen muss, damit es am Ende tot zu einem Spottpreis in den Kühlregalen liegt?« Mama hatte keine Ahnung. »Nicht umsonst waren deutsche Megaschlachthöfe gewaltige Verteiler der Seuche«, fuhr das Enkelkind fort. »Dort werden Menschen und Tiere gleichermaßen unwürdig behandelt. Und dieser Horror wird nicht aufhören, solange es so leichtsinnige Konsumenten wie dich gibt, die jedes Angebot annehmen, Hauptsache billig! Ich bitte dich um mehr Empathie für andere Lebewesen. Du hast doch eine Katze. Warum sind dir fremde Tiere so völlig egal?«
»Fremde Tiere sind mir überhaupt nicht egal«, empörte sich Mama. »Ich liebe Tiere! Wir sind doch früher oft zusammen in den Zoo gegangen. Erinnerst du dich nicht mehr, wie du damals vor den Pelikanen weggelaufen bist? Ich habe sie dann abgelenkt! Und als du von dem Nashorn so hinterhältig von der Seite angepisst worden bist, habe ich mich dazwischengestellt!«
»Zoos sind die KZs veralteter Tierhaltung! Dort werden Tiere und Vögel hinter Gittern gehalten, als wären sie Verbrecher, obwohl sie nichts Böses getan haben. Ihr einziges Pech war, irgendwann in die Hände der Menschen geraten zu sein«, polterte das Enkelkind zurück. »Zoos gehören verboten und geschlossen, das wird auch bald passieren. Und was Lebensmittel betrifft, die sind heutzutage alle gekennzeichnet, je nachdem wie bio sie wirklich sind. Ich gehe das nächste Mal mit dir zusammen einkaufen, Oma. Dann zeige ich dir, wie du deinen Konsum umstellen kannst«, versprach das liebe Kind.
»Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?«, wunderte sich Mama. »Wieso sind sie auf einmal so gereizt? Man kann doch jedem seinen Geschmack gönnen. Die einen kochen so und die anderen so. Ja, wir kaufen gerne Chickenwings als Fertigprodukt und machen sie in der Mikrowelle heiß. Die schmecken super, auf jeden Fall besser als dieses vegane Rührei. Das schmeckt nach Mehl.«
»Es geht nicht um den Geschmack, Mama«, erklärte ich. »Die Jugend kümmert sich um die Rettung des Planeten. Angeblich sind eure Chickenwings schuld daran, dass sich die Erde nicht mehr richtig dreht.«
»Verfluchtes Geflügel«, nickte Tante Inge zustimmend und wischte sich einen Schwan aus dem Nacken.
Ja, angeblich trugen Tierhaltung und Landwirtschaft einen erheblichen Anteil der Schuld daran, dass wir demnächst angebraten, überflutet und zum Dessert serviert wurden. Aber wem? Anderen Lebewesen, die sich an die globale Erwärmung besser anpassen konnten? Damit das nicht passierte, musste ab sofort das Leben jedes Einzelnen von uns der Ausbremsung des Klimawandels dienen. Der Weltbiodiversitätsrat forderte, wir sollten dringend aufhören, so viele Tiere zu halten, denn weniger Tiere bedeuteten weniger CO2-Ausstoß. Das Problem war nur, wir konnten auf Tiere nicht verzichten, selbst wenn wir sie nicht mehr aßen. Die Grundlage unserer Zivilisation bestand nämlich daraus, aus jedem Lebewesen einen zusätzlichen Nutzen zu ziehen. Hühner wurden zum Beispiel bei Managementtrainings aktiv eingesetzt, um die Führungsqualitäten der Teilnehmer zu prüfen. Wenn angehende Manager es schafften, dass ihnen Hühner zuhörten, würde es ihnen bei Menschen auch gelingen. Angeblich hatten Hühner nämlich ein Gespür für Führungskompetenz. Sie sagten es zwar nicht, aber sie starrten die Manager angestrengt an. Katzen wiederum waren gut fürs Herz, wenn man sie mit der linken Hand streichelte. Mit rechts nützte es der Verdauung. Und Pferdetherapie war das Highlight in den Entzugskliniken Brandenburgs. Es galt als erwiesen, dass der Entzug sanfter verlief, wenn man Alkoholiker in den Sattel setzte. Ziegen und Schafe dienten vielerorts als Orakel. Allerdings durfte man sie, anders als den Weltklimarat, für schlechte Prognosen sofort bestrafen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele vierbeinige Orakel und Wahrsager nach dem bitteren Ausscheiden der Deutschen bei der Fußball-EM 2021 geschlachtet worden waren.
Tiere machen uns glücklicher, sie machen sogar Kunst. Vor einiger Zeit erlebte ich in einem österreichischen Hotel eine kleine Sensation: einen malenden weißen Esel. Es war den Mitarbeitern aufgefallen, dass das Tier immer wieder mit dem Maul Stöcke aufhob und dann auf und ab schwang. Also gaben sie ihm einen Pinsel und Farbe und stellten ihm eine Leinwand hin. Die Eselbilder sind mittlerweile sehr teuer, auch wenn Kunstkritiker noch über die Frage streiten, was genau das Tier malte und was die bunten Flecken zu bedeuten hatten. Stellten sie unsere im Chaos versunkene Welt dar? Oder porträtierte der Esel einfach uns? Denn möglicherweise bestand unsere Lebensaufgabe gar nicht darin, die Welt zu retten, sondern einem Esel Modell zu stehen.
Unser Kandidat
Bereits Anfang August bedeckten sich die Bäume und Straßenlaternen mit bunten Wahlplakaten. Die Bundestagswahl stand bevor, und die Bürgerinnen und Bürger hatten zwei Monate Zeit, um sich einen Kandidaten vom Baum zu pflücken und ihn in den Bundestag zu schicken. Neben den Kandidaten hingen noch Plakate von Ikea und von Heino, der ganz Deutschland mit seinen Konzerten überzog. Corona hin oder her, Heino sang weiter. Ich war mir sicher, es gab inzwischen kein Dorf in Deutschland, in dem Heino nicht schon einmal gesungen hatte.
Meine Mutter schaute sich die Bäume und Straßenlaternen aus dem Autofenster mit großem Interesse an und zeigte sich überrascht von der Vielfalt der Plakate und Wahlsprüche. Sie wollte wissen, was die Unterschiede zwischen den Parteien und den einzelnen Personen auf den Bäumen seien, wie sie miteinander im Bundestag überhaupt klarkämen. Ich hatte Mühe, ihr zu erklären, dass Ikea und Heino zum Beispiel gar nicht kandidierten und auch die anderen nicht alle in den Bundestag einziehen würden, höchstens einer pro Baum. Die restlichen Kandidaten würden draußen im Regen hängen bleiben.
»Oh mein Gott, wie frustrierend muss das für sie sein, nicht gewählt zu werden«, bemitleidete Mama die Kandidaten. »Bei uns gab es so etwas früher nicht, dass man kandidiert und nicht gewählt wird.«
Ja, es würde nicht leicht für die Menschen sein, einen vom Baum zu wählen. Irgendwie schienen alle Kandidaten beim selben Fotografen im Studio gesessen zu haben, der sie aufgefordert hatte: »Sag Vanessa! Lach mal, mach den Knopf auf und schau fröhlich in die Kamera, als wäre gerade ein Kindergeburtstag im Gange, a ram sam sam.« Ich hätte mir einen mit ernstem Blick gewünscht, vielleicht einen wie Heino? Nur er blickte ernst, kandidierte aber nicht.
Die halbe Strecke von Berlin nach Prerow verfolgten uns fröhliche Bundestagskandidaten und der grimmige Heino, bis wir die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern überquert hatten. Von da an wurde es entspannter. Die Kandidaten sahen auf einmal alle aus wie Heino, kein a ram sam sam mehr, und je weiter nördlich wir kamen, desto grimmiger blickten sie von ihren Bäumen und Laternen auf uns herab, mitfühlend und besorgt.
Traditionell verbrachten wir das Augustende mit Mama an der Ostsee, dem Lieblingsort aller deutschen Radfahrer. Das Fahrrad war neben dem E-Auto zu einer modernen persönlichen Arche Noah geworden, denn angeblich wurden in ein künftiges Paradies nur noch vollständig geimpfte und geboosterte Radfahrer mit Helm oder genesene sowie doppelt getestete Tesla-Besitzer hereingelassen. Allerdings war so ein Tesla noch immer sehr teuer. Also traten die Deutschen fleißig in die Pedale und trainierten an der Ostsee fürs Paradies. Ihre Waden wurden von Jahr zu Jahr dicker, aber das Paradies ließ zum Glück auf sich warten.
Mama und ich fuhren nicht Rad. Kaum in Prerow angekommen, versuchten wir, die Gegend langsam zu Fuß zu erkunden, genossen den trüben mecklenburgisch-pommerschen Himmel, die Mücken und den Wind und bestaunten die Winterklamotten in den unzähligen Geschäften für Schlechtwetterkleidung. Alle Regenmäntel und Regenschirme, die wir besaßen, waren an der Ostsee gekauft worden. Und wir bewunderten wie jedes Jahr die schöne Eigenart der Einheimischen: ihre mit Stolz zur Schau gestellte Unfreundlichkeit. Sie waren ein Volk, das jede Servicementalität zutiefst verabscheute, gleichzeitig aber jede Ordnung verherrlichte. Wäre der gekreuzigte Jesus hier an der Ostsee wiederauferstanden, hätten die Einheimischen ihn sofort erneut ans Kreuz geschlagen, nicht aus Bösartigkeit, aber Ordnung musste sein. Ihre Lieblingsantwort auf beinahe jede Frage war »Nö«, wurde aber gelegentlich durch heftiges Kopfschütteln ersetzt. In einer Gaststätte oder in einem Restaurant gerieten die müden Radfahrer in Rage, wenn sie von den Kellnern »Na, was darf’s sein?« zugezischt bekamen. »Soll ich euch gleich aus dem Laden schmeißen, oder reden wir zuerst übers Wetter?«, so ungefähr konnte man diese Frage übersetzen. Und jedes Jahr hörte ich die Radfahrer über die Gründe dieser Unfreundlichkeit streiten.
Junge linksorientierte Radler deuteten sie als Kapitalismuskritik. Früher in der DDR hatten die Ostseeeinwohner bestimmt fröhlicher aus der Wäsche geguckt. Sie waren arm gewesen, aber glücklich. Vielleicht ein wenig verpeilt, was aber allen Menschen passierte, die nahe am Wasser leben. Nach dem Mauerfall konnten einige von ihnen viel Geld mit dem Tourismus verdienen und waren reich geworden. Und das Kapital vermiest den Charakter. Je mehr die Menschen besitzen, umso grimmiger gucken sie, besagt eine Volksweisheit.
Mir hat Heino einmal dasselbe erzählt. Ich drehte damals einen Film über Heimatklänge, und in Deutschland gehörte Heino zweifelsohne dazu. Immerhin beschallte er dieses Land seit über einem halben Jahrhundert ununterbrochen und hatte mehr Platten verkauft als Dschingis Khan, Boney M. und die Rolling Stones zusammen. Wir hatten uns in dem kleinen Dorf Neunkirchen getroffen, am Ende der Welt, wo Heino sich feierlich in Anwesenheit des Bürgermeisters in das Goldene Buch der Stadt eintrug. Unser Filmteam wurde ebenfalls feierlich begrüßt.
»Dann können Sie sich, Herr Kaminer, bei der Gelegenheit auch gleich eintragen«, meinte der Bürgermeister zu mir.
Ich blätterte für alle Fälle heimlich das Goldene Buch durch, um nachzusehen, ob es außer Heino und mir noch jemanden gab, der mit einer Eintragung gewürdigt wurde. Wir waren zu fünft, allerdings kannte ich die anderen nicht.
Nach der feierlichen Zeremonie fragte ich den Sänger, warum er eigentlich auf seinen Fotos und Plakaten nie lächelte und immer so grimmig guckte, als wolle er wirklich für Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag gewählt werden. Er verriet mir, dass ihm sein Manager vor sechzig Jahren, als seine Gesangskarriere mit dem Hit »Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich« begann, gesagt hatte: »Du darfst niemals vor der Kamera lächeln, wenn du über die Nuss singst. Sonst glauben die Menschen, dir ginge es zu gut, du wärst reich und würdest sie auslachen, weil sie dir Konzertkarten abkaufen. Dann klatschen sie nicht und denken, du würdest sie selbst für taube Nüsse halten. Du musst immer schlecht gelaunt und bekümmert aussehen, dann klatschen die Leute!«
Der Manager hatte auf den damals noch jungen Künstler einen großen Einfluss. Und seitdem sieht Heino vor der Kamera immer besorgt aus, und die Leute klatschen. Vielleicht hat derselbe Manager auch die Leute an der Ostsee beraten. Ihre Grimmigkeit sollte eigentlich längst als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO anerkannt werden. Die Menschen blickten unwirsch, damit niemand glaubte, es gehe ihnen gut. So behaupteten zumindest die jungen linksorientierten Radfahrer.
Die älteren erfahrenen Radler argumentierten dagegen. Sie meinten, diese Mentalität sei angeboren. Die Menschen im Norden wären schon immer so gewesen, nur dass sie in der sozialistischen Diktatur der DDR ihr wahres Ich nicht hatten zeigen dürfen. Im Sozialismus waren die Bürgerinnen und Bürger von der Staatsgewalt zur Fröhlichkeit gezwungen worden. Sie hatten in ihrem kommunistischen Alltag stets fröhlich zu sein und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Jeder Miesepeter wurde als Staatsfeind gebrandmarkt, jeder Stinkefinger in der Öffentlichkeit sofort abgehackt. Erst nach dem Fall der Mauer bekamen die Menschen im Norden ihr Recht auf Grimmigkeit zurück. Endlich konnten sie die verlogene kommunistische Maske der Freundlichkeit ablegen und frei von staatlich verordnetem Optimismus auf die Welt blicken, so wie es ihnen das Herz befahl: wie ein Starkoch auf eine tote Maus im Suppentopf.
Wer hatte nun recht? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.