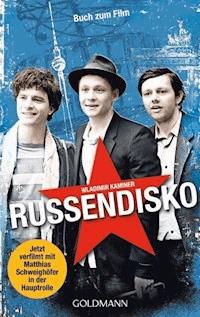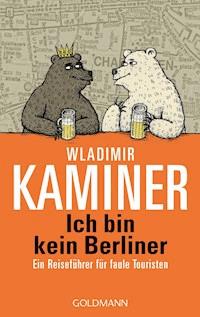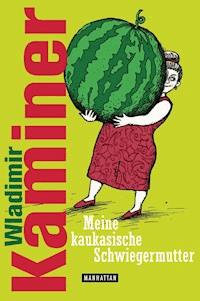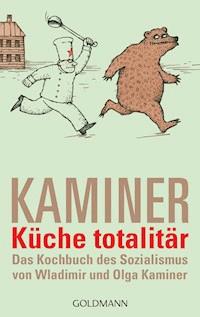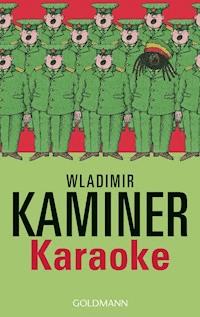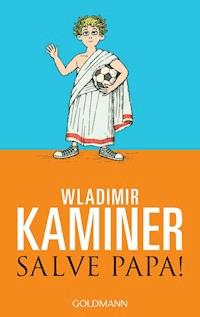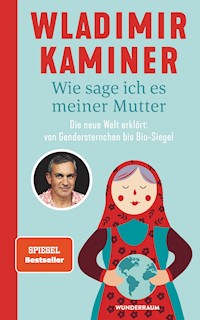3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Onkel Wanja kommt!
Onkel Wanja sieht sein letztes Stündlein herannahen und er wünscht sich von seinem Neffen Wladimir nur noch eines: »Bevor ich sterbe, möchte ich noch einmal die Welt bereisen. Vielleicht nicht die ganze Welt, vielleicht nur Europa oder gar nur Deutschland. Und auch dort nur Berlin. Kurzum, schicke mir bitte eine Einladung.« Gesagt, getan. Als Onkel Wanja in Berlin eintrifft, machen sich die beiden zu Fuß auf den Weg zu Wladimir nach Hause. Es ist ein Spaziergang durch die nächtliche Stadt voller eigentümlicher Begegnungen und unvergesslicher Betrachtungen über das Leben. Was ist gut, was böse? Was bleibt irgendwann von uns? Warum leuchtet die Hose des Onkels im Dunkeln? Und wo gibt es eigentlich die besten Matjes?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
WLADIMIR KAMINER
Onkel Wanja kommt
Eine Reise durch die Nacht
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Originalausgabe
2012 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2012
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Umschlaggestaltung:
UNO Werbeagentur GmbH
unter Verwendung von Fotos von Boris Breuer
Satz: Uhl + Massopust GmbH Aalen
ISBN 978-3-641-08541-4 V004
www.manhattan-verlag.de
Das Philosophenschiff
Jedes Mal, wenn ich nach Russland fahre, schaue ich mir die alten Schwarzweißfotos meines Onkels an. Wir spielen dabei stets das gleiche Spiel: Finde den Onkel auf dem Bild. Ich vergleiche die Fotos mit meinen Eindrücken draußen und versuche, anhand dieser Zeitdokumente festzustellen, wie stark bzw. wenig das Land sich verändert hat. Denn auf kurze Sicht ist die Wahrheit nicht zu erkennen, daher sind auch Zeitungen und Fernsehberichte keine große Hilfe. Manche meinen, das Land stehe am Anfang einer neuen Ära, die anderen behaupten, umgekehrt, es sei dem Untergang geweiht. Mit einem Blick aus dem Fenster ist jedoch ein Aufgang nicht von einem Untergang zu unterscheiden. Ähnlich ist es, wenn man auf die Sonne am Himmel schaut. Auch bei ihr ist nicht gleich klar, ob sie auf dem Weg nach unten oder nach oben ist. Die meiste Zeit hängt die Sonne einfach herum und strahlt. Irgendwann ist sie weg, und niemand wundert sich.
Ebenfalls in Russland haben sich Gut und Böse verschmolzen, sozialistische Angeberei und kapitalistische Schläue. Bei vielen neuen Entwicklungen schmeißen die Russen beides in einen Topf, um »nicht zweimal vom Sofa aufzustehen«. Während in Deutschland zum Beispiel die Nachrichtenprogramme im Fernsehen durch Werbepausen unterbrochen werden und die Zuschauer in dieser Zeit mit geübter Hand den Ton ausmachen können, ohne eine wichtige Nachricht zu verpassen, sprechen die russischen Nachrichtensprecher im Fernsehen die Werbung gleich mit. »Ja«, sagen sie, »die Lage in der Krisenregion spitzt sich weiter zu, der nächste Finanzcrash steht vor der Tür, die Wirtschaft ist aufgebracht, der Weltsicherheitsrat kann keine Stabilität mehr garantieren. In solchen Zeiten muss man seine Aufmerksamkeit besonders auf seine Verdauung richten. Mit der Zauberformel von Actimel werden Sie Ihre Verdauung unabhängig machen von den Entscheidungen des Weltsicherheitsrates.«
Oft und gern wird in den Nachrichtenprogrammen Werbung für Kopfschmerztabletten, für Schmerzmittel überhaupt, gemacht. Vielleicht denken die Nachrichtenmacher, die Medizin werde den Weltschmerz mindern, den ihre Nachrichten hervorrufen. Die politische Ideologie der Vergangenheit wird im heutigen Russland zum großen Teil durch die Religion ersetzt, so bekommt man oft in den Nachrichten von Adepten der Kirche zu hören, der wahre Grund jedes Unglücks sei der Unglaube, und alle Gnade komme von Gott. Die Tabletten muss man dennoch essen, aus Demut wahrscheinlich.
Mein Onkel sagt aber, die Tabletten helfen nicht. Wenn er sich nicht wohlfühlt, holt er seine alten Fotos aus dem Schrank. In seiner Generation war und ist das Aufbewahren und Anschauen dieser alten Bilder sehr verbreitet. Beinahe jeder aus seinem Jahrgang hat, glaube ich, mindestens 44 vergilbte Fotos in irgendeiner Schublade. Die Ironie des Fortschritts besteht heute darin, dass zwar jeder mit seinem Handy tausende von Fotos in bester Qualität machen kann, aber dann nichts mit ihnen anzufangen weiß. Die Schnappschüsse werden entweder gleich gelöscht oder im Jenseits des Internets abgeladen und vergessen. Die Schwarzweißfotos früherer Generationen haben dagegen ihre Wichtigkeit im Lauf des Lebens noch gesteigert. Sie sollen als Beweis dafür dienen, dass es einen tatsächlich gegeben hat, dass die Zeit läuft, die Uhrzeiger sich auch hinter unserem Rücken drehen und die Uhren für keine Sekunde aufhören zu ticken – nicht einmal nachts. Die Fotografien meines Onkels lassen einen allerdings daran zweifeln, dass es ihn jemals gegeben hat, denn auf keinem einzigen ist er richtig zu sehen. Zum Beispiel hier das Foto seiner Schulklasse, ein Gruppenfoto erster Güte. Die Jungs stehen, glatt gekämmt und ernst in die Kamera blickend, in den oberen Reihen, unten stehen die Mädchen, festlich gekleidet mit akkuraten Zöpfen, ganz unten die Lehrer und der Direktor. Nur der Onkel ist nirgends zu finden.
»Die Jungs haben mich hier in der Mitte versteckt«, erklärte er mir seine Abwesenheit. »Alle wussten vom Besuch des Fotografen und haben sich dementsprechend hübsch gemacht, nur ich hatte es vergessen. Ich kam in einem alten T-Shirt und mit schmutziger Hose in die Schule. ›Versteck dich, du Hund!‹, schrie mich der Direktor an, ›ich möchte auf meine alten Jahre deine dreckige Visage nicht in meinen Erinnerungen haben!‹ So habe ich mir ein Versteck zwischen den Jungs gesucht. Doch wenn man genau hinguckt, kann man mein linkes Ohr in der Mitte der Jungsreihe sehen.«
Auf einem anderen Foto dient der Onkel in der Armee. Es ist Winter, seine Einheit soll zum Fahneneid antreten, die Soldaten marschieren über den Platz. Man sieht viel Schnee, finster blickende Offiziere, verängstigte Soldaten, die sich anstrengen und die Beine unnatürlich hoch heben, als wären sie beim Ballett. Der Onkel ist nirgends zu sehen.
»Wir standen in einer Dreierreihe und der Fotograf auf der rechten Seite. Rechts vor mir aber schwang der Tatar sein Bein so hoch, das es mich völlig verdeckte. Ich war damals noch dünn und verschwand völlig hinter seinem Bein.«
Auf dem dritten Foto heiratet mein Onkel. Man sieht seine zukünftige Ehefrau in einem pompösen Brautkleid, wie sie ihre Unterschrift ins Buch der Eheschließungen setzt, neben ihr stehen die Zeugen mit großen Blumensträußen. Mein Onkel ist wie gewöhnlich unsichtbar, hinter dem Brautkleid und den Blumen versteckt. Später besuchte der erste Präsident der russischen Föderation, Boris Jelzin, seinen Betrieb, als er noch in Odessa in der Ukraine gearbeitet hat. Zu diesem besonderen Anlass wurde das ganze Kollektiv versammelt. Alle wollten sich mit dem Präsidenten zusammen fotografieren lassen. Auch mein Onkel. Dieses Foto ist das größte und das einzige Farbfoto in seiner Sammlung. In der Mitte steht der Präsident. Neben ihm der Betriebsdirektor, dessen Stellvertreter und der Hauptingenieur, sie haben den Onkel immer weiter vom Präsidenten weggedrängt. Am Rand des Bildes ist gerade noch eine Schulter zu sehen.
»Das ist zum Beispiel meine Schulter«, sagte mein Onkel. »Der Präsident hat mir sogar auf diese Schulter geklopft. Genau die hier. Ich bin mir absolut sicher, dass es meine ist. Ich werde doch meine Schulter von tausend anderen Schultern unterscheiden können«, versicherte mir mein Onkel, als ich vorsichtig meinen Unglauben äußerte.
Es gibt noch andere tolle Bilder in seiner Sammlung. Auf einem Foto ist er mit Freunden beim Angeln. Seine Freunde halten den Fang hoch, mein Onkel verschwindet völlig hinter dem sehr großen Fisch. Auf einem anderen ist er bei der Besteigung eines Berges in den Karpaten hinter seinem Riesenrucksack versteckt.
Die meisten Menschen auf den Fotos sind bereits tot, vor allem diejenigen, die sich gerne in den Vordergrund drängten, meinte mein Onkel. Sie waren als Erste dran gewesen. Nicht umsonst, sagen die Chinesen, wird nur der Vogel, der vorne fliegt, abgeschossen. Nach der Theorie meines Onkels schaut auch der Tod sich gerne alte Fotos an und holt diejenigen ab, die ihm am besten gefallen. Mein Onkel wird also möglicherweise ewig leben, solange er auf seinen Fotos unsichtbar bleibt. Ich bin auf jeden Fall immer davon ausgegangen, dass er unsterblich ist.
Wir hatten uns lange nicht gesehen, als er sich plötzlich bei mir meldete. »Meine Tage sind gezählt«, schrieb mir mein Onkel in einem zweiseitigen Brief in der perfekten Schrift eines Sechstklässlers. »Ich habe Schmerzen. Ich habe Rücken- und Nasenschmerzen, Bein- und Kopfschmerzen, ich habe nichts außer Schmerzen und eine Erinnerung daran, wie schön wir mit Dir damals 1981 auf dem Balkon in Odessa saßen und aufs Meer schauten. Ich möchte Dich gerne besuchen und von deinem Balkon schauen, egal wohin.«
Wir hatten uns damals in Odessa zufällig getroffen, mein Onkel galt in der Familie als schwarzes Schaf und wurde vor mir und den anderen Verwandten verschwiegen, versteckt. Sie hatten Angst, der Lebenswandel meines Onkels, der durch das Land hin und her pendelte, mal nach Osten und mal nach Westen, der ohne eine vernünftige Arbeit und nie auf Dauer mit ein und derselben Person verheiratet war, könnte meine junge Seele negativ beeinflussen. Einmal, ich besuchte meine Oma in Odessa, klopfte mein Onkel dort unangekündigt an und lud mich in seine damals noch neue Wohnung ein. Mich, einen vierzehnjährigen Jungen, freute seine Einladung sehr. Wir verbrachten einen ganzen Tag zusammen, und ich habe bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal guten alten Portwein probiert.
Mein Onkel erzählte mir unter anderem von seiner Reisetheorie: Er teilte alle Länder der Welt in zwei Kategorien ein – die der tomatenförmigen und die der gurkenförmigen. In den tomatenförmigen, meinte er, habe es nur Sinn, im Kreis zu reisen, von Norden nach Süden und zurück. In den gurkenförmigen müsse man dagegen parallel zum Äquator von West nach Ost reisen und die großen Städte dort meiden. Unsere Sowjetunion war ein gurkenähnliches Land, der Onkel reiste daher stets parallel zum Äquator. Nach seiner Theorie hatte die Form eines Landes auch Einfluss auf die Charaktereigenschaften seiner Bewohner. Danach kennen die Bewohner eines tomatenähnlichen Landes keinerlei innere Zerrissenheit, sie präsentieren sich als konsequent und haben immer eine Meinung, egal was passiert. Ein Mensch in einem tomatenähnlichen Land wird mit einem Maß für alles gemessen, er kann beispielsweise nicht ein schlechter Liebhaber, aber ein guter Politiker sein. Einmal gut, immer gut, sonst muss er gehen. Ein tief denkender Philosoph darf nicht gleichzeitig ein enthusiastischer Trinker sein, ein begabter Dichter niemals ein Geschäftsmann. In einem gurkenähnlichen Land dagegen sind die Menschen von Natur aus zwiespältig und unvorhersehbar. Sie können ihren Nächsten gleichzeitig retten und ihn treten, sein Haus anzünden und ins Feuer rennen, einen Untergehenden ans Ufer zerren und ihn, wenn er zu sich kommt, wieder ins Wasser schmeißen. In tomatenähnlichen Ländern sind die Bürger ordnungsliebend, in gurkenähnlichen ist es dafür selten langweilig.
Mein Onkel hatte alle Eigenschaften der Bewohner eines gurkenähnlichen Landes – er konnte sich sein Leben lang nicht festlegen. Er hat immer getauscht, was ihm in die Finger kam, wahrscheinlich vom Gefühl getrieben, etwas sehr Wichtiges verpasst, übersehen zu haben. Als Kind tauschte er Briefmarken mit chinesischen Sportlern gegen Briefmarken mit Vögeln, Bücher gegen andere Bücher, eine Sportart gegen eine andere. Später als Erwachsener tauschte er einen Job gegen einen anderen Job und eine Frau gegen eine andere Frau.
In der Sowjetunion war Tauschen Volkssport. Alles wurde gegen alles getauscht, Katzen gegen Mäntel, Platten gegen Drogen, Brillen gegen Fotoapparate, Gitarre gegen Pferd. Diese Angewohnheit, Hans im Glück zu spielen, kommt, denke ich, daher, dass es im Sozialismus zu wenig Möglichkeiten zum Geschäftemachen gab. Spekulieren war verboten, tauschen aber erlaubt. Und alle haben getauscht wie verrückt. Das wichtigste Tauschobjekt in der Sowjetunion war die Wohnfläche. Die meisten bekamen ihre Wohnung vom Staat, man konnte sie weder vermieten noch verkaufen, aber man konnte sie tauschen ohne Ende. Das Land war lang, groß und relativ dicht bebaut, alle Wohnungen waren mehr oder weniger gleich geschnitten, und die Sowjetbürger waren äußerst reiselustig. Sie annoncierten schon beim Einzug ihre Bereitschaft für den nächsten Aufbruch.
An einem richtig fetten Wohnungstausch waren normalerweise bis zu sieben oder sogar acht Haushalte beteiligt. Die einen wollten eine Zweiraumwohnung gegen eine Wohnung mit Balkon tauschen, die anderen suchten gerade so eine Zweiraumwohnung, hatten allerdings nur Zimmer ohne Balkon, dafür aber im dritten Stock. Also suchten sie jemanden mit Balkon, der in den dritten Stock wollte. Und der wollte seinerseits ein Küchenfenster zur Südseite, also suchten sie alle zusammen jemanden mit einem solchen Fenster. Und so zog sich der Tausch immer weiter hin, bis alle Interessen vertreten waren. Dann versammelten sich die Betreffenden in einem Restaurant, feierten den Neuanfang, und ein paar Monate später fingen die meisten bereits wieder an, einen neuen Ringtausch ins Auge zu fassen. Es war wie eine Sucht. Anfangs wollten die meisten durch diese Tauschgeschäfte bloß ihre Wohnverhältnisse verbessern, danach konnten sie sich aber nicht mehr bremsen. Aus Abenteuerlust oder Trägheit tauschten sie immer weiter, mal mit Gewinn, mal mit Verlust.
Mein Onkel tauschte dreißig Jahre lang wie ein Wahnsinniger. In Moskau hatte er beispielsweise angeblich ein hübsches Zimmer in einer Wohnung, in der noch weitere sechs Familien lebten, und jeder ging mit seinem eigenem Klodeckel in die Toilette. Das ärgerte meinen Onkel, also fuhr er nach Grodno. Ein altes russisches Sprichwort besagt, dass 3000 Kilometer für einen zähen Hund kein Umweg sind. In Grodno hatte er keine Nachbarn, aber die Stadt gefiel ihm nicht. Er wollte aufs Land, bessere Luft, ein freies Feld. Also tauschte er kurzerhand seine Wohnung in Grodno gegen ein halbes Haus in Krasnodar, ohne sich den neuen Ort vorher angesehen zu haben. Das halbe Haus erwies sich als Gartenhäuschen, das mitten in einem Kartoffelfeld stand. In der anderen Hälfte des Hauses lagerte Dünger, es roch nicht sonderlich gut, und mein Onkel tauschte leichten Herzens seine Haushälfte gegen ein Zimmer in Odessa. In Odessa selbst tauschte er dann auch noch einmal und wohnte dadurch auf einmal wie ein König, direkt am Meer. Zwei Jahre später tauschte er sich jedoch aus Odessa mit Zuzahlung nach Moskau zurück und fand sich schließlich in dem gleichen Zimmer und sogar mit ähnlichen Nachbarn wieder wie zu Anfang, nur diesmal an einem anderen Ende der Stadt. Danach hat er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr getauscht, aber immer mit Begeisterung von seinen Umzügen erzählt. »Natürlich hat es sich gelohnt!«, warf er sich in die Brust. Er habe so viele Orte gesehen, interessante Menschen kennengelernt, Frauen, Freunde fürs Leben. Nein, er würde auch im Nachhinein alles genau so noch einmal machen, er würde sein Schicksal mit niemandem tauschen wollen, aber sein Zimmer – sehr gern.
Ich habe ihn damals in Odessa besucht, in seiner schönen Wohnung. Er hatte einen Job als Buchhalter am Hafen gefunden und zufällig eine nette Dame aus der Wohnungsbaugenossenschaft »Der Seemann der Schwarzmeerflotte« kennengelernt. Sie hatte ihm geholfen, eine Einzimmerwohnung mit Blick aufs Meer zu bekommen. Aus dem Fenster konnte man bei gutem Wetter das Ein- und Auslaufen der Schiffe beobachten. Die meisten bewegten sich nicht, andere schwammen langsam von links nach rechts und zurück am Fenster meines Onkels vorbei.
Ich saß damals auf seinem Balkon und beobachtete das Meer. Man sah nichts außer diesen faulen Schiffen, die beinahe im Wasser schliefen. Manche von ihnen zeichnete ich in einem Block ab, trotzdem konnte ich in ihren Manövern keinen Plan entdecken. Aus meiner Sicht schwammen sie völlig sinnlos im Meer umher, als könnten sie sich nicht entscheiden, wohin. In meiner Phantasie stellte ich mir immer wieder vor, das Haus meines Onkels wäre in Wirklichkeit ein solches Schiff und würde langsam von Odessa Richtung Amerika driften. Die Grenzen auf See stellt man sich sowieso irgendwie menschenfreundlicher vor als die auf dem Festland. Keine Soldaten mit Maschinengewehren, kein Stacheldraht, keine Wachhunde. Nur die Möwen würden uns über die Grenze begleiten.
In Moskau und später in Berlin vermisste ich das Meer und die Schiffe sehr. In unserer jetzigen Wohngegend, auf der Schönhauser Allee, erinnert nur »Der Fischladen« an das maritime Leben: ein kleiner Verkaufstresen mit eingebautem Fischrestaurant. Der Laden gehört Thomas, einem Österreicher, der sehr gute Fish and Chips anbietet. Thomas erzählte uns, er sei früher Schiffsbauer gewesen und würde sich deswegen für Schiffe, Meere und Fische interessieren. Er habe außerdem vor, seinen nächsten Urlaub in der Karibik auf dem größten jemals gebauten Schiff zu verbringen. Das Schiff hätte bis zu 5000 Passagiere an Bord, 100 Restaurants, mehrere Schwimmbäder, ein Filmtheater, Golfplätze und sogar eine Gokartbahn. Das werde sein luxuriösester Urlaub, er habe eine Flatrate-Reise gebucht, behauptete er.
Mit Flatrate auf einem Schiff – das heißt, er kommt nie mehr wieder, dachte ich. »Das wird eine endlose Reise, schade um den Fischladen«, sagte ich. So sei es nicht, er käme schon zurück, erwiderte Thomas. Sobald er alle hundert Restaurants besucht, alle Filme gesehen und genug Golf gespielt habe, alle Damen und Herren und Wellen in der Karibik mit Namen und Nachnamen kennengelernt habe, komme er zurück nach Berlin, um hier weiter Fish and Chips zu verkaufen. Überdies gelte die Flatrate nur für maximal zwei Wochen, das heißt, er dürfe sich nur vierzehn Tage auf dem Schiff amüsieren, danach sei er verpflichtet, es zu verlassen. Auf die Frage, wohin sein Schiff denn überhaupt fahre, wusste Thomas keine Antwort.
Das Schiff ist inzwischen wohl das einzige Transportmittel, mit dem keine schnelle Reise zu machen ist, das überhaupt auf kein konkretes Reiseziel angewiesen ist. Es ist vielmehr eine Art, sich von der restlichen Welt abzuschotten. Man schaukelt irgendwo auf den Wellen, während die anderen ackern. Früher wurden Menschen und Tiere auf Schiffe getrieben. Es sei nur an die Arche Noah erinnert, das erste Schiff dieser Art, das sich ohne Ziel auf dem Wasser bewegte und sich dann auf die Suche nach festem Land machte. Und sogenannte Idiotenschiffe brachten regelmäßig und mehr oder weniger unfreiwillig europäische Auswanderer nach Amerika, damit sie ihren einstigen Nachbarn mit ihrem Traum vom schnellen Geld nicht endlos auf den Sack gingen.
In meiner gurkenähnlichen Heimat trug das berühmteste Schiff dieser Art den Titel »Philosophenschiff« und hieß Oberbürgermeister Haken. 1922 beschloss die junge sowjetische Regierung, sich vom überflüssigen Ballast der russischen Philosophie zu befreien. Die junge sozialistische Republik nannte sich zwar das Land der Räte, sie brauchte aber nur wohlmeinende, positive Ratschläge zur Verbesserung der ökonomischen Situation des Landes und keine philosophischen Zweifel. Mit Zweiflern und Nachdenkern konnte man keine neue Weltordnung aufbauen. Deswegen beschlossen Lenin und Trotzki, all jene russischen Denker des Landes zu verweisen, die sich von einer aktiven Zusammenarbeit mit der Sowjetmacht distanzierten, weil sie Zweifel an der Entwicklung der Revolution hegten, jedoch ansonsten keiner feindlichen Tätigkeit gegen die neuen Machthaber nachgingen. Der Genosse Trotzki brachte dies auf den Punkt: »Menschen, bei denen es keinen Grund gibt, sie zu erschießen oder sie zu dulden, müssen weggebracht werden.« In einer schnellen Aktion wurden 117 russische Philosophen auf das deutsche Schiff Oberbürgermeister Haken verladen und in Richtung Stettin geschickt.
Zu diesem Zeitpunkt erlebte die russische Philosophie gerade eine äußerst lebendige Phase. Die Philosophen stritten sich die ganze Zeit und hörten auch an Bord nicht damit auf. Die einen behaupteten, Russen seien ihrem Wesen nach Europäer, Russland solle daher den europäischen Weg der Aufklärung und der Vernunft einschlagen, und die Gesellschaft müsse langsam reformiert werden, damit man das Volk Schritt für Schritt auf einen europäischen, menschenfreundlicheren Weg lenken könne. Die andere Gruppe der Philosophen auf dem Schiff bestand dagegen darauf, Russland sei kulturell, wirtschaftlich und politisch schon immer ein Gegengewicht zu Europa gewesen. Es sei von Gott auserwählt worden, die leidende Seele, das hochschlagende Herz und das Gewissen der Menschheit zu sein. Es sei berufen, den ganzen Schaden der Aufklärung und der technischen Entwicklung mit der heilenden Kraft seines Geistes wieder zu kitten, mithin die europäische Nähe mit den asiatischen Wurzeln zu vereinen. Egal was Europa vorhabe, Russland müsse immer dagegen sein. Beide Philosophenfraktionen wurden gleichermaßen von den Bolschewiki des Landes verwiesen, und beide Seiten sahen in ihrer Ausweisung jeweils die Bestätigung der eigenen Theorie. Es ging laut zu auf der Oberbürgermeister Haken.
Es gab allerdings auch noch eine dritte philosophische Gruppe auf dem Schiff, repräsentiert von dem alten Professor Berdjajew. Er vertrat die sogenannte Weinsteintheorie. Laut dieser Theorie blieb immer etwas Ungeklärtes im Weltgeschehen. Bei jeder Entwicklung, bei jeder neuen Erfindung, sogar bei jeder Drehung des Planeten um die eigene Achse entsteht demzufolge immer auch etwas Irrationales, Unvorhergesehenes, so wie sich am Boden jedes klaren Weines ein dunkler Weinstein bildet, der auch noch da ist, wenn der Wein längst ausgetrunken wurde. Berdjajew behauptete, dass die Welt nicht zu erklären sei, jede Mühe mithin vergeblich und jedes Recht strittig. Niemand wisse, was komme. Diese seine Theorie verteidigte der Philosoph jedoch nicht im Gespräch mit seinen Kollegen auf dem Schiff. Stattdessen stand er die ganze Zeit allein an Deck, trank Wein, den er vorsorglich mit dabeihatte, schaute auf das dunkle Wasser und hörte den Schreien der Möwen zu, die das Schiff wie ein revolutionärer Konvoi von beiden Seiten umzingelt hatten, kleine Fische aus dem Meer fingen und die großen russischen Philosophen bis nach Stettin begleiteten. Später siedelten sich die meisten von ihnen in tomatenähnlichen Ländern an. Sie lebten dort relativ sorglos – bis Adolf Hitler mit seiner neuen europäischen Ordnung kam.
Ich bin aber abgeschweift und dadurch vom Onkel abgekommen. »Schmerzen, unerträgliche Schmerzen im ganzen Körper«, schrieb er. »Es hat keinen Sinn, die Wahrheit zu leugnen, ich sterbe. Bevor ich sterbe, möchte ich aber noch gerne einmal die Welt bereisen. Vielleicht nicht die ganze Welt, vielleicht nur Europa, oder gar nur Deutschland, und auch dort nur Berlin. Kurzum, schick mir bitte eine Einladung.«
Ich überlegte nicht lange und ging ins Einwohnermeldeamt. Eine Einladung nach Deutschland ist keine große Sache. Ich musste dafür bloß übers Internet einen Termin beim Amt beantragen und eine Bescheinigung des Arbeitgebers einholen, als Beweis dafür, dass ich genug verdiente, um meinen Gast soundso viele Tage versorgen zu können. Außerdem brauchte ich einen Nachweis, dass ich in meiner Wohnung genug Platz hatte und nicht beabsichtigte, die Obdachloseneinrichtungen der Hauptstadt für meine Verwandtschaft in Anspruch zu nehmen. Als Freiberufler hatte ich allerdings keinen richtigen Arbeitgeber, also konnte mir jeder Freund oder Nachbar eine solche Bescheinigung ausstellen, und die Wohnung bietet Platz genug für mehrere Onkels. Ich fuhr also am vereinbarten Tag zur Polizei, schwor auf die Ehrlichkeit der Angaben, bezahlte 30,– Euro, und fertig war die Einladung.
Sie nach Moskau zu schicken war etwas schwieriger, denn die Post ist in Russland eine unsichere Verbindung. Selbst wenn sie ausnahmsweise einmal funktioniert, kann es zuletzt am Briefträger scheitern. Die Briefträger in Russland entwickeln nicht selten ein ungesundes Interesse an Briefen, die aus dem Ausland kommen. Vielleicht sammeln sie Briefmarken und suchen nach passenden interessanten Bildern für ihre Sammlung. Oder sie vermuten in den Umschlägen wertvolle Inhalte. Manche Briefe kommen nie an, andere erreichen ihre Adressaten dagegen blitzschnell. In gurkenähnlichen Ländern ist das Leben eben ein ständiges Spiel, und die Post funktioniert dort wie russisches Roulette. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers liegt immer bei fünfzig zu fünfzig: entweder – oder.
Ich schickte meinem Onkel meine Einladung per Post, und siehe da, es funktionierte. Er bekam später aber doch noch Probleme, allerdings von anderer Seite, nämlich mit der deutschen Botschaft. Es dauert in der Regel drei bis vier Tage, ein Visum zu bekommen, doch zuerst muss man einen Antrag bei der Visavergabestelle ausfüllen. Die Termine dafür werden von einer externen Firma verteilt und sind knapp. Als mein Onkel mit der Firma telefonierte, bekam er einen Termin im nächsten Jahr. So lange konnte er nicht warten und rief deswegen mich an, ob ich die Angelegenheit von Berlin aus nicht irgendwie beschleunigen könne. Im Internet fand ich die Seite der deutschen Botschaft mit einem hübschen Weihnachtsmarkt bebildert und der Erklärung, dass »überall in Deutschland der Advent die stimmungsvollste Zeit des Jahres ist«. Was ist an diesem Fest so stimmungsvoll, wo sich doch alle in ihre Wohnungen zurückziehen und dort hinter ihren Gänsebraten verstecken, dachte ich und las weiter: »So lustig geht es bis zum Heiligen Abend am 24. Dezember zu. An diesem Tag feiern die Christen die Geburt von Jesus mit geschmücktem Tannenbaum und Geschenken, die darunter platziert werden. Diese Geschenke sind ein fester Bestandteil der deutschen Kultur.«
»Sehr geehrte Mitarbeiter der Botschaft«, schrieb ich an die Kontaktadresse. »Ich möchte Sie darum bitten, meinem Onkel noch in diesem Jahr einen Termin zu geben. Der Mann ist alt, und wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Hochachtungsvoll,
W. Kaminer«
Ich spielte mich natürlich als berühmter Schriftsteller auf, doch die Antworten werden von der Botschaft mit Hilfe eines Schreibroboters maschinell geschrieben, für ihn sind alle Menschen gleich, egal ob Schriftsteller oder nicht.
»Sehr geehrte Damen und Herren«, schrieb mir der Roboter zurück. »Sie bitten um einen Sondertermin in der Visastelle der Deutschen Botschaft Moskau. Sondertermine können jedoch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen gewährt werden. Bitte schildern Sie ausführlich Ihr Anliegen unter Darlegung des Reisezwecks und der besonderen Eilbedürftigkeit. Fügen Sie Ihrer E-Mail gegebenenfalls aussagekräftige Anlagen bei, die Ihre Darstellung stützen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine Sonderterminvergabe für touristische Reisen grundsätzlich nicht in Betracht kommt.«
»Sehr geehrter Roboter«, wieder ich. »Es handelt sich um ein Missverständnis. Ich habe keine Eilbedürftigkeitsnachweise und keine Ausnahmefälle, ich habe bloß einen alten Onkel, den ich einladen möchte, mich noch in diesem Jahr zu besuchen. Es müssen keine Sondertermine sein, uns reicht auch ein ganz normaler Termin. Es ist eine Herzensangelegenheit, nehmen Sie sie bitte persönlich!«, schrieb ich, wohl wissend, dass Roboter kein Herz haben, schon gar nicht einer von der Botschaft.
Der Roboter und ich schrieben uns drei Mal hin und her, bis sich eines Tages eine lebendige Frau mit Namen und Nachnamen meldete:
»Lieber Herr Kaminer, wie heißt denn Ihr Onkel?«
Er bekam einen Termin für den darauffolgenden Dienstag um 7.30 Uhr früh, und eine Woche später holte ich ihn schon vom Berliner Hauptbahnhof ab.
Im Sternbild des Weichenstellers
Der Zug aus Moskau – es gibt nur einen – braucht 26 Stunden bis Berlin. Er fährt in Moskau kurz vor Mitternacht los und kommt am Berliner Hauptbahnhof laut Fahrplan kurz nach Mitternacht an. Zwei Stunden verliert er irgendwo unterwegs. Dieser Zug überschreitet nicht nur die Grenzen des Landes, sondern auch die der Zeit. Die russische Eisenbahn hat nicht nur breitere Gleise, auf die kein westlicher Zug passt, Russland hat auch seine ganz eigene Zeit, und die Passagiere, die das Land verlassen wollen, haben zwei Stunden zusätzlich zum Nachdenken, ob sie es wirklich tun sollen.