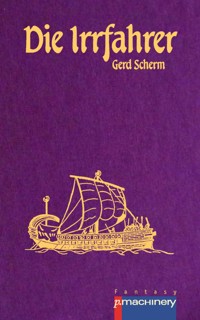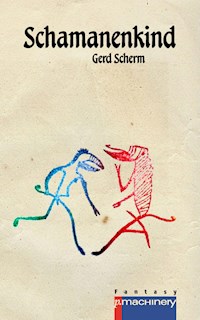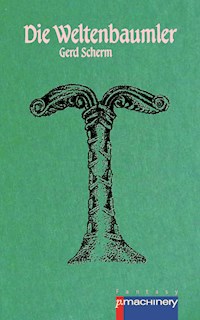
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Welt der Götter steht kopf! In Asgard wird ein Gott ermordet und die mythischen Tiere gründen eine Selbsthilfegruppe. Die nordischen Götter planen Ragnarök, den Weltuntergang, und Loki spielt sein ganz eigenes Spiel. Der Drache erlegt Siegfried und ein trickreiches Eichhörnchen wirbelt den Weltenbaum durcheinander. Brünhild verliebt sich und Seshmosis legt sich mit den Nibelungen an. Das Eisland Island ist Schauplatz des dritten turbulenten Abenteuers des chaotischen Völkchens der Tajarim. "Es gehört zu Gerd Scherms Spezialitäten, die Dinge gehörig auf den Kopf zu stellen." [Fränkische Landeszeitung] "Der Autor aus Franken verfremdet ein weiteres Mal sehr kenntnisreich und mit Ironie und Witz die mythologische Welt." [ekz. Bibliotheksservice] "Gerd Scherm spielt die Flöte des Humors über so viele Oktaven und mit so viel Obertönen, dass am Ende etwas ganz anderes hörbar wird, nämlich der Kern der Menschlichkeit." [Chip online]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gerd Scherm
DIE WELTENBAUMLER
Fantasy 25
Gerd Scherm
DIE WELTENBAUMLER
Fantasy 25
Die Weltenbaumler im Internet:
www.nomadengott.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Mai 2016
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Gerd Scherm & Friederike Gollwitzer unter Verwendung einer Zeichnung von Marianne Klement-Speckner
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 044 3
Schwertzeit, Axtzeit,
Schilde bersten,
Windzeit, Wolfzeit,
bis die Welt vergeht
»Der Seherin Gesicht«
aus der Edda
Aus den verborgenen Schriften der Propheten von Byblos
Aufgeschrieben ist dies für die Söhne der Söhne der Söhne. Wenn es denn in ferner Zukunft überhaupt noch Menschen gibt, die fähig sind zu lesen. Denen will ich künden von meiner Zeit, in der die Götter den Erdkreis betraten und missgünstig miteinander stritten.
Von Ägypten mit seinen tausend Göttern und Dämonen bis zum Zweistromland, wo Ischtar aufstand, sie alle herauszufordern; dort, wo der Zweidrittelgott Gilgamesch die Halbgötter der anderen Völker überragte. Von den namenlosen Furchtbaren der Hethiter will ich ebenso schreiben wie vom eifersüchtigen Jahwe der umherstreifenden Hebräer, der keinen anderen Gott neben sich duldete.
Und berichten will ich von meiner Heimat Byblos, wo Jahr für Jahr der Gott Mot den Gott Baal erschlägt, um dann gleichermaßen von dessen Gattin Astarte erschlagen zu werden.
All dieses schreckliche Götterwerk aber ist auf dem Elend von uns Menschen gebaut. Auf unseren Jammerschreien errichten sie ihre himmlischen Throne.
Kein Hoffen war uns Menschen geblieben angesichts der Grausamkeit der Götterwelt, die auch der Menschen Welt war in jener Zeit. Bevor in Ägypten die Pharaonen im Horizont der Sonne herrschten, während der Minotaurus in Knossos hauste und das Römische Imperium als ungedachte Idee in den Sümpfen des Tibers schlummerte, kümmerten sich die Götter noch bis ins kleinste Detail um den Alltag der Menschen. Doch wäre es nur ein fürsorgliches Kümmern gewesen! Eingemischt haben sie sich, und für alles wollten sie Opfergaben. Opfer! Opfer! Ob man einen kleinen Handel machen wollte oder ob der Hochzeitsbraten gelingen sollte, stets lechzten sie gierig nach ihrem Anteil wie ein Wucherer.
Doch im Ägyptenland jenes Zeitalters gefiel es einem Gott, mit all dem zu brechen. Er erwählte einen Propheten und wirkte mit und durch ihn.
Geheimnisvoll war sein Auftreten, so geheimnisvoll, dass er nicht einmal einen Namen trug, sondern schlicht »Gott ohne Namen«, GON, genannt wurde. Gepriesen sei sein verborgener Name!
Manche sagen, er wirke auch heute noch, doch stets im Verborgenen, und nur wenige Auserwählte würden seiner ansichtig. Und auch wenn er gerade nicht unter uns weilt, so könnte er doch jederzeit wieder über uns kommen. Oder unter uns.
Der Prophet aber jenes verborgenen Gottes hieß Seshmosis, was »der Sohn eines Schreibers« bedeutet, und der Verkünder war auch selbst ein Schreiber. An den Ufern des Nils erwählte GON seinen Propheten, auf dass er sein Volk hinwegführe aus dem Land des Pharaos, wo es große Unterdrückung und Verfolgung erleiden musste.
Doch nicht nur böse Menschen verfolgten den Stamm des Propheten, die Tajarim; auch ägyptische Götter geißelten sie mit ihrer Eifersucht. Der krokodilköpfige Sobek und der widdergehörnte Amun und selbst der schlangengestaltige Dämon Apophis beargwöhnten das kleine Volk.
Trotz aller Widrigkeiten gelang es dem Propheten mit Tricks und GONs Hilfe, die Seinen aus Ägypten in die Wüste erfolgreich hinters Gelobte Land der Väter zu führen. Ins Gelobte Land selbst konnten sie nicht, weil dieses inzwischen von den Söhnen anderer Väter bewohnt wurde. So leiteten GON und Seshmosis die Tajarim einen Tagesmarsch weiter nach Norden ins freie Byblos, wo man sich im Schmelztiegel der Levante niederlassen konnte.
Doch nicht vom Stamm der Tajarim will ich hier reden, sondern von GON, dem Gott ohne Namen.
Schon die ältesten Aufzeichnungen sprechen von einer nicht fassbaren Wesenheit, die sich einer Beschreibbarkeit durch ständige Verwandlung entzieht. Er sei »gestaltlos wie der Wind oder materialisiere in mancherlei tierischer Gestalt«, heißt es in einem frühen Papyrus, und in einem uralten Lied finden wir die Zeilen: »Der nichts erschuf, aber ständig erschafft« und »Der winzig klein die Welt durchreist«.
Die Schriften des ersten Propheten Seshmosis beschreiben GON als »groß an Macht, aber klein von Gestalt, doch diese dafür enorm wandelbar« und »dessen Macht reicht, so weit sein kurzsichtiges Auge blickt«. Alle Schriften sind sich einig, dass der Gott bei seinen Materialisationen kaum die Länge einer ägyptischen Elle erreichte. Auch sei der Wirkungsradius von GON äußerst beschränkt gewesen. Diese Beschränktheit stand wohl im Zusammenhang mit der altbekannten Tatsache, dass ein Gott nur so weit wirken kann, wie sein Auge reicht. Da der kleine Gott ohne Namen aber enorm kurzsichtig war, schränkte dies den Radius seiner göttlichen Macht doch erheblich ein. Überlieferungen sprechen davon, dass er nur fünfzig Schafe weit gewaltig wirken konnte, die weiter entfernten Schafe aber willig folgten.
Auch soll GON immer wieder Blitze eingesetzt haben, um Menschen zu disziplinieren, die seinen Tajarim Böses wollten. Dies führte selbst in größerer Entfernung von den Eingeäscherten zu spontanen Konfessionswechseln bei den Beobachtern.
Sein Volk baute dem kleinen Gott zum Dank einen hölzernen Schrein, auf dass er nun immer bei ihnen lebe. So konnten sie sich als Nomaden bei ihren Reisen seiner Gegenwart stets sicher sein.
Die Schrift sagt weiter, dass die Tajarim ein sorgenfreies Leben in Byblos führten und deshalb im Glauben an GON immer mehr nachließen. Aber der Gott wusste um die Trägheit und die Gedankenlosigkeit der Menschen und beschloss, sie nicht zu bestrafen. Nicht sehr jedenfalls, denn strafende Götter wie Jahwe, Baal und Seth gab es damals mehr als genug.
GON, der Gott der tausend Gestalten in kleiner Form, hatte nämlich schon vor langer Zeit, als er noch einen Namen besaß, aufgegeben, einen einzelnen Stamm als auserwähltes Volk hervorzuheben. Er wollte nicht mehr, dass Menschen sich für etwas Besseres hielten und dann in seinem Namen Reiche gründeten und gegen andere Reiche mit anderen Göttern in den Krieg zogen. Auch prächtige Tempelbauten und jubilierende Knabenchöre erfreuten ihn nicht.
Der kleine Gott hatte sich entschieden, sich um einzelne, scheinbar unbedeutende Wesen zu kümmern. Er wollte fortan ein Gott sein, den man nicht nur anrief, sondern mit dem man auch wirklich reden konnte.
Und von Weltuntergangsszenarien wie Armageddon, Ragnarök und Apokalypse hielt er äußerst wenig, im Prinzip gar nichts.
Links und rechts vom Weltenbaum
Ratatöskr war ein Eichhörnchen und ziemlich sauer. Den ganzen Tag hatte er damit verbracht, den Weltenbaum hinauf und hinunter zu rennen. Ständig musste er Botschaften überbringen, zwischen dem Adler Hräswelgr in der Krone und dem Drachen Nidhöggr, der in den Wurzeln hauste.
Adler und Drache waren schon seit langer, langer Zeit zerstritten und sprachen deshalb kein Wort mehr miteinander. Da es aber immer noch viele Dinge zu bereden gab, die den Baum, sprich die Welt zwischen ihnen betrafen, schickten sie das Eichhörnchen als Boten zwischen sich hin und her.
Anfangs versuchte Ratatöskr die bösen Worte der Kontrahenten zu mildern und gar zu beschönigen, doch schließlich merkte er, wie durch seine Schönfärberei der Ton zwischen den beiden immer versöhnlicher wurde. Ratatöskr erkannte, dass sein Job auf dem Spiel stand, und er beschloss zu handeln: Durch sinnvolles Umformulieren der Botschaften hassten sich inzwischen Hräswelgr und Nidhöggr wieder bis aufs Blut. Und wie die beiden hassen konnten! Immerhin bedeuteten ihre Namen »Leichenverschlinger« und »Neidhacker«.
An manchen Tagen knisterte ihre gegenseitige Abneigung den ganzen Weltenbaum entlang und führte zu schrecklichen Blitzentladungen in Midgard, in Mittelerde, der Menschenwelt. Doch der zunehmende Hass führte auch zu einer enormen Beschleunigung der zu überbringenden Botschaften, und das bedeutete Stress für Ratatöskr. Nun saß er erschöpft und ziemlich schlecht gelaunt auf einem Ast in der Zone des Baumes, die man als Midgard bezeichnete.
Der Wikinger Erik, genannt der Falkenäugige, langweilte sich. Weit und breit ließ sich niemand blicken, den er zum Kampf herausfordern konnte. Da kam ihm dieses vorwitzige Eichhörnchen gerade recht. Schnell hob er einen Stein auf, wog ihn sorgfältig in der Hand und warf ihn nach dem Tier. Ein wirklich prächtiger Wurf! Der Stein senkte sich in einer wunderbaren Flugkurve genau auf das Eichhörnchen nieder. Doch dieses fing den Stein geschickt auf und schleuderte ihn zurück. Mit zehnfacher Geschwindigkeit raste der Stein auf Erik zu.
Erik der Falkenäugige schrie schmerzerfüllt auf. Ab heute würde man ihn Erik den Einäugigen nennen.
Ratatöskr ballte seine kleine Faust und rief: »Jau! Volltreffer!«
Dann zwirbelte er triumphierend seine Ohrhaarbüschel und öffnete mit seinen Nagezähnen genüsslich eine Nuss. Der Tag war doch wesentlich besser, als er befürchtet hatte.
Über Ratatöskr erhob sich ein Rabe, der alles beobachtet hatte, mit mächtigen Schwingenschlägen in die Luft.
Seshmosis wandelte auf Wolke sieben. Natürlich nur im übertragenen Sinn, seine Füße bewegten sich ganz normal, wenn auch beschwingten Schritts durch das Hafenviertel von Byblos. Denn der Schreiber Seshmosis, Sohn eines Schreibers, der ebenfalls Sohn eines Schreibers gewesen war, fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben rundum glücklich. Seit seiner großen Fahrt mit der Galeere Gublas Stolz durfte er endlich ein Jahr ohne Abenteuer und Aufregungen erleben. Am nächsten Vollmond würde man ihn in die »Gilde der vollkommenen und auserwählten Schreiber im Orient zu Byblos« aufnehmen, ein Privileg, das nur wenigen Schreibkundigen zuteilwurde und höchste Anforderungen an den Kandidaten stellte.
Aber die absolute Krönung von Seshmosis’ Zustand der Glückseligkeit war Tani. Tani, die Schönste unter der Sonne; Tani, die Leidenschaftlichste unter dem Mond. Tani, die bezaubernde kleine Priesterin im Dienst der Göttin Seshat im »Wahren Exil-Ägyptischen Vielheiligen Vielgötter-Tempel zu Byblos«. Zugegeben, den meisten Raum dieses Vielzwecktempels beanspruchten die sogenannten »großen Götter« wie Isis, Osiris, Amun, Horus, Hathor, Anubis, und auch die »mittleren Götter« wie Apis, Methyer, Bastet, Bes, Chnum, Mafdet, Sachmet und Month machten sich ziemlich breit. Aber immerhin hatte Seshat, die »Schreiberin«, unter den »minderen Göttern« eine verhältnismäßig große Verehrungsnische in der südlichen Tempelwand, in die Tani täglich frische Opfergaben legte und vor der sie Gebete sprach.
Da dieser Dienst meist schnell erledigt war, verfügte Tani über sehr viel Freizeit, was wiederum ihrer Beziehung zu Seshmosis zugute kam. Der Schreiber seinerseits musste nur einen festen Termin pro Tag einhalten, und zwar »Die »Stunde des Dankes«« für seinen Gott ohne Namen, GON genannt, und so konnten die frisch Verliebten viel Zeit miteinander verbringen. Gerade war Seshmosis dabei, Tani im »Wahren Exil-Ägyptischen Vielheiligen Vielgötter-Tempel« abzuholen, wobei er den Weg durch den Basar nahm.
Ein Stand mit Schreibutensilien erregte seine Aufmerksamkeit; interessiert betrachtete Seshmosis das Angebot. Da unterbrach ihn eine aufgeregte Stimme: »Verschwindet, Ihr Unglücksrabe! Ihr Sendbote des Bösen, verlasst sofort meinen Stand!«
Irritiert blickte Seshmosis auf. Und er erkannte Nefer, den Händler, der ihm einst das magische Amulett von Kreta verkauft hatte.
»Geht woanders hin! Ich verkaufe Euch nichts, Ihr Diener des Verschlingers. Weichet von mir!«
»Beruhigt Euch, Nefer! Das Amulett gehörte zu den guten Artefakten, es war nicht verflucht«, versuchte Seshmosis den Händler zu beruhigen.
»Ich habe auch nie behauptet, dass ich verfluchte Amulette verkaufen würde. Ihr seid es, der verflucht ist!«
»Aber ich landete doch im Labyrinth des Minotaurus und nicht Ihr!«
»Dafür landete ich fast in Amentet oder im Hades oder im Rachen des Verschlingers oder wer auch immer mit seiner Jenseitsvorstellung recht haben mag. Zwei sehr finstere Fremde suchten mich heim und schnitten mir fast die Kehle durch. Ich verzichte gern auf das Geschäft mit Euch und bleibe dafür am Leben!«
Die Erinnerung an die beiden stets ganz in Schwarz gekleideten kretischen Mörder Nelos und Pelos ließen Seshmosis schnell davon Abstand nehmen, sich näher für ein Bronzestück mit merkwürdigen Schriftzeichen zu interessieren. Er verspürte in seiner jetzigen Lebenssituation noch weniger als sonst das Bedürfnis nach Abenteuern.
Mit einem Lächeln verabschiedete er sich von dem Händler und wünschte ihm noch ein geruhsames, langes Leben, bevor er freudig zum Arbeitsplatz seiner geliebten Tani eilte.
Die Götter Odin, Hönir und Loki waren wieder einmal unterwegs. Wobei Loki genau genommen nicht zu den richtigen Göttern gehörte; eigentlich wussten nicht einmal die Götter, ob Loki überhaupt zu irgendwem oder irgendetwas gehörte. Odin zog zwar gern mit dem Wolkengott Hönir und dem Listigen durch die Lande, aber von den anderen Asen und Wanen konnte keiner Loki leiden. Der Typ war einfach zu kompliziert – zum einen war er mehrfacher Vater, nämlich von Hel, dem Ursprung der Hölle, von Fenrir, dem Fenriswolf, und von der Midgardschlange. Zum anderen war er aber auch Mutter, nämlich von Sleipnir, dem achtbeinigen Ross, das er vom Hengst Swadilfari empfangen hatte.
Vor allem aber war er ein Trickster, dem man nicht trauen konnte und der ständig versuchte, Götter und Menschen, Riesen und Zwerge, Elfen und Trolle hereinzulegen. Keiner der Asen verstand, warum Odin einen solchen Narren an Loki gefressen und sogar Blutsbrüderschaft mit ihm geschlossen hatte.
Zu allem Übel besagte die Prophezeiung, dass der Unsympath Loki und seine furchtbare Brut eines Tages Ragnarök, »das Schicksal der Götter«, auslösen und gegen sie alle kämpfen würden.
Doch noch war es nicht so weit, und Odin, Hönir und Loki zogen in gelöster Stimmung über Land; in einer Stimmung, der man in späteren Jahren am sogenannten »Vatertag« wieder begegnen würde: ausgelassen, laut und ziemlich albern. So wanderten die drei einen quirligen, schnell fließenden Gebirgsfluss entlang und erreichten schließlich einen Wasserfall. Hönir setzte das Fass mit Met, das er mit sich schleppte, ab und klemmte es zwischen Steine, damit es nicht davonrollen konnte. Dann füllte er die Trinkhörner mit dem berauschenden Getränk und reichte zwei davon seinen Gefährten, während er sein eigenes in einem einzigen Zug leerte. Mit jedem Horn, das sie tranken, stieg die Stimmung der Wanderer.
Auf einmal blinzelte Odin heftig mit seinem einzigen verbliebenen göttlichen, aber schon ziemlich getrübten Auge, rülpste und deutete auf den Wasserfall: »Wenn das nicht Andwari ist!«
Im Wasserfall, der über einige große Steine in ein flaches Flussbett stürzte, schwamm und sprang ein stattlicher Hecht. An ihm war nichts Ungewöhnliches, außer vielleicht seine beachtliche Größe. Doch dieser prächtige Fisch war in Wirklichkeit der Zwerg Andwari in seiner Lieblingsfreizeitgestalt. Kaum jemand weiß, dass Zwerge von Haus aus Gestaltwandler sind, und sie geben sich auch alle Mühe, diese Fähigkeit nicht bekannt werden zu lassen. Man sagt, so mancher hätte sein Wissen über diese Fähigkeit der Zwerge mit dem Leben bezahlt.
Jeder Zwerg kann sich nämlich mühelos in ein anderes Wesen verwandeln – in einen Menschen oder in einen Drachen oder eben in einen Hecht. Zwerge, die dies nicht können, sind keine Zwerge, sondern Wichtel, oder sie tun nur so, als wären sie Zwerge, und sind in Wirklichkeit kleinwüchsige, militante Goldschürfer, die mit Helm auf dem Kopf und Doppelaxt in der Hand nach Bier grölen und für viel Geld fantastische, aber völlig erlogene Bücher über sich und ihre angeblichen Heldentaten schreiben lassen.
Der ebenfalls stark angetrunkene Loki ergriff nun einen Stein und warf ihn nach dem Hecht. Dabei rief er mit schwerer Zunge: »Heute gibt es zum Abendessen Zwerg!«
Mit einem kreischenden Laut des Protests, den nur Fische und Götter hören können, schnalzte der Hecht zur Seite und verschwand in der Gischt des Wasserfalls.
Stattdessen traf der Stein des Loki einen Otter, der gerade nach einem Lachs schnappte. Todwund wurde das Tier auf einen Uferstein gespült, seine Beute immer noch fest im Maul.
»Das nenne ich einen Wurf!«, sagte Hönir anerkennend. »Das gibt heute ein treffliches Menu mit Fisch und Fleisch. Und Met.«
Ein Eichhörnchen, das ganz in der Nähe auf einem Baum saß und die Szene beobachtet hatte, hielt den Atem an. Denn Ratatöskr wusste, wer soeben getötet worden war.
Die Stadt Byblos war ein natürlicher Hafen in einer sichelförmigen Bucht, die sich in Terrassen aus dem Meer Richtung Libanongebirge erhob. Der »Wahre Exil-Ägyptische Vielheilige Vielgötter-Tempel« befand sich auf der zweiten Terrasse von unten, ganz in der Nähe des größten Marktes der Metropole. Wegen des regen Handels mit Ägypten lebten viele Menschen aus dem Land des großen Stroms in Byblos, und natürlich wollten und mussten sie zu ihren heimischen Göttern beten. Außerdem war die Auswahl an levantinischen Gottheiten nicht sonderlich groß, im Vergleich zum ägyptischen Pantheon sogar lächerlich klein. Neben der lokalen Götterdreiheit Baal, Astarte und Mot gab es nur noch einige unbedeutende Dämonen, zu denen sich allerdings in jüngster Zeit eine aus dem Sinai importierte, ziemlich rigorose und eifersüchtige Gottheit namens Jahwe gesellt hatte. Und es kursierten in Byblos Gerüchte von einem kleinen, aber mächtigen Gott ohne Namen, der von geheimnisvollen Fremden verehrt wurde und große Wunder wirkte.
Tani wartete bereits vor dem Tempeltor auf Seshmosis. Bei ihrem Anblick pries sich der Schreiber erneut als den glücklichsten Menschen unter der Sonne und unter den Sternen; zumindest in dieser Stadt. Tani war seiner einstigen Liebe Rachel aus Jericho wie aus dem Gesicht geschnitten, sie war ihr in allen Belangen ebenbürtig und in einem Punkt sogar überlegen: Sie war hier, bei ihm, in Byblos.
Seshmosis begrüßte seine Geliebte mit einer vorsichtigen Umarmung, so vorsichtig, als wäre sie ein Schreibried, jenes zerbrechliche Werkzeug aus Schilfrohr, mit dem nur Schreiber richtig umgehen können.
Tani dankte Seshmosis seine behutsame Art, indem sie nicht wie andere Mädchen in ihrem Alter von den regionalen, muskelbepackten Größen im Wettlauf und Faustkampf, im Speerwurf und Steinheben schwärmte.
Zumindest nicht in Gegenwart von Seshmosis.
Die beiden schlenderten hinunter zum Hafen, wo Schiffe aus der ganzen Welt ankerten – schwarze Segler aus Kreta, ägyptische Frachtschiffe, die mit Zedernholz und Purpurstoffen beladen wurden, Galeeren aus den Tiefen des westlichen Meeres, die hellhäutige Sklaven brachten und dafür Gold mitnahmen. Qazabal, der Herrscher von Byblos, freute sich an dem regen Treiben, vor allem, weil es klingende Münzen in seine Schatzhäuser brachte. Und sein Zollinspektor Hiram, genannt »die Spürnase«, sorgte dafür, dass ihm kein einziges Goldstück entging. Zumindest versuchte er es.
Seshmosis und Tani saßen auf einem Felsblock am nördlichen Ende des Hafens und sahen und hörten nichts von der Geschäftigkeit um sie herum. Sie sahen nur sich. Wie bei allen Verliebten betrug ihr Wahrnehmungsbereich nicht mehr als eine Körperlänge.
Tanis Vater Matar handelte mit Sarkophagholz aus den Wäldern des Libanon, das er in Ägypten an die Einbalsamierer mit dem Slogan »Hält länger als die Ewigkeit« verkaufte. So hatte er es im Lauf der Jahre zu kleinem Wohlstand gebracht und konnte es sich leisten, dass seine Tochter als freischaffende Tempeldienerin die Nische der Seshat pflegte. Das brachte ihm Prestige in der ägyptischen Gemeinde von Byblos ein und kostete Tani schließlich nicht mehr als die eine Stunde Freizeit pro Tag.
Allerdings musste sie in letzter Zeit ständig Überstunden machen. Der Seshat-Glaube fand seit Kurzem in Byblos explosionsartige Verbreitung und immer mehr Anhänger. Zumindest erklärte Tani dem misstrauischen Vater ihr immer häufigeres und längeres Fernbleiben von Zuhause mit dem Umstand, dass in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Einwanderern angekommen sei, denen es an einer kompetenten Schreibergottheit mangle. Sie alle mussten an der Verehrungsnische der Seshat betreut und in die Grundzüge des Glaubens eingeführt werden. Das dauerte, vor allem, weil es sich um Ausländer handelte, die weder Ägyptisch noch Kanaanitisch sprachen. Das leuchtete Tanis Vater ein; mit Ausländern kannte er sich aus, er war schließlich selbst einer.
Dicht an dicht saßen die Liebenden. Seshmosis hatte sich eben zum achtzigsten Mal versichert, dass Tani fünf Finger an der Hand hatte, als diese plötzlich aufsprang.
»Ich kann nicht mehr sitzen, der Stein ist so hart«, jammerte sie.
»Ich finde auch, wir sollten irgendwohin gehen, wo es bequemer ist. Zu mir nach Hause zum Beispiel«, schlug Seshmosis vor.
»Heute ist es schon zu spät, lieber Sesh. Mein Vater wird immer misstrauischer und glaubt mir die Ausrede mit den vielen Einwanderern kaum noch. Lass uns lieber gehen, ich möchte keine Schwierigkeiten bekommen«, lehnte Tani ab.
Seshmosis liebte es, wenn ihn Tani zärtlich »Sesh« nannte. Und er verstand nur zu gut, dass sie Schwierigkeiten lieber aus dem Weg gehen wollte. Denn Schwierigkeiten waren dem Schreiber überaus verhasst. Schwierigkeiten, Abenteuer und Raffim lauteten die drei unangenehmsten Wörter in seinem Dasein.
Wobei die ersten beiden Begriffe sowieso schon im Namen Raffim beinhaltet waren und noch wesentlich mehr. Der dicke Händler verkörperte für Seshmosis vieles: Raffgier, Hinterhältigkeit, Verschlagenheit, Intrigen, Betrug, Diebstahl, Unterschlagung, Heimtücke, Erfolg, Gold, Macht, Ansehen, Respekt, reichlich Dienstpersonal, eine Villa und mehrere Mätressen. Wobei die Anzahl der Letzteren seit Raffims Beziehung mit einer wohlbeleibten Astartepriesterin rapide abgenommen hatte. Es gab seit dieser Liaison in Raffims Leben eigentlich überhaupt keine Mätressen mehr. In Wahrheit gab es kein Leben mehr in Raffims Mätressen, aber mit diesem Wissen wollte die Priesterin ihren Geliebten nicht behelligen.
Seshmosis begleitete Tani bis in die Nähe ihres Elternhauses auf der vierten Terrasse der Stadt. Zum Haus wagte er sich nicht, denn er wollte von den geschwätzigen Nachbarn nicht gesehen werden, die mit Sicherheit Tanis Vater vom Freund seiner Tochter berichtet hätten.
Nach einem wehmütigen Abschied machte sich Seshmosis auf den Heimweg hinauf zur siebten und höchsten Terrasse, wo er im Palast der Prinzessin Kalala ein Zimmer bewohnte. Gleich daneben lag die prachtvolle Villa seines Intimfeindes Raffim, und Seshmosis hoffte inständig, der Dicke möge ihm nicht über den Weg laufen.
Raffim lief Seshmosis nicht über den Weg. Er lauerte ihm auf.
»Ich muss mit dir reden, Schreiber!«, rief er und baute sich bedrohlich vor Seshmosis auf.
»Gerne doch, Raffim, nur zu, lass uns reden!«
»Wer ist der größte Einzahler in GONs Tempelkasse?«, fragte Raffim rhetorisch, denn er gab sogleich die Antwort: »Ich! Wer hat den göttlichen Schrein erst kürzlich prunkvoll ausstatten lassen? Ich! Warum werde ich dann nicht bevorzugt behandelt?«
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Raffim nicht ganz uneigennützig handelte und seine großzügigen Zahlungen an GONs Tempelkasse nur aufgrund einer massiven Erpressung durch Seshmosis erfolgten. Immerhin handelte Raffim im ganzen Orient erfolgreich mit Abschriften der Heiligen Rollen der Tajarim, wobei »Die Schöpfungsgeschichte«, »Die Tafel der Väter« und »Die Große Flut« bei den Religionsstiftern zwischen Euphrat und Sinai allgemein hoch im Kurs standen und »gerne genommen wurden«, wie Raffim es nannte.
Und für die Erlaubnis, Kopien anzufertigen und zu verkaufen, kassierte Seshmosis fünfzig Prozent der Erlöse für die Tempelkasse GONs, die er eigens dafür eingerichtet hatte.
»Welche Vorzugsbehandlung wünschst du denn?«, fragte Seshmosis misstrauisch.
»Ich finde, wer so viel für seine Gottheit tut wie ich, sollte darüber informiert werden, was in seiner unmittelbaren Umgebung so vor sich geht.«
»Raffim, du sprichst in Rätseln.«
Seshmosis war verwirrt, weil er wirklich keine Ahnung hatte, worauf der andere hinauswollte.
»Etwas Großes geht vor sich, und Barsil steckt mittendrin. Das spüre ich, das sagt mir mein Instinkt. Und meine Zuträger. Ich will wissen, was da vor sich geht, oder ich stelle alle Zahlungen ein!«
»Wie stellst du dir das vor? Glaubst du, GON ist ein Informant für Gauner? Das ist doch Blasphemie!«
Seshmosis’ Zorn wuchs, diesmal ging Raffim wirklich zu weit. Doch dieser ließ sich nicht beeindrucken.
»Ich weiß genau, dass Barsil ein religiöses Ding drehen will. Ich weiß nur noch nicht, was er im Einzelnen vorhat. Wehe, du hilfst ihm! Sei gewarnt!«
»Habe ich jemals Barsil dir gegenüber bevorzugt?«, fragte Seshmosis ohne Doppeldeutigkeit, denn bei allen Differenzen mit Raffim war ihm dieser doch wesentlich lieber als der hinterhältige, kriminelle Barsil.
»Versprich mir, dass du mich informierst, wenn du etwas hörst oder dir GON etwas flüstert. Es soll dein Schaden nicht sein!«
Mit diesen Worten verschwand Raffim erstaunlich flink auf sein Villengrundstück.
»Du bist zwar klein und völlig unbedeutend, Ratatöskr, aber du hast zumindest einen Vater und eine Mutter«, jammerte der goldene Eber Gullinborsti.
»Was nützen die einem, wenn sie nicht da sind, sobald man sie braucht?«, entgegnete das Eichhörnchen. »Als Loki mich verwandelte, ließen sie sich nicht blicken. Du hast zumindest zwei tolle Erschaffer. Die Zwerge Brokk und Sindri gelten weltweit als Genies!«
»Aber ich bin weder ein Wesen noch ein Ding. Dabei müsste ich doch so göttlich sein! ›Kampfschein‹ sei mein Name, sagte der Gott Freyr. Und was ist? Sie nennen mich ›Kampfschwein‹! Statt Glanz zu verbreiten, werde ich von ihnen als Schlachtfeldbeleuchtung missbraucht. Was nützt es da, dass ich über Wasser gehen und durch die Luft fliegen kann? Was nützt mir da meine ganze Einzigartigkeit?«
Krämpfe des Selbstmitleids erfassten den goldborstigen Eber, der schon seit Langem darunter litt, dass er nur erschaffen und nicht geboren worden war.
»Sei froh, dass dich Zwerge gemacht haben. Stell dir vor, du wärst das Werk von Riesen, dann hättest du jetzt mit Sicherheit die Nase am Bauch, die Füße auf dem Rücken, und du würdest aus dem Hintern gucken«, versuchte Ratatöskr den manisch-depressiven Freund zu trösten, was ihm aber gründlich misslang.
Gullinborsti, der sich an seinen guten Tagen »das dritte Gestirn am Himmel neben Sonne und Mond« nannte, grunzte verächtlich und stapfte wütend davon. Das Eichhörnchen hörte ihn nur noch grummeln: »Brauch keine Freunde, brauch niemanden, brauch keinen, nix, gar nix brauch ich.«
»Wer baut eigentlich einen Tempel für einen Gott, der den Beinamen ›Der große Verschlinger‹ trägt?«, fragte ein unförmiger Schatten, aus dem eine extrem lange Nase herausragte.
»Vielleicht jemand, der Angst hat«, mutmaßte eine zweite verhüllte Gestalt.
»Könntet ihr bitte mit dem Philosophieren aufhören und eure verdammte Arbeit machen? Los jetzt!«, befahl eine dritte Stimme in der Dunkelheit.
Das Gitter gab endlich seinen Widerstand gegen die numerische Übermacht von zwei Brecheisen auf und wich knirschend der Gewalt.
»Geht doch, Barsil«, triumphierte ein Schemen.
»Keine Namen, Mumal, du Idiot«, raunte der als Barsil Bezeichnete.
»Es hört uns doch sowieso keiner«, beschwichtigte die Nase.
»Aber ER könnte uns hören, Mot; es ist schließlich sein Tempel.«
»Dann hoffen wir nur, dass er gerade nicht zu Hause ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn unser Besuch nicht sehr erfreut.«
»Die Priester kommen uns sicher nicht in die Quere, die schlafen in ihren Quartieren ihren Rausch aus. So einen wirkungsvollen Trunk hat denen vor mir noch keiner spendiert«, sagte Barsil stolz.
Barsil galt im Stamm der Tajarim als der Zwielichtigste, aber auch als einer der Reichsten, wobei Letzteres mit Ersterem in unmittelbarem Zusammenhang stand. Barsil war von Jugend an erfolgreicher Verkäufer von Gebrauchtwaren, wobei die Vorbesitzer sich meist nicht freiwillig von ihrem Eigentum getrennt hatten. Und so mancher hatte den Trennungsschmerz nicht überlebt.
Meist arbeitete Barsil aus Eigeninitiative, doch diesmal war er im Auftrag unterwegs. Ibiranu IV., Herrscher von Ugarit, bezahlte ihn für den Einbruch in den Tempel des Mot in Byblos, und Barsil durfte die Beute sogar behalten. Ibiranu ging es lediglich darum, in dem nördlich gelegenen, konkurrierenden Stadtstaat Unruhe zu stiften. Möglichst viel Unruhe.
Daraufhin hatte Barsil den Steinbrucharbeiter Mumal und den Ochsentreiber Almak engagiert, auf dass sie ihm bei dem nächtlichen Einbruch halfen. Die beiden waren kräftig genug, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, und dumm genug, um garantiert nicht zu verstehen, worum es eigentlich ging.
Die drei Eindringlinge schlüpften durch das nunmehr entgitterte Fenster und landeten in einem Raum, der ganz offenbar als Rumpelkammer diente. Dem für diesen Raum zuständigen Priester war das Wort »Ordnung« mit Sicherheit noch nie begegnet. Kultgegenstände wie Kelche, Schalen und Tabletts wetteiferten mit abgebrannten Fackeln, blutigen Stofffetzen und den Schädeln diverser Tiere um den begrenzten Platz auf dem Fußboden.
Im Licht des halben Mondes balancierten die Einbrecher, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, durch das Chaos zur Tür, von der sie hofften, dass sie zum Tempel führen würde.
Der große, muskulöse Mumal erreichte sie als Erster und öffnete sie mit einem kräftigen Ruck. Dann schlüpfte er durch die Tür, und die beiden anderen folgten ihm.
Im großen Tempel des Mot zu Byblos glühten in dreizehn bronzenen Dreifüßen Tag und Nacht die Kohlefeuer. Zu Ehren von Mot, dem großen Verschlinger, der jedes Jahr nach der Ernte den mächtigen Gott Baal tötete und in die Unterwelt verbannte. Mot, der Regent der unfruchtbaren Zeit. Mot, dessen Name in allen Sprachen der Welt »Tod« bedeutete.
Zu seinem Leidwesen wurde Mot aber regelmäßig im Frühling von Astarte, der Gemahlin von Baal, besiegt und seinerseits in die Unterwelt geschickt. Und so wechselten sich Baal und Mot Jahr für Jahr in der Herrschaft über Welt und Unterwelt ab.
Kein vernünftiger Mensch hätte es gewagt, einem solchen Gott etwas zu stehlen, noch dazu ein heiliges Relikt. Doch Barsil war kein vernünftiger Mensch, er war ein Dieb aus Leidenschaft. Dabei hatte er es schon lange nicht mehr nötig zu stehlen, doch er konnte einfach nicht damit aufhören. Je riskanter ein illegales Unternehmen war, desto größere Befriedigung empfand Barsil.
Doch auch wenn er kein Risiko scheute, so war er keineswegs ein Trottel. Vorsichtig näherte sich Barsil dem Altar und bedeutete seinen Helfern, ihm zu folgen. Immer wieder blickten sich die drei Tajarim um, ob nicht einer der Priester auftauchen würde. Der gespendete Schlummertrunk hatte seine Wirkung jedoch nicht verfehlt, keiner störte sie.
Am Altar angelangt, atmete Barsil tief durch, bevor er furchtsam die Hände nach dem heiligsten Artefakt des Gottes Mot ausstreckte. Aber kurz bevor seine Finger den lebensgroßen, aus einem einzigen Rubin gefertigten Menschenschädel erreichten, zog Barsil sie wieder zurück. Stattdessen nahm er Almak den Sack ab und forderte Mumal auf: »Los jetzt, pack du ihn ein!«
»Zugreifen« und »Einpacken« gehörten zu den wenigen Dingen, die Mumal auf Anhieb verstand, und so griff er schnell zu und steckte das Artefakt vorsichtig in den aufgehaltenen Sack.
Mit einer Kopfbewegung gab Barsil das Zeichen zum Verschwinden und die drei nahmen den gleichen Weg zurück.
Nicht weit vom Ort des Geschehens schnarchten dreizehn Motpriester der leibhaftigen Begegnung mit ihrem Gott entgegen.
Die Sonne berührte fast den Horizont, und lange Schatten liefen den drei schwankenden Wanderern hinterher, als sie ein Haus erreichten. Es war – typisch für diese Gegend – mehr in die Erde hineingebaut, als auf ihr errichtet, und das Dach war zur Gänze mit Moos bewachsen.
Odin hämmerte mit der Faust gegen die aus groben Brettern gezimmerte Tür und rief mit schwerer Zunge: »Aufmachn! Wir wolln rein!«
Als sich nicht gleich eine Reaktion zeigte, hieb der Gott erneut mit der Faust gegen die Tür, diesmal so hart, dass sie barst.
»Ups! Das wollt ich nich«, lallte Odin und torkelte in die Stube. Hönir und Loki folgten ihm, ohne zu zögern.
An einem Tisch saßen zwei Männer und schauten die Eindringlinge erbost an. Einer von ihnen hatte schmutzig-graue lange Haare und einen ebensolchen Bart, der ihm bis auf die Brust reichte. Von Kleidung konnte man bei ihm ebenso wenig sprechen wie bei dem jüngeren, schwarzhaarigen Mann. Beide Körper waren lediglich von grob zusammengehefteten Rupfen bedeckt.
»Wer seid ihr, und was wollt ihr?«, fragte der Ältere der beiden ungehalten.
»Ich bin Odin, dein Gott! Und das ist mein Abendessen!«
Mit diesen Worten warf Odin den Otter und den Lachs auf den Tisch. Hönir und Loki nickten stumpfsinnig dazu, und der Wolkengott stellte das Metfass neben die beiden Kadaver.
Entsetzt starrten die beiden Männer auf den toten Otter. Dann deutete der Grauhaarige auf das Tier und brüllte: »Ihr Mörder! Ihr habt meinen Sohn umgebracht!«
Im gleichen Augenblick verwandelte sich der Jüngere blitzschnell in eine riesige Spinne. Noch bevor Odin, Hönir oder Loki reagieren konnten, waren sie schon in einem dichten, klebrigen Gespinst gefangen. Als die drei eingesponnen waren, veränderte die Spinne wieder ihre Gestalt und verwandelte sich zurück in einen Mann. »Ich bin Regin, der Bruder von Otter, und ihr werdet meinem Vater und mir Wergeld für diesen Mord bezahlen!«
Schlagartig war Odin nüchtern.
»Wie, was, dein Bruder? Warum tummelt er sich dann als Otter in einem Wasserfall?«
»Weil er, wie wir, ein Gestaltwandler war, göttlicher Trunkenbold! Und es beliebte meinem Sohn eben, als Otter Lachse zu jagen. Deshalb gaben wir ihm den Namen Otter«, antwortete der Ältere, der Hreidmar hieß.
»Ihr habt Glück, dass mein Bruder Fafnir nicht hier ist, sondern derzeit in Burgund weilt! Er hätte auf die Sühne des Wergelds sicher verzichtet und euch gleich getötet.«
»Vielleicht kommt es ja noch dazu, dass wir wenigstens zwei von euch töten, wenn der, den ihr ausschickt, das Wergeld zu holen, nicht bis zum nächsten Sonnenuntergang zurückgekehrt ist.«
Der Alte zückte hasserfüllt ein Messer. Dann ergriff er mit seiner Linken den Otter, setzte einige wenige gezielte Schnitte und zog dem Tier routiniert das Fell über die Ohren.
»Ich verlange, dass der Balg meines Sohnes mit rotem Gold gefüllt und von außen mit gelbem Gold umhüllt wird. Kein einziges Haar darf mehr sichtbar sein!«, forderte Hreidmar. Dabei siegte die Gier eindeutig über die Trauer.
Odin war der Spaß an diesem Ausflug gründlich verdorben, und er ordnete an: »Loki, es ist an dir, das Wergeld aufzutreiben. Du kennst dich hier in der Gegend am besten aus und weißt, wo man so viel Gold herbekommen kann. Die Zeit ist zu kurz, um den weiten Weg nach Asgard und hierher zurück zu schaffen.«
Und so ließen Hreidmar und Regin den Loki frei, auf dass er das Wergeld als Sühne für den Tod Otters besorge.
Immer noch beschwingt von seinem Treffen mit Tani, betrat Seshmosis sein Zimmer. Raffim und sein Anliegen bekümmerten ihn überhaupt nicht. Sollten er und Barsil ihre finsteren Angelegenheiten unter sich ausmachen, ihn ging das alles nichts an. Dachte er.
Ehrfürchtig verbeugte sich Seshmosis vor dem kleinen Schrein von GON, der in letzter Zeit mit den Einnahmen aus dem Schriftenverkauf wesentlich nachgebessert worden war. Den einst schlichten Holzkasten, den Schedrach, der Karrenbauer, gefertigt hatte, zierten nun an den vier oberen Ecken vier vergoldete Cherubim: ein geflügeltes Kalb, eine geflügelte Katze, ein Falke und ein geflügelter Fisch, der ziemlich waghalsig auf seiner Schwanzflosse balancierte.
Inmitten der Cherubim erschien plötzlich eine fünfte Gestalt, die diese kaum überragte – ein geflügelter Drache.
Seshmosis wusste, wer da in Wirklichkeit erschienen war, und sagte respektvoll: »Mein Herr, ich freue mich, dich zu sehen.«
Der dreißig Zentimeter große Drache hüstelte, wobei er kleine schwarze Rauchwolken ausstieß. Dann blickte er von einem Cherub zum anderen.
»Ich habe mich immer noch nicht an diese Dekoration gewöhnt. Man hat ja kaum noch Platz, auf seinem eigenen Schrein zu materialisieren.«
»Aber es sieht sehr gut aus, Herr, das sagen alle.«
»Na ja, wenn die Menschen so etwas brauchen, damit der Glaube leichter fällt, dann sollen sie es haben. Aber nun zu uns, mein lieber Prophet. Ich habe eine neue Aufgabe für dich!«
»Aber gern, mein Herr«, sagte Seshmosis in echter Demut.
»Es ist eher ein Auftrag denn eine Aufgabe. Es ist sozusagen etwas komplizierter, langwieriger.«
Der kleine Gott brach ab und rang sichtlich nach Worten. Seshmosis wurde misstrauisch. Dann dämmerte es ihm.
»Willst du, dass ich dafür Byblos verlasse?«, fragte er entsetzt.
»So könnte man sagen. Der Auftrag lässt sich nicht in Heimarbeit erledigen. Eine Reise ist unbedingt erforderlich.«
»Aber das geht nicht! Ich bin verliebt!«, protestierte Seshmosis.
»Ich weiß«, erwiderte der kleine Gott. »Schließlich war ich am Zustandekommen dieser Beziehung nicht ganz unbeteiligt.«
»Wie? Du hast? Was genau? Und warum?«, stammelte der Prophet.
»Es ist schon erschreckend, wie ein Mann des Wortes ins Stottern gerät, wenn es um die Liebe geht.«
»Was hast du? Und überhaupt?«
»Schon gut, schon gut. Ich möchte doch, dass du glücklich bist. Aber bitte lass uns jetzt zu deinem Auftrag kommen.«
»Nein! Es gibt keinen Auftrag! Beim nächsten Vollmond werde ich in die ›Gilde der vollkommenen und auserwählten Schreiber im Orient zu Byblos‹ aufgenommen. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Nein, antworte bitte nicht, denn du weißt es nicht, auch wenn du ein Gott bist! Götter haben von so etwas keine Ahnung, weil sie nicht wissen, was für Menschen wichtig ist.«
»Erklär es mir bitte, Seshmosis. Ich möchte dich verstehen«, bat GON.
Seshmosis war überrascht. Der kleine Gott interessierte sich wirklich für ihn.
»Um in diese Gilde aufgenommen zu werden, muss man Ägyptisch sowohl in Hieroglyphen als auch in demotischen Zeichen schreiben können. Ebenso ist es erforderlich, die assyrische Keilschrift perfekt zu beherrschen. Aber das ist noch lange nicht alles; vor allem muss man mit dem neu erfundenen phönizischen Alephbet, das nur noch aus zweiundzwanzig Zeichen besteht, vertraut sein und es auf alle gängigen Sprachen übertragen können.«
»Respekt, mein Lieber. Ich weiß, dass du dies alles kannst«, sagte der kleine Drache. »Und weiter?«
»Weiter? Was weiter? Ach so! Sie nehmen nicht jeden, es kommt auch noch auf die charakterliche Eignung an. Bei der geheimen Abstimmung werfen die Mitglieder dann weiße oder schwarze Kugeln in einen geschlossenen Kasten, Weiß für Ja und Schwarz für Nein. Ich wurde beim letzten Gildentreffen hell leuchtend gekugelt! Nur weiße Kugeln, keine Gegenstimme! Keine einzige schwarze Kugel ist bei mir gefallen!«, rief Seshmosis voller Stolz.
»Ich wusste schon immer, dass du toll bist. Seit unserer ersten Begegnung in Ägypten. Deswegen bist du ja auch mein auserwählter Prophet. Doch nun zu deinem Auftrag: Einer deiner Nachfahren ist in ernster Gefahr.«
»Das hat er anscheinend von mir. Was ist daran so besonders?«, fragte der Schreiber.
»Er ist leider der Letzte«, sagte der Drache leise und senkte das geschuppte Haupt.
»Wie – der Letzte? Ich verstehe nicht.«
»Nun ja, deine Nachkommen sind nicht ganz so zahlreich wie die Sterne am Himmelszelt.«
»Meine Familie war nie sonderlich expansiv. Wie viele Nachkommen habe ich denn?«, wollte Seshmosis wissen.
»Zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, um den es geht, nicht sehr viele. Um genau zu sein: nur noch diesen Einzigen. Ihn müssen wir unbedingt retten!«
Auf einer Energieebene, die sich in Byblos und doch nicht in Byblos befand, tobte Mot. Er fühlte sich persönlich beleidigt und war außerordentlich wütend wegen des Einbruchs in seinen Tempel.
Vor allem die Tatsache, dass bei diesem Frevel durch die Unfähigkeit seiner Priester keinerlei Blutvergießen stattgefunden hatte, betrachtete er als Lästerung seiner eigenen düsteren Präsenz.
Nun ertönte im großen Tempel des Mot zu Byblos ein schrilles Kreischen. Dreizehn völlig verkaterte Priester erwachten schlagartig aus ihrem Tiefschlaf. Der Hohe Priester Zarot rieb sich erstaunt die Augen: Der ganze Tempel schien zu glühen. Ein blutrotes Wabern erfüllte den Raum, und wohin er sich auch wandte, sah er dieses kreischende rote Etwas. Auf einmal formte sich das gestaltlose Wabern zu einem riesigen Maul und verschlang Zarot und die anderen Priester. Sie wurden einfach in das Etwas hineingesogen und waren verschwunden.
Vor dem Altar, an der Stelle, an der vor Kurzem noch ein Schädel aus einem roten Rubin gelegen hatte, bildete sich eine Gestalt. Eine erschreckend menschliche Gestalt.
Langsam und bedächtig sah sich der Mann im Tempelraum um. Dabei sog er immer wieder Luft durch die Nase ein, so als wolle er Witterung aufnehmen wie ein Bluthund. Genau das tat er auch. Mot, der Mensch, machte sich auf die Suche nach denjenigen, die seinen Tempel geschändet hatten. Und wenn es sein musste, würde er sie bis ans Ende der Welt verfolgen.
Im Gebäude der Stadtwache von Byblos herrschte helle Aufregung. Dutzende von Gläubigen wehklagten in allen Fluren und Räumen, weil aus dem Tempel des Mot über Nacht alle dreizehn Priester spurlos verschwunden waren.
»Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Bluttat an den Priestern.«
Mit dieser Auskunft versuchte Kommandant Maduk, seinen Besucher zu beruhigen. »Alle Blutspuren, die wir fanden, stammen vom normalen Opferbetrieb, da sind wir sicher.«
Doch Sekanka, Beauftragter des Herrschers von Byblos für religiöse Angelegenheiten, ließ sich nicht beruhigen.
»Dreizehn Motpriester verschwinden nicht einfach so. Da steckt mehr dahinter! Es würde mich nicht wundern, wenn die Baalpriester ihre Hände im Spiel hätten. Oder vielleicht ist es sogar eine Verschwörung von außerhalb.«
Kommandant Maduk war ein entschiedener Gegner von Verschwörungstheorien. Er glaubte, dass die normalen kriminellen Energien völlig ausreichten, um Böses in die Welt zu setzen. Deshalb sagte er ganz gelassen: »Wir gehen derzeit davon aus, dass die dreizehn sich zusammengetan haben, um gemeinsam den Menschenschädel-Rubin zu stehlen. Ich vermute jedenfalls, dass sich die abtrünnigen Priester mit ihrer Beute auf der Flucht befinden.«
»Nie hätte Zarot seinen Gott bestohlen«, wandte Sekanka ein.
»Was wissen wir schon von der Kraft der Versuchung? Wenn einer jahrelang tagtäglich mit so einem riesigen Juwel zusammenlebt, wächst die Begierde, und eines Nachts ist sie so groß, dass sie nicht mehr kontrollierbar ist. Auf jeden Fall suchen wir weiter nach Hinweisen.«
Damit war für Kommandant Maduk das Gespräch beendet.
Die Wölfe Skalli und Hati jagten schon seit undenklich langer Zeit. Doch keiner Beute galt ihre tägliche Hatz, sondern der Sonne. Skalli und Hati sorgten dafür, dass sie jeden Morgen im Osten loslief und am Abend im Westen verschwand. Dann durften die beiden Wölfe ruhen. Oder ganz normale Wölfe sein und das tun, was Wölfe nachts eben tun.
Zum Beispiel den Mond anheulen.
An diesem Tag war Hati besonders übermütig und kam der Sonne so nah wie nie zuvor. Immer wieder schnappte er verspielt wie ein Welpe nach ihren Strahlen. Gerade wollte er in eine Flammeneruption beißen, als er einen kleinen schwarzen Fleck entdeckte. Der Wolf hechelte noch näher an den Glutball heran und missachtete die warnenden Rufe von Skalli.
Abrupt blieb Hati stehen.
»Bist du verrückt geworden?«, fragte Skalli. »Zuerst rückst du der Sonne auf den Pelz wie nie zuvor, und dann bleibst du unvermittelt stehen. Willst du, dass die Zeit erstarrt? Wenn wir jetzt aufhören zu laufen, ist es für immer Mittag.«
Hati schloss wieder zu seinem Freund auf, aber nicht, weil dieser ihn überzeugt hatte, sondern nur, damit er nicht so laut schreien musste.
»Lass es, Skalli! Bleib einfach stehen. Die Sonne wird sich weiter bewegen.«
»Du weißt genau, dass sich die Sonne nicht von allein bewegen kann. Jeder weiß das!«
»Natürlich weiß ich das«, antwortete Hati entrüstet. »Aber geh doch näher ran, so nah wie ich vorhin, und achte auf den kleinen, dunklen Fleck.«
Skalli hatte die Wolfsschnauze endgültig voll und rannte ganz nahe an die Sonne heran, damit Hati endlich Ruhe gab. Als ihm die Hitze schon fast die Tränen in die gelben Augen trieb, sah er, was der Freund meinte: Ein Käfer schob die Sonne über den Himmel.
»Wer bist du, und was, um aller Götter willen, tust du hier?«, rief Skalli erbost.
Der Käfer drehte langsam den Kopf zu ihm und antwortete: »Mein Name ist Chepre, und ich stamme aus Ägypten. Ich mache diese Arbeit schon, so lange ich denken kann. Es ist sehr freundlich von euch, dass ihr mich seit einiger Zeit begleitet. Vorher war es doch enorm einsam hier oben.«
»Aber wie kommst du als Ausländer dazu, unsere Sonne über den Himmel zu schieben?«, frage Hati konsterniert.
»Ich kann euch verraten, dass es nicht eure Sonne ist. Sie ist in jedem Land gleich. Ich mache diese Arbeit schließlich schon seit Urzeiten im Auftrag der Götter.«
»Aber wir arbeiten doch auch für die Götter!«, wandte Skalli ein.
»Eure Götter sind jünger als meine. Deshalb schiebe ich die Sonne und ihr jagt lediglich hinterher. Basta! Und jetzt lasst mich weitermachen, die Menschen wundern sich schon, dass die Sonne stillsteht.«
Im frühen Morgengrauen brach Loki auf, und nach zwei Stunden erreichte er den Wasserfall, an dem er Hreidmars Sohn Otter getötet hatte. Es dauerte nicht lange, bis in Ufernähe ein mächtiger Hecht erschien, der sich sogleich in einen Zwerg verwandelte.
»Schmeckte der Braten nicht, Schnellschwätzer?«, fragte Andwari zynisch. »Das war wohl nichts mit Fisch und Fleisch. Mir scheint, diesmal hast du den Falschen erwischt.«
»Du hast den Stein auf Otter gelenkt, jetzt wird mir einiges klar!«
»Kannst du es beweisen, Wortverdreher?«
»Das kann ich nicht. Aber ich weiß, dass du das Wergeld bezahlen wirst!«
Mit einer blitzartigen Bewegung warf Loki ein Netz über den Gestaltwandler.
Es war ein ganz besonderes Netz, denn es gehörte der Meerriesin Ran, die damit gewöhnlich die Ertrunkenen auffischte und in ihr unterseeisches Totenreich brachte. Weil Loki das magische Netz vor einiger Zeit »ausgeliehen« hatte, musste Ran nun die Opfer der See umständlich von Hand einsammeln. Deshalb gehörte auch sie, die Gattin des Meerbeherrschers Ägir, zu denen, die noch eine Rechnung mit Loki offen hatten. Und in diesem Fall war es eine sehr große.
Aus dem Netz von Ran gab es kein Entrinnen und Andwari wusste das.
»Gut, du hast mich, ich bezahle das Wergeld«, räumte der Zwerg resigniert ein.
»Ich wusste doch, dass du hilfsbereit bist«, höhnte Loki. »Wo hast du dein Gold versteckt? Ich will alles Gold, das du besitzt, dein anderes Hab und Gut magst du behalten!«
»Bring mich zur Felsnase neben dem Wasserfall!«, forderte Andwari. Loki warf sich das Netz mit seinem Gefangenen über die Schulter und marschierte los.
Als sie den auffälligen Felsen erreicht hatten, murmelte der Zwerg einige unverständliche Worte. Obwohl Loki seine extrem guten Ohren spitzte, konnte er die zauberische Formel nicht verstehen.
Begleitet von einem knirschenden Geräusch, teilte sich der Fels in der Mitte und gab einen Durchlass frei. Schnell schlüpfte Loki mit Andwari durch den Spalt in die Höhle. Ein typisch niedriger Zwergenstollen führte in einer steilen Neigung in den Berg hinein. Immer wieder zweigten links und rechts weitere Gänge ab, die Loki aber ignorierte. Erst als sich der Hauptgang gabelte, fragte er: »Und wohin jetzt?«
»Den linken Gang und an der nächsten Gabelung rechts. Dann führen Stufen hinab in meine Haupthöhle und zu meinem Schatz, du Dieb!«
»Aber, aber! Ich sorge nur dafür, dass das Gold in Bewegung bleibt. Und ich liebe es, wenn es sich auf mich zubewegt.«
Nach kurzer Zeit erreichte Loki die Haupthöhle des Zwerges und öffnete den kleinen Verschlag, den Andwari als seine »Schatzkammer« bezeichnete. In der Felsnische lag einiges von Wert, vor allem erlesene Pelze, einige prächtige Schwerter, fein ziselierte Äxte und kostbare Speerspitzen und Lanzenblätter. Doch der Trickstergott beachtete sie ebenso wenig wie die Juwelen und Perlen, die Andwari in kleine Weidenkörbchen sortiert hatte. Wohl aber interessierte Loki der Inhalt einer hölzernen, mit Eisen beschlagenen Truhe. In ihr bewahrte Andwari sein Gold auf. Loki räumte sie vollständig leer und verstaute alles in einem groben Leinensack.
»Das müsste reichen, den Otterbalg zu füllen und das Fell zu bedecken!«
»Dann lass mich wieder frei! Ich habe deine Wünsche erfüllt«, forderte Andwari.
»Nicht ganz, nicht ganz. Ich hörte da von einem ganz besonderen Ring, den man Andwaranaut nennt. Ist der nicht auch aus Gold? Willst du mir dieses reizvolle Schmuckstück etwa vorenthalten?«
»Was macht ein einzelner Ring schon aus? Du sagtest gerade selbst, dass du genug Gold hast, das Wergeld zu bezahlen.«
»Mir scheint, dieser Ring ist etwas ganz Besonderes. Du willst mich doch nicht betrügen, oder? Sonst müsste ich dich vielleicht doch noch auf den Rost legen. Gegrillter Hecht schmeckt vorzüglich!«, drohte Loki.
»Verdammt seist du! Er liegt unter dem schwarzen Stein am Ende der Höhle. Nimm ihn hin, doch höre meinen Fluch: Vater und Sohn soll er bringen den Tod, Fürsten und Reiche entzweien, Gefährten trennen und Freunde verfeinden! Fehde und Krieg sollen entbrennen! Niemandem nütze mein Gut!«
»Starke Worte, Zwerg, doch ich werde den Ring nicht behalten, also wird dein Fluch mich nicht treffen.«
»Um dein Schicksal muss ich mich nicht kümmern, das steht nicht in meiner Macht. Das haben die Nornen längst gewebt, und es wird gewiss kein gutes sein. Und nun lass mich frei!«
Nachdenklich löste Loki das Netz der Ran und entließ Andwari in die Freiheit. Der Kerl wusste anscheinend etwas, von dem er selbst noch keine Ahnung hatte, und das beunruhigte ihn. Doch zuerst musste er sich darum kümmern, dass Odin und Hönir wieder freikamen.