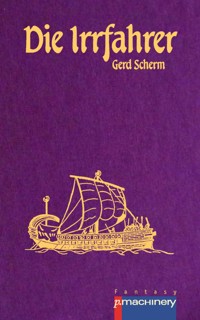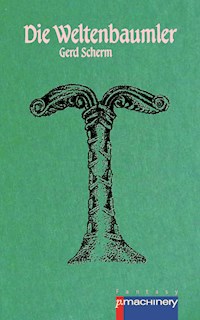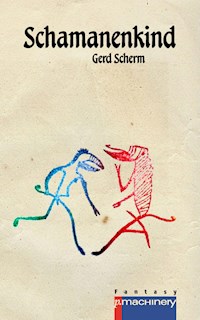Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählungen einer Kindheit und Jugend in den 1950er und 60er Jahren - das Kinderleben auf der Straße, die erbarmungswürdige Wohnsituation, der alltägliche Mangel, das Träumen und Hoffen. Ein Buch, das die Nachkriegszeit und das beginnende Wirtschaftswunder in Westdeutschland unprätentiös und humorvoll schildert. Gerd Scherm erzählt dies in einer Sprache, die Stimmungen nachvollziehbar macht, die Distanz wahrt und doch Nähe schafft. Den Geschichten sind zeitgenössische Fotos der Schauplätze und auch der Menschen zugeordnet. Sie vermitteln im Wortsinn ein Bild jener Zeit, die geprägt war von Schwarz und Weiß und sehr, sehr viel Grau. Vielleicht ist es gerade dieser Farbkontrast zu unserer heutigen Multimedien-Multicolorwelt, der uns diese, doch so nahe Zeit schon jetzt unendlich fern erscheinen lässt. Das Fazit des Autors: Bei allen Widrigkeiten und Hindernissen habe ich vor allem zwei Dinge gelernt: zum einen, dass eine positive Einstellung die Lage zumindest nicht verschlechtert, zum anderen, dass Hoffen nichts kostet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Autors
Vorwort Barbara Ohm
Hoffen kostet nichts
Ein Lehrer mit Kopfschuss
Auf Dreizehn
Besuch aus der Ostzone
Arbeit
Wirtschaftswunder made in Fürth
Dem Feuer zur Wehr
Ausflug aufs Land
Der Affe des Drogisten
Von Cowboys, Rittern
und anderen Landfriedensbrechern
Der deutsche Lotto-Meister
Die Schatzkammer am Schießanger
Ein Metzger wird geschlachtet
Verwandtschaft und andere Verhältnisse
Freddy und der Gelbe Löwe
Die Karpfenburg
Baracken und Schmusehasen
Juden Heggisch
Die Spanier sind da
Die Sache mit dem Sex
Das elektrische Paradies
Freibad – Zahlbad
Schule und andere Katastrophen
Immer wieder sonntags
Wie der Beat nach Fürth kam
Brillenschlange und Bücherwurm
Tante Hertha
Biographie Gerd Scherm
Bibliographie Gerd Scherm
Vorwort des Autors
1997 erschien unter dem Titel „Die Karpfenburg“ mein erster Band mit Kindheitsgeschichten aus der Fürther Altstadt. Da seit einiger Zeit diese Auflage vergriffen ist, ich gleichzeitig aber eine Vielzahl neuer Geschichten geschrieben habe, machte es Sinn, alle diese Erzählungen in einem einzigen, dem hier vorliegenden Band zusammen zu fassen.
Ich denke, meine Erzählungen sind zum einen kleine Facetten einer „ungeschriebenen“, da völlig nebensächlichen Fürther Stadtgeschichte. Zum anderen sind sie ein „von unten“ gesehenes Bild vom Leben dieser Zeit im Westen Deutschlands.
Denn viele meiner Leser, egal woher, erzählten mir, dass sie es ebenso oder ähnlich erlebt hatten:
der Lehrer mit dem Stock, das Kinderleben auf der Straße, die erbarmungswürdige Wohnsituation, der alltägliche Mangel, das Träumen und Hoffen.
Deshalb sind meine Geschichten auch die Geschichten von vielen tausend anderen, die in jener Zeit ins Leben aufgebrochen sind.
Wie bei der „Karpfenburg“ habe ich meinen Geschichten zeitgenössische Fotos der Schauplätze und auch der Menschen zugeordnet. Sie vermitteln im Wortsinn ein Bild jener Zeit, die geprägt war von Schwarz und Weiß und sehr, sehr viel Grau. Vielleicht ist es gerade dieser Farbkontrast zu unserer heutigen Multimedien-Multicolorwelt, der uns diese, doch so nahe Zeit schon jetzt unendlich fern erscheinen lässt.
Bei allen Widrigkeiten und Hindernissen habe ich vor allem zwei Dinge gelernt: zum einen, dass eine positive Einstellung die Lage zumindest nicht verschlechtert, zum anderen, dass Hoffen nichts kostet.
Gerd Scherm
Binzwangen im Oktober 2002
Vorwort
Vor einiger Zeit bekam ich Post aus Colmberg, wo Gerd Scherm jetzt lebt: Die ersten vier Geschichten seiner Jugend in der Fürther Altstadt. Unverhofft hatte ich abends vor dem Einschlafen eine vergnügliche Lektüre, Geschichten aus den fünfziger und sechziger Jahren - aus einer Zeit, die eigentlich noch so nahe ist und doch schon unendlich weit weg.
Auf die versprochenen weiteren Geschichten wartete ich schon und tauchte dann mit ihnen ein in die Fürther Altstadt und ihre Häuser, in denen zum Beispiel das Wohnzimmer der Familie Scherm so lag, dass alle Hausbewohner durchgehen mussten, wenn sie ihre Kohlen aus dem Keller holten, wo ein Plumpsklo am Ende des offenen Arkadengangs eine Steigerung der Lebensqualität bedeutete im Gegensatz zum Klo auf dem Hof; tauchte ein in eine Kindheit, in der Salzheringe mit ihrem Geruch von weither Kinderträume und Kinderglück bedeuteten, ein ausgeliehener Fußball eine begehrte Kostbarkeit war, in der Kinderbanden Ritterschlachten zur Verteidigung der Altstadt schlugen (wie gut, dass die Altstädter gewonnen haben!); tauchte ein in eine Zeit, in der die kleine Leihbücherei in der Gustavstraße das Erlebnis der großen weiten Welt vermittelte, Freddy Quinn im „Gelben Löwen“ ohne besonderen Erfolg sang, jedem Fürther das Wort „Weierräimla“ geläufig war und Kinder wie Erwachsene in einer engen nachbarschaftlichen Verbundenheit lebten.
Meine Lieblingsgeschichte ist das „Wirtschaftswunder made in Fürth“, weil man in dieser Geschichte erfährt, dass der Ludwig Erhard aus der Sternstraße gar nicht anders konnte. Er hat es nämlich in Fürth vorgemacht bekommen, wie das geht mit dem Wirtschafts-wunder. Nicht nur die Fürther Aushängeschilder der Wirtschaftswunderzeit, Max Grundig und Gustav Schickedanz, sondern auch die Fürther Kinder (und Gerd Scherm) hatten die ökonomischen Zusammenhänge begriffen und zeigten es dem Erhard, wie man in Notzeiten effektiv, schnell und gewinnbringend die Wirtschaft ankurbelt.
In diesem Band legt Gerd Scherm autobiographische Skizzen vor. Ganz behutsam schreibt hier ein geborener Fürther, wie er das Fürth seiner Jugend erlebt hat. Mir gefällt das gut, weil ich viele Dinge erfahre, die ich niemals in den Quellen finden kann, Fakten, Ereignisse, Zeitstimmungen, die sich dem zugereisten Fürther verschließen. Aber das allein ist es nicht. Ich gebe diesen Erinnerungen deshalb gerne meine guten Wünsche auf den Weg, weil sie so unprätentiös daherkommen, hingetupft, assoziativ:
So habe ich es erlebt.
Ich mag dieses Büchlein: Das liegt nicht nur am Inhalt, viel mehr noch macht das die Sprache aus, die Stimmungen nachvollziehbar macht, die Distanz wahrt und doch Nähe schafft.
Lauter Geschichten erzählt uns Gerd Scherm, die so viel über Fürth und die Nachkriegszeit berichten, über eine Zeit, die viele von uns miterlebt haben und die kaum mehr etwas mit der heutigen zu tun hat.
Alle diese Geschichten sind ein Lesevergnügen.
Barbara Ohm
Stadtheimatpflegerin Fürth
Hoffen kostet nichts
Stell dir vor, die Schule ist aus und du weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Zuhause fällt dir die Decke auf den Kopf, die Eltern sind arbeiten und das Wetter ist zu schlecht, um zum Fluss oder zum „Spielhäusla“ am Schießanger zu gehen. Der geneigte Leser mag jetzt einwenden, dass es angebracht wäre, die Hausaufgaben zu machen. Aber diese Möglichkeit ist völlig ausgeschlossen. Erstens mangels Lust, heute Motivation genannt, zweitens aus taktischen Gründen. Ich habe meine Hausaufgaben immer dann gemacht, wenn meine Mutter sehen konnte, dass ich sie mache. Das förderte das harmonische Zusammenleben.
Also blieb nur eins: Schulkameraden besuchen. Die kämpften ja mit dem selben Problem. Nachmittags war bei allen sturmfreie Bude, weil die Eltern arbeiteten. Bei fast allen. Bei manchen lebte nämlich die Großmutter mit in der Wohnung. Die arbeitete zwar auch, aber zuhause. Denn die fünfziger Jahre waren die große Zeit der Heimarbeit. Meine Scheller-Oma zum Beispiel „packte“ Spiegel. Dabei wurden kleine rechteckige Spiegel irgendeiner der vielen Fürther Spiegelfabriken an den Rändern in Papierstreifen eingefasst und zur Weiterverarbeitung hergerichtet. Der ganze Küchentisch war dann voll mit blanken und eingefassten sorgfältig aufgetürmten Spiegeln, braunen Packpapierstreifen und einem Leimtopf, der sein eindringliches Aroma in der ganzen Wohnung verbreitete. Wenn ich Pech hatte und im ungünstigen Moment bei meiner Oma auftauchte, war der Nachmittag gelaufen. Dann hieß es mit anfassen, bis die Kartons mit kleinen, frisch gepackten und nach Leim riechenden Spiegeln voll waren.
Etwas angenehmer war da die Heimarbeit der Oma meines Freundes, dem Pöhlmann Klaus. Sie drückte nämlich die Achsen in winzigkleine Spielzeugautos aus Kunststoff. Die mussten der Klaus und ich natürlich erst testen, bevor wir sie freigeben konnten.
Bei anderen Schulkameraden befanden sich die Eltern allerdings auf „Schlagdistanz“, was durchaus wörtlich gemeint ist. Das waren die Eltern, die einen eigenen Laden besaßen, der meist gleich hinter dem Wohnzimmer lag. Wie beim Reinhold Britting zum Beispiel. Seinen Eltern gehörte die Samenhandlung in der Oberen Fischergasse, die später die Kneipe mit dem sinnträchtigen Namen „Keimling“ beherbergen sollte. Der Reinhold, immer etwas pummelig, war einer meiner Begleiter vom Kindergarten bis zu meinem Abgang aus dem Hardenberg Gymnasium.
Als Sohn eines Ladenbesitzers gehörte er nach Altstadt-Kategorien zu „den Besseren“. Und noch eines hob ihn aus der Masse heraus: er hatte einen Onkel in Amerika! Der existierte nicht nur auf dem Papier oder in mündlich überlieferten Legenden, nein, er schickte dem Reinhold sogar Geschenke. Geschenke aus Amerika, unfassbar, toll und absolut neiderregend. Warum nicht ich, fragte ich mich bei jedem Besuch. Doch auch alles Nachfragen bei meiner gesamten Verwandtschaft brachte mich auf keine Spur, die nach Amerika führte, geschweige denn zu einem dort ansässigen Onkel. So konnte ich nur immer wieder staunend auf die Schätze blicken, die da über den großen Teich in die Obere Fischergasse gespült wurden.
Das Objekt meiner größten Begierde war dabei ein Schiffsmodell von Revell: die Victory, das Flaggschiff von Admiral Nelson bei der Schlacht von Trafalgar. Und ich denke, der Reinhold weiß bis heute nicht, wie glücklich er mich gemacht hat, als er mir eine überzählige Kanone des Schiffes schenkte. Sie maß zwar lediglich einen halben Zentimeter, aber für mich war sie riesig und gehörte fortan zu meinen größten Schätzen.
Bei Reinhold lernte ich auch einige Spiele kennen, die in „meinen Kreisen“ nur dem Namen nach bekannt waren – Romme und Schach. Nach meinem Schulwechsel verlor ich ihn aus den Augen. Aber einmal, im April 1996, las ich in der Zeitung von ihm. In einem Bericht über den Kreistag wurde über zwei Rekordhalter berichtet, die man verabschiedet hatte. Der eine gehörte dem Gremium 44 Jahre an, der andere, „mein“ Reinhold, eineinhalb Tage. Er war als Nachrücker einen Tag vor Ablauf der Legislaturperiode vereidigt worden.
Andere Anlaufstellen an trüben Nachmittagen boten der Heerdegen Michael von der Kohlenhandlung und die Winterbauers Lutz und Axel, deren Eltern den Spielzeugladen mit Puppenklinik in der Sternstraße besaßen. Dort konnten wir nach Herzenslust und vor allem ungestört spielen.
Bei mir waren die Schulkameraden nie. Wie auch. Unsere Mansardenwohnung war selbst für kleine Kinder zu klein. Mein Leben spielte sich in erster Linie am Küchentisch ab. Hier machte ich meine Hausaufgaben, natürlich immer für Mutter sichtbar, hier las ich, hier hörte ich Radio. Dieser Tisch war mein häusliches Zentrum, an ihm aßen wir und er war meine Spielfläche. Das Wohnzimmer war tabu, obwohl es in Wirklichkeit zur Hälfte mir gehörte. Denn dort schlief ich Nacht für Nacht auf dem Sofa, bis ich zur Bundeswehr kam. Natürlich träumte ich jeden Tag von einem eigenen Zimmer und einem eigenen Bett. Ich hoffte inständig, dass meine Eltern endlich im Lotto gewinnen würden. Ich hoffte, dass ich bald alt und reich genug wäre, eine eigene Wohnung zu haben. Ich hoffte und hoffte und hoffte.
Und Hoffen kostet ja nichts.
Ein Lehrer mit Kopfschuss
Im Gegensatz zur Praxis heutiger Grundschulen, unterrichteten am „Michala“ vor allem Männer, zumindest im Bubenschulhaus. Bei den Mädchen war das vielleicht anders, aber zu dieser Tabuzone hatten wir Andersgeschlechtlichen ja keinen Zutritt, geschweige denn Einblicke.
Die erste Zeit nach meiner Einschulung war für mich ziemlich langweilig, da man mir den Lehrstoff der ersten Klasse schon vorher zuhause eingetrichtert hatte, um meinen unruhigen Geist zu beschäftigen.
Dass Wissen nicht ganz ungefährlich ist, erfuhr ich erstmals in der Straßenbahn. Dort war mir seitens der Eltern und Großeltern bei Androhung von Strafe verboten, die Schildertexte laut zu lesen. Aus gutem Grund. Denn Kinder bis zu sechs Jahren durften umsonst die Straßenbahn benutzen, war man älter, musste man zahlen. Ein Kind, das Lesen konnte, war logischerweise schon in der Schule, also mindestens sechs Jahre alt. Zumindest in der Logik der Schaffner. Da es zu dieser Zeit noch keine Kinderausweise gab, meine Eltern meine Geburtsurkunde nie mit sich führten und Schaffner nur das glauben, was auf einem amtlichen Papier steht, musste ich zum Beweis meines Alters eben schweigen. Was mich ärgerte und das Lesen umso reizvoller für mich machte. Spuren davon zeigen sich noch heute: ich lese für mein Leben gern.
Doch zurück zur Schule.
Die ersten beiden Jahre war ich in der Obhut eines dicken, einigermaßen gutmütigen Lehrer namens Frosch. Einigermaßen gutmütig bedeutete, dass sich die körperlichen Erziehungsanteile in erträglichen Grenzen hielten. Die berühmten „Pfötschle“, die Schläge mit der Weidenrute auf die Handinnenflächen, gab es „beim Frosch“ nur, wenn alle anderen pädagogischen Maßnahmen sinnlos erschienen, also bei Schwätzen, vergessenen Hausaufgaben, Störung des Unterrichts, Zuspätkommen, schmutzigen Fingernägeln und ähnlich schweren Verfehlungen.
Sein Nachfolger in den Klassen Drei und Vier war dann der Lehrer Koch.
Er war von großer, beeindruckender Gestalt und hatte den Habitus eines preußischen Offiziers. Er legte allergrößten Wert darauf, mit seinen Schülern auf einer Ebene zu sein. Das erreichte er dadurch, dass er uns an einem Ohr packte, dieses nach hinten drehte, wobei er uns an dem selbigen hochzog, bis er uns, leicht nach unten gebeugt, in die Augen sehen konnte. Ein wahrhaft aufrechter Mann. Schon meine Mutter war in den Genuss dieses Vorzeigelehrers gekommen, wobei ich nicht weiß, ob seine deutlich sichtbare Schädelverletzung von einem Kopfschuss aus dem ersten oder dem zweiten Weltkrieg herrührte.
Wie auch immer die Unterrichtsziele und -richtlinien Ende der 50er Jahre formuliert waren, ich glaube nicht, dass sie beim Unterricht dieses Lehrers eine große Rolle gespielt haben. Das war auch nicht wichtig, denn in Wirklichkeit waren wir ja gar nicht seine Schüler - wir waren seine Rekruten. Und er unser Kommandeur.
Das heißt, dass er nicht nur den zeitüblichen Strafenkatalog praktizierte, sondern uns auch auf das Leben mit seiner ganzen zu erwartenden Härte vorbereitete. Und das beinhaltete für ihn auch den Krieg. Aus seiner Erfahrung tat man das am besten durch soldatischen Drill wie Antreten, in Reih und Glied der Größe nach geordnet Aufstellen und Abtreten und ähnlichen gruppendynamischen Erlebnissen.
Aber auch moralische Aufrüstung tat Not und so lernten wir das Deutschlandlied mit allen Strophen, von der Maas bis an die Memel, hörten die Geschichten von wahrer Tapferkeit und Vaterlandstreue, wie er sie selbst erlebt hatte, übten fleißig die deutsche Schrift und sangen, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, das schauerliche Lied vom treuen Kameraden, das bis auf den heutigen Tag bei allen Heldengedenkfeiern gespielt wird. Wer's nicht glaubt, begebe sich am Volkstrauertag in die Konrad-Adenauer-Anlage in Fürth oder auf jeden anderen beliebigen Platz mit Kriegerdenkmal in unserer Republik.
Dieses Lied verfolgte mich bis in den Schlaf und bereitete mir für Jahre Alpträume.
„Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite...“,
„Die Kugel kam geflogen...“ geisterte in schrillen, schrecklichen und vor allem blutigen Bildern durch meine Nächte.
Trotz aller Bemühungen meines Lehrers, fühlte ich mich gar nicht so recht auf den Heldentod vorbereitet. Ich wollte ihn nicht, auch wenn mich meine Klassenkameraden noch so sehr dafür bewundert hätten.
Spätere Generationen mögen erstaunt sein, dass man so einen bedauernswerten Kriegsinvaliden auf die ebenso bedauernswerten Kinder losgelassen hat. Nun, damals, Ende der 50er, war anscheinend niemand darüber erstaunt. Wir Kinder wussten es nicht anders, und die Erwachsenen hat es anscheinend nicht gekümmert. Jedenfalls sollte ich in meiner weiteren Schullaufbahn bis zu den legendären 68ern noch mehr Vertretern dieser Sorte begegnen.
Die hatten zwar keinen äußerlich sichtbaren Kopfschuss, aber...
Auf Dreizehn
Allen mit der Gnade der späten Geburt Gesegneten sei gesagt, dass die Gustavstraße damals die B 8 war, also die Fernverbindungsstraße von Nürnberg nach Würzburg, und dementsprechend war das Verkehrsaufkommen. Allerdings glücklicherweise nur in die Würzburger Richtung, also vom Königsplatz zum Heiligenberg.
Mein Geburtshaus war es nicht, die Gustavstraße Nummer Dreizehn. Das war die Nummer 27, und die war im Kannengießerhof, gleich neben dem Heerdegen-Haus. Die Häuser sind damals von den Leuten meist nicht mit den offiziellen Nummern bezeichnet worden, sondern mit Besonderheiten oder einfach mit den Namen ihrer Besitzer. Die Dreizehn war das Eitelhaus, und in dem wohnten wir.
Die Eitels waren geschäftstüchtige Leute, zumindest in den Augen meiner Eltern und dadurch auch in meinen. Mit der Frau Eitel machte ich „meine“ ersten Geldgeschäfte: sobald ich dazu in der Lage war, schickten mich meine Eltern an jedem Monatsersten mit dem Mietbüchlein und dem Mietgeld zur Hausherrin, die den Tribut wohlwollend von mir empfing.
Der Herr Eitel, den ich nur selten zu Gesicht bekam, war stolzer Besitzer eines Kinos in Nürnberg-Schniegling. Weil aber nicht nur sein Kino, sondern auch seine Freundin in Schniegling war, sah ich ihn erheblich weniger als die Frau Eitel, die bei uns im Hinterhaus eine Wäscherei betrieb. Den Kinobesitzer sah ich nur, wenn er seine Enkel, die ebenfalls auf Dreizehn wohnten, besuchte; die Uschi, den Klaus, die Beate und die anderen drei, die aber so klein waren, dass sie sich meiner Wahrnehmung ebenso entzogen wie die Kleinkinder im Hinterhaus.
Einmal, ein einziges Mal hat er auch mich mitgenommen in sein Kino. Da saßen wir ganz oben auf dem Rang und sahen viel Meer, viele Flugzeugträger, viele Flugzeuge, viele Soldaten und die Amis haben gewonnen.
Die Frau, wie gesagt, betrieb eine Wäscherei. Ich habe zwar keine Ahnung, wer es sich damals leisten konnte, seine Wäsche waschen zu lassen, aber sie hatte viel zu tun. Das merkte ich immer daran, dass der ganze Hof voll Wäsche hing und wir Kinder mit absolutem Hof-Spielverbot belegt wurden. Und wehe man erwischte uns bei einer schnellen Bewegung.
Wir Kinder auf Dreizehn, die drei Eitel-Enkel, der Schawelka-Gerd und ich, die Angelika aus dem Hinterhaus und die Seyerlein-Edda aus dem zweiten Stock, waren verbunden im spannungsvollen Wechselspiel von Zuneigung und Ablehnung, allesamt neugierig auf alles, was das Leben zu bieten hat. Verbündete in der Unterdrückung durch die Erwachsenen, die eine ganz andere Vorstellung von der Welt bevorzugten als wir. Allen voran der Herr Kaiser, der sich wie ein Büttel aufführte. Das war er ja auch von berufswegen, Beamter im Strafvollzug in Nürnberg in der Mannertstraße, und so hat er auch uns Kinder behandelt.