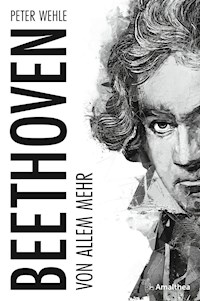Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Ein Pflichtbuch für Wien-Fans! Der große Kabarettist Peter Wehle besuchte "Gschlitzte" (Taschendiebe) und "Häfenbriader" (Gefängnisinsassen), "Flitscherl" (leichte Mädchen) und "Kieberer" (Polizisten), "Habsburger" (Falschspieler) und "Suacherl" (Untersuchungsrichter), und hat bei ihnen die Wörter der legendären Wiener Gaunersprache gesammelt. Das Ergebnis sind eine unterhaltsame und wissenswerte Einführung sowie ein vollständiges Wortverzeichnis zur Geheimsprache der Wiener "Strizzis", die von "Auszuzln" bis "Zimmerwanzen" alle - nicht immer ganz salonfähigen - Wörter und noch einiges mehr erklären. - erstmals mit vollständigem Wortverzeichnis - Wiener Dialekt/Wiener Mundart - unterhaltsam und informativ - zum Lesen und Schmökern - das perfekte Geschenk "Ein sehr unterhaltsames Buch, das gleichzeitig aber auch fundierte Hintergrundinfos enthält. Tipp: Kommt auch als besonderes Geschenk/Mitbringsel bei allen Wienern und Wienliebhabern sehr gut an!" "Ein tolles Buch vom Kabarettisten Peter Wehle mit vielen lustigen und interessanten Begriffen aus dem Wiener Dialekt bzw. der Wiener Mundart!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wehle
Die Wiener Gaunersprache
Peter Wehle
Die Wiener Gaunersprache
Vorwort
Mein Vater, der promovierte Jurist Peter Wehle, der nach den Kriegsjahren zwischen Frankreich und Stalingrad endgültig seine „beruflichen Zelte“ in der Musik, im Theater und im Kabarett aufgeschlagen hatte, schenkte sich zu seinem 60. Geburtstag ein zweites, ein sprachwissenschaftliches Doktorat, wie er es selber zu formulieren pflegte.
Daraus erwuchs der Klassiker „Die Wiener Gaunersprache“, dessen Erfolg der große Kabarettist und Autor noch zwölf Jahre miterleben konnte. An seinem 72. Geburtstag erlitt er zwei Schlaganfälle, an deren Folgen er einige Tage später verstarb.
Am 9. Mai 2014 jährte sich der Geburtstag meines Vaters zum 100. Mal, am 18. Mai 2016 ist sein 30. Todestag.
„Wir sollten unbedingt …“ – es gab mehrere Anregungen, einige seiner bekanntesten Werke aufzufrischen, neu aufzulegen. Wie zum Beispiel sein Standardwerk zur „Wiener Gaunersprache“. Dankenswerterweise griff der HaymonVerlag diese Idee tatkräftig auf.
Erfreulicherweise ergab sich die Möglichkeit, den – fachlich wie menschlich herausragenden – Soziologen und Kulturanthropolgen Univ.-Prof. Dr. Roland Girtler für ein Nachwort zu gewinnen.
Und dann … fanden wir in der Doktorarbeit meines Vaters einen bisher ungenutzten „Schatz“! Ein detailliertes Wörterverzeichnis, das – neben dem charmant-informativen Text des früheren Buchs – weitere interessante und vergnügliche Einblicke in eine vergangene Sprache mit glänzenden Zukunftsaussichten bot.
Wobei … was heißt hier „bot“?
Bietet!
Und immer wieder bieten wird – jedes Mal, wenn die p. t. Leserinnen und Leser schmunzelnd zwischen Koberern und Kieberern flanieren und mehr über die Mameloschn der Galeristen wissen wollen.
Peter Wehle (… junior)
Wie kommt man auf dieses Thema?
Meschugge, wie Kabarettisten, Bücherschreiber und manch andere „Freischaffende“ schon sind, kam ich auf die Idee, in sehr vorgeschrittenem Alter noch einmal auf die Universität zu gehen. Der Wiener Dialekt, die Wissenschaft von den Dialekten überhaupt, hatte mein besonderes Interesse erregt.
So kam ich zu den Germanisten und lernte Eberhard Kranzmayer kennen. Ein echter Kärntner – das ist er bis zu seinem Tod im Jahr 1975 geblieben – mit einem umwerfenden Sprachtalent. Er hielt an der Universität Wien überaus interessante Vorlesungen, die ich einige Semester lang in der Art besuchte, wie andere Leute ins Kino oder ins Theater gehen.
Wir wurden miteinander bekannt und kamen darauf zu sprechen, dass bemooste Häupter wie ich, die außerdem einem Beruf nachgehen, nur in seltenen Fällen ein zweites Universitätsstudium ernst nehmen und beenden. Was ich denn als junger Mensch studiert hätte?
Jus. (In Deutschland: Jura.) Als Werkstudent, fügte ich stolz hinzu.
Werkstudent?
Ja. Barpianist. In Prag und Wien. War eine interessante Zeit: zusammen mit vielen lichtscheuen Gestalten, Animierdamen, Zuhältern, Hochstaplern … Zwei Monate, während der Semesterferien, verdiente ich genug, um dann wieder vier Monate in Wien studieren zu können.
Die nächste Frage – nach einer Minute Nachdenken –, ob es mir ernst sei mit diesem jetzigen Studium der Germanistik, ob ich die Zeit für eine Dissertation erübrigen könnte.
Ich weiß nicht … Vor allem: Was sollte ich denn als Thema nehmen?
Da zog mich Kranzmayer in eine Ecke der Aula und wurde ganz persönlich und hatte sichtlich etwas auf dem Herzen:
Er habe seit langem ein Dissertationsthema in petto, das er aber keinem „normalen“ Studenten geben könne. Vielmehr müsse der, dem er es anvertrauen würde, drei Bedingungen erfüllen, und er habe bisher noch keinen Kandidaten gefunden, der das vermochte.
Es war richtig spannend, wie in einem Märchen, wo dem jungen Burschen drei Aufgaben gestellt werden, nach deren Lösung er die Königstochter bekommt. Also: erstens sollte der Kandidat schon ein älteres Semester sein, zweitens sollte er mit dem Strafrecht vertraut sein und drittens sollte er Mittel und Wege wissen, sich mit echten Gaunern in Verbindung zu setzen. Ich war – ganz ehrlich gesagt – einigermaßen verblüfft: Das traf alles auf mich zu. (Über den letzten Punkt werde ich noch berichten.) Aber was war das für ein Thema?
Jetzt war Kranzmayer richtig aufgeregt: „Wollen S’ über die Wiener Gaunersprache arbeiten? – Ich kann keinen jungen Hörer damit beauftragen, weil der Einfluss der Leut, die er ausfragen muss, schädlich sein könnt. Ich brauch juristische Kenntnisse, weil es eine Paragraphensprache gibt, zu der man das Gesetzbuch einigermaßen kennen muss, und endlich: Wie soll ein ,Normaler‘ dazukommen, echte Gauner zu finden und zu befragen?“
Nun – ich habe natürlich ja gesagt, und das Resultat dieser Unterredung liegt – in stark überarbeiteter Form – vor Ihnen.
Gaunersprachen im Allgemeinen
In jeder Sprachgemeinschaft gibt es soziale, berufliche, durch Sonderinteressen zusammengewürfelte Gruppen, die ihre eigene Sprachform entwickeln; sie unterscheidet sich durch den Wortschatz und durch eigene Redewendungen von der Standardsprache. Oft hat sie den Charakter einer Geheimsprache. Jedes gehobene Fachsimpeln gehört schon dazu, aber am stärksten sind die Eigenheiten bei den Gaunersprachen ausgebildet, weil sie ja ursprünglich den Zweck hatten, gewisse Nachrichten unverständlich für Außenstehende zu machen.
Ärzte reden ja auch nicht deutsch, wenn Unberufene zuhören. Sie reden lateinisch.
Einer meiner Ärztefreunde erzählt gerne die Geschichte, wie ihn in der Straßenbahn ein biederer Mann ansprach, er, der Arzt, habe ihm einst durch ein geheimes Zauberwort das Leben gerettet. „So?“, wunderte sich mein Freund, „was hab ich denn zu Ihnen gesagt?“
„Ich weiß es noch ganz genau: Ich bin zum Sterben gewesen im Krankenhaus, ganz furchtbar elend, und dann sind Sie zur Visite gekommen, Herr Professor, haben mich ganz scharf angeschaut, und dann haben Sie gesagt: Moribundus! – Und gesund bin ich worden!“
„Moribundus“ ist lateinisch und heißt: ein Sterbender. Wie gut, dass der Biedere die Fachsprache der Ärzte nicht kannte!
Gaunersprachen sind also Varianten der Gemeinsprache. Für sie ist das Motiv der Geheimhaltung maßgebend. Sie ordnen sich grammatikalisch und syntaktisch der Alltagssprache ein, und daher sind nur ihr abweichender Wortschatz und ihre spezifischen Redewendungen zu untersuchen.
Das aber soll im Folgenden recht gründlich geschehen. Und wenn auch die Forschungen in Vermutungen ausarten.
Die Sprache der „Wiener Galerie“ im Besonderen
Warum nennen sich die Wiener Gauner selbst Galeristen? In den wenigen Fachbüchern, die man zu diesem Thema wälzen kann, finden sich nicht einmal Erklärungsversuche. Aber bei Unterredungen mit stolzen Mitgliedern dieser Gilde waren zwei Meinungen zu hören:
Das Opernpublikum – natürlich früher, heute gilt das längst nicht mehr – gliederte sich in drei verschiedene Gruppen: Da waren die Logenbesucher, die Aristokraten, der Geldadel; dann das Parkett, wo die Bürgerlichen und allenfalls wohlhabende und kunstverseuchte Handwerker saßen; und endlich die Galerie, auch „der Juchhe“ genannt. Dort gab es Säulensitze, hinter denen man überhaupt nichts sah, dort gab es keine feierliche Kleidung, weil man es eben „nicht hatte“, und von dort könnte sich das Wort Galeristen herleiten, eben von den Parias, den Ausgestoßenen, von denen, die nicht mehr dazugehören.
Die zweite Erklärung scheint viel „gaunertümlicher“:
Hinter dem Kartentisch, an dem ein (ländliches oder sonstiges) Opfer durch Falschspielen gerupft oder geschoren werden sollte, bildete sich oft eine Reihe von Zundgebern, also von Herren, die den rupfenden Kartenkünstler mit Informationen teils über das Blatt des Opfers, teils über von außen dräuende Gefahren versorgten. Und dieser Halbkreis soll auch „Galerie“ geheißen haben. Der alte Häfenbruder, der mir das in einem Tschecherl in den enteren Gründen erzählte, war seiner Sache sehr sicher – aber er war der Einzige, der das behauptete.
So möge sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Ich selbst würde die „richtige“ Erklärung gern so sehen: Schon lange gibt es bei der Polizei Sammlungen von Fotografien der Stammkunden; in Fachkreisen, also bei den Betroffenen, haben sie den Spitznamen „Galerie“ – d. h.: Bildergalerie – erhalten. Galerist ist somit der, dessen Konterfei amtlich gepflegt und aufbewahrt wird, im Profil und en face, meist mit einer Kennnummer, auf die manche Galeristen sogar stolz sind, weil sie das Zeichen ist, dass der Abgebildete sich einbilden kann, zur „Zunft“ zu gehören.
Die Sprachvariante der Wiener Unterwelt setzt sich aus rotwelsch-jiddischen Ausdrücken, aus Lehnwörtern der Nachbarsprachen und lokalen Mundartausdrücken zusammen, die bei den Galeristen vielfach eine andere Bedeutung als im gängigen Wiener Dialekt haben. Beispiele werden folgen.
Und wie fängt man an?
Gaunerwörterbücher gibt es natürlich schon lange. Da gibt es zum Beispiel den „Polizeilichen Schutz und Trutz nebst einem Wörterbuch der Diebessprache“ von Chr. Rochlitz, 1839 in Erfurt erschienen. Dann gibt es ein Buch von Rudolph Fröhlich: „Die gefährlichen Klassen Wiens“, 1851. Das war schon viel interessanter. Dort fand ich zum Beispiel eine Erklärung für den Ausdruck müllisieren (verhaftet werden), die mir sehr wahrscheinlich scheint; auf Seite 137 steht der Satz: „In den Gefängnissen ist das hauptsächliche Unterhaltungsspiel der lange Puff, auch Mühle ziehen genannt.“
Später gibt es immer mehr Wörterbücher mit Gaunerfachausdrücken, aber meist sind sie zu dem Zweck hergestellt worden, der Obrigkeit Behelfe zur Kontrolle der Unterhaltung und vor allem der Korrespondenz von Strafhäftlingen zu bieten.
Das letzte mir bekannte Werk über die Gaunersprache der Wiener Galerie stammt aus dem Jahr 1968, ist von einem pensionierten Wiener Kriminalbeamten namens Julian Burnadz und wurde in Lübeck verlegt.
Aber was stimmt in diesen Büchern? Vielleicht sind da erfundene Wörter aufgezeichnet, Spontanbildungen einer Verbrecherbande oder uralte, nicht mehr gebrauchte Ausdrücke? Ich sollte – bei meiner Dissertation – doch eine Bestandsaufnahme der Gaunerwörter aus der Mitte des 20. Jahrhunderts geben.
Nein – da half mir kein Kaiser und kein Claudius und kein Gott, ich musste eine Zettelkartothek anlegen, ich musste Galeristen befragen, nach geeigneten Verbindungen suchen und mich vor allem ins Nachtleben stürzen. Zunächst musste ein Fahrplan erstellt werden, die „Diss“ (Studentenabkürzung für Dissertation) sollte ja einen Aufbau haben, geeignete Literatur musste gefunden werden. Die Hilfe der Herren Assistenten war mir sicher. Und dann musste mir ein bisschen Publicity zu weiteren „Quellen“ verhelfen; ich fand auch wirklich interessierte Journalisten, die Artikel über mein Vorhaben verfassten, und als Reaktion trafen viele Briefe ein, die wiederum der Zettelkartothek auf immer weitere Beine halfen.
Na ja – es wurde geschrieben, umgeschrieben, kritisiert, nochmals geprüft, und dann war die Diss nach vier Jahren fertig.
Das steht da in zwei Zeilen. Und es sagt nichts über die wichtigste Arbeit: die Gespräche mit Gewährsleuten und – vorher noch – das Finden von Gewährsleuten.
Man sucht Gewährsleute
Es waren viele interessante Typen dabei. Ich interessierte mich immer zuerst für ihr privates Schicksal und lud sie zu einem möglichst alkoholischen Getränk ein. Beides löst die Zunge und bringt Ergebnisse.
Ob wohl der Kofferraum-Emmerich noch lebt? Er war ein verkrachter Akademiker, und ich lernte ihn bei einem Sommerurlaub in Tirol kennen. Er lebte davon, dass er nachts in unversperrten Kofferräumen Gegenstände „fand“, die er an einen Gajer in Innsbruck verlängerte (also: einem Hehler übergab), und ab und zu fuhr er kassieren. Er profitierte vom Leichtsinn der Touristen und hatte seine Gaunerdialektkenntnisse erst bei seinen zwei Verurteilungen in der Strafhaft begründet. Einmal, so erzählte er mir, war er vier kalte Nächte unterwegs, ohne auch nur einen einzigen offenen Kofferraum zu finden. Endlich hatte er Glück: ein Nobelwagen – der Kofferraum weit offen und prall gefüllt! Da naht sich in eifrigem Gespräch der Eigentümer. Emmerich, schnell gefasst, packt den Stier bei den Hörnern und macht den Herrn auf seinen unverzeihlichen Leichtsinn aufmerksam. Dieser, bestürzt und beschämt und von der Anständigkeit des Warners überzeugt, schenkt ihm zweihundert Mark, mehr als er in der ganzen abgelaufenen Woche „verdient“ hatte.
„So eine Masen“, kommentierte Emmerich am nächsten Tag den Vorfall, „so eine Masen werd ich nicht bald wieder haben.“
Viel, sehr viel hab ich in einem kleinen Gasthaus in Kagran gelernt.
Pächter war der Willy Abermann, und der war mir von einem Kriminalbeamten empfohlen worden. Als ich mit etwas Bauchweh und sehr schüchtern eintrat, wurde ich von Chef Willy sehr freundlich und per du wie ein alter Kampfgenosse begrüßt. Er war auch wirklich der Meinung, dass ich irgendwo mit ihm eine Zellteilung vorgenommen hatte, aber bald stellte sich heraus, dass ich Jahre vorher gelegentlich einer Gulaschhüttentour mit Qualtinger mit ihm Bruderschaft getrunken hatte, und so stand er mir „altem Freund“ vom ersten Moment an mit sehr viel Offenherzigkeit und großem Verständnis gegenüber.
Wir unterhielten uns am ersten Tag über die Polizei. Ich erfuhr, dass man die Polizei Kieberei oder die Höh nennt, dass der verhaftende Beamte als Zangler bezeichnet wird, weil die Handschellen sehr logisch als Zangeln, also Zangen (sie heißen auch Achter), bekannt sind, und ich lernte ohne Namensnennung einen Herrn kennen, der in den dortigen Kreisen als „Kabelspezialist“ geradezu Weltruhm genoss:
In längst vergangenen Zeiten pflegte dieser erfindungsreiche Herr die Eigentümer von nicht allzu gut gesicherten Wohnungsschlössern durch ein Telegramm, also ein Kabel, zu einer Besprechung zu berufen. Während ihrer Abwesenheit war es natürlich für ihn ein Leichtes, in den Wohnungen ungestört einen Bären zu reißen, das ist: einen Safe auszuplündern.
Warum ein Geldschrank ausgerechnet mit einem Bären verglichen wird, habe ich etymologisch nicht herausgekriegt – es muss wohl das bildhafte Vergleichswort, die Ähnlichkeit, die Metapher gewesen sein. Man könnte den Bären aber auch vom jiddischen peri, Erwerb, ableiten. Man könnte – aber man muss nicht. Ein paar jüngere Ganoven haben den Ausdruck Tsafe oder Safe (gesprochen wie geschrieben) gebraucht, was wohl auf die mangelhafte Englisch-Aussprache-Kenntnisse mancher Unterweltler zurückzuführen ist.
Beim Willy war ich noch ein paarmal, und immer gab es reiche Beute für mich. Er lebt jetzt ganz woanders und wird sicher schmunzeln, wenn er diese Zeilen je zu Gesicht bekommt.
Ein makabres Interview
Der hilfreiche Oberkellner einer Wiener Nobelbar vermittelte mir einmal die Bekanntschaft eines blitzgescheiten, sehr gut gekleideten jungen Mannes, der mir in fehlerfreiem Schriftdeutsch ganz verblüffende Definitionen lieferte.
So erklärte er mir zunächst einmal den Begriff Tschocherer als „Gerät, das beim Einbruch zur Verlängerung des Unterarms dient“.
Er war sehr verwundert, fast indigniert, dass ich den Ausdruck Privatdozentin nicht in der Fach-Nebenbedeutung kannte, und er umschrieb ihn mir als eine wohlhabende Prostituierte, die mit eigenem Auto im ersten Gang auf Kundenfang ausgeht.
Ich war begeistert.
Mehr, bitte viel, viel mehr, bat ich.
Aber er musste noch weiter und forderte mich auf, ihm Gesellschaft zu leisten, er würde mir noch andere „Gewährsleute“ zugänglich machen.
Ich sah auf die Uhr: halb drei Uhr früh – und ich hatte am nächsten Tag zu tun und war sehr müde. Also verabredeten wir uns für den folgenden Abend in der gleichen Bar: Same place, same station, same jokes.
Ich saß ab Mitternacht wartend da, bis – bis mein Freund, der Ober, von einer ausgesprochen lichtscheuen Figur in die Garderobe gerufen wurde. Er kam leichenblass zurück:
Der sympathische junge Mann von gestern war eine Stunde, nachdem wir uns getrennt hatte, in einem Naschmarkt-Café von einem eifersüchtigen Rivalen erstochen worden.
Mir wurde kalt. Vielleicht wäre dieses Buch über die Gaunersprache nie geschrieben worden, wenn ich nicht am Abend vorher so lebensrettend müde gewesen wäre!
Auch von Frankisten kann man lernen
Als Frankisten oder Frankfurter werden von den Galeristen alle nicht zu ihnen gehörigen Personen bezeichnet – und die waren mir meist als Stofflieferanten lieber, weil sie problemlos und bereitwillig zur Verfügung standen. Darunter waren Gerichts-, Justiz- und Polizeibeamte, Musiker, Journalisten und viele andere, oft tatsächlich profunde Kenner der Materie.
Da war ein namhafter Wiener Strafverteidiger, den ich aus meiner Studienzeit recht gut kannte, der wollte nicht mit der Gaunersprache heraus. Er behauptete, dass seine Klienten mit ihm nur hochdeutsch parlierten.
Eines schönen Vormittags saß ich in einem Vernehmungsraum des Wiener Landesgerichtes und unterhielt mich mit einem Häftling, der sich bereit erklärt hatte, mir Auskünfte zu geben. Aber unsere Unterhaltung erstarb bald, denn durch eine offene Tür hörten wir ein Gespräch, das mich veranlasste, mitzustenografieren: Der eine der beiden Gauner, die sich da unterhielten, war offenbar ein gefinkelter Ezzesgeber, der andre ein Mann, der einen versuchten Bankeinbruch als straflos hinzustellen versuchte, weil er auf der Stiege schon umgekehrt sei, als er in der Bank einen bekannten Kieberer bemerkte. Dieses Gespräch war mit so vielen mich interessierenden Fachausdrücken gespickt, dass ich „meinen“ ohnedies nicht sehr ergiebigen Kunden durch einen Justizbeamten wieder in seine Zelle schicken ließ und den gleichen Beamten bat, mir doch eine Unterredung mit dem Ezzesgeber zu vermitteln.
Der Ezzesgeber war der bekannte Anwalt. Als wir wenig später in einem Kaffeehaus (wo denn sonst – wir waren beide Wiener) über die Gaunersprache debattierten, stellte sich heraus: Er hatte es bisher als rufschädigend empfunden, seine Vertrautheit mit dem Ganoven-Jargon zuzugeben, obwohl er seine blühende Praxis gerade dem Umstand verdankte, dass er stets sofort das Vertrauen der Herren Delinquenten erwarb, weil er genau ihren Ton sprach. Die Kenntnis der Gaunersprache kann also auch für einen Frankisten von geschäftlichem Vorteil sein.
Da nun das Eis zwischen uns beiden gebrochen war und ich meiner Begeisterung über seine Doppelsprachigkeit Ausdruck gegeben hatte, war auch er ein Quell der neuen Fachwörter für mich geworden.
Von ihm erfuhr ich zum Beispiel, dass das elektronische Instrument, mit dem Häftlinge auf das Vorhandensein von metallischen Gegenständen geprüft werden, kurzerhand Pracker benamst, der Vorführungs- und Vernehmungsraum als Waggaun, also Waggon, bezeichnet wird und man nur in einem der beiden Wiener Landesgerichte den Ausdruck Pomatschka für ein aus Apfelresten selbstgebrautes Getränk kannte; es wird wohl nie jemand ergründen, warum die Häftlinge in der Alser Straße einen Ausdruck verwenden, den ihre Kollegen am Hernalser Gürtel ausnahmslos als unbekannt bezeichnen.
Was ist Rotwelsch?
Mit diesem Begriff ist man von Anfang an konfrontiert, wenn man sich mit Gaunersprachen befasst. Auch wenn die Ezzesgeber elegant gekleidete Anwälte oder unterstandslose Kübelstierer unserer Tage sind: Man muss in die Geschichte hinuntersteigen, tief, um die gaunersprachliche Gegenwart zu begreifen.
Im 13. und 14. Jahrhundert, nach der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit, entstanden in Deutschland große, sehr gut organisierte Räuberbanden, die eine Art Staat im Staate bildeten und sogar eine eigene Gerichtsbarkeit entwickelten. Infolgedessen benötigten diese Banden eine Geheimsprache oder zumindest Geheimwörter, um ihre Tätigkeit vor den Rudimenten der staatlichen Gerichtsbarkeit geheim zu halten. Aber woher stehlen? Man musste die Wörter aus einer gesprochenen Sprache nehmen, denn schreiben und lesen war ja damals fast eine Geheimkunst.
Man konnte aber keine Fremdsprache der Gebildeten nehmen, etwa Latein oder Griechisch, denn gerade den Gebildeten gegenüber wollte man doch unverständlich bleiben, abgesehen davon, dass die Galeristen sicher Grausameres zu tun wussten, als Fremdsprachen zu lernen.
Da bot sich eine Sprache an, mit der die Herumzieher in Berührung kamen: die Sprache der jüdischen fahrenden Händler. Diese Sprache, das Jiddische, war in ihren Anfängen im Getto entstanden und hatte sich in der noch viel stärkeren Isolation der Juden im Osten Europas zu einer Sprache entwickelt, die Deutsch nach wie vor als Grundstock behielt, sich aber durch vorwiegend aramäische, hebräische, slawische Einflüsse und durch die Aufnahme von deutschen Dialekt-Elementen in ihrem Wortschatz erheblich verändert hatte.
Der „Liber vagatorum“, eine der ersten Rotwelsch-Wörtersammlungen, stammt von MartinLuther. Er erschien 1510, und es findet sich darin der Satz: „Es ist freylich solch rottwelsche Sprach von den Juden komen, denn viel ebreischer Wort drynnen sind, wie denn wol merchen werden, die sich auff Ebreisch verstehen.“ Diese Feststellung ist nur zum Teil richtig. Denn aus dem Jiddischen bezogen die Herren Gauner zwar viele ihrer Vokabeln und Redewendungen, aber sie bedienten sich – auch sprachlich –, wie es kam: Sie übernahmen alte deutsche Wörter, die umgebildet worden waren oder deren Bedeutung sich verändert hatte, sie nahmen Wörter aus verschiedenen Fremdsprachen, sie übernahmen Zigeunerwörter, und bei einigen Bildungen kann man heute nicht mehr sagen, woher sie genommen worden sind. Aus diesem Bestand entwickelten sie ihre Geheimsprache, das Rotwelsch.
Das Wort ist zum ersten Mal aus der Zeit um 1300 überliefert. Woher es abzuleiten ist, darüber ist sich die Fachwelt nicht einig: Einige behaupten, dass rot selbst ein rotwelsches, ungeklärtes Wort für Bettler ist und die Nebenbedeutung „falsch“ und „untreu“ hat. Andere wieder meinen, dass es von der damals üblichen Praktik der Bettler stammt, sich mit blutähnlichen Farben zu beschmieren, um mehr Mitleid zu erregen, dass es also von dem Farbwort Rot kommt; das müsste dann aber eine sehr unappetitliche Zeit gewesen sein – und das war sie vermutlich auch. In einem Wörterbuch fand ich sogar die Ableitung von dem Wort Rotte, was aber wirklich zu weit hergeholt erscheint. So viel zum ersten Bestandteil des Wortes Rotwelsch.
Welsch ist dagegen bekannt. Von Kauderwelsch oder Kinderwelsch sprechen wir ja noch heute, und wir wissen, woher es kommt: von althochdeutsch walihisk, was so viel wie romanisch, vor allem im Sinne von exotisch, fremd, unverständlich, heißt. Sie werden es nicht glauben, aber auch die Walnuss und der Prince of Wales haben dieselbe sprachliche Wurzel.
Verblüffend ist, dass sich das Rotwelsch bis in unsere Zeit erhalten hat, obwohl es in seinen Anfängen nie aufgeschrieben worden ist. Freilich, in neuer und neuester Zeit gibt es viel Literatur darüber; eines der ersten bedeutenden Fachbücher über das Rotwelsche stammt von dem Lübecker Polizeidirektor namens Friedrich Christian Benedict Avé-Lallemant. Durch Selbststudium wurde er ein tiefgebildeter Judaist, und 1858 bis 1862 gab er ein Werk über das „Gaunerthum“ heraus, das noch immer Gültigkeit hat.
Wie aktuell das Rotwelsch auch heute noch ist, das erhellt die Tatsache, dass 1974 der Schriftsteller Günter Puchner den gelungenen Versuch unternommen hat, Bibelstellen ins Rotwelsche zu übersetzen. Außerdem werden immer wieder Kongresse von Rotwelschexperten abgehalten, sodass uns sicherlich noch allerhand Neuigkeiten ins Haus stehen werden. Und wer weiß, wie viele Ausdrücke aus dem Rotwelschen der Gegenwart nach und nach in die Hochsprache herüberwandern werden, gleichsam als freundliche Gegengabe. Es gibt ja dafür schon viele Beispiele aus der Vergangenheit – nur merken tut man’s nicht:
Hals- und Beinbruch! – ja, warum wünscht man einem Freund ein gebrochenes Bein? Weil es sich nicht um einen Bruch, sondern um einen Segen handelt: Broche heißt Segen und kommt aus dem Jiddischen.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht man oft zu Silvester und überlegt dabei kaum, dass es keine Neujahrssitte gibt, bei der man rutschen müsste. Kommt auch gar nicht von rutschen, sondern von rotwelsch-jiddisch rosch, was Kopf oder Anfang heißt.
Blau in Verbindung wie „blauer Montag“, „blaumachen“ hat nichts mit der Farbe zu tun. Rotwelsch belo, belau, blau heißt „nichts“, „ohne“. Es gibt freilich auch eine andere Erklärung des Wortes, die besagt, dass es sich um einen Begriff aus der Färberei handle: Man färbte Stoffe mit Waid und musste sie dann 24 Stunden an der Luft liegen lassen. Während dieser Zeit konnte man natürlich nicht arbeiten. Soll mir recht sein. Mir ist die Ableitung aus dem Rotwelschen lieber. Ähnlich geht es mir mit dem Sargnagel als Begriff für die Zigarette. Man kennt schon seit langem, heißt es, im Englischen den coffin-nail, eben den Sarg-Nagel, eine Bezeichnung für jemanden, der einem tödlich auf die Nerven geht. Ich finde aber, es kann doch kein Zufall sein, dass das rotwelsch-jiddische Wort für stinken sarchen lautet. Oder?
Weil gerade von „Broche“ die Rede war: Kennen Sie den schon?
Da kommt ein junger jüdischer Formel-I-Pilot auf Wunsch seiner chassidischen Eltern zu einem alten Rabbi und sagt: „Rabbi, mei Tate wünscht, du sollst sprechen eine Broche über meinen Ferrari.“
Der Rabbi weiß nicht, was ein Ferrari ist, er weiß auch nach der Erklärung nicht, was für einen Segensspruch man über eine solche Rakete sprechen könnte, und er gibt dem Jungen den Rat, sich bei seiner nächsten Amerikareise an einen der reformierten jungen Rabbiner zu wenden, die es dort immer häufiger gibt.
Das geschieht auch, und der junge Rabbiner in Amerika hört sich die Bitte um die Broche für den Ferrari aufmerksam an und sagt dann in bestem Jiddisch: „Ferrari – ich verschtej. Aber wus is Broche?“