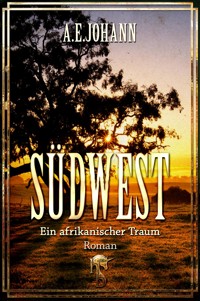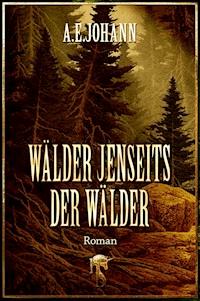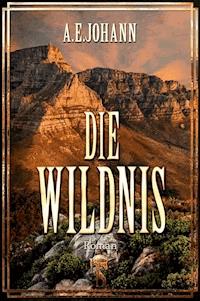
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vom Zweiten Weltkrieg überrascht, strandet der Seefahrer Wilhelm Barkholtz mit seiner Nichte Clarissa in Deutschland. In seinem Tagebuch blickt er zurück auf sein Leben als Trapper in der Wildnis Nordamerikas, seine rastlose Suche nach seiner großen Liebe Anne, die sein Leben bestimmt, seit das Schicksal sie 1918 trennte. Nach ruhelosen Jahren auf See findet er in den Steppen Südafrikas ein mögliches neues Glück. Der Hinweis eines Freundes führt ihn 1927 nach Kanada, zu Anne, die dort mit Mann und Kind lebt. Aber ohne mit ihr gesprochen zu haben, kehrt Wilhelm nach Afrika zurück, um dort das Glück zu finden, das ihm mit Anne verwehrt blieb. Zu spät, wie sich herausstellt. Clarissa versucht, die durch die Wirren der Kriege gerissenen Lebensfäden wieder neu zu knüpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
A. E. Johann
Die Wildnis
Roman
Erster Teil
24. V. 1947.
Ich habe mich noch nie an einem Tagebuch versucht. Inzwischen bin ich zweiundsechzig Jahre alt geworden. Zweiundsechzig Jahre sind eine lange Zeit, wenn man so viel in seinem Leben erfahren hat wie ich und so weit umhergeworfen wurde.
Manche Nacht und manche Stunde hat mich das weiße Blatt schon angestarrt. Manch ein Güterzug und mancher Schnellzug klirrte draußen über die Gleise. Sie haben mich kaum gestört; dicht umdrängten mich die Gesichter der Vergangenheit.
Wenn man so am Ende seines Lateins angelangt und so alt geworden ist wie ich, dann muss man allmählich mit der Vergangenheit abrechnen; ich muss feststellen, ob sie mir oder ob ich ihr etwas schuldig blieb – ob sich der schmerzliche Aufwand, den man Leben nennt, überhaupt gelohnt hat.
Ich glaube dies deutlich zu spüren: Mein Dasein ist noch nicht verurteilt, nur vergangen zu sein.
Doch in der Flaute, die wie eine Krankheit die Gewässer rings um mich befiel, widerstehe ich der Versuchung nicht, mich über die Reling zu lehnen und in die glasklaren, unbewegten Wasser hinunterzublicken, die mein Fahrzeug tragen.
Und ich sehe sie unter mir in den Fluten versunken – und leise verzerrt die Spiegelung des Wassers ihre Umrisse: die Dörfer und Städte von einst, die Wiesen und Wälder.
Ich selbst wandele unter mir in der gläsernen Tiefe dahin und werde des kühlen Beschauers nicht gewahr, der sich über des Schiffes Bord herniederbeugt und starrt und lauscht, so inbrünstig, als könnte er wieder lebendig machen, was seit Jahrzehnten schon ins Vergessene hinabsank!
Seht ihn an, wie er hinschlendert, jener Wilhelm Barkholtz, der ich gewesen bin. Sein Schopf ist noch blond und dicht; seine mächtigen Schultern hält er breit und aufrecht. Mühelos trägt er seine Ein-Meter-Neunzig und lässt sein Bambusrohr an der elfenbeinernen Krücke wirbeln, wobei er sich vergnügt eins pfeift – was kostet die Welt? So trug man sich damals auf dem Bund von Yokohama oder auf dem Market-Place von Sydney, damals vor dem Ersten Weltkrieg. Und der griese Wilhelm Barkholtz oben knurrt zwischen den Zähnen, wie er den gläsernen da unten im Vineta der Vergangenheit spazieren sieht: »Warte nur, du Laffe, dir wird das Pfeifen schon vergehen!«
Es ist wohl eine Stunde her, dass mich Clar durch die verschlossene Tür aus dem Nebenraum anrief:
»Bist du immer noch auf? Es muss doch schon sehr spät sein.« Ich habe ihr geantwortet:
»Schlafe nur, Kind! Ich krame ein wenig in Erinnerungen. Morgen ist ja Feiertag!«
»Ach ja!«, hörte ich sie erwidern und sich mit einem Seufzer auf die andere Seite drehen, wobei ihre dürftige Bettstatt wie gewöhnlich knarrte. Sie vermag ja unablässig zu schlafen. Gott sei Dank, dass sie es kann: So wird sie am ehesten die furchtbaren Erlebnisse und Entbehrungen verwinden, die sie seit dem Zusammenbruche erlitten hat.
Wie ein Wunder erscheint es mir, dass ich das zerrupfte, halb zerstörte Mädchen sozusagen von der Straße aufsammeln konnte. Ich hatte es schon aufgegeben, in dem grässlichen Wirbelsturm den letzten halbflüggen Vogel aus unserem Barkholtz’schen Nest noch zu retten. Denn Clar, oder Clarissa, wie sie eigentlich heißt, meiner Schwester letztes Kind, ist außer mir der einzige Mensch, in dem noch Barkholtz’sches Blut fließt. Alle anderen sind auf dem ungeheuren Scheiterhaufen, auf dem sich Deutschland falschen Göttern opferte, mit verbrannt und als tote Asche in den Wind geblasen.
25. V. 1947. Pfingstsonntag!
Mit den einzigen Freunden, die wir hier fanden, sind wir am Nachmittag auf den Schulterberg gestiegen: mit Geiger und seiner Frau. Geiger ist Bürgermeister des kleinen fränkischen Landstädtchens Hahnewald, in dem uns das wirbelnde Kielwasser des Krieges an den Strand spülte. Ich konnte dem Städtchen einen Dienst leisten: Auf Soldaten der amerikanischen Besatzungstruppe war geschossen worden; warum und von wem, das blieb unklar, doch sollte an der Stadt ein Exempel statuiert werden. Mir kam das alles äußerst blödsinnig vor. Ich legte mich mit meinen besten Sprachkenntnissen ins Mittel. So angesprochen ließen sich die Fremden schließlich überreden, Gnade für Recht ergehen zu lassen.
Nach diesem handgreiflichen Beweis meines Könnens nahm mich die gute Stadt vom Fleck weg in ihre Dienste, um zu dolmetschen. Später bot mir der neue Bürgermeister, eben Geiger, an, als Lehrer am Progymnasium des Städtchens zu wirken – aushilfsweise! Ich nahm den Vorschlag an und konnte für Clar und mich diese kleine Wohnung herausschlagen.
Warum also nicht? Ich putzte meinen lang vergessenen Doktorhut, besann mich auf mein schönes Baseler Staatsexamen in den Naturwissenschaften, fand sogar unter meinen geretteten Papieren noch einen Beleg darüber und unterrichte nun zu meinem eigenen Erstaunen die Büblein des Städtchens in Mathematik, Physik und Chemie, das heißt: bis auf Weiteres, provisorisch! Denn die echten Magister werden eines Tages wieder auftauchen.
*
Morgen ist abermals Feiertag, und ich darf mir die Nacht um die Ohren schlagen. Clar mit ihren achtzehn Lenzen lächelt mitleidig freundlich, wenn ich bis in die Puppen schlafe …!
Vor mir unser »häuslicher Herd« – wie prächtig sie das Ungeheuer wieder geputzt hat! Ich habe ihr schon hundertmal davon abgeraten; umsonst ist jede Mühe, die auf diese Missgeburt der Technik verschwendet wird.
Denn ich schreibe dies natürlich in unserer winzigen Küche; hier steht der einzige Tisch, groß und fest genug, daran zu schreiben. In meinem Zimmer gibt es nur eine alte, grün gestrichene Waschkommode, die ich obendrein voller Bücher gepackt habe, und schließlich ein gebrechliches Möbel auf Rollen, das zwar an einen Tisch erinnert, aber keiner mehr ist. Wenn man viele Jahre unter dem blanken Himmel kampiert hat, dann nimmt man solche Kleinigkeiten mit Humor.
Draußen schreit ein Käuzchen. Wahrscheinlich hat es sich in dem zerschossenen Wasserturm der Eisenbahnstation ein Notquartier eingerichtet.
Es ist wunderbar still und kühl und dunkel. Kein Auto stört den Frieden mehr.
Wollt ihr euch wirklich nahen, ihr Gesichte der Vergangenheit?
*
Unauslöschlich haben sich mir die Ereignisse jener Nacht im September des Jahres 1917 ins Gedächtnis eingegraben. Von ihr ab rechne ich mein Schicksal, obgleich ich damals schon zweiunddreißig Jahre zählte. Die Tage zuvor waren von jener berauschenden Klarheit, jener schwermütigen Süße erfüllt gewesen, wie sie nur die Indianer-Sommer im Felsengebirge als letztes, holdestes Opferfest des Jahres aufblühen lässt. Ich arbeitete an meiner Fallenstrecke, die mir und meinem Gefährten Dan den Winter über Beschäftigung – und Pelze! – gewähren sollte. Aber stets kehrte ich früher auf meinen Berg heim: Zu sehr verlangte mich danach, von der Höhe den Abend über Bergen und Wäldern verblassen zu sehen.
Das Blockhaus, in dem ich wohnte, duckte sich in eine Mulde an der Berglehne. Vor Jahren hatte hier ein Windbruch den Wald gelichtet. Die gestürzten Fichten lieferten im Überfluss das Baumaterial für die Hütte; meine Vorgänger hatten das niedrige, ziemlich längliche Obdach mit viel Kunst und Sorgfalt wie für die Ewigkeit gefügt. Die Stirn des Hauses war westwärts dem Tale zugekehrt, mit einer schlichten Veranda davor, die von dem vorspringenden Dach beschirmt wurde. Der Boden schwebte schon in mehr als Mannshöhe über dem felsigen Grund, denn der Hang fiel talwärts immer steiler ab, um schließlich senkrecht zum Fluss hinunterzustürzen. Er bahnte sich in der kühlen, feuchten Tiefe in wildem Gleichmut seinen Weg, an glatten Wänden vorbei, seine Gletscherwasser um bemooste Felsen gischtend, wütend und ewig.
Auf einem groben Schemel hockte ich. Hinter der Kette der Kaskaden war die Sonne zur Rüste gegangen. Aber noch brandete ihr Licht wie goldener Schaum über die fernen Gipfel und zeichnete die Felsentürme mit brennendem Pinsel nach. Waren die Berge nicht kristallen, aus nachtblauem Glase aufgebaut? Je dunkler es wurde, desto seltsamer spielten die Farben ins Violette hinüber. Über dem tief sich abwärts beugenden Tal schwebten zwei Raubvögel in weiten Kreisen ruhevoll.
In der unendlichen Stille vernahm ich den Gesang des Stromes aus den Abgründen. Wie ich ihn liebte, den verhaltenen Orgelton aus dem Innern der Erde! Seit ungezählten Sommern durchrauschte er das verschwiegene Tal. Ein Lied der unaufhaltsamen Zeit; sie sang es sich selber, niemand sonst zur Ehre, es sei denn einem Gotte – oder gar Gott!
Wenn mit den rinnenden Stunden die Schatten der Nacht mich dichter umringten, wenn die Sterne aufbrannten, zuerst die wandelnden, Venus oder Mars oder Jupiter, mit trostvoll ruhigem Licht, die festgehefteten dann, der mächtige Sirius, Aldebaran, der lodernde, diamanten die Wega, wenn der Gesang des meerwärts strebenden Stromes in der höher wogenden Dunkelheit stärker und selbstgewisser zu brausen begann, wenn tauige Kühle und die Düfte der Nacht mir Gesicht und Hände fächelten, so überfiel mich wohl eine sonderbare Erstarrung. Ohne ein Glied zu rühren, lauschte ich dann auf das dumpfe Klopfen meines Herzens; in den Ohren pochte es wie auf gedämpfter Pauke. Lebte ich noch? War ich noch ich? Ich verging, vermischte mich ganz mit den Säften der Einöde. Wuchsen nicht Wurzeln aus meinem Herzen tief ins felsig-feuchte Erdreich? Schwebte ich nicht auf den Schwingen der Steinadler über dem Abgrund der Nacht? Rann mein Blut nicht einsam und selbstverloren durch die Gefäße meines Leibes wie die Ströme tief in den Schluchten, Geäder des Gebirges? Wer war ich, der ich allein hier lebte, inmitten ungeheurer Berge? Ich wusste nicht einmal, ob sie alle schon Namen trugen. Gott hat sie namenlos erschaffen.
Erstarrt saß ich lange, nur noch ein winziges Teilchen der Nacht. Und bis in die letzte Faser, den feinsten Nerv durchwogte mich das hinreißende Glück, die zermalmende Qual vollkommener Einsamkeit.
Gewöhnlich weckte mich ein fallender Stern aus meiner Starre. Die Schnuppe stürzte ihren knisternden Silberbogen mitten in mein Herz und der Funken sprang über.
So auch in jener Nacht, von der ich erzähle. Ich erhob mich steif und reckte mich. Noch einmal warf ich einen Blick über das schlummernde Tal. Es war verwandelt nun; der Zauber hatte mich entlassen. Friedvoll schwieg die Wildnis mir zu Füßen; jenseits hoben sich sanft in den Nachthimmel die Schattenrisse der Kaskaden.
Ich trat ins Haus und entzündete die Kerze; ich goss mir ein Glas kalten Tee ein und setzte mich an den Tisch.
Bald würde der bescheidene Kerzenschein Besuch herbeilocken, eine Waldeule, die am Rand der Lichtung in einer hohlen Fichte wohnte. Da war sie schon! Ihr Ruf fuhr klagend zu mir herüber. Wie immer saß sie auf dem zugespitzten Felsblock, der sich ein Dutzend Schritte unterhalb der Veranda gleich einem Wächter drei Mann hoch aufreckte.
Geheimnisvoll, schön und voll Wahrheit stiegen ewige Werke vor mir auf, gleich fernen Felsenküsten: Herrlich und immer herrlicher sich entschleiernd grüßen sie heimkehrenden Schiffern trostvoll und heimatsüß entgegen, und ich fand mich verzaubert an den Quellen wieder, die im innersten Abgrund sprudeln.
In jener Nacht, als die Eule schrie, das Flämmchen der Kerze brannte und auf der Eisenplatte meines Herdes einen stumpfen Widerschein weckte, in jener Nacht, in der mein Schicksal seinen Anfang nahm, denn bis dahin war das Leben nur Vorbereitung gewesen, las ich die Verse:
»Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern hat mich befallen, und Grauen hat mich übermannt.
Ich sprach: Oh, hätte ich Flügel wie die Tauben, dass ich flöge und wo bliebe! Siehe, so wollte ich ferne hinwegfliehen und in der Wüste mich verbergen!«
Und ich? Wovor bin ich geflohen?
Ich löschte endlich das Licht und trat noch einmal vors Haus. Es war Zeit, schlafen zu gehen. Am kommenden Tage wollte ich die beiden letzten Fallen meiner Strecke an die gewählten Plätze schaffen und verankern; das bedeutete einen Marsch von zwanzig Meilen hin und zurück, hin mit beträchtlicher Last.
Ich würde mir am anderen Ende der Fallenstrecke ein festes Obdach bauen müssen, denn ich hatte eine weite Strecke ausgelegt. Dreimal in der Woche wollte ich sie ablaufen, mich mit Dan abwechselnd. Es empfahl sich sehr, für den Fall eines plötzlich hereinbrechenden Unwetters oder gar Unfalls einen Nothafen anzulegen. Das würde mindestens eine Woche kosten. Hoffentlich hielt das trockene, warme Wetter des Herbstes noch an.
Kein Mond schien. Nur das Sternenlicht rieselte mild. Der Wind schlief. Aus der Tiefe sang der Strom. Ich stand auf dem Grunde der Nacht. Und über mir wogte das Meer der Ewigkeit.
Der Waldkauz strich von der Felsnadel ab, auf lautlosen Schwingen dicht an mir vorbei, dass ich kühl die Luft wehen fühlte.
Gerade schickte ich mich an, den Stuhl und einige Geräte ins Innere der Hütte zu tragen (manchmal kamen vor Morgengrauen Braunbären zu Besuch und verschleppten oder zerbrachen im Spiel, was draußen umherstand), als mich ein ungewohnter Laut aufhorchen ließ. Ich richtete mich auf, hielt den Atem an und lauschte.
Jetzt …! Ja, kein Zweifel war möglich: Es rief jemand in der Nacht, ganz ferne, doch deutlich hörbar.
Wieder der Laut aus Süden! Der Rufende musste etwa dort zu suchen sein, wo der Pfad aus dem Felsen kletterte und den Talgrund erreichte. In der nächtlichen Stille, der unbewegten, kristallenen Luft, trug der Schall unglaublich weit.
Ob es Dan war, der mich rief? Doch der kannte den Weg auch bei Nacht. Wer aber auch immer des Nachts da unten rief, er war in Not! Nur mir konnte der Ruf gelten, denn außer mir atmete kein menschliches Wesen in diesen Bergen und Tälern weit im Umkreis.
In kurzen regelmäßigen Abständen hörte ich den Ruf nun, ein kaum vernehmbares Seufzen, von weit her. Ich sprang ins Haus, entzündete eine Sturmlaterne und eilte mit ihr wohl hundert Schritte den Pfad entlang bis zu einer Stelle, wo er sich um eine weit ins Tal vorspringende Felsnase wand; hinter ihr begann er sich sehr steil zu senken. Diesen Punkt, das wusste ich, konnte man vom oberen Ende der Talwiesen her erkennen. An der Bergnase also blieb ich stehen und schwenkte die Laterne einige Male auf und nieder, verhielt dann – und nochmals auf und nieder. Lauschte: Da drang noch einmal der Ruf zu mir und verstummte dann. Man hatte mein Zeichen gesehen und verstanden.
Schon hatte ich die Laterne gelöscht – im Sternenschein unterschied ich den Steig viel sicherer – und eilte bergab. Nur Dan Halvorsen wusste, dass sich hinter der Felsnase die Hütte verbarg! Nein, nicht er allein …!
Ich erschrak. Auch dem Thomas O’Flaherty hatte ich es anvertraut, als er mich mit seiner Schwester Anne vor einem Jahr besuchte. Auch der alte Mike O’Flaherty, ihr Vater, wusste davon. Die Vorbesitzer meiner Hütte waren ja seine Freunde gewesen. Als sie zu Beginn des Jahres 1915 in den Osten der Staaten zogen, wo sie sich leichteren Verdienst erhofften, hatten sie mir auf O’Flahertys Empfehlung gegen geringes Entgelt ihre Hütte mit aller Einrichtung abgetreten, denn O’Flaherty war mit einer Schwester meines Vaters verheiratet.
Mein Herz pochte wild; nicht bloß von der Hast des gefährlichen Abstiegs im unsicheren Sternenlicht!
Plötzlich stand wieder in meinem Hirn die Frage auf: Wovor war ich geflohen, als ich mich in diese Berge zurückzog?
Vor mir selber?
Oder vor Anne O’Flaherty?
Ich wundere mich heute noch, dass ich den Talgrund erreichte, ohne mir Knochen und Hals zu brechen, denn ich tobte bergab, als wäre es heller Tag und der schmale Pfad eine breite Treppe. Wahnsinn, auch nur zu vermuten, dass es Anne war, die gerufen hatte! Was wollte sie mitten in der Nacht in meinem entlegenen Tal? Unmöglich, es konnte Anne nicht sein!
Es war Anne!
Während ich die letzten hundert Schritte abwärts sprang, unterschied ich große Schatten, die sich auf dem Wiesenplan bewegten: Pferde. Da stand ein Mensch. Eine Frauenstimme rief:
»Bill, bist du es?«
»Ja!«
»Gott sei Dank!«
Ich näherte mich langsam, um die Pferde nicht zu schrecken.
»Anne, um alles in der Welt, was bringt dich hierher?«
Ich sah eine dunkle Gestalt im Grase liegen: Ich hörte einen Mann stöhnen. »Himmel, wer ist das, Anne?«
Sie reichte mir die Hand. Ihre Worte überstürzten sich: »Thomas ist es. Er blutet. Ich habe ihn gerade noch bis hierher bekommen; er konnte sich nicht mehr auf dem Pferde halten, obgleich ich ihn festband. Wir sind seit letzter Nacht unterwegs. Hier versagte er. Ich fand den Anstieg nicht. Die Pferde weigerten sich. Gott im Himmel sei Dank, dass du mich hörtest! Ich glaube, er stirbt! Bill, wenn er stirbt …!«
Ihre Kraft war am Ende. Sie lag an meiner Brust und weinte heftig. Ich bebte wie ein Baum, neben dem der Blitz in die Erde schlägt. Ich schob sie sachte fort: »Komm, Anne! Was ist mit Tom?«
Ich entzündete meine Laterne. Fast erkannte ich Thomas nicht wieder. Sein Gesicht blickte mich grau an, war von Schmerzen schrecklich verzerrt. An der rechten Schulter und Brust zeigte das feste, bunt gewürfelte Hemd eine dicke Blutkruste, durch die ständig frisches Blut nachsickerte. An der rechten Hüfte schlug ebenfalls Blut durch die steife Cordhose. Mit dem Messer schnitt ich das Hemd fort. Ein Verband kam zum Vorschein; er bildete nur noch einen blutigen Knäuel. Ein Ausschuss dicht unter dem Kugelgelenk lag frei; unaufhörlich rann daraus der rote Lebenssaft. Der Einschuss am Schulterblatt war trocken und fest verkrustet, mit geronnenem Blut verklebt. Tom stöhnte entsetzlich, als ich ihn vorsichtig zur Seite drehte, um den Einschuss zu finden. Ich rührte die Kruste nicht an, schnitt die Fetzen des Verbandes rundum weg.
»Wir müssen das Blut zum Stehen bringen; es ist hellrot und schaumig. Die Lunge ist gestreift.«
»Ich habe noch Verbandstoff!«
Aus Mull drehte ich einen steifen Pfropfen und stopfte ihn in den Wundkanal, drückte dann den Handteller darauf. Tom stöhnte wie ein Tier und wand sich. Wohl eine halbe Stunde hielt ich den Pfropfen mit meiner Hand fest an seinem Platz. Er beruhigte sich, lag schließlich ganz still. Ich konnte die Hand endlich abheben: Es hatte sich ein fester Wundverschluss gebildet. Ich hüllte die ganze Schulter abermals in einen festen Verband.
Er schien zu schlafen. Ich flüsterte:
»Wie schaffen wir ihn jetzt auf den Berg?«
»Wenn er sich etwas ausgeruht hat … Hier können wir nicht bleiben.«
»Hole die Pferde, Anne! Dich kennen sie. Mir würden sie doch nur davonlaufen. Ich glaube, sie sind zum Fluss hinunter!«
»Ja, Bill!«
Sie ging durch das tiefe, taunasse Gras davon und war bald in der Nacht verschwunden.
Noch hatte ich keine Ahnung, was geschehen war. Sie hatten sich zu mir geflüchtet. Irgendetwas Schreckliches musste geschehen sein. Es kümmerte mich kaum. Eins nur wusste ich: Anne in höchster Not war zu mir geflohen – zu mir! Anne, mitten in meine Einöde!
Da tauchte sie wieder auf, die beiden Pferde am Zügel führend. Ich rüttelte Tom sachte, er schlug die Augen auf, lächelte mühsam:
»Bill, du? Gott sei Dank!«
»Tom«, sagte ich, »du musst noch einmal aufs Pferd. Wirst du’s noch eine Stunde aushalten?«
»Es muss ja gehen!«
»Wir stützen dich beide!«
Ich hob ihn aufs Pferd. Manchmal ist es gut, wenn man so groß ist wie ich und Hufeisen auseinanderbiegen kann. Anne setzte sich rittlings hinter ihrem Bruder auf des Pferdes Kruppe und umschlang ihn mit ihren Armen. Ich führte den Gaul. Den Zügel des zweiten Tieres band ich an den Schwanz des ersten.
Es wurde ein hartes Stück Arbeit, denn das Pferd war müde und störrisch; aber wenn es nicht wollte wie ich, presste ich ihm das Gebiss um den Unterkiefer, dass es knirschte. Es musste mir die teure Last auf den Berg tragen. Ich konnte es jetzt nicht schonen.
Ehe es noch dämmerte, schlief Tom schon auf meiner Bettstatt, Anne auf einigen weichen Bärenfellen.
Ich lag auf einer Schütte trockenen Mooses, sah leise den Tag in den Fenstern meiner Hütte aufglimmen und horchte auf die tiefen Atemzüge der Schlafenden. Anne flüsterte zuweilen im Traum, aber ich konnte nichts verstehen.
Bis auch mir die Augen zufielen.
31. V. 1947.
Als ich vor sechs Tagen die letzten Worte geschrieben hatte, muss ich bald darauf an meinem Küchentische eingeschlafen sein. Ein Wunder war es schließlich nicht. Über Pfingsten hatte ich mir nur wenig Schlaf gegönnt. Kühl wehte schon die Frühluft in das offene Fenster. Der Kopf war mir einfach auf die Brust gesunken. Die Hand lag noch auf dem Papier; aber der Stift war ihr entfallen.
Clar hat es mir berichtet. Ihr erschreckter Ausruf weckte mich. Ich fuhr verwirrt hoch. Im Traum hatte soeben die Eule geschrien. Aber nicht Anne stand vor mir, wie ich wohl vermutet hatte, sondern, in ihren alten blauen Bademantel gehüllt, Clarissa.
»Was ist denn?«, fragte ich ärgerlich.
»Ach, Ohm, du hast mich so erschreckt! Du hast dagesessen, als wärst du tot! Ich hörte etwas in der Küche und kam heraus, um nachzusehen, was es wäre. Es ist ja schon Zeit zum Aufstehen. Warst du noch gar nicht im Bett?«
»Nein! Ich muss über meiner Schreiberei eingeschlafen sein. Sieh, da stehen sie noch, die letzten Worte: Bis auch mir die Augen zufielen.«
Sie blickte mit mädchenhafter Neugier auf das Blatt.
»Schreibst du ein Buch, Ohm?«
»Das nicht gerade. Ich notiere mir nur einiges, was ich nicht vergessen möchte. So eine Art nachgeholtes Tagebuch. Wenn ich dann einmal tot bin, darfst du es lesen!«
»Da kann ich ja noch lange warten!«
»Sehr schmeichelhaft! Aber wahrscheinlich deckt mich schon die Erde, wenn du erst gerade ans Heiraten denkst.«
»Ach, rede nicht so. Du willst mir bloß Angst machen. Ich will nichts vom Heiraten wissen. Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist: dass ich dir die Wirtschaft führe und die Kragen plätte und die Strümpfe stopfe. Du bist doch jetzt so etwas Ähnliches wie Studienrat. Der braucht eine Haushälterin!«
»Gewiss, gewiss! Ich bin durchaus einverstanden mit dem jetzigen Zustand!«
Mir war etwas ungemütlich bei dem Gespräch. Diese jungen Dinger von heute reden wie ein Wasserfall, wenn sie etwas durchsetzen wollen. Aber wie sie da stand, noch kindlich schmal, ziemlich hoch aufgeschossen, eng in ihren verschossenen Mantel gewickelt, das kastanienbraune Haar wirr um die reine, ungetrübte Stirn und die graugrünen Augen, die schon so viel Entsetzliches gesehen haben. Mit bestürzender Deutlichkeit erinnerte sie mich wieder an meine Mutter, ihre Großmutter.
»Lass uns jetzt Kaffee trinken. Ich lege mich dann hin und nachmittags wandern wir zum Gnevenwald, das heißt, wenn du nicht lieber schwimmen gehen willst. Ich täte das auch ganz gern; aber das junge Gemüse an der Wirle macht mir zu viel Spektakel. Morgen muss ich sowieso wieder so tun, als ob ich den Bakel schwinge.«
»Lieber gehe ich mit dir in den Gneven! Lässt du mich jetzt allein hier, damit ich mich wasche und fertig mache?«
»Natürlich! Rufe mich dann!«
Ich legte meine Papiere zusammen und verschwand in mein Zimmer.
So leben wir beide zusammen, die Achtzehnjährige und ich, der Zweiundsechzigjährige, der zwar noch schwimmt, beliebig lange, und acht oder zehn oder vierzehn Stunden im Sattel sitzen würde, wenn es üblich wäre, dass in Deutschland die Studienräte reiten – und nun gar die Hilfsstudienräte (die »im Zuge des Zusammenbruchs« auf ihre Posten gelangt sind!) –, und wo Reiter den unbeweisbaren Verdacht erwecken, entweder Militaristen oder Junker oder gar – entsetzliche Vorstellung! – beides zugleich zu sein!
Jetzt ist es nun mit Gottes Hilfe wieder Samstag geworden. Meine Bengels sind sicher mit mir zufrieden gewesen; die Hebelgesetze machten ihnen Spaß, und im Übrigen war ich meist nicht bei der Sache.
*
Ich zergrüble mir das Hirn, wie sich damals vor zweiunddreißig Jahren auf meinem Einödberg über dem brausenden Shaggy-River das Schicksal weiter entfaltete.
Anne pflegte ihren Bruder mit Hingabe. Ich hatte eigentlich nicht viel mehr zu tun, als für Essen und Trinken zu sorgen. Tom lag im Fieber, vermochte kaum die Augenlider zu heben vor Schwäche. Es wird mir immer ein Wunder bleiben, dass er überhaupt mit seinen Wunden den weiten Ritt hat überstehen können. Aber er war auf Pferdesrücken in der Wildnis groß geworden und nie eine Stunde krank gewesen.
Sein Vater, der alte Mike O’Flaherty, züchtete Schafe auf einer riesigen Farm am Columbia. Der Ire O’Flaherty, der sich als einer der Ersten in diesen entlegenen Landstrichen niedergelassen hatte, hatte seine beiden Kinder in der gleichen schroffen Ablehnung Englands erzogen, die er als Knabe aus der Armut Irlands mitgebracht und die ihm sein Vater als ein heiliges Vermächtnis aufgetragen hatte. Seine deutsche Frau, meines Vaters Schwester, hatte nichts daran zu ändern vermocht. Wahrscheinlich hatte sie den schwarzhaarigen, schnellen, unbeugsamen Mann viel zu sehr geliebt. Die Barkholtz stammen aus dem Kehdinger Land, von der Unterelbe, und soweit sie nicht Bauern oder Pastoren gewesen sind, waren sie zur See gefahren und hatten oft genug ihre großen Knochen in die fernsten Meere gesenkt.
Eine romantische Geschichte übrigens, wie die Cora Barkholtz an den Iren Mike O’Flaherty kam. Mein Vater, Lauritz Barkholtz, segelte in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als Eigentümer und Kapitän eine Viermastbark über die Seven Seas. Er frachtete insbesondere Holz von der Westküste Nordamerikas nach Japan und China und brachte Seide und Kulis zurück. Auf diesem Schiff habe ich die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht, denn meine Mutter, ich und schließlich meine um fünfzehn Jahre jüngere Schwester Minna, wir lebten alle mit meinem Vater an Bord der »Barbara Veit« (so hieß meine Mutter, ehe sie heiratete). Wie andere Kinder im Kinderwagen festgebunden werden müssen, damit sie nicht auf den Rasen fallen, so musste ich mit einem Gurt aus altem Segeltuch festgezurrt werden, um nicht in den Pazifischen oder Indischen Ozean zu stürzen.
Auf eine dieser Reisen hatte mein Vater seine Schwester Cora mitgenommen, die sich ein wenig die Welt ansehen sollte, ehe sie sich endgültig im Kehdinger Land niederließ. Denn eine Weile die Nase in Allerweltswind gehalten zu haben, das verstand sich für jeden und jede Barkholtz beinahe von selbst. Ich war damals neun Jahre alt und stand kurz vor meiner Übersiedlung nach Basel zu den Verwandten meiner Mutter; irgendwo musste ich schließlich »richtig« zur Schule gehen; ich wuchs meiner Mutter, die mich bis dahin sehr sorgsam unterrichtet hatte, allmählich aus der Hand; und es machte ihr immer weniger Spaß, mir den alten Bootsmann Lührs in die Wanten nachsenden zu müssen, wenn Religion oder Kopfrechnen angesetzt waren. Mein Vater lachte nur zu meinen Streichen, und meine Mutter hatte oft genug zu beweisen, dass sie uns beide, den großen und den kleinen Barkholtz, nicht nur auf liebendem, sondern auch auf geduldigem Herzen trug. Nun deckt sie längst die grüne See, vor der sie eine geheime Furcht wohl nie ganz verwunden hat. Eine Baseler Bürgerstochter – auf allen Meeren daheim, das passt gewiss nicht zusammen. Ob sie glücklich war?
Tante Cora war weißhäutig, hellhaarig, blauäugig, kleiner und zierlicher als mein Vater, der überlebensgroß geraten war. Ich weiß noch, dass sie mir vornehm und stolz erschien, denn sie trug stets eine goldene, edelsteinbesetzte Brosche, die ein geflügeltes Insekt darstellte, einen breitrandigen Florentinerhut und einen mit vielen seidenen Rüschen besetzten Sonnenschirm. Diese drei Abzeichen ihrer Würde prägten sich mir fest ein.
Wir kamen nach Snohomish, nördlich Seattle. In San Francisco hatten wir eine Ladung chinesischer Kulis an Land gebracht; das war für mich eine aufregende Fracht gewesen. Die schlitzäugigen Männer schleppten alle ein Säckchen Heimaterde über den Ozean, um damit begraben zu werden, wenn sie in der Fremde sterben sollten. Ich fand die Beutelchen überaus erregend, und meine Mutter hatte einige Differenzen mit mir auszufechten, weil ich mir unbedingt einen Zopf wachsen lassen wollte, wie ihn meine schnell gewonnenen Freunde, die Söhne des Himmels, trugen.
In Snohomish wollten wir die »Barbara Veit« voll Schnittholz für die Kaiserlich Chinesische Regierung laden. »Für die alte Kaiserin in Peking!«, sagte mein Vater und erzählte mir Wunderdinge von dem bösen Drachen in der Verbotenen Stadt.
Doch mussten wir aus irgendeinem Grunde auf unsere Ladung warten, und mein Vater überredete meine Mutter, mit ihm einen Ausflug in die Berge zu machen, die sich östlich und westlich des mächtigen Puget-Sundes erheben, an dem Seattle liegt. Er wusste, wie sehr meine Mutter sich stets nach Bergen und grünen Wäldern sehnte, und er nahm jede Gelegenheit wahr, sie für ein paar Tage vergessen zu machen, dass er sie um Haus und Hof und Garten gebracht hatte und ihr nur das schwankende Achterdeck eines hölzernen Schiffes als Heimat bieten konnte. Die »Barbara Veit«, die in der Bucht vor Anker lag, wurde der Obhut des Ersten Steuermanns, des ebenso schweigsamen wie unübertrefflichen Herrn Habersack, überlassen. Ich wurde indessen dem allkundigen Bootsmann Lührs anvertraut, der der einzige Mensch war, der mich zuweilen verprügelte, sehr zum Schrecken meiner guten Mutter (mein Vater sah nicht hin; er wusste, was er an seinem Bootsmann hatte), Lührs, den ich bedingungslos als den Inbegriff aller Mannhaftigkeit und brotlosen Künste verehrte.
Selbst meine Mutter konnte nicht leugnen, dass Lührs, dieser kleine, scheinbar plumpe, glatzköpfige Mann, mit Muskeln wie eiserne Knollen, krummen Beinen und viereckigen Händen aus Teer, Horn und Leder, besser auf mich aufpasste als zehn Kindermädchen, dass ich ihm vor allen Dingen besser an der Leine ging als der Pudel seinem Herrn. Wir lebten auf der »Barbara Veit« als eine einzige große Familie, will es mir in der Erinnerung, der wahrscheinlich schönfärberischen, erscheinen; und der Vater herrschte über uns alle unbeschränkt, wohl nicht immer voller Langmut, sicher aber mit Großmut und Anstand. So wuchs ich auf mit Vater und Mutter, dem Ersten und dem Zweiten Steuermann, dem Bootsmann und dem Zimmermann, dem Segelmacher und den anderen »Händen« allen, einschließlich Koch und Moses, dem Schiffsjungen, Claas Claassen aus Jadebüll, den ich mit seinen weidlich abstehenden Ohren nicht gut leiden mochte. Denn mit unbeschreiblichem Hochmut nahm er meine Winzigkeit nie zur Kenntnis, durfte er doch mit in die Wanten, selbst hinauf zur Royal-Rah, während mich Lührs stets herunterholte, wobei er mich unter den linken Arm klemmte wie ein Paket. Auf Deck bekam ich dann eine hinter die Ohren, die nicht von schlechten Eltern war, und Lührs sagte etwa: »Da hast du noch gar nichts auf zu suchen, da auf der Fock, du ungeteerten Nichtsnutz! Da …! (Ohrfeige.) Die wäscht dich kein Regen mehr ab!«
Nun gut! Vater und Mutter ließen sich an Land rudern; Tante Cora war natürlich mit von der Partie. In fünf Tagen sollten die Ausflügler wieder zurückkehren. Am sechsten Tage wollte Vater das Schiff zur Ladestelle verholen lassen. Am siebenten würde die Ladung bereit zur Übernahme sein. So war es abgesprochen. Aber das Beiboot wartete den ganzen fünften Tag über an der Pier; der Herr Kapitän und die Seinen stellten sich nicht ein. Habersack brachte das Schiff an den Ladeplatz. Wir luden Bündel auf Bündel von schönen glatten Brettern, Rot-Zedern müssen es gewesen sein. Die ganze Besatzung war von Unruhe und Besorgnis erfüllt. Am vierzehnten Tage, als wir längst wieder auf der Reede vor Anker lagen, denn die Laderäume waren voll, die Luken dicht, das Schiff segelfertig, erschienen Vater und Mutter – in düsterster Stimmung. Tante Cora fehlte. Noch am selben Nachmittag signalisierte Vater den Schlepper herbei. Der nahm uns an die Leine, und wir glitten über den weiten, stillen Sund der Juan-de-Fuca-Straße und der offenen See entgegen.
Auf meine Frage, wo Tante Cora geblieben wäre, erhielt ich nur eine ausweichende Antwort. Mit der Zeit reimte ich mir jedoch aus gelegentlichen Äußerungen bei Tische das Wesentliche zusammen: Tante Cora hatte an Land einen Mann gefunden, war vom Fleck weg geheiratet worden und kam nicht wieder mit nach Hamburg. An Land passierten so verrückte Sachen; auf See kam dergleichen nicht vor, da ging alles ordentlich und verständig zu. Das war Lührs’ Auffassung von der Sache und meine demzufolge auch.
Heute verstehe ich den Ärger meines Vaters, das beschämte Entsetzen meiner Mutter. Auf einem Fest in dem Städtchen Snohomish hatte Cora Barkholtz den Iren Michael O’Flaherty kennengelernt. Die beiden so verschiedenen Menschen, er fast schwärzlich zu nennen, feurig, witzig, leicht aufbrausend, sie in ihrer hochmütig wirkenden Langsamkeit, hellhäutig, doch offenbar fähig zu kühler Glut, entbrannten zueinander auf den ersten Blick. Noch am gleichen Abend beschlossen sie zu heiraten; sie führten den Beschluss auch aus gegen alle Bedenken, gegen alle heftigen Proteste meines Vaters und meiner Mutter. Die blonde Cora aus dem Kehdinger Lande erklärte mit der ganzen Starrköpfigkeit ihrer Rasse: »Wenn ihr beide meine Trauzeugen nicht sein wollt, dann mieten wir uns zwei von der Straße!«
Ein Pfarrer fand sich schnell, der die beiden zusammengab, nach katholischem Ritus übrigens, denn der irische Bräutigam war natürlich katholisch. Cora muss wohl völlig außer sich gewesen sein. Aber da sich die Eheleute wahrhaft liebten und achteten, hat es wohl wegen des Glaubens niemals Streit gegeben. Cora O’Flaherty, geborene Barkholtz, ist nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt; sie zog mit ihrem Mann zu den Schwiegereltern in die östlichen Wildnisse des Staates Washington, pflegte die alten Leute bis zu ihrem Tode und trat dann die Stelle ihrer Schwiegermutter an. Die Ehe entwickelte sich wider alles Erwarten sehr glücklich. Cora brachte die geduldige Liebe auf, die der Mann brauchte, und er verlieh ihrem Leben den schnelleren Schwung, nach dem sie sich im Geheimen gesehnt haben mochte.
Ich traue dem alten Glauben, dass nur ein wahrhaft liebendes Paar schöne und wiederum liebenswürdige Kinder zeugt. Wenn dies gilt, dann müssen der Ire O’Flaherty, der noch in Cahersiveen, in der Grafschaft Kerry, Irland, geboren war, und das helläugige Mädchen aus dem Kehdinger Land sich sehr geliebt haben, denn Anne, die Erstgeborene, und Thomas, der Jüngere, waren schön und liebenswürdig, wobei Tom mehr nach der Mutter, Anne mehr nach dem Vater geschlagen war.
*
Im April 1917 war Amerika in den Krieg gegen Deutschland eingetreten. Die O’Flahertys begeisterte das nicht sonderlich. Weniger, weil die Mutter aus Deutschland stammte, als vielmehr weil sie Iren waren … Tom, der prächtige Bursche, ging an den ererbten irischen Überzeugungen zugrunde. Ich lernte damals, dass Hass immer sinnlos ist.
Tom wurde zu den Waffen gerufen; er gehorchte widerwillig. Der Drill wurde ihm, der nie in seinem Leben eingezwängt gelebt hatte, zur Qual. Wahrscheinlich verlieh er seinen Ansichten über den Krieg allzu oft und allzu deutlich Ausdruck; vielleicht hatte sich auch seine deutsche Mutter herumgesprochen. Bei einer Felddienstübung mit scharfen Patronen verlor er sich aus der Hand und schoss einen Kameraden namens Burley, der ihn hänselte und schon oft gehänselt hatte, über den Haufen. In der ersten Panik floh er. Wohin anders als nach Hause! Der Telegraf war schneller. Polizei erwartete ihn. Doch er näherte sich der heimatlichen Farm nicht ohne Vorsicht. So entging er dem Hinterhalt, den man ihm gelegt hatte, um Haaresbreite. Die Häscher sandten ihm einen Schauer von Kugeln nach, trafen aber erst, als er schon zu Pferde saß und über den Koppelzaun fegte – sonst hätte er sich wohl kaum noch auf den ungesattelten Gaul schwingen können. Eine Stunde lang verfolgte ihn die Polizei; dann verbarg ihn die Nacht in ihrem schützenden Mantel.
Anne aber, die zarte, zierliche, mit dem Antlitz einer süditalienischen Madonna, wusste ihn verloren, wenn er nicht vor Tagesanbruch weit war und jede Spur gelöscht. Sie glaubte auch, erkannt zu haben, wie ihn eine Kugel ereilte, packte also in fliegender Hast das Notwendigste zusammen, umarmte Vater und Mutter und zog im weiten Bogen mit den besten Pferden davon. Nach ihr würde niemand fragen; man hatte sie kaum beachtet. Gleich stand bei ihr fest: Wenn ich Tom finde, bringe ich ihn in die Berge zu Bill. Dort vermutet uns niemand.
Der Vater hatte ihr beschrieben, wohin sich Tom wahrscheinlich gewendet haben mochte: in ein Gelände, wo ein unbeschlagenes Pferd kaum Spuren hinterließ, wo man dem Fliehenden nur mit großer Vorsicht folgen konnte. Anne, die nicht schlechter ritt als ihr Bruder und jeden Winkel des Landes kannte, stieß schon nach drei Stunden Weges auf den Verwundeten. Sie verband ihn, so gut sie konnte. Bald nach Mitternacht ritten sie weiter und gewannen bis zum Morgengrauen viele Meilen Vorsprung.
Die Verfolger haben den Fliehenden in ganz anderer Richtung gesucht, wie wir später vernahmen. Die Geschwister waren längst außer Gefahr, während sie noch wie gehetzt Stunde um Stunde vorwärts hasteten, den Pferden das Äußerste zumutend.
So gelangten sie schließlich zu mir.
5. VI. 1947, 3 Uhr morgens.
Es ist schon eine Stunde her, seit Clarissa wieder zu Bett ging. Ich stand soeben noch am offenen Fenster und sah dem Gewitter nach, dem ungeheuren, das ferne über den Waldbergen vergrollte, noch immer ganze Bündel von Blitzen zwischen den blauschwarzen Wolken und der geduldig finsteren Erde hin und her schmetternd. Nun rauscht der Regen, der langersehnte. Die vergangenen Tage haben in schwüler Hitze geschwelt. Morgen, ich meine heute, ist Feiertag, Fronleichnam. Der Regen wird in einigen Stunden versiegen; dann werden die Straßen frisch und kühl zwischen ihren ins Pflaster gepflanzten grünen Bäumen und unter reichen Girlanden die Prozession von Altar zu Altar führen.
Die Einwohner des Städtchens sind überwiegend katholisch; ich wünsche ihnen einen Festtag ohne Staub, ohne Regen, mit leichter Sonne zwischen hellen Wolken und einem erfrischenden Wind.
Gewitter wie dieses habe ich in Europa selten erlebt. Es begann bei sinkender Nacht mit einem elektrischen Sturm in den höchsten Wolkenregionen, ohne Donner und Regen. Die Wolken, hinter denen das grelle Licht wie aus geborstenen Riesensternen unaufhörlich hin und wieder flackerte, standen wie Steingebirge am Himmel. Clar hatte sich todmüde und erschöpft niedergelegt; die zitternde Spannung der Atmosphäre ließ sie nicht schlafen.
Plötzlich schlug eine weiße Lohe, knisternd wie Wälder von Silberpapier, in die Akazienallee jenseits der Landstraße; ein Knall von hunderttausend Kesselpauken auf einmal, mit schärfstem Hieb geschlagen. Und gleich danach nochmals, und nochmals. Die Luft, das Hirn, das Feld und jeder Nerv: nichts als Opfer dieses alles zersplitternden, furchtbaren Schlages. Die Blitze endlich hatten den Weg aus den Wolken zur Erde gefunden. Es flammte das Land fahl, eine einzige schaurige Geistererscheinung.
Ich war beim ersten scharfen Schlag zusammengefahren, vom Donner gerührt, buchstäblich! War es mir doch am offenen Fenster, als sei der furchtbare Funken mitten in meine Stirn gezielt.
Ein Arm drängte sich plötzlich hilfesuchend unter den meinen. Da war das Kind mit einem Male neben mir, vom Lager gestoßen, besinnungslos vor Angst, dem Urlaut des losbrechenden Gewitters nicht gewachsen. Zitternd schmiegte sie sich an mich:
»Ohm, was war das? Mein Gott, das ist furchtbar!«
Ich legte meinen Arm um die schmale, heiße Schulter und spürte, wie ihre Hand sich leise auf meine hob; die kleine verarbeitete Hand; rau ist sie von Herd und Abwasch, aber auch mit Narben und Spuren der Arbeit im Steinbruch behaftet, zu der sie gezwungen wurde: länger als ein Jahr, dahinten in Schlesien, wo sie zu Hause war. Hier ihr Vater als ein »Gutsbesitzer«, ein »Ausbeuter«, erschlagen, hier ihre Mutter auf kopfloser Flucht verschollen und nie wieder aufgetaucht, und wo ein mir befreundeter polnischer Arbeiter sie schließlich ausfindig machte. Unter mancherlei Listen führte er sie über zwei grüne Grenzen mir schließlich zu.
Meine Antwort wurde von den Donnern halb verschlungen:
»Gewitter, Kind! Eine Stunde lang hat es getobt. Solch furchtbaren elektrischen Aufruhr habe ich eigentlich nur auf den Prärien und im nordwestlichen Felsengebirge erlebt …!«
Und indem ich die Worte aussprach, öffnete sich abermals jäh und groß ein Vorhang des Erinnerns. Als wäre es gestern gewesen, stand jene Nacht im Frühling 1918 vor meiner Seele, als Anne mir endlich anheimfiel und ich ihr für immer. Und während mein Arm das Kind neben mir umfangen hielt, den verflogenen Vogel, wähnte ich Anne an mich gelehnt, warm und wortlos … Im menschenleeren Gebirge über dem Shaggy vor meiner Hütte, des Nachts, umloht vom Widerschein elektrischer Stürme, willig endlich, beide wir, nach einem halben Jahre scheuer Qual und verlorenen Zauderns. Meine Sinne haben unbestechlich das bewahrt, was damals war: die Wärme ihrer Schulter, den Duft ihres Haares, das leise, stille Wehen ihres Atems und den sanften Glanz ihrer dunklen, weit geöffneten Augen, die sie zu mir hob, wenn die Berge in maßlosem Feueraufschrei flammten.
Ich weiß nicht, wie lange wir so standen, Clarissa und ich, und das Gewitter sich zu voller Majestät entfalten, dann langsam weiterwandern und versinken sahen.
»Ich glaube, ich friere, Ohm!«
»Dass ich daran nicht gedacht habe! Du wirst dich erkälten! Das Gewitter kommt nicht wieder! Du wirst schön schlafen. Der Regen kühlt wunderbar!«
»Ja, ich gehe schon!«
Und ich zog die Tür ins Schloss. Wollte allein sein.
Steige herauf aus der Tiefe der Zeit, selige Nacht von einst!
Der Anblick des ferne und ferner verlodernden Wetters hielt mich fest. Eindringlich und voll göttlichen Gleichmuts strömte der Regen zur Erde, Wolken zauberischer Düfte aus allen Poren pressend. Der Vorhang, der sich vor meinem inneren Auge aufgetan – er enthüllte nicht nur die geheimnisschwere Fülle jener lang versunkenen Nächte und Tage; er gab auch den Blick in einen höhnisch hohlen Abgrund frei.
Die unbeschreibliche Absurdität dieses Daseins!
Mir will kein passenderes Wort einfallen als dieses Fremdwort! Absurd, wahrhaft absurd, mein Leben! Aber nicht nur dieses: aller Menschen Leben in dieser Zeit! Millionenhügel von Toten, Pyramiden von Totenschädeln, Scherbengebirge von Idealen, Zielen, Grund- und Glaubenssätzen in allen Farben des Regenbogens, bis zur Unkenntlichkeit befleckt, überströmt von den Springfluten des Blutes der Menschen; sie haben sich zur höheren Ehre der Götzenbilder geopfert, die sie zuvor selbst ausgeschwitzt.
Wir wissen nun, wie man hunderttausend Seelen in einem Wimperzucken zu Staub zerbläst, zerglüht. Wir könnten in wenigen Tagen ganze Länder leer töten, wie man Ameisenhaufen mit Benzin übergießt und ansteckt. Wir können ehrwürdige Städte verbrennen und zerschmettern und sie binnen einer halben Nacht in stinkende Ruinen verwandeln. Verflucht sind meine Tage, in denen sterbliche Geschöpfe dieser kleinen, kalten Erde die Kraft entfesselten, welche die Sterne leuchten lässt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Können wir die Tränen auch nur einer Mutter trocknen, deren Sohn aus stahlzerhackten Nachthimmeln in die Feuerorkane der Städte stürzte, die zu entfachen ihm befohlen war, deren Tochter im Gas grässlicher Kammern erlosch? Können wir die Hungernden speisen, die Bloßen bekleiden, die ohne Obdach behausen? Die Vögel haben Nester, und die Füchse haben Höhlen, aber die Söhne der allwissenden, allmächtigen Menschen, die schneller fliegen als Schwalben, tiefer tauchen als die Haie in tropischen Meeren, sie haben nichts, wo sie ihr Haupt hinlegen.
Wir sind allesamt ins Nichts geworfen, in den wirbelnden Strom, der nach gewaltigem Umtrieb in der Wüste verschlammt und versickert.
Ach, wo bist du, meine Gefährtin? Alt und grau bin ich, und kalt bin ich nun und sehne mich nach der Glut des Anfangs. Damals aber verzehrte ich mich vor Verlangen nach der vollkommenen Stille des Endes.
Ich spüre eine milde Hand auf meinen grauen Haaren wie immer, wenn ich verzweifle. Ohne sie wäre ich längst des kreiselnden Treibens müde geworden. Sehnsucht zerschneidet mein Herz; ach, wie es mich tröstet, leise zu sprechen:
»Ich denke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen …«
»Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meere, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich: ›Finsternis möge mich decken!‹, so muss die Nacht doch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht!«
So muss die Nacht doch Licht um mich sein …? Da ich es flüstere, scheint es schon auf, milde und einer sanften Ahnung gleich.
Ich beuge mich über meine Vergangenheit.
Ich beuge mich vor meiner Vergangenheit …!
Von der Nacht an, als die Stimme aus der Tiefe mich talwärts rief, war ich also nicht mehr allein in meiner Hütte. Auf meiner Bettstatt kämpfte Tom mit Zähigkeit gegen den Tod an. Durch den niedrigen Raum wanderte hin und her, mich langsam und leise ganz und gar verwandelnd, dies Mädchen, schmal und dunkel. Ich war nicht für mich allein. Des Stromes Gang aus dem Abgrund, die Gesänge des Windes von den Bergen füllten mir Herz und Ohren nicht mehr allein. Immer war sie da mit einem sanften Blick aus den großen schwarzen Augen; immer war alle Hausarbeit getan, wenn ich von der Fallenstrecke kam; immer hatte sie einen Wunsch bereit, nie für sich selbst, stets nur für den schmerzhaft leidenden Bruder. War ich überhaupt für sie vorhanden in jenen endlosen Monaten, als der Winter die Berge deckte und der Schnee uns von aller Welt schied?
An Toms Schulterwunde heilte der Durchschuss, wenn auch nur zögernd, zu. Wir konnten ja nichts tun, als die Wunden sauber halten, solange sie offen waren, sie kühlen, wenn sie brannten, und mussten uns im Übrigen auf die gesunde Natur des Verletzten verlassen.
Die Hüftwunde war es, die das Siechtum Monat für Monat hinzog, ohne dass ein Ende sich abzeichnen wollte. Trotz sorgsamster Pflege, kräftiger Nahrung und ungestörter Ruhe wollte Tom nicht wieder zu Kräften kommen.
Als Dan Halvorsen, der Norweger, mein Kamerad von See her, zehn Tage nach der Ankunft der Geschwister, wie verabredet, wieder auf meiner Höhe eintraf, merkte ich ihm schon nach wenigen Stunden an, dass ihn unsere unerwarteten Gäste hoffnungslos verwirrten. Nicht Tom – den kannte und schätzte er wie ich. Dan, der auf Walfischfängern gefahren war und Segelschiffe und Dampfer verachtete, hatte schon genug Unfälle erlebt, um sich noch viel über eiternde Wunden aufzuregen. Das gehörte mit zum Alltag der Männer; man pflegte und ermunterte die Kameraden geduldig, aber ohne überflüssiges Mitleid, bis sie wieder die Glieder regten oder eben mit dem Tode abgingen. Dann senkte man sie in die grüne See oder an einer fernen Küste ins Grab – und sprach noch nach vielen Jahren von ihnen, als lebten sie und hätten nur zufällig auf einem anderen Kahne Heuer genommen.
Dan war mit mir in Manzanillo an Land gegangen, als der deutsche Frachter, auf dem er als Vierter, ich als Dritter Offizier gefahren war, nach listenreichem Versteckspiel quer über den ganzen Pazifik endlich im Spätherbst 1914 den schützenden neutralen Hafen an der mexikanischen Westküste erreicht hatte. Des tatenlosen Daseins in dem heißen Fliegenloch wurden wir bald überdrüssig, und mir fiel ein, dass ich mich ja bei meines Vaters Schwester, bei Tante Cora, melden konnte, die den Iren O’Flaherty geheiratet hatte. Wir wurden hocherfreut eingeladen. Und wenn ich meinen Freund Dan Halvorsen mitbringen wollte – so wäre auch er willkommen; es gäbe Arbeit genug für jeden. So waren wir denn von Manzanillo losgegangen; aber es dauerte fast ein Jahr, ehe wir von Süd-Mexiko aus den Staat Washington an der kanadischen Grenze erreichten. Wir taten dies und jenes unterwegs, wären fast in Texas auf einer großen Rinderfarm geblieben – dann wieder in San Francisco, wo Dan prächtige Landsleute aus Romsdal entdeckte, die mit Schiffsausrüstungen handelten und uns seetüchtige Leute gern behalten hätten.
Eines regnerischen Abends im Spätherbst 1915 fielen wir meinem Onkel O’Flaherty ins Haus. Zwei Tage waren wir von der nächsten Bahnstation über die öden Hochflächen des Columbia-Plateaus gewandert. Dann standen wir vor Anne, dem Mädchen voll dunkler Anmut, die das väterliche Geschlecht ihr mitgegeben, voll stolzer Klugheit und Beständigkeit, die sie von der Mutter hatte. Wenn man sie anschaute, so glaubte man die alte irische Sage, dass der schwarzhaarige, fein gebildete, nervige Schlag aus dem Westen und Süden der Insel von den Söhnen eines spanischen Königs Milesius abstammte, die vorzeiten an die neblige, sturmumtoste Küste Irlands verschlagen wurden. Anne war ganz »Milesierin« mit ihrem ovalen, bräunlichen Gesicht, den glänzend schwarzen, schweren Flechten, die den zierlichen Kopf umkränzten; ihr Wesen aber glich dem der Mutter, die von dem weiten hellgrünen Flachland an der Niederelbe stammte. Vielleicht war es dieser Gegensatz, der uns zwei ungeschlachte Kerle beinahe magisch anzog: die geheimnisvolle Fremdartigkeit im Äußeren, das verwandtschaftlich Vertraute im Denken und Fühlen. Denn das Fremdartige verlockte uns mit tausend süßen Stimmen aus allen Winkeln der Windrose. Sonst wären wir nicht zur See gegangen, hatten es beide nicht nötig: er, der Sohn reicher Bauern aus dem Romsdal, und ich, Sohn eines sparsamen Vaters und Adoptivsohn wohlhabender Bürgersleute aus Basel. Zugleich aber webte uns zwei See- und Landfahrern die Heimat im Blut, ganz in der Tiefe, ohne dass je darüber gesprochen wurde. In dem Mädchen Anne schien beides auf schier bestürzende Art vereint, seltsam durchdrungen; zwei Traumwelten waren in einem Wesen lebendig geworden: die Heimat und die Ferne.
Wir sprachen nicht darüber; wir dachten nicht einen Augenblick daran, uns als Rivalen zu beargwöhnen. Denn dass wir halb garen Männer ohne Haus und Hof dies schöne Wesen je erringen könnten, lag völlig jenseits der Grenzen unserer Einbildungskraft. So befanden wir uns wohl unter der etwas strengen, aber gütigen Fürsorge meiner Tante Cora. Mit Tom, der innerlich dem Vater, äußerlich der Mutter glich, und dem alten O’Flaherty, der sich unter den weißen Haaren den jugendlichen Feuerkopf unverändert bewahrt hatte, waren wir den ganzen Winter über ständig unterwegs, zu Pferde und zu Fuß, um die vielen Tausend Schafe der Farm zu versorgen (in den weiten Hochebenen jenseits der Kaskaden gibt es nicht viel Schnee). Aber recht heimisch konnten wir nicht werden, weil wir nicht heimisch genug werden konnten. Anne behandelte uns gleichmäßig freundlich, fast schwesterlich zärtlich zuweilen. Aber Dan zog stets ein Gesicht dabei wie die Katze, wenn’s donnert.
Ich tat, als wenn ich nichts merkte. Am besten wär’s auf See oder sonst wo allein, damit man sich wieder in die Hand bekäme. Der alte O’Flaherty merkte nichts, aber der Tante blieb unser Zustand nicht verborgen. Ob wir ihr nicht gut genug für ihre Tochter waren, ob sie Anne nicht verwirren wollte, ob sie meinte, das große Gefühl müsse stets wie eine Offenbarung hereinbrechen, wie es ihr ergangen war – wie dem auch sei: Als wir im Sommer 1916 Gelegenheit hatten, die Nachfolge zweier alter Freunde O’Flahertys in den Bergen über dem Shaggy anzutreten, hielt sie uns nicht zurück. Die Fallenstrecke lag weit westlich der Schaffarm, hoch in den Kaskaden, wo die Wälder schon dicht und hoch und üppig werden, weil bis hierher noch die Regenwolken reichen, die der Stille, der ewig unruhige Ozean herübersendet.
Wir griffen mit beiden Händen zu, ließen uns von den zwei Graubärten das Handwerk der Pelzjägerei mit allen seinen Schlichen und Kniffen ein paar Monate lang erklären und legten uns dann allein ins Zeug. Schlecht und recht trappten wir bis zum Ende des Winters 1916 und verdienten wenigstens so viel Geld, dass wir uns den Sommer über halten und eine verbesserte Fallenstrecke anlegen konnten.
Der Winter 1916/17 brachte uns schon reichere Beute, aber wieder verwandten wir unseren ganzen Verdienst für eine bessere Ausrüstung. Wir lernten jeden Tag hinzu, unsere Instinkte schärften sich mit jeder Woche; die Einöde, der große Wildgarten Gottes, wurde uns vertraut; sie zahlte uns ihren Zoll; denn ein Wesen lebt vom anderen, Fuchs und Marder, Skunk und Berglöwe, der Vielfraß und die Menschen.
*
Ja, Dan Halvorsen fiel aus allen Wolken, als er bei seiner Rückkehr Anfang Oktober 1917 die Geschwister O’Flaherty bei mir vorfand. Der riesige Mann (er stand noch zwei Finger breit höher in den Stiefeln als ich) zitterte am ganzen Leibe; ich trat nach der ersten Begrüßung mit ihm vor die Hütte, um ein paar freundschaftliche Worte auszutauschen.
»Was soll das wohl werden, Bill! Anne ist hier und Tom in schwerem Siechtum! Am liebsten drehte ich um und käme nicht wieder!«
»Unsinn, Dan! Mich hier allein lassen mit vierzig neuen Fallen! Wer soll Anne beistehen? Einer von uns wird bald ständig unterwegs sein müssen! Willst du sie hier mit dem Kranken allein lassen?« Er schüttelte hilflos den Kopf. Das wollte er natürlich nicht. Vierteilen hätte er sich gern für sie lassen, aber Abend für Abend mit ihr in ein und derselben Hütte zusammen sein – nein, das konnte kein Mensch aushalten.
»Ich bin mit unserer Nothütte am anderen Ende, drüben am Yelling Yellow, nicht fertig geworden bei all dem Hin und Her und der Aufregung. Ich musste für Anne ein Bett zimmern und ihr eine Kammer bauen mit ein paar Pfosten und Decken. Wir konnten nicht auf die Dauer in Kleidern schlafen, verstehst du. Wie wäre es aber, wir bauten die Hütte am Yelling Yellow geräumiger aus, als wir vorhatten, damit du dauernd dort wohnst und auch ich da unterschlüpfe, wenn Anne hier mit Tom allein sein will. Den Zugang um die Felsnase könnten wir einfach abriegeln; die beiden wären dann hier ganz sicher!«
Dan nickte: »Ja, das geht! Wenn nur nicht alles so verflucht nass wäre!«
»Werden am Regen nicht eingehen, Dan!«, antwortete ich. Es regnete schon seit einer Woche. Die Wolkenfetzen wallten den Hang entlang. Kalt und verhangen gähnte das verwandelte Tal. Zwei Tage nach der Ankunft der Geschwister war der holde Traum des späten Herbstes zerweht. Ich trauerte ihm diesmal nicht nach, denn der Regen löschte in wenigen Stunden alle Spuren, die die Fliehenden für kundige Augen hinterlassen haben mochten. Er fesselte Anne und mich an die Hütte und zwang mich, den Ofen in Gang zu setzen. Ich dankte heimlich dem Himmel, dass ich so viel zu verrichten hatte; ich war wie von einem Fieber ergriffen, die Hütte für meine Menschenschwester umzubauen. Nichts schien mir gut genug. Hätte nicht die Rücksicht auf den Kranken mich gehindert, so hätte ich wohl von früh bis spät gehämmert und geklopft. Ich weiß noch, wie sie entdeckte, dass ich alle Pelze, die Tom nicht brauchte, zusammengelegt hatte, um ihr Lager so weich und warm wie möglich auszustatten; denn es wurde schon kalt; ewig weinte der Wind um die Ecken und im blechernen Schornstein; ich selbst lag auf einer Moosschütte; sie war nur sehr mager – und als der Regen einsetzte, konnte ich kein Moos mehr sammeln.
»Bill, du hast mir alle deine Hirschdecken und die Bärenfelle gegeben, und du selbst liegst auf den Brettern«, sagte sie. Es klang wie ein Vorwurf und doch – Tau auf mein Herz. Ich antwortete ungeschickt und sah ihr in die Augen dabei, was ich selten tat:
»Anne, sieh, hier, alles ist dir!« Ich zuckte mit den Achseln, wusste nicht weiter; meine Augen irrten ab. Wir standen ein paar Herzschläge lang ganz still. Dann fuhr sie mit veränderter Stimme fort:
»Wie recht ich hatte, als ich Tom hierher brachte …« Ja, was sollte ich darauf sagen! Ich wusste es nicht. Nach einer Weile ganz unerwartet:
»Bill, lieber Bill!« Sie sank auf einen Schemel am Tisch, legte den Kopf auf die Arme und schluchzte:
»Wenn er uns stirbt! Und die Eltern wissen nicht, wo wir sind. Wenn man uns findet!«
Ich tröstete sie, so gut ich konnte: »Er bleibt am Leben, Anne. Tom ist zähe. Den Eltern bringen wir bald Nachricht. Dan ist jetzt da. Wir stopfen den Weg um die Nase zu; die Pferde kommen fort. Schnee wird sein. Niemand findet uns hier!«
Ich streichelte ihre Schulter. Sie haschte nach meiner Hand, legte ihren Kopf an meinen Arm und flüsterte:
»Weißt du, dass du dich für Tom in Gefahr bringst?«
»Da frag’ ich wenig nach … Für Tom, gewiss …« Ich stockte. Sie blickte hoch: »Und für mich, sag’s nur, Bill!«
»Ja, für dich!«, knurrte ich.
Wir erschraken beide, als plötzlich von meinem Bette her Tom dazwischen sprach. Wir hatten ihn schlafend gewähnt.
»Ihr seid zum Schießen, ihr beide!«
Aus seinem hohlwangigen Gesicht blitzte ein Schimmer des alten Übermutes, der ihn seinem Vater ähnlich machte, so wenig der grauäugige, fahlblonde Mann ihm sonst auch glich.
»Zum Schießen! Komm, Anne, bedauernswertes Schwesterherz, der Lappen auf meiner Schulter ist schon wieder heiß!«
Tom hatte kein Talent, irgendetwas romantisch zu nehmen. Er lachte uns schlichtweg aus, der zerschossene Bursche. Ohne Tom wäre ich wohl nie ans Ziel gelangt!
Dan war also da. Unsere Fallenstrecke führte auf etwa gleicher Höhe mit dem Haus am Hang entlang ins Gebirge hinein, bis sie schließlich auf den donnernden Oberlauf des Shaggy stieß. Hier stürzte sich einen Steinwurf weiter stromab der Fluss über einen Felsenriegel in die Schlucht hinunter, in welcher er dann tief unterhalb meiner Hütte bis zum Austritt in das flache Wiesental dahintobte. Ein Windwirbel hatte uns zwei riesige Douglasfichten quer über das Wildwasser geworfen. Wir benutzten sie als Brücke. Jenseits führte die Fallenstrecke in vielen Windungen über den nächsten, höheren Gebirgszug. Ein flacher Sattel im Verlauf des sonst äußerst schroffen Kammes erleichterte den Übergang ins weiter westliche nächste Tal, das des Yelling Yellow; an seinem Ostufer fand die Fallenstrecke ihr Ende. Dort, unter einer steilen Wand, die den Ost- und Nordwind abschirmte, sollte die zweite, viel kleinere Hütte entstehen. Der Platz lag knapp eine Fichtenhöhe über dem hier schnell, aber glatt und lautlos dahinsausenden Yelling Yellow. Das Gewässer machte erst viel weiter talab seinem Namen Ehre; hier fegte es noch glasklar, hellgrün und über weite Strecken katzenleise die scharfe Felsfurche entlang.
Am fünfzehnten Tag nach der Ankunft der Geschwister schien Tom zum ersten Male ein wenig erholt; er nahm auch schon für Stunden Anteil an unseren Verrichtungen. Wir besprachen uns mit Anne. Natürlich, wir sollten uns nicht abhalten lassen, die trapping line bis zum Letzten vorzubereiten. Sie fürchtete sich nicht. Doch der Zugang um die Felsnase würde besser geschlossen! Und wilde Tiere, wenn sich solche zeigten, denen wollte sie heimleuchten. Gewehre wären ja genug da.
In der Tat, wenn man den schmalen Felsvorsprung verbarrikadierte, auf dem sich der Pfad zu meiner Hütte um das senkrecht aus der Shaggy-Schlucht aufragende Vorgebirge schmiegte, dann saßen wir sicher und geborgen in einem ungeheuren Felsenschloss. Denn von oben her, von den schließlich senkrechten Wänden in unserem Rücken stieg niemand herab; in der Schlucht des Shaggy duldeten die wütenden, zusammengepressten Wasser keinen noch so kühnen Kletterer; und vom Tal des Yelling Yellow her führte der einzig mögliche Weg über jenen Sattel, dem auch unsere Fallenstrecke sich einschmiegte; wer den Sattel aber überschreiten wollte, der musste zuvor an dem Blockhaus vorbei, das wir am Yellow zu errichten vorhatten; nur von ihm aus war der Anstieg zum Sattel zu entdecken.
Den Pfad um die Felsnase sperrten wir bald. Dan kletterte über der kritischen Stelle ein Stück in die Wand und schlug ein paar Dynamitpatronen in passende Spalten. Als die Dinger losbrannten, stürzte eine Lawine von Schutt und Geröll herab. Nun war überhaupt nicht mehr zu erkennen, dass hier jemals ein Durchlass sich geöffnet hatte.
Da wir ohnehin die Pferde mitnehmen mussten, konnten wir uns den mühseligen Marsch an den Yellow erleichtern. Die Tiere fanden noch überall Futter; Schutz vor dem Wetter brauchten sie nicht, sie hatten nie einen Stall gesehen, weder sommers noch winters. Wir packten ihnen also alles, was wir nötig hatten, auf die Sättel: Äxte, Beile, Sägen, Zimmermannswerkzeug, die schwere Nagelkiste, zwei Rollen Dachpappe, eine kleine Eisenplatte zu einem Herd und Ofen, Ofenrohr, Stricke, ein paar kostbare Bretter, die wir selbst im Schweiße unseres Angesichts vor Monaten schon aus glattem Stamm geschnitten hatten, und natürlich ein paar Töpfe, etwas Proviant, Decken – mit einem Wort, die Pferde würden sehr vorsichtig treten müssen, wenn wir sie hoch oben, wo der Shaggy noch flach floss, sicher über die Felsen lotsen wollten.
»Leb wohl, Anne! In vier, fünf Tagen bin ich wieder da!«
»Leb wohl, Bill!«
Sie stand in der Tür unter dem Vordach; die Schwaden des Regens fegten eiskalt über den Hang. Dan war schon mit den Gäulen voraus. Und dann, als hätte sie es nicht sagen wollen:
»Komm bald, Bill! Damit ich nicht so allein bin.«
Ich hob nur noch die Hand zum Gruß und machte mich eilig davon; Dan hatte seine liebe Not mit den unwilligen Pferden. Ehe mich am Rande der Lichtung der Wald aufnahm, blickte ich mich um. Sie stand noch immer unter dem Vordach. Wusste sie, dass ich zurückschauen würde? Sie winkte. Die Stämme rückten bald dazwischen …
Von unserem Marsch über den Gebirgszug, der das Tal des Shaggy von dem des Yelling Yellow trennte, ist nicht viel zu berichten. Es regnete, das ist alles. Unser Ölzeug von See, das wir bis hierher auf den Berg geschleppt hatten, bewährte sich. Der Waldboden verwandelte sich hier und da schon in Sumpf. Dan, der die Spitze hielt, hatte den jeweils besten Weg zu finden, damit die vorsichtig stelzenden Pferde nicht versackten; sie misstrauten dem unbekannten, unwirtlichen Gelände. Die Wolkenfetzen krochen zwischen den Stämmen und über die Abhänge hin, schlaff und zähe wie nasse Watte. Die Stämme reckten sich feucht und schwarz. Das Moos, längst vollgesogen wie ein Schwamm, schmatzte unter unseren Stiefeln und quoll über. Und aus den kaum sich regenden Wipfeln tropfte es, tropfte.
So zogen wir auf dem Grunde der schweigenden Wälder mühselig dahin; hoch über uns, von den Kämmen der Berge her, hörten wir zuweilen wie die Stimmen ferner, wüster Geister den Sturm heulen, der in sausender Fahrt den Regen heranführte. Weit draußen hatten die Lüfte sich über der gischtenden, brüllenden See, über den öden, grauen Unendlichkeiten des Großen Meeres mit Feuchte vollgesogen. Am Stauwehr der Küstengebirge entluden sie nun ihre nasse Last.