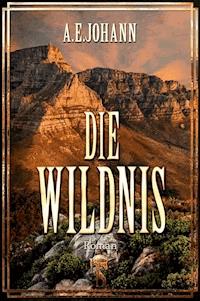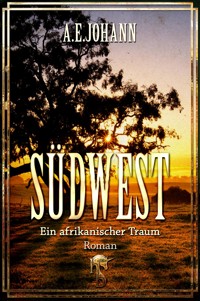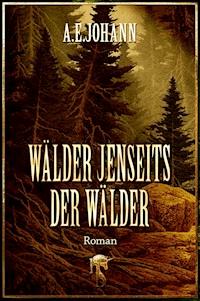
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nordamerika im Jahr 1763: Der Siebenjährige Krieg ist beendet, Frankreich muss seinen Besitz im weiten Tal des St. Lorenz-Stroms, im heutigen Kanada, dem Sieger überlassen. Viele Kanadier versuchen, sich der englischen Herrschaft zu entziehen, um ein freies Leben in der Wildnis zu führen. Unter ihnen ist der deutsche Walther Corssen. Gemeinsam mit seinem Sohn William und einer Handvoll entschlossener Männer gelingt ihm der Durchbruch zu den Wäldern jenseits der Wälder, einer urwaldhaften Landschaft von unvorstellbarer Schönheit – und allgegenwärtiger Lebensgefahr. Bis der Bauernsohn aus der Heide an der Seite einer bezaubernden Indianerin zu einem neuen, seinem ganz eigenen Leben findet. Mit »Wälder jenseits der Wälder« wird die große Kanada-Trilogie von A. E. Johann fortgesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
A. E. Johann
Wälder jenseits der Wälder
Roman
»There is the land where the mountains are namelessand the rivers all run God knows where.«(»Dort ist das Land, wo die Berge noch keinen Namen haben,und die Flüsse alle fließen, Gott weiß wohin.«) Robert W. Service »Songs of a Sourdough« Toronto 1907
Erstes Buch:Stromauf
1
William Corssen stieg vom Bug aus ins flache Wasser, noch ehe das Boot der Uferkante nahe kam und den kieseligen Flussgrund berührte. Die Außenhaut des Kanus war genauso empfindlich wie die aller mit Birkenrinde überspannten indianischen Kanus, und die beiden Männer, der blutjunge und der gereifte, wollten und durften ihr Fahrzeug unter keinen Umständen gefährden. Vierzehn Tage lang waren sie jetzt von der Nordküste der gewaltigen Fundy-Bucht her nord- und nordwestwärts unterwegs, immer ankämpfend gegen die nur mäßig starke Strömung des Saint-John, und nicht ein einziges Mal hatten sie die weißliche Rindenhaut ihres Gefährtes zu flicken brauchen. Das wäre zwar nicht schwierig gewesen. Das Töpfchen mit Fichtenharz stand im Heck des Bootes stets bereit. Aber es hätte sie aufgehalten. Das dunkelbraune Harz war mit Bärenfett angereichert, um es ein wenig geschmeidiger zu machen. Alle feinen Risse in der Birkenrinde ließen sich mit der Mischung, sobald sie erhitzt wurde, leicht verschließen. Über größere mussten Flicken aus Rinde geklebt und vernäht werden, was nur von geschickten und sorgsamen Fingern verrichtet werden konnte. Aber Walther Corssen war ein gelehriger Schüler seiner indianischen Freunde gewesen; sein Sohn William gab sich Mühe, es ihm gleichzutun.
William war barfuß ins Wasser gestiegen, hatte sich die Hosen hochgekrempelt. Angenehm kühlte die klare Flut Spann und Knöchel bis zur halben Wade. Der Bursche war nur mittelgroß. Aber unter dem ledernen Hemd wölbten sich kräftige Schultern und die Hände, die den Bug des Bootes umklammerten, waren braun und hart wie die eines Mannes. Seinem merkwürdig schmalen, von dunklen Augen und dunklem wirrem Haar beherrschten Gesicht waren die nur fünfzehn Lenze, die er zählte, nicht abzulesen; die Züge waren von einem frühen Ernst geprägt, der ihn älter erscheinen ließ, als er war. Es lag auf der Hand, dass ihm schon vieles zugemutet werden konnte, was sonst nur ein Mann zuwege brachte.
William hob den Bug des Bootes auf die dick bemooste Uferkante und zog das Kanu einen Schritt weit aus dem Wasser. Um ihm dies zu erleichtern, war Walther Corssen, sein Vater, ins Hinterende des Fahrzeugs getreten. Er störte jedoch das Gleichgewicht des schwankenden Bootes nicht, brauchte darauf auch gar nicht mehr zu achten. Dass diese außerordentlich leichten, kiellosen Kanus stets gleichmäßig ausgelastet zu halten waren, wenn sie nicht kippen sollten, war den beiden Männern längst in Fleisch und Blut übergegangen.
Walther Corssen sprang an Land und blickte sich um. Er wies auf den Ansatz der bewaldeten Landzunge, die stromauf weit in den hier aus Norden heranziehenden Strom vorstieß: »Da ist er wieder, der Rauch!«
Über der dunklen Zeile des fernen Waldes stieg ein milchiges Wölkchen in die blaue Luft, sehr zart, aber deutlich erkennbar. Weitere folgten ihm nach – wie von einem kräftig genährten Feuer aus nicht ganz trockenem Holz gespeist. William fasste in Worte, was der Ältere dachte. Es war ein Zeichen seiner Jugend, dass er das eigentlich Selbstverständliche glaubte aussprechen zu müssen:
»Indianer sind das nicht. Die machen kein Feuer, dessen Rauch zu sehen ist, es sei denn, sie wollen ein Signal geben. Aber das da ist kein Signal. Es dringt ja immerwährend Rauch nach. Ob wir die Siedlung, die wir suchen, endlich erreicht haben, Vater?«
»Ich denke, so ist es, William. Aber wir müssen uns vorsichtig heranmachen. Vielleicht sind die Leute misstrauisch. Sie dürfen uns nicht für Feinde halten. Das könnte gefährlich werden. Sie werden sicherlich erfahren haben, dass der Krieg zu Ende ist und dass der König von Frankreich ihn verloren hat. Die akadischen Franzosen hatten mit dem König von Frankreich nie viel im Sinn. Aber den König von England lieben sie erst recht nicht – und das mit gutem Grund, weiß Gott!«
Jedem Lauscher wäre die Unterhaltung zwischen den beiden Männern, dem blutjungen und dem gut vierzigjährigen, merkwürdig vorgekommen. Die zwei Waldläufer allerdings schienen nichts Ungewöhnliches dabei zu empfinden. William nämlich sprach Französisch, das harte Französisch aus der Bretagne und der Normandie, das die Siedler in ›Neu-Frankreich‹ am unteren Sankt-Lorenz-Strom sprachen, das auch die Franzosen in ›Akadien‹ gesprochen hatten, den Gebieten um die Bay of Fundy und südlich der St.-Lorenz-Mündung am Atlantik. Walther Corssen aber hatte deutsch gesprochen, jeder von beiden offenbar in der Sprache, die ihm von klein auf am geläufigsten war, wobei jeder dem anderen nicht nur ›seine‹ Sprache zubilligte, sondern sie auch genauso wie die von ihm selbst bevorzugte verstand.
Der ältere Corssen fuhr fort: »Komm, Sohn, wir wollen uns etwas zu essen machen. Dies ist ein guter Platz, vom Wasser her nicht einzusehen – wenn wir uns dort hinter den Büschen halten. Das Kanu bringen wir ein paar Schritte in den Wald hinein. Wir müssen überlegen, wie wir es am besten anfangen, uns mit den Leuten jenseits der Landzunge bekannt zu machen. Gebe Gott, dass es die Akadier sind, die wir suchen!«
Bald brannte ihr kleines Feuer, rauchlos, mit Feuerstein, Zunder, ein paar Spänen leicht zu entflammender Birkenrinde und etwas trockenem Reisig schnell in Gang gebracht. In der Pfanne brutzelten weiße Bohnen mit Speck; beide kauten schon an kräftigen Stücken schieren Wildfleischs, das – an der Luft getrocknet – fast wie kräftiges altes Brot zu essen war und auch ähnlich schmeckte.
Kaum wurden sie noch von Mücken, Fliegen oder anderem Geschmeiß belästigt. Das Jahr 1765 neigte sich in die zweite Hälfte des August. Der Sommer begann bereits, müde zu werden – und mit ihm die Angriffslust der Insekten. Doch leuchtete das wilde Land weit umher im warmen Licht des Nachmittags. Ein sanfter Wind kräuselte die von leisen, aus der Tiefe dringenden Wallungen überwanderte Oberfläche des großen Stromes, des St. John. Über flache Hügel floss der Wald, eine dunkle, schwere Flut, zu den Ufern des gemach ziehenden Gewässers hinunter – in der Ferne, jenseits der lautlos wandernden Strömung, war er nur ein schwarzer Strich über dem schattenfarbenen Nass. In ihrer Nähe aber erstreckte sich eine sanft durchrauschte Galerie aus üppigem Unterholz und weit darüber hinausragenden schwarzen Fichten. Im unermesslichen Blau der Höhe zogen traumhaft langsam zwei strahlend weiße Haufenwolken ostwärts – mit lichtblauen Schattungen in den runden Locken. Ein vollkommener Tag, strahlend wie aller Tage erster.
Das Feuer war gelöscht und seine Spur getilgt. Die Pfanne und der Proviant wurden wieder im Heck des Kanus verstaut. William schien mit sich ins Reine gekommen zu sein.
»Soll ich es nicht zuerst allein versuchen, Vater? Wenn es die akadische Siedlung ist, die wir finden müssen, dann klingt mein Französisch echter als das deine. Wenn ich heute nicht mehr zurückkommen kann, dann komme ich morgen, du brauchst dich nicht zu beunruhigen. Ist dies der Platz nicht, den wir suchen, kehre ich noch heute Nacht zurück. Ich werde sehr vorsichtig sein.«
Walther Corssen blickte zu der lang gestreckten Landzunge hinüber, hinter welcher noch immer ab und zu blasser Rauch aufschwebte, um dann zwei Handbreiten über der Kimm spurlos zu vergehen. Er erwiderte:
»Vielleicht hast du recht. Du sprichst das akadische Französisch. Demnächst werden wir übrigens englisch sprechen müssen. Dann werde ich dir auszuhelfen haben, mein Junge. Nun gut, geh also! Ich werde hier auf dich warten. Aber nur bis morgen Mittag. Dann werde ich dich suchen. Und nochmals: Riskiere nichts! Beobachte zuerst aus der Ferne. Wenn du nicht ganz sicher bist, dass du die Leute vor dir hast, die wir suchen, dann kehre um, damit wir uns erst beraten. Versprich mir äußerste Vorsicht, William!«
»Ich verspreche es, Vater!«
Der junge Bursche blickte den schon um die Schläfen ergrauenden Mann aus großen dunklen Augen an. Und wenn der Ältere den Worten des Jüngeren vielleicht nicht unbedingt vertrauen mochte, so überzeugten doch der Ernst und die Wahrhaftigkeit in diesen braunen Augen.
Walther Corssen fügte hinzu: »Ich glaube, du solltest keine Waffe mitnehmen. Man wird dir dann eher glauben, meine ich.«
»Ich hätte auch keine mitgenommen. Mach dir keine Sorge. Ich weiß, was auf dem Spiele steht.«
»Gut, mein Junge!«
William war mit einem leichten Schlag auf die Schulter entlassen und wenig später im Unterholz verschwunden.
William hielt lauschend inne. Er hatte sich vorsichtig durch dichtes Gestrüpp geschoben, hatte auch einige Lichtungen umschritten. Dort hatten die Biber ein Bachtal abgedämmt und ein weites Sumpfland geschaffen. Kranbeeren, großfruchtig, prall, reiften in Fülle. William hatte die Augen offen gehalten und sich fast so lautlos fortbewegt wie ein Indianer. Ein paarmal waren dabei seine Gedanken zu Indo geglitten, dem verlorenen indianischen Ziehbruder, den er in der Heimat Nova-Scotia zurückgelassen hatte, ebenso wie die kleine Schwester, die zärtlich geliebte, und all die anderen Jugendfreunde und Gefährten und – das Grab der Mutter. Indo hatte ihm oft genug bewiesen, dass man sich im wilden Wald nur dann einigermaßen leise und schnell voranbringen konnte, wenn man nicht die harten, schweren Schuhe der Europäer, sondern die leichten, weichen Mokassins der Indianer an den Füßen trug. Und wie viel angenehmer die zu tragen waren!
Wenn er sich nicht in der Entfernung verschätzt hatte, musste er den Waldriegel, der die Landzunge deckte, bald durchquert haben. Noch größere Vorsicht war geboten. Er hielt also inne, regte sich nicht. Sonderbare Töne waren an sein Ohr geweht, Töne, die nicht in diese Einsamkeit und Wildnis zu passen schienen. Er lauschte angestrengt.
Ohne dass er es wusste, stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht. Freundlichere Klänge ließen sich kaum denken, ihn zu begrüßen, auf so gespannter und unsicherer Erkundung, wie er sie unternommen hatte. Er kannte das Liedchen, das da gesungen wurde. Er hatte es mehr als einmal mitgesungen, als die alte Heimat Kagetoksa auf der Höhe der großen Halbinsel Neu-Schottland noch so sicher wie in Abrahams Schoß inmitten der unermesslichen Wälder, der Seen, Flüsse, Ströme und Felsenhügel zu ruhen schien. Zwar hatte er nicht recht begriffen, warum sich die Älteren bei den Worten des Textes so gerne anlachten. Aber eine Stimme in seinem Innern hatte ihm zugeflüstert: Warte nur, es dauert nicht mehr lange, und du begreifst es auch.
Die Stimme im Walde, eines Mädchens Stimme, kein Zweifel, machte ihm plötzlich den Hals ein wenig eng. Er schluckte. Was war das? Fing etwas Neues an? Offen war er ganz und gar. Durstig auf alle Zukunft, jung!
Die Stimme setzte noch einmal an, begann wieder von vorn. William hatte sich ihr genähert, immer noch lautlos. Vielleicht kannte das Mädchen nur den ersten Vers. Er unterschied schon die Worte. Er würde der Sängerin notfalls mit dem Text des zweiten und dritten und vierten Verses aushelfen können.
»Mon père et ma mèren’ont que moi d’enfant.Encore ils m’ont fait faireun bon cotillon blanc.Je n’aimerai jamaisqu’ à l’âge de quinze ans.«[1]
»Quinze ans«, sieh einer an, fünfzehn Jahre also, ja, das war William auch! Er schob sich sachte vorwärts, hielt sich aber im Schutz der Gebüsche, überblickte die mit hohem Gras und Kraut bestandene moorige Lichtung. An ihrem Rande bückte sich die Sängerin nach rechts, nach links, sammelte Beeren in einen aus Rohr geflochtenen Korb, der ihr am linken Arme hing – und sang, dass es schallte, ganz unbekümmert um Wildnis, Stille und Einsamkeit: »Je n’aimerai jamais qu’à l’âge de quinze ans.« War sie erst vierzehn?
Sie machte eine Pause, stellte den Korb ab, um das rote Tuch fester zu binden, das ihr schwarzbraunes Haar umschloss und offenbar die schweren Zöpfe hindern sollte, nach vorn zu fallen.
William, vergnügt und heiter wie seit vielen Wochen nicht mehr, vermochte der Versuchung nicht zu widerstehen und stimmte lauthals in die Stille hinein ein anderes der Liedchen an, die damals unter dem jungen französischen Volk am unteren Sankt Lorenz, im Annapolis-Tal und am unteren Restigouche umliefen:
»Quand j’étais chez mon père,petite et jeunetton,m’envoie à la fontainepour pêcher du poisson.«[2]
Die Beerensammlerin schien gute Nerven zu haben. Sie erschrak nicht, als die fremde Stimme vom Waldrand zu ihr hinüberscholl. Sie unterließ es nur ein paar Herzschläge lang, an ihrem Kopftuch zu knüpfen und drehte sich langsam nach dem Sänger um, ohne die Arme sinken zu lassen. Sie wusste nicht, dass sie ein Bild bot, das sich in seiner kunstlosen Anmut dem jungen Burschen unverwischbar einprägte.
William schritt auf das Mädchen zu. »Du singst hier im Wald, als wärst du allein auf der Welt.«
Sein Lächeln weckte das ihre. »So kann man sich täuschen. Aber wer bist du? Wo kommst du her? Ich habe dich noch nie gesehen.«
»Das glaube ich gern. Ich bin zum ersten Mal in dieser Gegend. Aber ich bin froh, dich getroffen zu haben. Und dass wir dieselben Lieder kennen!«
»Ja, das gefällt mir auch! Wie heißt du?«
»Ich heiße William Corssen und komme aus der akadischen Siedlung Kagetoksa im innersten Neu-Schottland. Mein Vater und ich mussten fliehen, da sich mein Vater schon vor mehreren Jahren dem Kommando der Engländer entzogen hat.«
Jedes Lächeln war aus dem Antlitz des Mädchens fortgewischt. Ihre Brauen hatten sich leicht zusammengezogen, ihre Augen verdunkelten sich in einem Ernst, der dem auf dem Gesicht des Jungen seltsam entsprach und die beiden einander ähnlich machte, so verschieden sie auch auf den ersten Blick erscheinen mochten. Die Heiterkeit, die als Abglanz der liebenswürdigen Lieder ihre Gemüter erhellt hatte, war verflogen. Die Umstände, unter denen sich William und dieses Mädchen trafen, waren keine glücklichen – und beide wussten es, wenn er auch noch ein halber Knabe war und sie ein junges Ding – zwar nach Mädchenart in diesem Alter wahrscheinlich einen Schritt weiter in Wissen und Ahnung als er.
Sie blickten sich an, als wollten sie sich bis auf den Grund durchdringen. Das Mädchen hielt es schließlich nicht mehr aus, ihre Augen glitten ab. Halb geistesabwesend begann sie wiederum Beeren in ihren Korb zu sammeln.
William regte sich: »Ich helfe dir! Damit du schneller fertig wirst und den Korb voll bekommst.«
Sie war in ihren Gedanken nicht beim Beerenpflücken, sondern noch bei dem, was der Fremdling mitgeteilt hatte. Sie stellte fest, immer noch ein wenig scheu: »Wir stammen auch aus Akadien, das du Neu-Schottland nennst. Ich weiß, so heißt es jetzt, seit die Engländer uns vertrieben haben – vor zehn Jahren. Ich war damals ein kleines Kind, kann mich nur noch an lauter Angst und Not erinnern. Meine beiden kleineren Geschwister, ein und zwei Jahre alt, starben auf See und wurden in das brausende Wasser geworfen. Das war das Allerschrecklichste! – Schließlich blieben wir hier bei dem Grande Chute, dem Großen Wasserfall. Und da sind wir noch heute.«
Williams Herz zitterte: Also nicht nur seinen Leuten war schrecklich mitgespielt worden! Auch die Freunde und Nachbarn – alle! – waren entwurzelt und abermals entwurzelt worden, als wären Menschen wie Unkraut.
Schon sprach er davon – und während der Weidenkorb sich langsam füllte, tasteten sich die beiden einander näher. Er erfuhr bald, dass sie Martine hieß, Martine Leblois, und keine Eltern mehr hatte – die seien kurz hintereinander vor einem halben Jahr an einem ›Gehirnfieber‹ gestorben; es gebe ja keinen Arzt in Grande Chute. Sie habe nur noch einen älteren Bruder, Justin sei sein Name – und sie hausten nun beide allein auf dem elterlichen Hof.
Sie hatte den gefüllten Korb aufnehmen wollen. Doch schien sie es ganz natürlich zu finden, dass William ihn an seinen Arm hängte. Sie ist kräftig, dachte er; man merkte ihr gar nicht an, dass der Korb so schwer ist.
Martine brauchte nicht erst zu fragen, ob der Junge, den sie da aufgelesen hatte, sie ins heimatliche Dorf bei dem Grande Chute, dem ›Großen Wasserfall‹, begleiten wollte. Sie fuhr nach einer Weile – als hätte sie nicht gleich gewagt, es auszusprechen – mit unsicher gewordener Stimme fort, legte ein fast beschämtes Geständnis ab vor diesem dunkeläugigen Fremden, der ihr so merkwürdig vertraut vorkam:
»Wir sind gar nicht gut daran, Justin und ich, unter den Leuten von Grande Chute. Wir werden mit dem Hof nicht fertig. Justin hat nie Lust gehabt, Bauer zu werden, und der Vater hat ihn niemals streng herangenommen. Es zieht ihn mit Macht in die Wälder. Das kann ich gut verstehen. Wir haben keinen einzigen Blutsverwandten mehr im ganzen Dorf, seit Vater und Mutter tot sind. Die sind alle unterwegs gestorben nach der Austreibung – auf dem Schiff. Oder sind auf andere Schiffe verladen worden. Niemals war zu erfahren, wo sie wieder an Land gesetzt worden sind. Vielleicht tausend Meilen weiter im Süden an der Atlantikküste, vielleicht sogar erst im mexikanischen Golf. Das wurde im vergangenen Sommer bei uns erzählt, von Leuten aus Québec. Grande Chute war niemals ganz ohne Verbindung mit Québec. Und wenn man keine Verwandten hat weit und breit – du weißt vielleicht, William, wie es dann geht!«
Ja, das wusste er, der junge Waldläufer. Obwohl als Sohn deutscher Eltern auf die Welt gekommen, war er in einem akadischen, einem französischen Dorf groß geworden und selbst mit Leib und Seele Akadier geworden. Die französischen Bauernsippen hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Aber wer das Unglück hatte, keiner solchen Sippe anzugehören, der war wie ein loser Stein auf schlechter Straße, wurde hierhin geschoben und dorthin gestoßen, und es sah sich kaum einer um, wenn er unter die Räder geriet.
William berichtete vom Schicksal seiner jüngeren Schwester Anna, die noch zu jung gewesen war, auf die weite Reise, die heimliche Flucht, mitgenommen zu werden. Auch sie besitze keinen einzigen Blutsverwandten unter den Leuten von Kagetoksa. Aber Anna sei schon als kleines Kind in die Familie ihrer Busenfreundin, der gleichaltrigen Danielle Maillet, aufgenommen worden. Dort werde sie es gut haben, sicherlich – wenn sie auch die Mutter ganz gewiss entbehrte. Aber die liege seit sechs Wochen schon unter der kühlen Erde. Und wenn nicht ein paar befreundete Micmac-Indianer das Grab pflegten, so würde es bald verwachsen und nicht mehr zu erkennen sein.
Die beiden wanderten an einem schnellen Bach entlang, der sicherlich zum großen St.-John-Fluss hinunterstrebte; sodass sie zuweilen auf längeren Strecken nebeneinander im feuchten, festen Sand des Bachufers zwischen felsigen Kanten dahinschreiten konnten. Im Gespräch gerieten sie bald in ein sich immer dichter zusammenziehendes Netz von Traurigkeiten, Ängsten, auch Hoffnungen und Sehnsüchten, als hätten sie aufeinander gewartet. Sie fragte schließlich:
»Du wirst doch früher oder später dorthin zurückkehren, woher du gekommen bist, um zu sehen, wie es deiner Schwester geht? Deinem Vater mögen die Engländer vielleicht noch nachstellen und ihn zur Verantwortung ziehen. Aber dir, William, können sie nichts vorwerfen. Du könntest dich in ein paar Jahren um deine Schwester kümmern.«
Das hatte er noch nicht bedacht. Aber da dies Mädchen es von ihm erwartete – sagte er, seiner Sache sicher: »Um meine Schwester kümmern? Du meinst das? Ja, das werde ich wohl tun. Nein, ganz gewiss werde ich es tun, sobald ich frei dafür bin. Aber fürs Erste muss ich bei meinem Vater bleiben.«
Bedrückt erörterten sie die böse Zeit, in die sie ohne ihr Zutun geworfen waren und die ihnen Schuld und Verantwortung aufbürdete, obwohl sie ganz gewiss nicht danach verlangten. Doch wurde die Stunde auch von einem ungewissen Glück durchweht. Sie waren nicht mehr allein; sie gingen nebeneinander her, und ihre Hände streiften sich manchmal, unabsichtlich.
Der Bach trat aus den Wäldern. Eine Flussebene öffnete sich, im Norden von einer felsigen Riffkante eingegrenzt. Über diese Kante wälzte sich schimmernd gewölbt der große Strom, stürzte in breiter Front die mächtige Stufe hinunter, schäumte silbern, mit donnerndem Rauschen im Aufprall, schleiernden Staub versprühend, überstürzte sich in hoch aufspringenden Schwällen, tobte weiter talwärts, den aus der Höhe ständig nachdrängenden Fluten so eilig wie möglich Raum gewährend: les grandes chutes, die großen Fälle!
»Du solltest sie sehen, William, wenn im Frühling das Eis bricht und das Hochwasser niederkommt. Es ist fast zum Grausen, und man kann sein eigenes Wort nicht verstehen vor fürchterlichem Getöse. Jetzt läuft der Strom nur mit halber Kraft.«
William glaubte es gern. Wasserfälle waren ihm nichts Neues. Aber noch nie hatte er einen Fall von solcher Breite und Gewalt zu Gesicht bekommen. Doch wie alle Menschen, die nicht in Städten geboren sind, nahm er die Natur und ihre Wunder nur als das große Ringsum, als die mehr zufällige Bühne, auf der sich das Eigentliche, das Menschliche, erst abzuspielen hatte. Er wollte vor allem wissen, wo das Dorf läge, in das seine neu gewonnene Freundin gehörte. Sein Vater wartete auf Botschaft.
Martine erklärte: »Hier war es unseren Leuten zu laut und auch zu nass vor ewigem Gischt in der Luft. Wir haben noch eine Weile zu gehen. Um die nächste Biegung, dann kommen die ersten Häuser in Sicht. Gleich eines der ersten ist unser Haus. Justin wird vielleicht schon da sein. Er hat dem Nachbarn beim Pflügen geholfen mit unseren zwei Ochsen. Es wird ja schon Abend.«
Die Sonne hatte sich in den Westen geneigt. Goldenes Gespinst zog durch die Wipfel der Fichten am Waldrand. Die Felder der Siedlung lagen am Fluss gereiht. Die Blockhütten duckten sich mit schindelgedeckten Giebeln unter Weiden und Ahorn, als wären sie nicht gebaut, sondern gewachsen. Die meisten Felder waren leer, abgeerntet und viele bereits frisch gepflügt. Auf den blanken, umgeworfenen Erdschollen fing sich hier und da rötlicher Abendglanz.
Justin war schon heimgekehrt, hob gerade den Ochsen das Joch von den Nacken und schickte die braunbunten Tiere erst zur Tränke, ehe er sie auf die Weide hinter dem Hof zum Wald hinauf entließ. Justin Leblois sah seiner Schwester ähnlich, mochte aber drei oder vier Jahre älter sein als sie und William. Er war nur mittelgroß, zeigte sich aber sehr stämmig und verfügte offenbar über eiserne Muskeln. Auch Martine war von kräftigem Wuchs, doch zugleich von angenehmem Ebenmaß der Glieder; sie hatte nichts Elfenhaftes; eher mochte man an eine Amazone denken. Dazu stimmte auch ihr Gesicht. Die fast senkrecht gestellte, schön geflügelte Nase ging beinahe ohne Einbuchtung in die geräumige Stirn über, die von lichtbraunem Haar, das unnötig straff gespannt und im Nacken zu einem üppigen, festen Knoten geschürzt war, schmal eingerahmt wurde. Ein kräftig gezeichneter Mund mit vollen Lippen über einem deutlich betonten Kinn und einem festen Hals vollendeten dies verlässliche Gesicht zu einfacher und klarer Schönheit.
Der viel dunklere William Corssen war zwar eine Handbreit höher gewachsen als die Geschwister Leblois, wirkte aber beinahe zierlich neben ihnen mit seinen schlanken Gliedern und schmalen Hüften.
Justin zeigte sich zunächst misstrauisch und hörte sich aufmerksam an, was William über Woher und Wohin berichtete. Doch vermochte er offenbar keine Widersprüche zu entdecken und so erschloss auch er sich allmählich: »Ich bringe dich zu unserem Bürgermeister, zu Albin Tronçon. Der mag entscheiden, ob wir dich und deinen Vater beherbergen dürfen; ich kann es natürlich nicht. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Engländer werden auch hier bald auftauchen. Und du weißt ja, wie es ist: Die Leute ahnen nicht, was die Zukunft bringen mag, und keiner will sich Scherereien machen.«
Martine mischte sich ein: »Was redest du, Justin! William und sein Vater sind Akadier wie wir. Sie sollten sich erst einmal ausruhen nach der langen Flucht und Reise. Dann wird man weitersehen. Und warum sollten sie nicht erst einmal bei uns wohnen? Wir haben Platz genug.«
Doch Justin gab keinen Bescheid. Wortlos griff er nach seiner Mütze und winkte William: Komm mit!
Justin hatte richtig vorausgesehen, wie sich die Leute von Grande Chute, vertreten durch ihren Bürgermeister Tronçon, verhalten würden, wenn ihnen in dieser ungewissen und sorgenvollen Zeit nach verlorenem Kriege ein Fremder in die ohnehin gefährdete Gemeinschaft schneite.
Justin hielt sich abseits in dem lang gestreckten, niedrigen Raum mit den Wänden aus entrindeten Fichtenstämmen. Er wollte nichts weiter sein als ein stummer Zeuge der Verhandlung vor dem Bürgermeister. Er hatte diesen Fremdling eingebracht, der seiner Schwester im Walde zugelaufen war. Er würde auch dafür verantwortlich sein, ihn wieder aus der Gemarkung fortzuschaffen, sollten er und sein Vater in Grande Chute nicht erwünscht sein.
William hatte sein Sprüchlein aufgesagt in dem dunkelnden Raum, hatte dem feindseligen Blick des schweren, ungefügen Mannes standgehalten. Riesige schwarze Brauen wölbten sich über diesen mitleidlos prüfenden Augen, so buschig und struppig, als wollten sie den rotbraunen Schnurrbart des Bürgermeisters noch übertrumpfen.
Nachdem der Alte alles erfragt hatte, was ihm zu wissen notwendig schien, schwieg er eine Zeit lang, starrte mit über der Brust gekreuzten Armen vor sich hin. Die Sonne war untergegangen. Der Bürgermeister ragte wie ein breiter, schattenhafter Turm im Hintergrund des Raumes. Der Schatten sprach schließlich das Urteil mit rauer, keine Spur von Freundlichkeit verratender Stimme: »Ihr seid Akadier, ja, aber nicht französischer Herkunft. Dein Vater ist als Untertan des Königs von England auf unserer Seite gewesen, muss also Verfolgung befürchten. Wir haben dasselbe getan wie eure Leute, sind der Deportation durch die Engländer ausgewichen. Uns hat man noch nicht zur Rechenschaft gezogen. Wir wissen nicht, ob und wann dies geschehen wird. Wir werden alles daransetzen, hier zu bleiben, damit man uns nicht auch zum zweiten Mal vertreibt, wie euch. Ihr müsst es einsehen: Wir können uns keine weitere Verantwortung aufladen. Eures Bleibens ist hier also nicht. Aber es wird keiner etwas dagegen haben, wenn ihr ein paar Tage verweilt, um euch etwas auszuruhen und mit neuem Proviant zu versehen. Keiner soll hungrig von hier weiterfahren, und schon gar kein Akadier, den das gleiche Schicksal wie uns getroffen hat.«
William entgegnete mit gepresster Stimme: »Danke, Bürgermeister. Das ist genug fürs Erste. Mein Vater hat nicht daran gedacht, sich hier auf die Dauer niederzulassen. Aber er hofft, jemand zu finden, der über die Wege oder die Kanurouten Bescheid weiß, die weiter ins Innere führen. Nicht nach Québec. Dort wird es von englischem Militär und englischen Beamten wimmeln. Aber vielleicht weiter den Sankt Lorenz aufwärts, nach Montréal, und über Montréal hinaus nach Westen. Dort sollte man wieder unter Franzosen sein. Die Engländer verstehen nicht viel von den Wäldern und der Wildnis, und von Kanus noch weniger.«
Der Bürgermeister erwiderte, nun beinahe freundlich: »Wir haben die Routen längst erkundet, brauchten ja wie ihr Anschluss zur Außenwelt. Aber nicht zur Küste. Dort wären wir den Engländern in die Arme gelaufen. Zum St. Lorenz also, wo unsere Landsleute saßen und sitzen seit mehr als hundert Jahren. Der Mann, der dich hergebracht hat, Justin Leblois, der hat die Routen nach Rivière du Loup und Trois Pistoles, nach Québec und Montréal mehr als einmal befahren.«
»Ich werde also morgen meinen Vater hierher bringen. Unser Kanu ist gut instand.«
»Gut, gut, ihr seid uns willkommen.«
Justin ließ sich jetzt zum ersten Mal vernehmen, seit er den Fremdling vorgestellt hatte: »Martine meinte, die beiden könnten bei uns wohnen. Ich bin einverstanden. Unser Haus liegt weit draußen, und der Wald ist nicht fern. Sollte sich etwas Unerwünschtes ereignen, so können sie schnell im Walde untertauchen. Ihr Kanu müssten sie allerdings vorher versteckt haben.«
Aus dem Dunkel kam die Stimme des Bürgermeisters, ungeduldig: »Davon will ich nichts wissen, Justin. Und je weniger Leute sonst davon wissen, desto besser. Geht jetzt!«
Die beiden jungen Männer stolperten auf dem zerfahrenen Karrenweg heimwärts. Das Haus des Bürgermeisters lag gut eine halbe Stunde Weges, groben und holprigen Weges, von dem Anwesen der Geschwister Leblois entfernt. Die Nacht hatte ihre samtene, mit vielen Sternen glitzernd geschmückte Fahne längst voll entfaltet. Doch nahmen die beiden Wanderer nicht viel wahr von der quellklaren Kühle, die von den Flussauen herüberwehte, und selbst den Sternschnuppen, die, wie immer um diese Zeit des späten Sommers, ihre Silberpfeile durch den Himmel schossen, gelang es nicht, sie von ihren trüben Vorstellungen abzulenken. Im Grunde war nichts entschieden. Alles, worauf es wirklich ankam, hing nach wie vor in der Schwebe.
William vermochte das bedrückte Schweigen nicht länger auszuhalten. Er fragte – nur um etwas zu sagen: »Seid ihr gut mit den Indianern ausgekommen oder habt ihr Schwierigkeiten gehabt, als ihr vor zehn Jahren hier in der Wildnis anfingt?«
»Wir können uns nicht beklagen. Die Maleciten, die hier weit verstreut beheimatet sind, gehören zu den Micmacs und haben sich stets als Freunde der Franzosen betrachtet, ebenso die Abenakis, die ihnen benachbart sind. Die Irokesen weiter im Süden, die gefürchteten ›Sechs Nationen‹, sind ihre Todfeinde – und die Irokesen sind die bösen Bundesgenossen der Engländer. Den Micmacs hier blieb gar nichts anderes übrig, als zu den Franzosen zu halten. Wenn sie Gewehre, Pulver und Blei haben wollten, um sich gegen die von den Engländern ausgerüsteten ›Sechs Nationen‹ zu wehren, dann mussten sie bei den Franzosen Anschluss suchen. Nein, wir hatten gar keine Schwierigkeiten. Wir verdanken den Indianern sogar sehr viel.«
William hatte sich von der eigenen Ungewissheit ablenken lassen. Er erzählte, dass er mit einem Indianer, der bei der Geburt die Mutter verloren hatte, zusammen aufgewachsen war. Der Stamm, dem dieser Ziehbruder angehört habe, sei durch eine von Europa eingeschleppte Seuche so gut wie aufgerieben worden. Doch habe der Vater seines Ziehbruders, den sie Indo genannt hätten, zu den wenigen Überlebenden gehört. Kokwee habe er geheißen. Ohne diesen aus der Häuptlingsfamilie stammenden Mann hätten seine Leute, die sich nicht von den Engländern deportieren lassen wollten, niemals den wunderbaren Flecken Erde auf der Höhe Akadiens oder Neu-Schottlands gefunden, wo sie sich zehn Jahre lang vor den Engländern versteckt gehalten hatten und von wo sie dann wieder hatten weichen müssen, da ihr Geheimnis nicht mehr länger vor den Engländern zu bewahren gewesen war.
William war ins Erzählen geraten. Justin erkannte, wie eng ihre akadischen Schicksale verwandt, wie ähnlich die Leblois und die Corssens davon geprägt waren. Freundschaft keimte auf zwischen den beiden, und fast hatten sie ihre Bedrücktheit vergessen, als der Giebel der heimatlichen Hütte, ein schwarzer Schattenriss, vor ihnen auftauchte.
Martine hatte einen Teil der am Nachmittag gesammelten Wildbeeren gekocht und mit Honig gesüßt. Dazu gab es eine sämige Gerstengrütze, die leicht gesalzen war. Zusammen ergab das eine Speise von ungemein kräftigem und ermunterndem Geschmack. Dann briet sie noch ein paar gekochte Kartoffeln mit einigen Scheiben durchwachsenen Specks, bis der Speck rösch und beinahe trocken geworden war. Der hungrige William bekannte, so Wohlschmeckendes noch nie gegessen zu haben. Aber Martine meinte, er müsse sich wohl täuschen; er habe allzu lange mit der eintönigen Kost der Kanureise vorliebnehmen müssen. Deshalb allein komme ihm die süße Beerengrütze wie ein Festmahl vor.
Ihr schönes, klares Gesicht wurde vom Schein des Herdfeuers angestrahlt. Das rötliche Flackerlicht zeichnete die Konturen ihres Kopfes mit dem Haarknoten im Nacken zärtlich gegen den dunklen Hintergrund des Hüttenraumes. Es gab kein anderes Licht als das des Herdfeuers. William nahm all dies in sich auf. Ihm war, als hebe sich ein Vorhang, um ihm den Ausblick auf ein Land freizugeben, von dem er bislang nichts geahnt hatte. Das konnte nur Martine bewirkt haben. Sie sagte: »Ihr werdet also nicht hier bleiben. Der Bürgermeister will es nicht. Die anderen werden es dann auch nicht wollen. Es ist alles unsicher. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wir haben das Gleiche erfahren, seit die Eltern gestorben sind. Aber, natürlich, von hier vertreiben hat uns niemand wollen oder können.«
Nach diesen Worten schwiegen alle drei eine lange Zeit; müde und satt waren sie und sonderbar traurig. Zuweilen knackte eines der Fichtenscheite, die Martine in den Herd gelegt hatte, um den großen Wasserkessel zu erhitzen. Es war noch einiges abzuwaschen, und dann wollte jeder sich reinigen nach dem bewegten Tag.
Nach einer Weile räusperte sich Justin und fragte: »Was habt ihr überhaupt vor? Wisst ihr schon Genaueres? Dein Vater will hier in Grande Chute nicht bleiben, wie du dem Bürgermeister erklärt hast.«
William hatte bis dahin unentwegt aus den Augenwinkeln Gesicht und Hände des Mädchens beobachtet, hatte den Blick auf ihrem Haar, dem der Widerschein des Herdfeuers manchmal ein messingfarbenes Flimmern entlockte, ruhen lassen. Ein kleiner Seufzer schlüpfte ihm über die Lippen. Dann war er wieder gegenwärtig:
»Mein Vater spricht nicht viel. Wir waren auch zu sehr damit beschäftigt, erst einmal eine gehörige Strecke Weges zwischen uns und die alte Heimat zu legen. Quenneville, der Schiffshändler aus Annapolis Royal, der all die Jahre zu uns gehalten hat und die Brücke nach draußen gewesen ist, hat uns über die Fundy-Bay gesegelt. Dann mussten wir uns an den Engländern vorbeidrücken, die sich an der Mündung des St. John sehr breitmachen. Und dann ging’s den St. John aufwärts bis hierher. In einem Dorf der Maleciten haben wir glücklicherweise das Kanu kaufen können, ein gutes Boot. Die Indianer halfen uns gern. Sie erzählten uns von Grande Chute und dass die Leute hier auch aus Akadien stammten. Das hatten wir schon von Quenneville erfahren. Der weiß seit jeher alles, was sich in und um Akadien abspielt. Er kommt mit seinen kleinen Seglern in jeden Küstenwinkel. Jetzt haben wir also Grande Chute erreicht. Es ist für uns nur eine Zwischenstation auf dem langen Weg in den Westen, weit über Montréal hinaus, wo nur die Franzosen Bescheid wissen. Dorthin also, wo die Waldläufer, die Coureurs de bois, die Pelze einkaufen, die dann für viel Geld nach Frankreich verkauft werden oder nach Deutschland und Spanien. Mein Vater versteht sich auf den Fang von Pelztieren und auch darauf, wie die Felle aufbereitet werden müssen, ehe man sie auf dem Markt anbieten kann. Am wichtigsten ist ihm wohl, einen Ort zu finden, wo ihm keine Offiziere und Beamten, keine Verordnungen, Auflagen und Vorschriften das Dasein verbauen, wo er selber beschließen kann, was er machen will, solange er keinem anderen in die Quere kommt. Und ich bin der gleichen Meinung, lasse mir auch nicht gern was vorschreiben.«
Wenn die Geschwister Leblois nicht ebenso alt oder nur wenig älter gewesen wären als der, der so stolze Reden führte, dieser ihnen zugelaufene und so schnell vertraut gewordene William Corssen, so hätten sie wohl seine allzu vollmundigen Aussagen belächelt. Aber sie waren jung wie er, nahmen seine Worte so ernst und wichtig wie er selber. Martine blickte den Gast sogar mit verstohlener Bewunderung an. Sie nahm das Wort, tastend, nachdenklich:
»Wir sind hier allein auf uns angewiesen, haben eigentlich keinen festen Stand mehr in dieser Gemeinde, seit die Eltern tot sind. Man hat uns geraten, wir sollten bei anderen Familien unterkriechen, den eigenen Hof aufteilen und verkaufen. Aber dagegen hat sich Justin ebenso gewehrt wie ich. Man ist uns jetzt gram deswegen und lässt uns links liegen.«
Justin schien nicht recht zugehört zu haben. Er meinte, als spräche er zu sich selbst: »Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mit euch in den fernen Westen gehen. Ich finde keinen Spaß an der Bauernwirtschaft. Aber was wird dann aus Martine?«
Martine, mit plötzlichem Trotz in der Stimme: »Das wäre sehr einfach. Ich ziehe mir Männerhosen an und komme mit.«
Die beiden jungen Männer starrten das Mädchen an, als hätten sie nicht recht begriffen. Martine stand neben dem Herdfeuer, voll vom roten Flackerlicht beglänzt. Kraft, ein beinahe übermütiges Selbstvertrauen, strahlte von ihr aus. Ihre schimmernden Augen waren weit offen. Um ihre starken Lippen huschte ein Lächeln, furchtsam war dieses Mädchen nicht.
William trank ihr Bild in sich hinein. So etwas gab es also: Mädchen, die kühn waren, ohne Angst vor der Fremde und dem Unbekannten! Das erfuhr er hier und jetzt zum ersten Mal, und es riss ihn fort. Er war zu keiner Antwort fähig.
Justin dagegen hatte seinen anfänglichen Schreck schnell überwunden und stellte mit gut brüderlicher Grobheit fest: »Du bist verrückt, Martine! Ein Mädchen – und endlose Reisen im Kanu, ins Ferne und Wilde? Gewiss, du weißt mit einem Paddel umzugehen – aber bestehst du das auch zwölf Stunden am Tag und länger? Bei Regen, Kälte, Hitze, bei Tag und Nacht – und immer im Freien? Du weißt nicht, was du redest, Martine. Und außerdem: Glaubst du etwa, dass Williams Vater sich mit einem Mädchen belasten würde, auf weiter Fahrt und ungewisser Route? Das halte ich für ausgeschlossen. Was ist deine Meinung, William?«
Der Angerufene hätte lieber nichts gesagt. Aber Justin ließ nicht locker. William hatte schließlich zu bekennen: »Ich glaube, mein Vater würde Nein sagen. Ein Mädchen am Paddel im Kanu, das würde er wohl für unmöglich halten.« Er wagte nicht aufzusehen nach diesen Worten, saß da, in lauter Unglück getaucht, hilflos, fühlte sich elend. Und noch elender wurde ihm, als Martine den Kopf aufwarf, sich abwandte, die Tür der Kammer hinter sich zuzog und hörbar verriegelte.
Justin suchte bald in einem Winkel des großen Hüttenraumes die Pritsche auf, die ihm als Nachtlager diente. Für den Gast war ein Strohsack in einem anderen Winkel schon bereitgelegt.
Missmutig, kaum noch ein Wort wechselnd, gingen die beiden jungen Männer schlafen.
2
Es gab in Grande Chute unterhalb der großen Fälle des St.-John-Flusses unter den Siedlern mehr als einen, der gar nichts dagegen gehabt hätte, wenn sich die beiden Corssens, der alte und der junge – vielleicht nicht in ihrer Mitte, aber wenigstens am Rande des Dorfes – niedergelassen hätten. Es sprach sich nämlich schnell herum, dass der ernste, wildniskundige Mann, der da zu ihnen gestoßen war, sehr genau über die Zeitläufte Bescheid wusste.
Die Leute von Grande Chute saßen seit mehr als zehn Jahren weit von jedem Schuss. Die Küste der Bay of Fundy lag außerhalb ihres Bereichs. Dorthin dachte niemand. Dort lief man den Engländern in die Arme, deren kalte Unerbittlichkeit die Akadier fürchten gelernt hatten. Also waren nur nach ›Neu-Frankreich‹, nach Québec am großen St.-Lorenz-Strom, vorsichtige Fühler ausgestreckt worden. In Québec wurde Französisch gesprochen, und zwar von gleichgesinnten Menschen. Aber auch dort traf man auf Beamte, französische diesmal, die eindringliche Fragen stellten und Auskunft darüber verlangten, ob die entlegene Siedlung nicht steuerlich herangezogen werden müsste. Überhaupt sei es nicht erlaubt, dass Franzosen, wie und wo auch immer, sich dem Zugriff und der Befehlsgewalt des Allerchristlichsten Königs entzögen und auf eigene Fasson selig würden. Wenn Grande Chute nicht so weit entlegen gewesen wäre und so schwierig und nur quer durch ungebrochene Wildnis zu erreichen, so hätte der königlich französische Gouverneur der Gebiete im Tal des St. Lorenz, welche die Franzosen ›Kanada‹ zu nennen sich gewöhnt hatten (nur diese Gebiete, keine weiteren!), gewiss die gepuderten Locken seiner Perücke energisch geschüttelt und von der Zitadelle in Québec einen Steuereinnehmer nach Grande Chute geschickt; es musste schließlich auch dort irgendetwas zu holen sein. Aber Grande Chute versteckte sich weit außerhalb des St.-Lorenz-Tals im leeren, dunklen Niemandsland des ungeheuren, noch kaum erforschten Kontinents. Man ließ die Leute dort am besten ungeschoren – vorläufig, bis sie entweder umgekommen waren oder sich wider Erwarten durchgesetzt hatten. Dann blieb immer noch Zeit, ihnen klarzumachen, dass auch sie der Ehre teilhaftig zu sein hätten, zum Ruhme und zu den Einkünften des Königs von Frankreich, zur silbernen Pracht des Lilienbanners, ihr bescheidenes Scherflein beizutragen.
Die Leute von Grande Chute waren Akadier, wie es auch die von La Have und Kagetoksa in Nova-Scotia gewesen waren, das heißt: die zwei, drei Generationen, die auf amerikanischem Boden groß geworden oder schon in die amerikanische Erde gesunken waren, hatten die unerhörte und für den Menschen aus dem alten Erdteil zunächst ganz unerhörte Weite und Freiheit des neuen Kontinents allmählich begriffen. Auf geheime Weise war solche Unabhängigkeit schließlich zu einem Teil ihrer selbst geworden. Zwar konnte man sich der Gewalt der alten Mächte von jenseits des großen atlantischen Meeres auch hier kaum entziehen – noch nicht! –, aber man verlernte es, sie als ›von Gottes Gnaden‹ hinzunehmen, unterlief sie, wo man konnte, wich ihr aus, wenn es sich einrichten ließ, in die grenzenlose Leere, in die waldigen, schattendunklen Einöden der gewaltigen neuen Heimat.
Die Leute von Grande Chute hatten also ihre Besuche von Québec-Stadt oder Rivière du Loup, überhaupt des französischen ›Kanada‹, auf das Notwendigste beschränkt, nach der alten, bewährten Regel, dass Regierungen und Verwaltungen umso erträglicher werden, je seltener man auftaucht und je größer der Zwischenraum ist, den man zwischen sie und sich zu legen imstande ist. Die Leute von Grande Chute hatten sich zwar ›draußen‹ gelegentlich mit Werkzeugen und Geräten für den Alltag versehen müssen, hatten aber bei ihren kurzen und möglichst unauffälligen Besuchen in der französischen Kolonie am unteren St. Lorenz nicht allzu viel und nur wenig Verbürgtes vom Lauf der Welt erfahren.
Dann hatten die Engländer in einem einzigen Anlauf die Zitadelle von Québec und die Stadt dazu erobert und sich schließlich überall in Neu-Frankreich durchgesetzt. Das Lilienbanner war in den Staub gesunken. Neu-Frankreich hatte aufgehört zu existieren – was jedoch durchaus nichts daran änderte, dass die Bewohner dieser Gebiete Franzosen waren, sich als solche und dazu als gute und treue Katholiken fühlten und hartnäckig fortfuhren, Französisch zu sprechen und vom Englischen so wenig wie möglich Notiz zu nehmen.
Die Leute von Grande Chute hatten sich also auf sich selbst zurückgezogen, hatten gehofft, dass auch die neuen Herren im fernen Québec sie nicht bemerken und behelligen würden, befürchteten aber im Geheimen doch, eines hässlichen Tages aufgestöbert und an eine behördliche Kette gelegt zu werden.
Walther Corssen, wie sich bald ergab, nachdem er erst einmal bei den Geschwistern Leblois mit seinem Sohn William Quartier bezogen hatte, wusste über die alten und neuen Umstände im Lande Genaueres zu berichten; er schien sich sowohl in den englischen wie den französischen Verhältnissen zuverlässig auszukennen. Obendrein war er vertraut mit allen Künsten der Wildnis, sprach ein leidliches Micmac, verstand sich offenbar auch aufs Englische und war im Übrigen ein besonnener und vernünftiger Mann, der Vertrauen erweckte und gut zu leiden war. Würde er in Grande Chute bleiben wollen – so meinten viele –, wäre es unklug, ihn abzuweisen, auch wenn er bei den Engländern schlecht gelitten wäre. Es brauchte ja keinem Außenstehenden auf die Nase gebunden zu werden, dass er nicht von Anfang an zu Grande Chute gehört hatte. Doch waren solche Überlegungen eine Rechnung ohne den Wirt, wie sich bald herausstellte.
Walther Corssen hatte gleich am Anfang dafür gesorgt, dass sein Kanu nicht etwa bei den Leblois versteckt wurde, das heißt, unterhalb der Fälle. Sollten er und sein Sohn sich gezwungen sehen, ohne Aufenthalt das Weite suchen zu müssen, so würden sie dann nur stromab fliehen können, dorthin also, woher sie gekommen waren. Der Sinn des Mannes aber stand nach Westen, ins Ferne, Unbekannte. Seit er seine Frau begraben hatte, seit er aus der neuen Heimat als ein Ausgestoßener hatte weichen müssen, seit er die kleine Tochter Anna bei guten Freunden und Nachbarn hatte zurücklassen müssen (eine schnelle, viele Wochen dauernde Flucht durch ungebändigte Wildnis hatte er dem Kinde nicht zumuten dürfen), seit, mit einem Wort, die neue Heimat, die die geliebte Frau mit der ganzen Kraft und Unbedingtheit ihres Herzens ersehnt und auch erschaffen hatte, ihm abermals zerstört war, fragte Walther Corssen nicht mehr danach, ob, wie und wo er wiederum Wurzeln in die amerikanische Erde treiben konnte – so wie er bereits einmal verwurzelt gewesen war, ohne doch den Wurzelgrund halten zu können.
Das unbezwingbare Verlangen, das ihn und die Geliebte über das große Wasser nach Westen gezogen hatte – schwächer ausgeprägt bei ihm, ungemein stark aber bei Anke, seiner an ihrem dritten Kind (und vielleicht an geheimer, nicht bewältigter Schuld) gestorbenen Frau –, dies Verlangen war darauf gerichtet gewesen, das in der bäuerlichen Welt verankerte Dasein, aus dem man sie herausgerissen hatte, in der neuen Welt neu zu begründen. Der Versuch war fehlgeschlagen – nicht jedoch, weil die erste sich der Mühe der Siedler verweigert hätte, sondern weil die Bösartigkeit der alten Welt mit über den Ozean gefahren war und hier auf die alte Weise kalt und erbarmungslos zugestoßen hatte. Anke, die geliebte Frau, war jäh erloschen, wie ein Licht von hartem Windstoß ausgeblasen wird. Mit ihr die Sehnsucht, neue, feste Wurzeln in eine neue warme Erde zu treiben.
Walther Corssen hatte sich aufrichten, über das Grab hinweg um seiner und des Sohnes Freiheit und Sicherheit willen den Blick in die dunkle Unermesslichkeit dieses noch weithin herrenlosen Erdteils wenden müssen. Wenn sich schon kein Siedelboden bieten wollte, den die alten Herren aus Europa ihm nicht jederzeit neiden, mit Steuern schmälern oder gar abjagen würden, dann wollte er sich lieber der Vogelfreiheit des leeren, fernen Westens ausliefern, wollte, mehr oder weniger bewusst, dem Schicksal entsprechen, das im Grunde allen Menschenkindern vorgezeichnet ist: nur Gast zu sein, wo auch immer man weilt.
Walther hatte also nicht lange darüber nachzudenken, wo sein Kanu zu verbergen war, als der Sohn ihm die Nachricht brachte, dass ihr erstes Ziel am großen St. John erreicht war; die akadische Flüchtlingssiedlung bei den ›Großen Fällen‹. Walther, William und der hilfsbereite Justin hatten zunächst das Gepäck über die Landzunge hinweg zu dem Anwesen der Geschwister Leblois getragen. Dann aber wusste der ältere Corssen es einzurichten, dass er das Kanu mit dem Sohn allein aus dem Wasser hob, sich das Boot kieloben auf seine und des Sohnes Schultern stülpte und mühselig einen Weg durch Wald und Dickicht suchte, um es oberhalb der großen Wasserfälle hinter Busch und Laubwerk in einem geschützten Felsenwinkel zu verstecken. Damit war, nach menschlichem Ermessen, ihre Weiterreise den St. John River aufwärts gesichert.
Die Corssens hätten die schwierige ›Portage‹, die Tragestrecke über die bewaldete Landzunge zu dem Versteck oberhalb der Fälle, vermeiden können, wenn sie das Boot mit allem Gepäck zu Wasser um das geräumige Vorgebirge herum an die gut ausgebaute Bootslände von Grande Chute gepaddelt hätten und dort an Land gestiegen wären. Das aber hätte sich vor aller Augen vollzogen. Nach dem Verbleib des Bootes wäre sicherlich gefragt worden, wenn es eines Tages nicht mehr an seinem Pfahl geschaukelt hätte.
Es war jedoch dem Walther Corssen aus der Lüneburger Heide in den sechzehn Jahren, die er in den Wildnissen Neu-Schottlands zugebracht hatte und in denen er ein aufmerksamer Schüler seines indianischen Freundes Kokwee gewesen war, längst in Fleisch und Blut übergegangen, sich so unauffällig wie möglich zu bewegen, seine Spuren zu verwischen, seine Absichten und Ziele unbestimmt zu lassen. Es war besser, zu fragen, als befragt zu werden; es empfahl sich eher, Antworten herauszulocken, als selbst zu antworten.
Und darauf kam es an. Bildete doch Grande Chute die erste Siedlung, den äußersten Rand der Gebiete des nun schon ›ehemaligen‹ Neu-Frankreich am unteren Sankt Lorenz, das die Franzosen ›Kanada‹ nannten – ein indianisches Wort, das etwa ›Heimat‹ oder ›unser Land‹ bedeutet. Walther Corssen hatte von vornherein an dieser Stelle rasten wollen, um vielleicht einige Auskünfte über das nun von den Engländern eroberte ›Nouvelle France‹ einzuheimsen – oder sich auch notfalls warnen zu lassen.
Noch war ja nicht entschieden, ob er sich mit seinem Sohn von diesem Ort aus klar nach Westen wenden sollte, in eine Richtung also, die von den Franzosen, wie er gehört hatte, schon seit hundert Jahren und mehr erkundet worden war – oder ob es sich empfahl, den Südwesten oder gar Süden anzustreben, wohin von den älteren, weiter im Süden an der atlantischen Küste Amerikas gelegenen englischen Kolonien her, tastende Vorstöße ins Innere unternommen wurden. Dies allerdings – so glaubte Corssen, urteilen zu müssen – längst nicht mit dem gleichen Wagemut, der gleichen Vorsicht und der gleichen Fähigkeit, sich die Freundschaft der indianischen Ureinwohner des weiten, weiten Hinterlandes zu sichern, die bis dahin den kühnen Ausgriff der französischen ›Waldläufer‹ in die verschleierte Tiefe des Kontinents ausgezeichnet hatten.
Das Herz zog Walther in die ›französische‹ Richtung, nach Westen, wo sich dem Kanu ein weitgespanntes Netz von Wasserstraßen anbieten sollte. Die Vernunft empfahl jedoch, sich eher nach Süden oder Südwesten in Gebiete zu wenden, die von jeher unbestritten unter englischem Einfluss standen. Dort würden er und sein Sohn nicht nach dem Woher und Wohin gefragt werden. Dort hatte der nun mit dem englischen Triumph abgeschlossene Krieg, der sieben Jahre gewährt hatte, sich nur wenig bemerkbar gemacht.
Im Norden sahen sich die Engländer auch nach dem militärischen Sieg einer weit überlegenen Zahl französischer Siedler gegenüber, die schon seit drei und mehr Generationen im Lande saßen und mit ruhigem bäuerlichem Selbstbewusstsein auf ihrem Erstgeburtsrecht in diesem sommerwarmen, strahlend schönen, aber auch grimmig winterharten Lande bestanden. Dort würden, musste Walther Corssen sich sagen, die Engländer noch in Jahren nicht aufhören, nach Leuten zu fahnden, die, obgleich hannoversche Untertanen des Königs von England, sich auf die französische Seite geschlagen, also sozusagen Fahnenflucht begangen hatten.
Walther Corssen war ja sogar englischer Soldat gewesen, hatte allerdings die Zeit, für die er sich als junger Kerl im Braunschweigischen hatte anwerben lassen, regelrecht und nicht ohne Anstand abgedient. Erst danach hatte er sein Schicksal mit dem der akadischen Franzosen in Neu-Schottland vereinigt – das heißt aber auch, so musste es den Engländern erscheinen – mit dem der Frankokanadier, mit Québec, und auf diesem Umweg auch mit den Lilien von Frankreich, den in Amerika nun gebrochenen, endgültig verwelkenden.
Walther kannte die Engländer: Mit kalter, zäher Gründlichkeit würden sie die neu gewonnenen Gebiete am unteren Sankt-Lorenz-Strom durchkämmen, um all der Personen habhaft zu werden, die ihnen nicht genehm waren, die sich aktiv gegen sie gewendet hatten und ihnen vielleicht in Zukunft noch gefährlich werden konnten. Doch dies Land war riesengroß, war wild und unerschlossen. Nachrichten und Anordnungen kamen nur langsam voran. Walther und William Corssen waren der behördlichen Gewalt, die ihnen auf dem Boden Neu-Schottlands sicherlich gedroht hätte, mit weitem Vorsprung ausgewichen, hatten schon zwei Dutzend Tagesreisen zwischen sich und möglicherweise lästig werdende Befrager gelegt, hatten sich auf einem sehr schnellen, noch so gut wie unerforschten Wege – den St. John aufwärts[3] – aus dem Staube gemacht und würden den vorgeschobenen Posten im Südwesten des französischen Kanada, die Ausfallspforte in den Westen und fernen Westen, das Städtchen Montréal, viele Monate, wahrscheinlich sogar ein Jahr eher, erreichen als jede Anweisung der sich nur mühsam durchsetzenden englischen Administration. Mochten sie also getrost nach einem gewissen Walther Corssen, gebürtig aus den Celle-Lüneburgischen Stammlanden Seiner Majestät des Königs von England, später in Diensten der englischen Kolonialverwaltung in Halifax, fahnden!
Wenn es je so weit kommen sollte, dann wollte Walther Corssen längst mit seinem Sohne William in den dunklen, unabsehbaren Hintergründen des Westens verschwunden sein, die, wenn überhaupt irgendjemandem, dann nur den Indianern gehörten.
Selbst wenn man ihm goldene Brücken gebaut hätte, wäre Walther Corssen nicht versucht gewesen, in Grande Chute zu bleiben – und damit sein Schicksal zum zweiten Mal mit der ungewissen Zukunft einer akadischen Siedlung zu verquicken. Gewiss, seinem Sohn William hatte er das so eindeutig noch nicht klargemacht, hatte es vielleicht noch nicht einmal sich selbst mit letzter Folgerichtigkeit vor Augen geführt. Nach wenigen Tagen in Grande Chute aber wusste er: Mit leichtem Gepäck will ich fortan reisen; will nicht wieder das Herz an eine neue Heimstatt hängen, will die Früchte dieses Erdteils pflücken, wo immer sie sich bieten, auch wo ich vorher nicht gepflügt und gepflanzt habe. Unterwegs sein – so soll meine Heimat heißen, und Beute machen will ich, wo immer sie sich anbietet.
Er hätte es nicht aussprechen können, aber es blieb wahr: Mit der geliebten Frau war ihm die alte Heimat – und der Versuch, eine neue zu gewinnen – ins Grab gesunken. Jetzt erst war er ein Mensch des neuen Erdteils, war er zum Amerikaner geworden.
Zwei unerwartete, von außen in seine Kreise stoßende Ereignisse trugen dazu bei, ihm Grande Chute lediglich als den ersten Rastort zu weisen, auf einem Wege, dessen Ende noch völlig im Dunkel lag.
Eines Abends um die Mitte des August saßen die Geschwister Leblois mit ihren Gästen vor der Hütte, um nach der Hitze des Tages die Kühle zu genießen. Die beiden Corssens hatten sich in die Arbeit auf dem kleinen Bauernhof eingeschaltet, wie es üblich war, auch um sich den Proviant zu verdienen, dessen sie für die Weiterreise bedurften. So entsprach es der Sitte in diesen bäuerlichen Bereichen, in denen Bargeld nur eine geringe Rolle, geleistete Arbeit eine umso wichtigere spielte.
Die vier waren miteinander vertraut geworden. Man hatte aneinander nichts Falsches entdeckt. Es schien sogar, als räumten die Geschwister, denen die Eltern allzu früh gestorben waren, dem erfahrenen, besonnenen Mann, der ihnen ins Haus gefallen war, eine Art Vaterstelle ein – gerade weil er nichts dergleichen beanspruchte, seine beiden Gastgeber durchaus für voll und gleichrangig nahm und seinen Rat nur anbot, wenn er darum gefragt wurde.
Sprachen die vier Menschen unter dem weit ausladenden Hüttendach nur von alltäglichen Dingen, so nahmen sie doch den schönen Glanz des Augustabends weit geöffnet in sich auf. Aus der Ferne drang als dunkle Grundmelodie und sehr verhalten der Gesang der Wasserfälle herüber. Wie das unablässige Summen der tief gestimmten Saiten eines Kontrabasses schwebte der Ton in der milden, von Düften beladenen Luft. Nach dem Harz der Fichten roch es hier, nach den Kräutern, Gräsern und Blumen auf der schon halb abgeweideten Wiese, nach den frischen Wassern des Stroms, die zwei Steinwürfe weit unterhalb der Hütte vorbeiwanderten. Sie strudelten noch immer unruhig dahin, hier und da mit schaumigem Silber gesprenkelt, vom Sturz über die hohe Felsenstufe erregt. Und es roch auch nach brennendem, frischem Holz. Am Flussufer, etwas abseits, stand das Räucherhaus des Dorfes. Am vergangenen Nachmittag hatten zwei Familien einen großen Fang von Lachsen und Forellen zum Räuchern eingehängt und im Räucherofen das Feuer aus feuchtem Eichenholz in Gang gebracht, das den Fischen, wenn sie richtig eingesalzen sind, so herzhaften Geschmack verleiht und sie den ganzen Winter über genießbar macht. Der aus dem Schornstein dringende weißliche Rauch – bei unbewegter Luft steigt er hoch auf und bleibt erstaunlich lange als blasses Wölkchen sichtbar –, dieser Rauch war es gewesen, der vierzehn Tage zuvor die beiden Corssens hatte hoffen lassen, das erste vorläufige Ziel ihrer gehetzten Reise im Kanu könne erreicht sein.
Sie schauten, als gäbe es keine andere Wahl, während ihrer dahinplätschernden Unterhaltung auf die rastlos wallende Fläche des großen Stroms hinunter. Die nie sich erschöpfende, in ihren Mustern und Formen sich nie wiederholende Bewegung der wandernden Wasser zog die Blicke an wie ein starker Magnet, ein Gleichnis des Stroms, in den alles menschliche Dasein verwoben ist.
Jenseits der schwarz-grünlich-gläsernen Flut lagerte die breite Bordüre des Waldes, flossen die Wipfel der Abertausend Fichten wie zu üppigem Samt zusammen, viel schwärzlicher noch und schattendichter als die Wasser des Stroms. Über allem wölbte sich ein welthoher Himmel, von der sachte verglimmenden Nachglut der schon versunkenen Sonne bis hoch in den Zenit rotgolden erhellt, und bald zu sanfteren Farben erblassend. Denn von Osten her hob sich schon – in veilchenfarbenen Tönen und dann zu immer tieferem Blau verschwebend – langsam das vollkommene Rund der Nacht, sog die letzten Lichter des Tages unmerklich sachte, doch unwiderstehlich in sich auf. Die erste Hälfte der Nacht würde mondlos sein. Schon ließen sich Sterne ahnen, zarteste Silberstäubchen. Ein warmer Spätsommertag war vergangen, eine kühle Spätsommernacht kündigte sich an mit ihrer makellosen, ihrer prachtvoll durchfunkelten Stille, mit unendlicher Ruhe über Strom und Wäldern, über nie verletzter Wildnis.
Martine Leblois saß ganz am Ende der Bank neben ihrem Bruder Justin, so weit entfernt wie nur möglich von dem gleichaltrigen William. Der junge Bursche, der sie beim Beerensammeln vor zwei Wochen im Wald überrascht hatte, versetzte sie in eine sonderbare und beunruhigende Spannung, wenn sie nicht vermeiden konnte, mit ihm allein zu sein –, verführte sie aber trotzdem, das Alleinsein mit ihm zu suchen. In einer Pause des Gesprächs, das bis dahin fast ausschließlich von Justin und dem alten Corssen bestritten worden war, nahm Martine das Wort:
»Ihr redet so, als sei es schon fest abgesprochen, dass Justin sich anschließt, wenn ihr euch demnächst wieder auf den Weg macht, weiter den St. John aufwärts, um Montréal zu erreichen und schließlich das Pays d’en haut.[4] Und was wird dann aus mir?«
Walther Corssen und Justin schwiegen. Es war zu spüren, dass sie diese Frage offenbar noch nicht genügend bedacht hatten. Vom anderen Ende der Bank her ließ William sich hören. Er hatte sich bis dahin an der Unterhaltung kaum beteiligt:
»Ja, das frage ich mich schon eine ganze Weile. Martine kann hier doch nicht allein bleiben, falls Justin mit uns reisen sollte. Ohne Hilfe kann sie den Hof unmöglich allein bewirtschaften. Wir müssen natürlich bei all unseren Plänen auch an sie denken.«
Justin fühlte sich betroffen. Aber er hatte sich gefasst und erwiderte unwillig, beinahe barsch: »Ich habe ihr schon hundertmal gesagt, dass ich hier nicht auf die Dauer bleiben will. Nun bietet sich mir endlich die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe: Ich kann Grande Chute verlassen. Unsere Nachbarn, die Marsaults, würden unseren Hof gern mit dem ihren zusammenlegen. Sie mögen dich, Martine, das weißt du. Und Jean Marsault ist der einzige Sohn – wie oft haben er und seine Eltern nicht schon angedeutet, dass sie sich glücklich schätzen würden, wenn du …«
Er kam nicht weiter. Martine fuhr ihm dazwischen: »Hör auf, Justin! Du weißt, und wenn du es nicht wissen willst, dann sage ich es jetzt noch einmal vor Zeugen, dass ich darüber nicht mit mir reden lasse. Jean Marsault ist ein braver junger Mann, und seine Eltern sind brave Leute, ganz gewiss. Ich habe auch gar nichts gegen sie. Aber da einheiraten – nein, keine zehn Pferde kriegen mich so weit!«
Walther Corssen hörte mit Schrecken, wie da ein Streit aufflammte, der wohl schon lange unter der Decke schwelte. Und der junge Corssen am Ende der Bank saß wie versteinert. Ihm war, als hätte sich ihm eine eiserne Klammer um den Hals gelegt: Oh, Martine, man kann dich doch nicht zwingen …
Doch, man kann! Justin fühlte sich auf seine Weise ebenso in die Enge getrieben, wie Martine auf die ihre. Auch an Justin zerrten die Wünsche in diese, die Verpflichtungen jedoch in jene Richtung. Kaum verhohlene Wut, sogar Bosheit schwang in den Worten, mit denen er nach nur kurzem Zögern antwortete:
»Zehn Pferde vielleicht nicht, Martine. Aber dir ist ja wohl klar, dass ich dein Vormund bin und an Vaters Stelle getreten. Niemand im Dorf, weder der Bürgermeister noch sonst wer – ich habe auch schon mit Tronçon gesprochen –, wird etwas einzuwenden haben, wenn ich sage: Du heiratest Jean Marsault. Und das erst recht, wenn ich weiter sage, dass ich nicht in Grande Chute bleiben will.«
Martine war ein kluges Mädchen. Sie hatte sich plötzlich in der Gewalt. Sie erwiderte leise, scheinbar gleichmütig: »Du willst fort, Justin, und ich muss heiraten. Das ist ganz einfach, nicht wahr? Nun ja, vielleicht gibt es keine andere Wahl.«
Walther Corssen spürte, dass sein Sohn William nebenan auf der Bank vor Erregung bebte. Vorsichtig wollte er die Hand auf die neben der seinen sich aufs Holz stützende des Jungen legen. Es empfahl sich nicht, in den Streit der Geschwister einzugreifen. Doch William schien die leichte Berührung, mit welcher der Vater ihn zu beruhigen trachtete, eher wie den Stich einer Tarantel zu empfinden. Er riss seine Hand an sich und sprang auf: »Keine andere Wahl? Das ist ja Unsinn! Warum keine andere Wahl? Wenn Justin mit uns mitkommt, warum soll dann nicht auch Martine mitkommen können, das möchte ich wissen!«
Justin fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Er hatte den um Jahre jüngeren William noch als ein halbes Kind genommen. Das schien plötzlich nicht mehr zu stimmen. Der Eigenwille, die zornige Kraft, die von dem jungen Corssen ausging und aus seinen Worten klang, waren ganz unverkennbar. Justin würde mit William rechnen müssen, wenn er sich den Corssens anschloss. Martine schien recht zu haben, wenn sie bezweifelte, dass die Dinge ›einfach‹ lägen. Er suchte nach einer Antwort.
Auch Walther Corssen war von Williams Reaktion überrascht worden; sein Ausbruch bestürzte ihn. William war doch noch zu jung, als dass er …
Die Nacht hatte in aller Stille ihre Herrschaft angetreten. Das war so langsam vor sich gegangen, dass die Augen sich mühelos hatten anpassen können. Auch in dem zarten Sternenlicht, das nun die Stunde regierte, ließ sich weit sehen.
Bevor noch den beiden anderen Männern eine Antwort auf Williams auftrumpfende Rede einfiel, wurde die Aufmerksamkeit der vier abgelenkt. Martine hatte den Kopf erhoben. Halblaut sagte sie: »Es kommt jemand den Pfad herauf.«
Der Pfad, das war der dicht über dem Flussufer verlaufende Fußweg, an dem in weiterem oder näherem Abstand alle Gehöfte der Siedlung Grande Chute aufgereiht lagen. Es ging sich besser auf ihm als auf der oberhalb der Höfe verlaufenden und manche Umwege machenden Karrenstraße.
Ja, es kam jemand vom Fluss herauf. Der sich ruhig nähernde Schatten war immer deutlicher zu erkennen. Justin erhob sich und ging dem späten Besucher einige Schritte entgegen. Er war hier der Hausherr. William hatte plötzlich an Bedeutung verloren.
Der Näherkommende rief verhalten durchs Dunkel: »Ich bin es, gut Freund, Pancrace Matthieu. Wollte sehen, ob ich noch einen wach finde bei euch.«
»Komm nur, Pancrace, du bist willkommen. Wir sitzen alle noch vor dem Haus. Für dich ist auch Platz.«