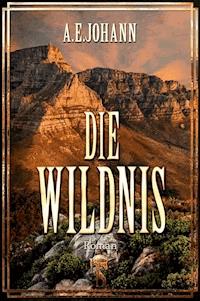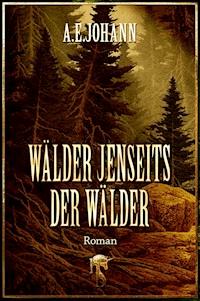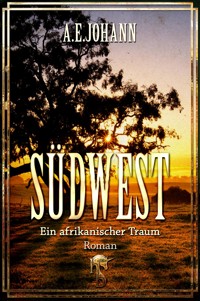
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der deutsche Siedler Wilhelm Korthinrich hat das karge Land am Waterberg in der südafrikanischen Wildnis fruchtbar gemacht und zur Farm Otjikarare ausgebaut. Doch nach Jahren harter Arbeit kommt es zu einem Aufstand der Herero – unter den Opfern ist Wilhelm Korthinrich. Wilhelms Tochter Marthe hält nach dem Unglück unermüdlich am Erbe ihres Vaters fest. Sie bleibt auf der Farm und gründet mit dem schottischen Offizier Kurt von Horsberg eine Familie. Doch schon bald muss Marthe erkennen, dass sich die Welt nicht nur um Otjikarare dreht: In Europa bricht der Erste Weltkrieg aus und Kurt wird als Reservist wieder einberufen. »Südwest« ist ein Roman über eine außergewöhnliche Frau in der südafrikanischen Wildnis, der auf wahren Begebenheiten beruht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
A. E. Johann
Südwest
Ein afrikanischer Traum
Roman
Teil I: Fremde Erde
Sollte das wahr sein? …
War man deshalb so weit und so lange gefahren, um schließlich nichts weiter zu erreichen als dies jämmerliche Ziel? So sah es also aus, dies Südwestafrika, das die einundzwanzig Mannschaften und Unteroffiziere unter dem Hauptmann Kurt von François »beschützen« sollten, das heißt, es war eigentlich nicht viel zu sehen, was sich zu sehen oder zu beschützen lohnte. Tagelang war das englische Frachtschiff, halb unter Dampf, halb unter Segeln, wie es das Wetter erforderte, an der Südwester Küste südwärts geschippert, nicht eben schnell; mehr als acht, höchstens zehn Seemeilen in der Stunde waren nicht zu erwarten. Die deutschen Soldaten auf dem englischen Schiff, als »Forschungsreisende« getarnt, hatten an der schwankenden Reling gestanden und nach Osten geblickt, wo irgendwo im Dunst und kalten Nebel das Land liegen musste, für das sie sich in einem Anfall von Wagemut – oder war es Übermut gewesen? – gemeldet hatten. Ganz selten nur war Land in der Ferne erkennbar geworden als ein schmaler, blasser Streif am Horizont – es konnte genauso gut für eine ferne Wolkenbank gehalten werden.
In dem kleinen Speisesaal des Schiffes war eine simple Seekarte der Westküste Afrikas an die Wand geheftet gewesen, damit die Passagiere, an die fünfzig Männer, nur wenige Frauen, etwa verfolgen konnten, welche Fortschritte auf der langwierigen Reise von London nach Kapstadt am »Kap der Guten Hoffnung« man Tag für Tag zuwege brachte!
Wilhelm Korthinrichs, einer der verkappten deutschen Kavalleristen, war es, der bei eingehendem Studium der Seekarte entdeckte, dass der lang gestreckte Nordabschnitt der südwestafrikanischen Küste den Namen »Skeleton-Küste« führte, also »Gerippe« oder »Knochenküste«. Weiß der liebe Himmel, das klang nicht sehr einladend!
Manch einer der Kameraden des Reiters Korthinrichs, der bis dahin den Mund ziemlich voll genommen hatte – für Korthinrichs selbst galt das jedoch nicht –, wurde danach recht still. Der Bootsmann des Schiffes stammte von der Waterkant, fuhr aber schon so lange auf englischen Schiffen, dass er sein Plattdeutsch beinahe verlernt hatte. Immerhin vermochte er dem deutschen »Forschungsreisenden« Korthinrichs zu erklären, dass die Küste so hieße, weil manch ein Schiff an ihr gestrandet war und viele Schiffbrüchige in der wasserlosen Wüstenei dahinter verdurstet wären. Dort würden also immer wieder menschliche Gerippe aus dem Sand gewaschen oder vom ewigen Westwind aus den wandernden Dünen geweht. Die Namib – so hieße die lang gestreckte Wüste hinter dem Streifen der schweren, unpassierbaren Brandung – die Namib stellte eine gnadenlose Landschaft dar; sie legte eine schwer überwindliche Barrikade zwischen das Ufer des Meeres und das Hochland im Innern. Und Häfen, die diesen Namen verdienten – so der Bootsmann zu Korthinrichs –, die gäbe es an der ganzen langen Küste nicht, von der Kunene-Mündung im Norden, wo das portugiesische Angola aufhörte, bis zur Oranje-Mündung im Süden, wo das britische Kapland anfinge – abgesehen natürlich von Walvis-Bay, wo schon seit längerer Zeit die britische Flagge wehte, wo die deutschen »Forschungsreisenden« mit all ihren Kisten und Kasten an Land gehen wollten.
Die beiden hatten Geschmack aneinander gefunden, der alte »Seebär« Pete Pettersson von der Unterelbe und der junge, ewig wissbegierige Passagier Wilhelm Korthinrichs, der dem Bootsmann das altvertraute Plattdeutsch wieder ins Gedächtnis zurückgerufen hatte.
So erkundigte sich denn der Bootsmann nach dem Gespräch über die Knochenküste:
»Stimmt denn das, Mister Korthinrichs, was man so hört, dass die Deutschen vor ein paar Jahren in der Angra Pequeña, der ›Kleinen Bucht‹ weiter im Süden, einem verdammt schwierigen Landeplatz – und die Inseln davor sind obendrein britisch – eine Faktorei, einen Kaufmannsladen für die Eingeborenen, eingerichtet haben, dass die deutsche Flagge darüber gehisst wurde und nun dieser ganze riesige Brocken Südwestafrika deutsche Kolonie werden soll? Bisher wollte ja dies dürre Land mit der trostlosen, an die fünfzig Meilen oder mehr breiten Namib-Wüste im Vorfeld niemand haben. Viel ist da bestimmt nicht zu holen. Die Deutschen kommen ein bisschen zu spät, scheint mir.«
»Ja, Bootsmann, wirklich Genaues weiß ich auch nicht. Aber es steht fest, dass schon seit Jahrzehnten in der Mitte des Landes deutsche Missionare unter den Eingeborenen arbeiten, dass deutsche Händler auf dem Hochland unterwegs sind und dass ein angesehener Bremer Kaufmann mit Afrikaerfahrung in der Angra Pequeña eine Handelsniederlassung eingerichtet und mit den Häuptlingen im Innern Verträge abgeschlossen hat. Von all dem kann ja wohl das Deutsche Reich nicht ganz unbetroffen bleiben. Die Eingeborenen im Innern, wie die Missionare nach Berlin berichtet haben, liegen sich ständig in der Wolle, schlagen sich eifrig tot und treiben sich das Vieh ab, wo sie nur können. Da muss schließlich etwas unternommen werden, damit nicht die Weißen – das sind ja nicht nur Deutsche – in die blutigen Stammeskriege hineingerissen werden und womöglich Leben und Besitz verlieren.«
Dem weit umhergekommenen Bootsmann gefiel das Sprüchlein nicht besonders, das der junge Korthinrichs in leicht belehrendem Ton aufgesagt hatte – die einundzwanzig Mann der »staatlichen Truppe« waren vor der Abreise aus Deutschland nach preußischer Manier gründlich instruiert worden, wie sie als Zivilisten ihren Auftrag unterwegs auf dem englischen Schiff darzustellen hätten; und dieser Wilhelm Korthinrichs war noch nie schwer von Begriff gewesen. Der Bootsmann schob die wollene Kappe aus der Stirn, die er trug, und kratzte sich den Haarschopf mit gebogenem Mittelfinger:
»Wissen Sie, Mister Korthinrichs, ich habe fast mein ganzes Leben bei den Engländern in Heuer gestanden, die längste Zeit bei dieser Castle-Linie, und habe einiges erlebt. Walvis-Bay, wo wir anlegen werden, damit Sie und Ihre Kollegen an Land gehen können – wir haben auch einige Fracht für Walvis-Bay –, das ist schon englisch. Die Engländer glauben, dass alle Länder, die noch keinem gehören, vom lieben Gott für die Königin von England bestimmt sind. Und das Land hinter Walvis-Bay, das große Südwestafrika, das haben sie nur deshalb noch nicht vereinnahmt, weil mit der Wüste, dem dürren Dornbuschland im Innern und den wilden Niggern nichts anzufangen ist, wovon man sich Gewinn versprechen könnte. Aber wenn jetzt ein anderer kommt und will sich festsetzen, werden sie böse werden, die Engländer – das kenne ich schon! No, no, Mister Korthinrichs, was die Briten anbetrifft, da macht mir keiner was vor. Ich bin immer ganz gut mit ihnen ausgekommen und hab’s bis zum Bootsmann gebracht. Weiter wird aus mir nichts! Aber was soll unsereins auch weiter wollen!« …
Der Bootsmann hatte sich seine Wollmütze wieder in die Stirn gezogen und sich seiner Spleißarbeit an einem durchgescheuerten Tau zugewandt.
Der junge Korthinrichs war nachdenklich geworden nach dieser Unterhaltung. So klar und vaterländisch brav, wie man es dem kleinen Kommando von jungen Männern vor der Ausreise eingeschärft hatte – und man hatte gefälligst zu glauben, was die Vorgesetzten in der Instruktionsstunde lehrten! –, nein, ganz so einfach schienen die Verhältnisse in dem Land, dem man entgegenfuhr, doch nicht zu liegen. Aber es empfahl sich wahrscheinlich, solche Bedenken mit den Kameraden nicht zu erörtern. Viel herumzureden – dazu neigte Korthinrichs ohnehin nicht …
Das Schiff hatte Kurs aufs Land genommen. Die für Walvis-Bay bestimmten Passagiere machten sich für die Ausschiffung bereit. Korthinrichs war froh, dass sich die Wochen der ewigen Schaukelei – die manchem schlecht bekommen war – endlich ihrem Ende näherten, dass man bald wieder darstellen würde, was man in Wahrheit war und sein wollte: Soldat und Reiter unter dem guten Hauptmann von François, der sich, wie sie alle an Bord des Schiffes, in albernes Zivil hatte kleiden müssen.
Das Schiff tastete sich um eine lang gestreckte, sandig flache Halbinsel in den Hafen. Die deutschen Männer standen an der Reling und blickten dem Ziel entgegen, von dem unterwegs so viel die Rede gewesen war. Walfischbucht – der einzige, brauchbare Hafen an der gut dreizehnhundert Kilometer langen Küste Südwestafrikas. Den Männern verschlug es die Sprache. Walvis-Bay – wo war es überhaupt? Diese magere, dürftige Ansammlung von wenigen Dutzend niedriger Holzhäuser und Schuppen, mehr oder weniger regellos auf gelben Sand gesetzt?
Kein Baum, kein Strauch! Sand, nichts als Sand, der aus dem Innern in gelben Dünen heranzubranden schien – und eine hölzerne Landungsbrücke, der sich das Schiff nur mit äußerster Vorsicht näherte. Die in den Sand gerammten Bohlen machten keinen sehr standhaften Eindruck, krachten, ächzten und schwankten, als der Leib des Schiffes sich gegen sie legte.
War man so weit und so lange gefahren, um diesen höchst kümmerlichen Ort zu erreichen …? Und er war nicht einmal deutsch, sondern britisch. Der Union Jack flatterte, zerfleddert schon an den Kanten, an einer hohen Stange neben dem völlig reiz- und schmucklosen Zollschuppen.
Aber wenn die Männer sich auch wunderten, ja, wie Korthinrichs, aufs Tiefste bestürzt waren, für Gefühle der Enttäuschung oder der Furcht blieb jetzt keine Zeit. Die Kisten und Ballen, welche die Ausrüstung der »staatlichen Truppe« enthielten, mussten unversehrt an Land und weiter landein geschafft werden. Es gab einige Debatten mit dem britischen Zoll. Aber das hatte der Vorgesetzte auszubaden, und die Papiere der »Forschungs-Expedition« waren in Ordnung. Allen brannte der Boden unter den Füßen. Nur endlich fort aus diesem Gebiet unter englischer Hoheit! Man war ja hergereist, um für den Schutz deutscher Leute in einem Land zu sorgen, das sich, wie es hieß, dem Deutschen Reich anvertraut hatte, das also drauf und dran war, deutsches Land zu werden, wenn auch der Hafen Walfisch-Bay als englischer Pfahl im deutschen Fleisch verbleiben würde – bis auf Weiteres.
Die Mannschaft und ihr Führer atmeten auf, als sich bald nach der Ankunft herausstellte, dass der lange vorher bestellte Agent für den Weitermarsch der kleinen Truppe ins Innere des Landes gewissenhaft vorgesorgt hatte. Zwei ungemein starke, mit zehn Joch gesunder und starker Ochsen bespannte Wagen unter hoch aufschwingenden Planen standen bereit, das Gepäck der Männer, die Kisten mit ihren Waffen, Sätteln, Geschirren, Uniformen und der Munition für ihre Karabiner aufzunehmen. Und auch für Pferde, junge, saubere Tiere, die gut im Futter waren, allesamt an Sattel und Zaumzeug längst gewöhnt, war gesorgt. Das hob die Stimmung unter den jungen Männern ungemein, denn Reiter waren sie alle, als gute Reiter waren sie ausgesucht und angeworben worden. Ohne Pferd war man nur ein halber Mensch – das stand für jeden der Männer als allererste Wahrheit fest.
Keine Schiffsplanken mehr, keine Schaukelei und Übelkeit! Pferde stattdessen, gute Pferde! Es ging also los! Jetzt erst ging es richtig los! Drei Kreuze hinter diesem Sandloch Walfisch-Bay und auch hinter der hohen See!
*
Der breite Gürtel von riesigen Wanderdünen, der sich zwischen der Küste um die Walfischbucht und dem langsamen Anstieg zum Südwester Hochland unabsehbar nach Norden und Süden entlangdehnt, war für die Ochsen vor den Planwagen und die Pferde der Reiter überaus mühsam zu durchqueren gewesen. Von See her stand wie beinahe stets ein steifer Wind, Sturm beinahe, ins Land hinein, riss und wirbelte den feinen Sand von den Dünenkämmen in schleiernden Wolken, brannte auf Gesicht und Händen, machte die Augen tränen, die Zähne knirschen, verstopfte die Ohren. Manchmal waren Spuren von winzigen Tieren im Sand zu erkennen. Aber dazu musste man sehr genau hinsehen. Ganz ohne Leben war also auch diese trostlos gelbe Wüste nicht.
Die Männer steckten schon in ihren fahlen Uniformen und saßen im Sattel; es ging landein, weg von der vermaledeiten Küste. Auch diese infernalische Namib würde irgendwann überwunden werden, folgte man doch einem Karrenweg, der sich deutlich genug abzeichnete, wo ihn der ewig treibende Sand nicht verweht hatte. Aber die Hottentotten-Treiber der Ochsengespanne vor den schwerfällig wankenden Planwagen waren sich offenbar ihres Weges vollkommen sicher. Der breite Wüstenriegel vor dem Anstieg zum Hochland musste eben durchstoßen werden, ob es einem passte oder nicht.
Die Reiter zogen den Ochsenwagen weit voraus, um nicht zu dem treibenden Sand auch noch den Staub der schwerfällig trottenden Gespanne in der Nase zu spüren. Sie merkten es alle, Reiten in diesem Land mit der grellen, harten Sonne, den kalten Nächten und der Glut der Mittage, das würde kein Zuckerlecken sein! Korthinrichs sagte sich: Zurückzublicken hat keinen Sinn; schlimmer als hier kann’s nicht kommen, also vorwärts! Noch zweihundert Kilometer bis Otjimbingwe, wo die Rheinische Mission ihr Hauptquartier hat und wo auch wir vorerst unseren Standort finden sollen. Dass sich die Missionare, die schon seit den Vierzigerjahren im Lande wirken, eine Wüstenei als Siedelplatz für ihre Hauptstation ausgesucht haben – das ist wohl kaum zu erwarten …
Nach einigen Dutzend ermüdender sandiger Meilen trat die »Pad«, der Karren-»Pfad«, in ein breites, aus dem Innern herziehendes flaches Tal ein, in dem sich, wie leicht zu erkennen war, vor nicht allzu langer Zeit ein Fluss oder Strom aus dem Innern zum Meer gewälzt haben musste, wenn sich auch jetzt, gegen Ende des europäischen Sommers (der hier auf der Südhalbkugel der Erde die Zeit des Winters, der trockenen, kalten Zeit, bedeutete), in dem weiten Strombett kein Tropfen Wasser entdecken ließ. Sand, Sand auch hier, aber blässerer, festerer als in den ewig wandernden, wehenden Dünen der gottverlassenen Namib. Dem Flusstal folgend ging es langsam und gleichmäßig bergauf, landein. Schon zeigten sich Felsen, bedrängten steinerne Wände das Flussbett. Und Leben kündigte sich an, niedriges Kraut zuerst; ein paar schnelle Insekten schwirrten; auf dem Steilufer der Schattenriss eines kleinen mageren Hundes gegen den Himmel gezeichnet, von der »Pad« her im Stromtal deutlich über der Kante der Böschung auszumachen! Ein Hund …? Nein, kein Hund! Ein Schakal, wie die Männer von dem alten Buren belehrt wurden, der die Planwagen, die Ochsengespanne und ihre schwarzen Treiber kommandierte! Ein Schakal also, das erste afrikanische Tier, das mir begegnet, stellte Korthinrichs bei sich fest. Leben gibt es auch hier und nicht nur tote Dünen-Ödnis!
Am dritten Tag endlich änderte sich das Bild, wie es keiner der aus dem grünen Mitteleuropa ins südwestliche Afrika geworfenen Reiter für möglich gehalten hatte. Was sich ihnen wie der Zug eines Gebirges entgegengebaut hatte, erwies sich als die vielfach gebrochene Kante eines strahlend weiträumigen Hochlands, das, wie der Führer der kleinen Truppe seinen Leuten erläuterte, sich etwa eintausenddreihundert Meter hoch über den Meeresspiegel erhob; allerdings würde es von Gebirgen unterbrochen, die bis zu zweitausend Metern darüber aufstiegen.
Die zunächst nur locker über die ansteigenden Ebenen verteilten Büsche, fast alle mit Dornen vieler Arten bewehrt, wie der wissbegierige Korthinrichs bald erkannte, sie rückten allmählich enger zusammen, vereinten sich schließlich zu unabsehbaren, dichteren Hainen, über die vereinzelt höhere Bäume, Kameldorne zumeist, mit vertrackt verwinkeltem Astwerk, hinausragten. Von den Kämmen des weithin wallenden Geländes her – es schwang dahin wie ein erstarrtes Meer – öffneten sich schier unermessliche Fernblicke. So klare, so helle, ungemein durchsichtige Luft meinte der Reiter Korthinrichs noch nie erlebt zu haben – womit er keineswegs unrecht hatte!
Nichts war zu merken von der »Schwüle der Tropen«. Leicht ging die Luft; immer wehte ein bald sanfter, bald starker Wind über den Weiten, die sich olivgrün, goldbraun, auch silbrig, wo Grasflächen sich dehnten, ins schier Grenzenlose erstreckten. Rudel von nie gesehenem Wild tauchten manchmal am Wege auf, gar nicht besonders scheu, Springbock-Herden, Oryx mit langen Spießhörnern, herrlich grau, weiß und schwarz gezeichnet. Und auch schon die stolzeste aller Antilopen des Landes, die Schraubenantilope, der Kudu mit dem wie gedrechselten, gewundenen Gehörn, wurde gesichtet, wenn auch nur für Augenblicke. Das Tier äugte bewegungslos aus der Deckung der hohen Gebüsche zu dem vorbeiziehenden Reitertrupp herüber, wie aus Erz gegossen mit erhobenem, schwer bewehrtem Haupt, ein herrliches Standbild! Und setzte dann, plötzlich misstrauisch geworden, aus dem Stand in hohem Satz davon und war im Dornbusch verschwunden, als hätte es nicht soeben noch das Herz der Reiter auf der staubigen »Pad« um ein paar Schläge schneller schlagen lassen.
Wilhelm Korthinrichs saß aufrecht und doch locker im Sattel. Seine Glieder und Muskeln – guter Reiter, der er war! – passten sich jeder Bewegung des schnell schreitenden oder auch trabenden Pferdes an: Er brauchte sich keine Mühe zu geben, konnte die Augen schweifen lassen, ließ sich keine Einzelheit der neuen strahlenden Welt entgehen, die sich vor ihm und an den Flanken des Weges auftat. Ungeheuer fremd kam ihm dies überhelle Dornbuschland in den ersten Tagen vor. Da ritten sie und ritten und immer rollte langsam die gleiche, dicht, aber nicht allzu dicht bewachsene Baum- und Busch-Steppe an den Seiten ab, tauchte vor ihnen aus dem leichten Dunst des fernen Horizonts und versank hinter ihnen, als hätte sie keinen Anfang und kein Ende. Wer sie so, aus einem eng und alt besiedelten und seit tausend Jahren pfleglich genutzten Land stammend wie der junge Reiter Korthinrichs, zum ersten Mal erlebte, der mochte kaum glauben, dass es dergleichen überhaupt gäbe: so viel unabsehbare, unberührte Einsamkeit, so viel seltsam großartige, überwältigende Eintönigkeit, die doch nirgendwo sich wiederholte, sondern in ewig neuen Abwandlungen bewies, dass sie lebte, seit Abertausend Jahren in sich selber schwingend in unerschütterlichem Gleichmut.
Und noch etwas anderes kam ihm zu Bewusstsein, dem Stunde für Stunde unter heißer Sonne in lang auseinandergezogener Kavalkade vor sich hin zockelnden Reiter: Die Luft über diesen von Abertausend Gebüschen übergrünten Weiten – diese trockene, unendlich leichte Luft, die jeden Schweißtropfen schnell trocknen ließ, die rein und warm in die Lungen strömte und das Atmen zu einer Lust machte, solch herrliche, mit zarten und zugleich herben Gerüchen beladene Luft hatte es für ihn noch nie gegeben, sie war ein Wunder!
Ja, ein Wunder war es ihm, dem Reiter aus einer ganz anderen Welt, dass es ein Land wie dieses überhaupt gab. Doch so war es! Da erstreckte es sich weit um ihn her ganz und gar wirklich, nie geahnt und nun doch alle Sinne bedrängend, in seiner Andersartigkeit beinahe heimliche Furcht erregend.
Aber dieser Korthinrichs neigte nicht zu Angst oder ungewissen Gefühlen. Er hatte sich zu Afrika entschlossen. Nun galt es, damit fertig zu werden und nicht zurückzublicken. Schon auf diesem ersten langen Wanderritt von der toten Küste ins duftende Hochland Südwestafrikas hinauf erlebte er in sich die Wende, die Hinwendung zu diesem Sonnenland, die vor ihm und nach ihm so viele Menschen aus der gemäßigten Zone, aus dem alten Europa, erlebt haben. Das geschah, als er als Erster des Kudu-Bullen ansichtig wurde zwischen den Gebüschen am Wegrand, des herrlichen Tieres der Wildnis mit dem mächtig gewundenen Gehörn, groß wie ein Pferd oder größer, mit schwerer Wamme am stark gebogenen Hals. Ein Urbild der Freiheit, in unbewusster, kühner Schönheit und Kraft, so hatte sich der Kudu den Augen des Reiters dargeboten, ganz überraschend, eine plötzliche Erscheinung zwischen zwei hohen, runden Weißdornbüschen.
Der unvermutete Anblick war dem Reiter wie ein Blitz in den Sinn gefahren, verging schon nach ein paar Sekunden. Die Brust des Mannes hob sich in einem tiefen Atemzug. Er wusste plötzlich, es kam ihm wie eine Erleuchtung: Welch ein Land! Welch ein ungeheuer herrliches, freies, wildes Land! Es wartet auf mich. Hier will ich sein. Hier will ich mir Lebens- und Heimatrecht erringen! Ich habe mich nicht geirrt. Hier bleibe ich!
*
Otjimbingwe dann endlich, die große Missions-Station, schon weit im Inneren, eine Ansammlung von niedrigen, weit verstreuten Häusern mit weiß gekalkten Wänden. Hottentotten, Herero, Berg-Damara – Korthinrichs wusste sie bald zu unterscheiden. Eine viel kleinere Anzahl von weißen Männern tauchte auf, mit Vollbärten zumeist: ernsthafte Missionare, Händler, Abenteurer, nur wenige weiße Frauen, ausnahmslos solche, die zur Mission gehörten. Lärm und Unruhe, Geschrei und Gewimmel, Staub von Ochsenwagen, Peitschengeknall der Treiber, Berittene auf schweißnassen Pferden, Ziegenherden und kläffende Hunde, die Glocke der Missionskapelle. Nach der Stille der Steppe der schrille Spektakel der Menschenwelt …
Die Truppe unter dem Hauptmann von François war sehnsüchtig erwartet worden. Ein britischer Händler war unterwegs, weiter im Osten des Landes, in die blutigen Fehden zwischen Hottentotten und Herero geraten, war von einer Hottentotten-Schar überfallen, beraubt und als Geisel genommen worden, die von der Mission ausgelöst werden sollte. Stattdessen würde man nun den Burschen die frisch von der Küste eingetroffenen Schutztruppen-Reiter auf den Hals schicken! Drei Tage nach ihrer Ankunft saß die Truppe bereits wieder im Sattel. Diesmal waren die Karabiner am Sattel scharf geladen, und den Pferden wurde das Äußerste abverlangt, denn Zeit war nicht zu verlieren. Es brauchte kein Schuss abgegeben zu werden. Die Räuberbande machte sich schleunigst aus dem Staub, als statt des erhofften Lösegelds in Form von Schnaps, Kattun und Tabak die bewaffneten Reiter auftauchten. Das war etwas Neues! Damit hatte man nicht gerechnet. Die Verhältnisse begannen sich offenbar zu ändern.
Und Korthinrichs war von Anfang an mit dafür verantwortlich, dass sie sich änderten in Südwestafrika. Ein paar Jahre würde er im Sattel sitzen und reiten müssen, reiten! Dann hatte er – mit all den anderen – von dem Land Besitz ergriffen.
Und das Land von ihm!
Er ahnte nicht, wie hart und von Gefahr umwittert er würde reiten müssen, landauf und landab, ehe er endlich aus dem Sattel steigen und versuchen konnte, für sich und die Seinen im weiten, leeren Busch eine Heimstatt zu gründen.
Teil II: Landnahme
Der Schwarze hob seine Rechte und schwenkte sie in einem weiten Halbkreis, als wollte er das Land vorstellen:
»Dies ist der Platz, Herr!«
Der Reiter zog den breitrandigen Filzhut vom Schädel und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Dann richtete er sich im Sattel ein wenig auf, vereinte seine Hände mit den Zügeln und der Krempe des Hutes auf dem Sattelknauf und blickte sich um:
»Wie heißt dieser Ort in der Sprache deines Volkes, Amos?«
»Auf Herero trägt er den Namen Otjikarare, Herr.«
»Und was bedeutet das?«
»Das ist gar nicht so leicht zu sagen, Herr. Es ist eben nur ein Name. Aber so ungefähr benennen wir Herero eine Stelle in bergigem Land, von der man weit sehen kann.«
Der Reiter ließ das Wort aus der Herero-Sprache ein paarmal, als wollte er es ausprobieren, über seine Zunge gleiten:
»Otjikarare, Otjikarare – ein Ort, von dem man einen weiten Blick hat. Ganz gewiss, der Name stimmt …!«
Die beiden Männer am sanft geneigten Hang der hinter ihnen von Südwesten locker heranwogenden Berge und Hügel ließen ihre Pferde für eine Weile verschnaufen. Sie verhielten sich still für geraume Zeit, tranken das Bild ein, das ihren Augen wohltat; sie waren verzaubert, rührten sich nicht.
Ja, Verzauberung wehte aus den unabsehbaren Steppen heran, die sich nach Nordosten ins Grenzenlose zu dehnen schienen, ein leiser Zauber in der Tat, der den Mann im Sattel zu einer Statue erstarren ließ.
Ein blassblauer, seidenzarter Dunst schwebte über der fernhin wallenden Steppe, die Ahnung unermesslicher Einsamkeit. Die Sonne hatte sich im Nordwesten bereits ins letzte Viertel ihrer gleißenden Bahn geneigt. Ihre Glut, die um die Mittagszeit wie jeden Tag flammend gesengt hatte, war fühlbar abgeklungen. Der Luftzug – einen Wind konnte man ihn kaum nennen –, der aus den unendlichen Weiten hügelan geweht kam, war knochentrocken; er ließ deshalb den Schweiß auf der Stirn des Reiters schnell vergehen, schenkte sogar ein Gefühl der Kühlung, obgleich er immer noch wie aus dem Feuerloch eines Ofens zu stammen schien. Dies war ein Land, in dem über allem die Sonne regierte, herrlich, strahlendes Licht spendend in überreicher Fülle – und gnadenlos!
Kein Zeichen menschlichen Lebens, so weit das Auge reichte und so forschend die Blicke auch suchen mochten nach allen Richtungen. Nichts weiter bot sich dar als der unabsehbare Busch, dornig, sperrig, hoch genug, dass ein Reiter nicht darin zu entdecken war, wenn er es darauf anlegte, aber doch nur locker geordnet; Mann und Ross konnten ihn ungehindert durchschweifen – und auch das Vieh! Denn überall unter den Dornbüschen, den hier und da ihr verknorrtes, verqueres Gezweig in den Himmel reckenden Kameldornbäumen, stand kräftiges Gras in fußhohen Bülten, goldgelb jetzt bis grausilbern gegen Ende der trockenen, der »kalten« Jahreszeit – »Heu auf dem Halm«, ging es dem Reiter durch den Kopf. Hier würde er sich nicht zu sorgen brauchen; viele Rinder würden sich hier in der schier grenzenlosen Steppe reichlich nähren – aber:
»Wie ist es, Amos, gibt es Wasser in dieser Gegend?«
Der schwarze hochgewachsene Mann mit den sonderbar schlenkrig wirkenden Armen und Beinen, die doch in ihren lang gestreckten Muskeln viel zähe und gewandte Kraft beherbergten, war vom Pferd gestiegen, hatte sich ein paar Schritte abseits auf einem an der Oberkante wie künstlich geglätteten weißlichen Felsblock niedergelassen, als wollte er den reglos in die Weite starrenden Reiter in seinen stummen Betrachtungen nicht stören. Nun schreckte ihn die plötzlich auf ihn abgeschossene Frage – eine Frage von schicksalhafter Bedeutung, wie er als Herero wohl wusste – aus der Lässigkeit auf, in die er nach dem heißen, rastlos durchrittenen Tag schnell verfallen war. Er sammelte sich und trat neben den Reiter an den Kopf des Pferdes, das sich nicht regte, nur die Ohren spielen ließ – auch an seinem Hals und an seinen Flanken trockneten bereits die breiten Flecken des Schweißes, der das Fell dunkel genässt hatte …:
»Weiter hinten im Gebirge gibt es zwei versteckte Felsenlöcher, wo sich gutes Wasser die ganze Trockenzeit über hält. Aber sehr viel ist das nicht – kaum genug, dass dort das Wild seinen Durst stillt, manchmal auch ein Leopard. In der Regenzeit führen die beiden Omurambas, die du da unten gut erkennen kannst, regelmäßig für einige Tage oder auch Wochen Wasser, wenn die Regen reichlich fallen. Das versiegt aber bald, wenn die Regen nachlassen. Hier und da mag es noch im Sand zu finden sein, wenn man tief genug hinuntergräbt. Aber für die Viehtränke reicht das nicht aus. Deshalb hat dir ja auch mein Vater dies Land hier zugebilligt.« …
Der Reiter überhörte den leichten Unterton von Spott, den zu verbergen sich der Schwarze gar keine Mühe gegeben hatte. Der hagere Mann im Sattel war nun schon seit fast fünf Jahren in diesem Sonnenlande unterwegs, war weit umhergekommen und hatte gelernt, dass man als Weißer den schwierigen, stolzen und oft genug arroganten Herero gegenüber nie seinen Gleichmut verlieren durfte, wenn man von ihnen als ein vollwertiger oder gar überlegener Gesprächs- oder Handelspartner anerkannt werden wollte. Deshalb ging er nur auf eine der Angaben seines Führers an diesem Oktobertage ein:
»Die Omurambas da unten, Amos, an den Schlängellinien aus dichter gestellten Baum- und Buschgalerien gut erkennbar, führen regelmäßig Wasser in der Regenzeit, sagst du? Regelmäßig? Kann man sich darauf verlassen?«
»Ich glaube schon, Herr. Mein Vater und unsere alten Leute, die kennen das Land.«
Der Reiter erwog in Gedanken, was er gehört hatte, wollte noch wissen:
»Und wo fließen sie hin, die beiden Omurambas, wenn sie fließen, Amos?«
Die Antwort kam ohne Verzug:
»Oh, sie fließen nirgendwohin, die du da siehst weiter unten, Herr. Wenn es einmal sehr stark regnet, dann mögen sie bis zum großen Omuramba Omatako vordringen. Aber das kommt nur ganz selten vor. Meistens vergehen sie alle in der Omaheke, der wasserlosen, in der niemand von uns leben kann oder will. Blicke nur nach Nordosten, Herr! Ganz, ganz hinten da, wo der Himmel und die Erde zusammenfließen, dort beginnt sie, die wasserlose Omaheke. Dort kann man nicht leben.«
»Soweit man von hier aus sehen kann, Amos, ist der Busch noch dicht, üppig beinahe; es gibt gutes Gras, und die vereinzelten Kameldornbäume spenden Schatten. Und die Berge hinter uns sorgen dafür, dass die Lüfte sich austauschen zwischen oben und unten – ein schönes Stück Land, Amos!«
»Ja, soweit das Wasser von den Bergen vordringt, ehe es versickert oder verdunstet, täuscht der gute Eindruck nicht. Mein Vater sagt, du hättest ihn gut bezahlt, und er wolle dir das Land geben von den zwei kleinen Wasserlöchern im Gebirge bis dahin, wo die Dürftigkeit der Omaheke anfängt, mit den Tälern der beiden Omurambas da unten und dem, was zwischen ihnen liegt. Das wäre ein deutlich umgrenztes Gebiet, man könnte ein paar Hundert Rinder darauf weiden und fett machen, wenn es nur Wasser gäbe. Aber die Weißen zaubern ja allerlei, vielleicht zaubern sie auch Wasser heran, wo es sonst nur in der Regenzeit für wenige Tage oder Wochen Wasser gibt.«
Wieder war ein versteckter Hohn in den Worten des Herero nicht zu überhören – und der Reiter hatte scharfe Ohren. Er ging nicht darauf ein, dachte auch nicht daran, sich gekränkt zu fühlen. Dazu war jetzt keine Zeit. War er nicht tagelang von Otjimbingwe nordwärts geritten, hinter sich den knarrenden Planwagen mit zwölf Joch Ochsen davor, der, in Tauschwaren verwandelt, sein ganzes Vermögen enthielt …? Dieses Land hier an der Nordost-Abdachung des Hügellandes, aus welchem der Waterberg aufragte, hatte ihm im Sinn gelegen, seit er es fünf Jahre und fünf Regenzeiten zuvor zum ersten Mal erlebt hatte, dies wunderbare Stück Erde im Hochlandbusch Südwestafrikas. Damals war er mit einer Patrouille unter Führung des Hauptmanns von François wochenlang unterwegs gewesen. Der ebenso kluge wie furchtlose von François sollte mit den Nord-Herero unter ihrem Häuptling Kambazembi Fühlung aufnehmen, sich im Lande umsehen und einen Eindruck von seiner Natur und seinem Wert zu gewinnen suchen.
Auf den Patrouillen-Ritten hatte Korthinrichs häufig Gelegenheit gehabt, die Herero zu beobachten. Sie weideten im Busch ihre großen Herden, die ihren Stolz und ihren Reichtum verkörperten, die ihnen Nahrung und Kleidung lieferten und den Mittelpunkt ihres Daseins bildeten. Doch es war ja in dem himmelweiten Land so viel Platz vorhanden, dass die Herden neben der Fülle des Wildes kaum ins Gewicht fielen. Korthinrichs erkannte mit dem Blick des niedersächsischen Bauernsohns, der er ja war – und geblieben wäre, hätte er auf dem alten Familienhof nicht dem älteren ungeliebten Bruder weichen müssen –, dass das Vieh der Herero wenig wertvoll war. Von überlegter Züchtung, von Auslese beim Aufbau einer einheitlichen Herde hatten die Schwarzen offenbar nicht viel Ahnung; ihnen kam es nur auf die Zahl der Tiere an, die sie ihr eigen nennen konnten.
Korthinrichs hatte sich gesagt, dass in einem Land mit so reichlichem und nahrhaftem Gras und Kraut, in dem so prachtvolles und kerngesundes Wild gedieh, überlegte Rinderzucht erfolgreich sein müsste. Und über den Absatz würde man sich wohl kaum Sorgen zu machen brauchen. In diesem Land der weiten Entfernungen würde der Ochsenwagen – mit den zehn bis zwanzig Zugochsen davor an langer Kette – noch für vorläufig nicht absehbare Zeit seine Bedeutung behalten, wenn auch schon davon geredet wurde, die Küste von der Mündung des Swakop her, wo deutsche Seeleute einen Ankerplatz ausfindig gemacht hatten, um mit ihren Anlandungen vom britischen Walvis-Bay weiter im Süden unabhängig zu werden, durch eine Eisenbahn mit der Mitte des Landes, mit dem erstaunlich schnell wachsenden Windhuk, zu verbinden.
Auch ließen sich in der Regenzeit, wenn die Wasserlöcher voll waren, Herden fetter Rinder entweder an die Küste oder in langen, langsamen Trecks südwärts nach Südafrika treiben, wo sie einen aufnahmewilligen Markt vorfanden. Es gab ja schon eine Anzahl von englischen und deutschen Händlern im Lande, die ihre aus Europa eingebrachten Waren – Kattun, billigen Schmuck, Waffen, Werkzeuge und natürlich Branntwein – gewöhnlich äußerst vorteilhaft gegen die Rinder der Eingeborenen eintauschten. Die Eingeborenen, die Herero, erst recht die Hottentotten oder Nama, diese aus der Kapkolonie im Süden gegen die Herero anbrandenden kampfeslustigen, viehräuberischen Stämme insbesondere, hatten auch bereits gelernt, was Geld bedeutete und was damit bei den Weißen anzufangen war; das sollte den Handel mit ihnen in Zukunft weiter erleichtern.
Solche und andere Überlegungen waren dem jungen Schutztruppen-Reiter auf den langen Patrouillen-Ritten durchs Herero-Land unablässig durch den Kopf gegangen; er hatte Augen und Sinn offen gehalten und hatte sich schließlich gesagt: Wenn erst einmal Frieden herrscht in diesem Land, die Herero und die Nama sich nicht mehr ewig in der Wolle liegen, einander das Vieh abtreiben, die Hirten erschlagen, die jämmerlichen Hütten und Dörfer verbrennen, dann muss man hier land-, besser viehwirtschaftliche Betriebe aufbauen können, die bei einigem Glück und natürlich viel Fleiß auch für eine europäische Familie eine sichere Existenzgrundlage darstellen sollten.
Der hagere, sehnige, nur wenig über mittelgroße Reiter vom Stamm der Niedersachsen hatte sachliche Überlegungen solcher Art in seinem klugen, wenn auch etwas langsamen Hirn Monat für Monat und schließlich für Jahre hin und her gewälzt und allmählich reifen lassen. Er war schließlich zu dem Beschluss gelangt: In diesem Land lässt sich leben, hier bleibe ich, hier kann ich mir aufbauen, was mir in der Heimat verwehrt worden ist: einen eigenen Besitz, Haus und Hof und bewegliche Habe, Vieh und Pferde, dazu Land, weites Land, so viel davon, wie ich an einem Tag umreiten kann, und wenn ich will, noch viel mehr. Und besser kann ich das Land und seine Launen gar nicht kennenlernen, als wenn ich nicht nur meine drei vertraglichen Jahre abdiene, sondern noch so lange bei der Truppe bleibe und mit ihr bis in fernste Winkel des Herero-Landes vordringe, oder hinauf ins Ambo-Land jenseits der wildreichen Niemandsgebiete um die Etoscha-Pfanne und hinunter in die so viel dürftiger sich bietenden Weiten des Nama-Landes, bis mir das große Südwest keine Geheimnisse – oder Überraschungen – mehr verbirgt. Irgendwann werde ich dann den Absprung wagen, werde mir Land zuweisen lassen, mich mit dem Häuptling in Güte einigen und mir meine eigene große Farm aus der Dornbusch-Wildnis schneiden – mit dem allerbesten Gewissen von der Welt, habe ich doch dann zur Befriedung dieser wunderbaren Steppen das Meinige beigetragen.
Der im Laufe der Zeit unter der afrikanischen Sonne wahrhaft lederzäh gegerbte Steppenreiter Wilhelm Korthinrichs glaubte zwar in all der Einfalt und Nüchternheit seines bäuerlichen Gemüts, dass es nur Erwägungen der Vernunft gewesen waren, die ihm den Entschluss nahegelegt hatten, im Land der Trockenflüsse wie dem Swakop oder dem Omatako, der Kameldornbäume und der fernen blauen, leeren Gebirge, in denen die Paviane ihr albern anmutendes Wesen trieben, in diesem ungemein weiträumigen Land mit der herbe duftenden Luft Fuß zu fassen. Tatsächlich aber war er, wie es so vielen anderen Kindern Europas auch erging, von dem starken Zauber der Gefilde Afrikas eingefangen, war eben auch verzaubert worden.
Verzaubert von den kalten Nächten auf dem Hochland des Innern, wenn im samtenen, tief veilchenblauen Himmel Abertausend Sterne ihre Funkeltänze aufführen in Bildern, die den Menschen der Nordhalbkugel der Erde fremd sind, und unter denen man doch das strahlende »Kreuz des Südens« bald zu erkennen lernt, Nächte, in denen der eisige Wind nur ganz sachte durch die dornigen Dickichte schweift, ohne ihnen mehr als ein allerfeinstes, beinahe unwirkliches Wispern zu entlocken. Im Schlafsack unter dem Sternenhimmel, warm und trocken aufgehoben, wenn auch nicht besonders weich gebettet – und die kühle, duftende Luft streift über die Stirn wie ein Elfenkuss –, wo und wie ließe sich ein Schlafgemach denken, großartiger, stiller und heimlicher als dieses!
Und im Frühling, also hier auf der Südhälfte der Erde im November oder Dezember, wenn die ersten Regen mit Donnergepolter über dem verdorrten Land heraufgezogen und herniedergestürzt sind, wie da das gestern noch graubraune staubige Land in wenigen Tagen zum himmlischen Wunder eines Blumenflors erwacht, so reich und herrlich und tausendfach, das man glaubt, den eigenen Augen und Sinnen nicht trauen zu dürfen. Die »Lilien auf dem Felde«, hier blühen sie dann, jede ein Wunderwerk an zarter Form und kunstvoller Zeichnung, zu Millionen dicht an dicht unter den jeden Tag vergnügter und üppiger in graugrünem Blattgefieder sich bauschenden Dornbüschen. Und die Sternblumen, die Narzissen und mannigfache Kräuter breiten sich aus zu dicht gewebten, leuchtenden Teppichen. Die Antilopen und Gazellen, die federleichten, hoch aufschnellenden Familien der Springböcke, die Rinder und Schafe senken die feuchte, schwarz glänzende Muffel ins taufrisch aufsprießende junge Gras; und bald wird dann ihr Fell wieder blank und dicht, das doch in den letzten Wochen und Monaten der trockenen, der kalten Zeit struppig geworden war und seinen Glanz verloren hatte.
Die Trockenflüsse, von den Buren ursprünglich und längst von jedem Mann mit weißer Hautfarbe »Riviere« genannt, die »Omuramba« der Herero, die viele Monate nichts weiter in ihren breiten Betten zwischen den Galerien der hohen Uferbäume aufwiesen als hellen Mahlsand, schier grundlosen, durch den die schweren Planwagen sich nur höchst widerwillig wühlten, was den Ochsen davor unter den langen Peitschen der Treiber große Qual bereitete, ja, dann »kamen die Riviere ab« – wie man in Südwest sagte – füllten sich mit jagender, gelbbrauner, schäumender Flut, entwurzelten ganze Bäume am Ufer und spülten sie davon, überschwemmten flaches Gelände weithin und gruben vielleicht dem Fluss ein neues Bett. In Zeiten starker Regen erreichten die ihrem Namen nun durchaus nicht mehr entsprechenden Trockenflüsse quer durch die Namib-Wüste sogar das Meer, in stärksten Regenzeiten manchmal für Wochen, ohne wieder zu versiegen. In der warmen, der Regenzeit mochte es auch im hohen Innern des Landes für ein paar Tage hintereinander schwül und drückend werden, doch nie für lange; ein neues Gewitter fegte unter hallendem Donner und mit ganzen Bündeln von Blitzen den Himmel wieder klar und rein und schenkte dem in Abertausend Tau- und Regentropfen blinkenden Land von Neuem die wunderbare Frische und Leichtigkeit der Luft, die manchen Menschen aus dem überdrängten Europa zum eigentlichen Wahrzeichen des Südwester-Landes wurde. – Wenn dann gegen Ende des Südsommers die Regen seltener wurden und schließlich versiegten (zur Zeit also, wenn sich in Europa der Sommer gerade erst ankündigte), schwand die Blumen- und Blütenpracht der Steppe dahin, als hätte es sie nie gegeben, und das Psalmwort wurde wahr, in dem es heißt: »Ihre Stätte kennet sie nicht mehr.«
Aber jener Wilhelm Korthinrichs vermochte sich niemals darüber klar zu werden, ob er nun der Regenzeit mit ihren Blumen und ihren in schlechten Jahren allzu seltenen Gewittergüssen den Vorzug geben sollte oder den ewig klaren, tiefblauen Himmeln der kühlen, der trockenen Monate von April bis Oktober.
Jeden Morgen hebt sich dann der Feuerball der Sonne aus einem stillen Meer von roter, schließlich goldener Glut in einen, wenn überhaupt, dann nur am Nachmittag, von blendend weißen Wolkenschiffen durchsegelten Himmel hinauf und vertreibt in ein, zwei Stunden die Kühle, ja Kälte der bald silbern vom wechselnden Mond erhellten – so hell, dass bei Vollmond ein Buch lesen kann, wer scharfe Augen hat – bald nur von zartem Sternenlicht durchrieselten Nächte. Hart und gewaltsam brennt am hohen Mittag über dem von heißem, trockenem Wind durchpulsten Land die Sonne, seine unumschränkte Herrscherin. Die Mopane-Büsche in den nördlichen Gegenden des Landes schwitzen dann ihren herben duftenden Saft aus, dessen fremdartiges Aroma von keiner europäischen Nase je zu vergessen ist. Das Wild hat sich im Schatten der hohen und oftmals hinderlichen Dornbüsche, die von den Buren »wacht een beetje« (wart’ ein bisschen) genannt werden, niedergetan oder auch unter einer Sykomore, einer Art von wildem Feigenbaum, der essbare, walnussgroße Früchte hervorbringt.
Und auch ein Reiter tut dann gut daran, abzusteigen, dem Pferd den Sattel zu lüften, ihm Zaum und Gebiss abzustreifen, damit es sich am trockenen, aber nahrhaften Gras und Kraut stärken kann. Ist gar am Rande eines Riviers ein Anabaum in der Nähe, König aller Bäume in Südwest (wenn man von den riesigen Baobab, den Affenbrotbäumen, im Norden des Landes absieht), dann braucht man den weidenden Pferden nicht einmal Fußfesseln anzulegen, damit sie sich nicht allzu weit verlaufen. Die gut fingerlangen Schoten des Anabaums bedecken dicht den Boden unter der mächtig ausladenden Krone um den gewaltigen Stamm, den zwei Männer kaum umspannen; sie schmecken süß, die Früchte des Anabaums, und werden vom Vieh und von Pferden hoch geschätzt; die Pferde lassen einen so angenehm für sie gedeckten Tisch nie im Stich, bis die Reiter, wenn die Sonne den hohen Mittag hinter sich gelassen hat, wieder aufsatteln. Die trockene, harte Hitze, die vor Kurzem noch wie aus einem Ofenloch hervorzuprallen schien, lässt dann nach, merkwürdig schnell, als hätte sich die Kraft des Sonnenballs in der Mittagszeit verbraucht. Der Reiter erlebt die Stunden, wenn das Gestirn des Tages sich unverkennbar tiefer in den Westen senkt, als eine zweite Frische und fühlt sich aufgefordert, noch längst nicht Rast zu machen, sondern weit in den Abend hineinzureiten. Ist die Sonne schließlich in einem glühend goldenen, dann purpurnen Feuersturm hinter den westlichen Horizont getaucht, dem Auge unerträglich bis zum allerletzten Blitz, so sickert Kühle aus dem allmählich zu zartem Rosa verglimmenden Himmel hernieder. Der Schweiß auf den Stirnen der Reiter und am Hals und den Flanken der Pferde ist getrocknet. Sollte es nötig sein, werden Mann und Ross bis spät in die Nacht hinein weiterziehen, um die Kühle, die auf der Höhe der trockenen Zeit zur Kälte werden kann, zu nutzen. Denn die Nächte sind ja niemals dunkel wie in unseren wolkenreichen Breiten, sondern ständig klar und durchwebt vom bleichen Licht des zu- und abnehmenden Mondes oder auch nur vom lautlosen Geflimmer, alle Farben des Regenbogens durchzitternd, der Abertausend fernen Welten des Alls.
Trockenes Holz ist überall zur Hand oder das dürre Gezweig eines abgestorbenen Kameldorns oder gar eines jener stolzesten Bäume des Damara-Landes, die von den Herero mit dem umständlichen Namen Omumborombonga ausgezeichnet worden sind, eichenähnliche Gewächse, die ihre dichten Kronen bis zu fünfzehn Metern Höhe aufrecken. In ihrem dicht verschlungenen Geäst, so meinen die Herero, wenn die Missionare sie noch nicht bekehrt haben, leben die Ahnen des Stammes fort. Aber die Omumborombongas sind nicht so häufig in der Damara-Hochsteppe zu finden wie etwa der allgegenwärtige Weißdorn oder der Hakjesdorn. Und wenn man Herero unter seinen Leuten hatte, so empfahl es sich, die schöne Würde der Bäume mit dem langen Namen nicht zu stören, indem man mit ihren trockenen Zweigen das abendliche Kochfeuer speiste.
Die flackernden Feuer des Nachts, die man gern bis zum Morgengrauen in Gang hielt, um die wilden Tiere abzuschrecken, sie schufen eine warme helle Kammer, eine bergende, freundliche Behausung in der weltenhohen Stille und Einsamkeit der Sternennacht. Der vergangene Tag wurde besprochen rings um die leise prasselnden Flammen, und was der nächste bringen würde. Die Forderungen, die den Reitern gestellt waren, rückten dann oft genug in die Hintergründe der Steppennacht; Geschichten tauchten auf, tanzten um die Feuer, ließen die ferne Heimat wieder auferstehen, vergangene Abenteuer und Träume von einer Zukunft, die für alle noch ungewiss war – denn ewig würde man nicht reiten. Man würde entweder, wenn die Dienstzeit, zu der man sich verpflichtet hatte, abgelaufen war, wieder in die Heimat nach Norden zurückkehren oder sich hier in diesem seltsam betörenden Sonnenland mit den lohenden Mittagen und den manchmal eisig kühlen Nächten festsetzen – aber wie und wo?
Wilhelm Korthinrichs war mit der Unschlüssigkeit, von der so viele seiner Kameraden beunruhigt wurden, schon in seinem zweiten Südwester Jahr fertig geworden. Gewiss, es wäre herrlich gewesen, wenn er auf dem alten, angestammten Hof in Lungbüttel hätte bleiben können. Aber da saß der ältere Bruder und brauchte nach Sitte und Herkommen nicht zu weichen, hatte auch, was sich Wilhelm nie recht erklären konnte, die Eltern auf seiner Seite. Stets der Zweite im Kommando zu bleiben, dazu eignete sich der jüngere Bruder nicht – und alle waren ganz einverstanden damit gewesen, dass er sich freiwillig ins ferne Südwestafrika gemeldet hatte, ein Gebiet auf dem Erdenrund, von dem man sich in dem grünen Land am Elm eine nur ganz blasse und ungewisse Vorstellung machen konnte. Wilhelm würde dort weit vom Schuss sein und nicht mehr länger mit seiner querköpfigen Aufsässigkeit den Frieden und gleichmäßigen Ablauf der Arbeit auf dem großen Lungbütteler Hof infrage stellen. Hier hab’ ich Platz, hier wird mir keiner dazwischenreden, hier wärmt mich die Sonne im duftenden Busch, hier kühlt mich die Nacht und schenkt tiefen, erholsamen Schlaf – und Gott sorgt dafür, dass in der heißen Zeit rechtzeitig die Regen fallen und das weite Land wieder grünt und blüht in großer Pracht – hier bleibe ich!
Und hier – und das ist wohl die Hauptsache – wird mir niemand mehr verbieten wollen oder auch nur können, dass ich mir meine Friedel ins Land hole und sie – mehr noch mich selber vor mir selber! – ehrlich mache und mich ihr auch äußerlich und ehelich verbinde, wie ich ihr innerlich längst und für alle Zeit verbunden bin. Sie wird nicht zögern, wenn ich komme und ihr sage: Komm, Friedel, es ist so weit; wir werden uns halb zu Tode schuften müssen in Südwest, aber auf unserem Hof im Dornbusch auf dem Anstieg zum Waterberg mit dem weiten, weiten Blick in die Ferne bis ins Unabsehbare der Omaheke wirst nur du, Friedel, und ich etwas zu sagen haben – und unser Marthchen wird endlich erleben und begreifen, dass sie nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater hat – und dann soll sie nicht mehr nur den Mutternamen Kröning tragen, sondern ein Korthinrichs-Kind sein und fortan auch so heißen, Martha Korthinrichs, Tochter des Wilhelm Korthinrichs aus Lungbüttel bei Königslutter und seiner Frau Friederike, geborene Kröning, gebürtig aus Preußisch-Wartenburg in Westpreußen.
Wilhelm wusste, dass seine Friedel auf ihn gewartet hatte die fünf langen Jahre hindurch, die er in Südwest unter von François und dann unter Leutwein verritten hatte. Ja, er hatte den drei Jahren, zu denen er sich anfangs gebunden hatte, noch zwei weitere hinzugefügt. Er war ein bedachtsamer und geduldiger Mann und wollte sich mit allen Kanten und Konturen der erst langsam Form annehmenden deutschen Kolonie Südwestafrika vertraut machen, ehe er sich für einen bestimmten Platz entschied, ehe er genau begriffen hatte, welche Risiken er übernahm, wenn er sich und Frau und Kind diesem ungezähmten Land mit seinem wankelmütigen Klima, den wilden Tieren und den schwer berechenbaren Eingeborenen, ohne die als seine Arbeiter, Hirten und Helfer er aber nicht auskommen würde, anvertrauen wollte. Je weiter nach Norden er sich umsah auf den Hochflächen des Südwester Innern, wo die Herero mit ihren Rinderherden von Wasserstelle zu Wasserstelle wanderten, desto reichlicher bewachsen zeigte sich das Land, desto zuverlässiger war in der heißen Zeit mit den Regen zu rechnen. Dort hatte Wilhelm auf einem der am weitesten nach Norden ausgreifenden Erkundungsritte von Windhuk her – er war schon Unteroffizier und hatte die Patrouille angeführt –, in den Bezirken der Nord-Herero, denen der angesehene Häuptling Kambazembi vorstand, die Stelle gefunden, die ihm in jeder Hinsicht dem zu entsprechen schien, was er sich erdacht und errechnet – ganz im Geheimen auch erträumt – hatte. Denn wenn dieser Wilhelm Korthinrichs auch wesentlich ein sachlich nüchtern handelnder Mann war, so war er doch in seinem innersten Kern – was bislang nur seine Friederike, die »Friedel«, begriffen hatte – ein sehnsüchtiger Träumer, der sich mit dem Alltag und der Nützlichkeit allein nicht abfinden mochte und sich stets, allerdings nur im Verborgenen, vom Ungewöhnlichen und Fremdartigen gern verlocken ließ. Aber ganz deutlich wusste das nur die Friedel, nicht einmal er selber.
Friederike Kröning hatte als eines von vielen Geschwistern auf dem kleinen Hof der Eltern bei Preußisch-Wartenburg, nachdem sie dem Kindesalter entwachsen war, keinen Platz mehr gehabt. Über einen Vermittler in Schneidemühl hatte sie sich als Magd auf ein großes Bauerngut nach Lungbüttel am Elm im braunschweigischen Land verdingt, denn zu Haus hatte es keine Arbeit mehr für sie gegeben. Bei einer Tanzerei zur Feier von Kaisers Geburtstag hatte sie den jüngeren Sohn vom großen Nachbarhof der Korthinrichs kennengelernt, und beide hatten sich auf den ersten Blick zueinander hingezogen gefühlt. Beide erkannten auch bald eine gewisse Verwandtschaft ihrer Schicksale. Das Mädchen hatte den allzu zahlreichen Geschwistern im Westpreußischen Raum geben müssen, und der junge Mann konnte und wollte nicht des älteren Bruders Knecht werden auf dem väterlichen Hof. Die beiden waren ineinandergestürzt wie zwei streunende Himmelskörper, denen vorbestimmt ist, sich auf ihrer Bahn zu treffen.
Natürlich blieb ihr heimliches Verhältnis im Dorfe nicht verborgen, wo wie in allen Dörfern die menschlichen Beziehungen, freundliche wie feindselige, auf die Dauer ans Tageslicht kommen. Der alte Korthinrichs, grimmig unterstützt vom Hoferben, Wilhelms älterem Bruder, hatte geschäumt vor Zorn, als ihm hinterbracht wurde, dass Wilhelm sich an eine arme Magd aus dem Osten des Reiches gehängt hatte. Das Ansehen der Familie hätte gefordert, dass Wilhelm anderswo in der Gegend in einen ansehnlichen Hof, auf dem nur eine Tochter als Erbe vorhanden war, einheiratete. Es gab mehr als eine Gelegenheit dieser Art in den Nachbardörfern, und der alte Korthinrichs hatte sogar bei den Tochtervätern vorgefühlt und war auf große Gegenliebe gestoßen, hatte doch der alte Name Korthinrichs in der Gegend einen vorzüglichen Klang; dazu war Wilhelm ein schmucker und tüchtiger junger Kerl, dem auch die Mädchen von den ältesten und reichsten Höfen gern und verlangend hinterherblickten. Der Vater hatte zwar nach Vätersitte in diesen altsächsischen Bezirken den Hof dem Ältesten zu übertragen. Aber das bedeutete nicht, dass der zweite Sohn nach Möglichkeit nicht ebenso großzügig auszustatten war. Und als schon alles im besten Zuge war, »verplemperte« sich der allerdings von jeher eigenwillige Wilhelm mit einer Magd vom Nachbarhof, die nicht einmal aus der Gegend stammte, sondern – Gott weiß woher – aus dem Osten hereingeschneit war und dazu bettelarm.
Aber mit Wilhelm war nicht zu reden gewesen; er beharrte standhaft auf der einmal getroffenen Wahl. Die Liebenden verschworen sich, nicht voneinander zu lassen, was immer auch kommen möge, wie lange sie auch aufeinander warten müssten. Und als der alte Korthinrichs bei dem Nachbarn durchsetzte, dass die Magd Friederike Kröning entlassen und des Dorfes verwiesen wurde, entfremdete er sich den jüngeren Sohn endgültig; seinen Anteil am Erbe allerdings würde weder er noch der Hoferbe dem Nachgeborenen verweigern können.
Wilhelm war, nachdem seiner Friederike der Verbleib im Dorf auf »hinterrücksche« Weise unmöglich gemacht worden war, erst recht mit Vater und Mutter und Bruder zerfallen. Aber noch war er nicht »großjährig« und hatte den Weisungen des Vaters, der genauso starrköpfig war wie der Sohn, zu gehorchen; es gab nur einen Ausweg: sich freiwillig zu den Soldaten zu melden, zu »kapitulieren«, wie man sagte, das heißt, die Absicht zu bekunden, das Soldatsein zum Beruf zu machen. Wilhelm meldete sich also – gegen den Willen des Vaters, der aber in dieser Hinsicht nicht durchzusetzen war – zu einem Kavallerie-Regiment in Hannover, war er doch von Jugend an mit Pferden wohl vertraut, verstand sich auf sie und mit ihnen – wie er manchmal betrübt meinte – besser als mit Menschen.
Bei der Auswahl des Reiterregiments war für den jungen Soldaten Korthinrichs von ausschlaggebender Bedeutung gewesen, dass seine Friederike bei einem Offizier ebenjenes Regiments als »Mädchen für alles« eine verhältnismäßig nicht schlecht bezahlte Anstellung gefunden hatte, nachdem sie Lungbüttel hatte verlassen müssen. Ein glücklicher Zufall hatte es gefügt, dass Friederike Kröning im Kontor der Stellenvermittlerin für häusliches Personal einer Frau von Crohna-Perditen aufgefallen war, die nach einer Reihe von Enttäuschungen mit Hausmädchen aus dem hannoverschen Gebiet darauf aus war, eine verlässliche und intelligente Person aus ihrer Heimat und der ihres Mannes zu finden, die also »dieselbe Sprache sprach« wie die Freifrau von Crohna-Perditen. Die Crohna-P.s waren eine in Ostpreußen alteingesessene begüterte »Junker«-Familie und fühlten sich in dem reichlich steifleinenen und auch versteckt arroganten Hannover nicht sehr wohl. Die Freifrau hatte wenigstens in ihrem eigenen Haus (in dem es bei den beschränkten Mitteln hinter der vom Range des Hausherrn bestimmten vornehmen Fassade sehr bescheiden und sparsam zuging) einen Menschen zur Hilfe haben wollen, der in der freundlichen und geräumigen Welt der altpreußischen Lande aufgewachsen war, wo jedermann den Platz kannte, der ihm gebührte, aber darin auch anerkannt war.
Friederike und ihre neue Dienstherrschaft verstanden sich bald recht gut und lernten einander in den verschiedenen Rollen, die sie zu spielen hatten, mit ehrlicher Sympathie schätzen. So war es denn Friederike, die ihrem treuen Wilhelm das Regiment empfehlen konnte, in welchem ihr Dienstherr, der Freiherr Udo von Crohna-Perditen, als Rittmeister diente. Das Mädchen wurde schon nach wenigen Monaten zu einem sowohl von den drei Kindern wie von den Eltern gern anerkannten Glied der Familie – in zweiter Ordnung natürlich, aber in dieser wohlgelitten und auch respektiert, wie es sich gehörte.
Wilhelm und Friederike sahen sich nicht häufig. Beider Dienst forderte sie, wenn man genau hinsah, an die sechzehn Stunden am Tag – und beide verrichteten ihn gern, da er ihnen und ihren Wünschen entsprach. Immerhin hatten sich beide in neuen, unvertrauten Umwelten zurechtzufinden und empfanden menschliche Nähe und Wärme und das Gefühl von gleich zu gleich nur, wenn ihnen die seltenen Stunden des Alleinseins geschenkt waren. Es kam also, was beinahe naturgesetzlich kommen musste: Irgendwann, als die Umstände sich willig oder gar verführerisch zeigten, vergaßen sie sich doch und stürzten ineinander, da die Sehnsucht, die Liebe, die Einsamkeit sonst nicht mehr auszuhalten gewesen wären. Die Liebenden »sahen sich vor«, so gut sie konnten. Aber die Leidenschaft ging allzu oft mit ihnen durch. Allzu lang waren die Zwischenzeiten, in denen sie sich nicht sahen, sondern nur voneinander träumen konnten.
Die Freifrau hatte den Verehrer ihrer guten und ihr bald unentbehrlich gewordenen »Rike« mit der Zeit kennengelernt und fand, dass ihre fleißige und geschickte Helferin im Haushalt und in der Kinderstube sich kaum einen besseren »Bräutigam« hätte aussuchen können als den ehrlichen, sauberen Reiter Wilhelm Korthinrichs aus dem Regiment ihres Mannes. Es erschütterte die Freifrau geradezu, dass an einem Sonntagabend in der Küche ihres Hauses nicht Rike es war, sondern der angehende junge Berufssoldat, der mit dem Geständnis herauskam, dass sein Mädchen ein Kind bekäme. All die guten Instinkte der feudalen »Junker«-Welt im östlichen Preußen – es gab auch viele, die weniger erfreulich waren – gaben nun der Freifrau auf, den Abhängigen zu helfen, wenn sie sich allein nicht mehr helfen konnten. Wilhelm hatte »kapituliert« und war ans Militär mit seinen starren Vorschriften gebunden, durfte frühestens heiraten, wenn er als »Aktiver« zum Unteroffizier oder Feldwebel aufgerückt war – und damit hatte es noch gute Weile.
Aber die Freifrau – unter Beistand des Freiherrn – fand Rat für das junge Paar, das nun erst recht entschlossen war, sich fürs ganze Leben aneinander zu binden – und sich doch nicht binden durfte. Friederike rief ihre nächstjüngere Schwester aus Preußisch-Wartenburg in Westpreußen, die auf dem kleinen elterlichen Hof nun ebenso entbehrlich geworden war wie wenige Jahre zuvor Friederike, nach Hannover in den Dienst der freiherrlichen Familie an Rikes Stelle. Friederike selbst aber wurde rechtzeitig, ehe noch ihr Zustand sichtbar war, auf das große Rittergut der freifraulichen Eltern bei Preußisch-Holland in Ostpreußen verfrachtet, um dort im Haus des Leutevogts ihr Kind zur Welt zu bringen und sich danach unter die Dienstleute des Gutes einzureihen, wobei vorgesehen war, dass sie bald in den häuslichen Dienst der Besitzer-Familie übernommen werden sollte. In ihrer heimatlichen östlichen Welt würde Friederikes Ruf kaum gekränkt sein; dort nahm man allzu Menschliches menschlich und vertraute darauf, dass sich die Verhältnisse schon »irgendwann und irgendwie rangieren« würden, da ja der noch nicht ganz fertige Vater sich ehrlich und standhaft zu dem Kind bekannte, das er seinem Mädchen »gemacht« hatte.
Die Liebenden wurden also weit voneinander getrennt – bis auf die wenigen Urlaubstage, die dem jungen Reitersmann zustanden. Aber die beiden waren so geartet, dass Widerstände oder Missgeschicke sie eher stärker und hartnäckiger machten, als dass sie davon geschwächt wurden. Es war ihnen beiden gewiss, dass sie früher oder später auch vor der Welt ein Paar sein würden – vor Gott waren sie es längst. Sie brauchten nur zu warten und die Augen offen zu halten, ob und wo sich vielleicht eine Gelegenheit bot, ihrem Schicksal eine günstigere Seite abzugewinnen.
Wilhelm meinte, ein solches Sprungbrett gefunden zu haben, als der Rittmeister von Crohna-Perditen eines Tages den Gefreiten Korthinrichs in der Kaserne zu sich befahl und ihn unter vier Augen darauf aufmerksam machte, dass er sich zu einer neu aufgestellten kleinen »Schutztruppe« melden könnte – unter besonders günstigen Bedingungen bei Verpflichtung auf zunächst nur drei Jahre und mit der Aussicht, in der da unten südwärts vom Äquator neu entstehenden Kolonie vielleicht Besitz zu erwerben und unter heißerer Sonne am Aufbau eines afrikanischen Deutschland mitzuwirken. Der Freiherr und die Freifrau hatten nämlich inzwischen mit Friederikes Schwester allerbeste Erfahrungen gemacht, waren aus allem Dienstboten-Ärger heraus und zeigten sich der jungen Frau und dem Mann, die ihnen zu diesem angenehmen Zustand verholfen hatten, dankbar.
Wilhelm schrieb ausführlich an seine »Friedel« – wie er sie gern, wenn auch einigermaßen unpreußisch, zu nennen liebte, nachdem ihm eine höchst seltene poetische Anwandlung diesen Namen eingegeben hatte, schon ganz am Anfang, als sie sich, noch in Lungbüttel, zögernd zueinander tasteten. Ein einziges Mal konnte er noch im gleichen Sommer den großen Plan mit ihr in stundenlangen Gesprächen erörtern, als sich die beiden in Preußisch-Holland bei Wilhelms letztem Urlaub trafen. Sie fassten den Entschluss gemeinsam, sahen sie doch in Deutschland, wie die Verhältnisse lagen, keine besonders großartige Zukunft vor sich, während das ferne afrikanische Land mit Möglichkeiten lockte, die über das im alten Land zu erwartende Maß weit, wenn auch noch sehr unbestimmt, hinauszugehen schienen. Südwest hatte den jungen Reiter Korthinrichs nicht enttäuscht, wenn ihn auch die lebensfeindlichen Gefilde der Namib-Wüste längs der Küste und die dürren, kahlen Steppen im Nama-Land, das heißt, im Süden der Kolonie, zunächst bestürzt, ja erschreckt hatten. Er war dabei gewesen, als von François mit seiner damals schon 250 Mann umfassenden Truppe im April 1893 die Feste Hoornkrans erstürmte, in die sich der Hottentotten-Führer Hendrik Witbooi mit dem Rest seiner Streitmacht, etwa 500 Mann, zurückgezogen hatte, nachdem er gegen Maherero unterlegen war. Und unter Leutwein hatte er zu der Streitmacht gehört, die den immer noch aufsässigen Hottentotten-Führer in der Naukluft eingeriegelt und zur Übergabe gezwungen hatte. Damals hatte Hendrik Witbooi die deutsche Schutzherrschaft für sich und seinen heruntergekommenen und verarmten Stamm »unbedingt« angenommen und sich sogar bereit erklärt, den Deutschen als Bundesgenosse militärischen Beistand zu leisten, wenn dies von ihm verlangt wurde. Das war am 15. September 1894 geschehen, und in der Tat, wie sich herausstellen sollte, hat dann Hendrik Witbooi mit den anderen Nama-Stämmen den Frieden zehn Jahre lang eingehalten.
Der von der starken afrikanischen Sonne, den ewig zwischen den dichten Büschen des Landes lauernden Gefahren und Ungewissheiten, den endlosen Ritten durch wegelose Weiten zu lederner Zähigkeit und ständiger Wachheit aller Sinne erzogene Reiter Korthinrichs hatte sich nicht so sehr von dem kargen Nama-Land im Süden als vielmehr von dem viel dichter und schattiger begrünten Damara-Land weiter in der Mitte und gegen Norden von Südwest angezogen gefühlt. Je weiter nach Norden im Land, desto üppiger und enger schlossen sich die dornigen Büsche aneinander, beinahe schon lichte Wälder bildend – wie noch weiter nordwärts gegen den viele Dutzende von Kilometern breiten Streifen des Niemandslandes hin, der die Weidegebiete der Hereros von den Ackerbau und Viehzucht treibenden, in großen befestigten Dörfern wohnenden Ambo–Stämmen trennte.
*
Während der ganzen langen fünf Jahre, die Wilhelm Korthinrichs unter der heißen Sonne und den kalten Sternen des Südwester Hochlandes verritt, war ihm nur ein einziger Urlaub in Deutschland gestattet gewesen und dies, als die ersten drei Jahre seiner ursprünglichen Verpflichtung abgelaufen waren und Wilhelm sich für zunächst zwei weitere gebunden hatte.
Der Entschluss, sich, seiner Frau – für ihn war sie es längst! – und seinem Kind, dem kleinen Marthchen, im Land der duftenden Dornbüsche eine neue Heimat zu schaffen, in der man weder seine Friedel noch die Tochter je über die Achsel ansehen würde (denn dergleichen würde ihnen im alten Land wohl nicht erspart geblieben sein), diese Entscheidung war langsam in ihm gereift. Er neigte nicht zu vorschnellen Urteilen. Er wollte sich auch vergewissern, ob der Mensch, den er sich zur Gefährtin seines Daseins ausgewählt hatte, den Mut aufbrachte, ihm aus zwar bescheidenen, aber vertrauten Umständen in ein ganz und gar unbekanntes Gefilde zu folgen, wo große, aber höchst unverbürgte Hoffnungen auf Gewinn und Aufstieg in den grenzenlos zur Omaheke und der ungeheuren Kalahari verschwimmenden Steppen warten mochten – Hoffnungen, nichts weiter als Hoffnungen!
Er war zuerst nach Preußisch-Holland gefahren, ohne sich eine Viertelstunde länger als nötig in Bremen, wohin ihn der Woermann-Dampfer getragen hatte, oder in Berlin aufzuhalten. Friederike hatte ihn auf dem kleinen Bahnhof erwartet; ihre Gutsherrschaft, die das tüchtige Mädchen, seinen klugen Verstand und seine angeborene Heiterkeit schätzen gelernt und sie zur Unterstützung der Wirtschafterin für den Dienst im Gutshaus und seiner mächtigen Küche herangezogen hatte, war nicht kleinlich gewesen und hatte der »Rike« freigestellt, die Tage mit ihrem jungen Mann aus Afrika ohne Rücksicht auf die Pflichten ihrer Stellung im Haushalt zu nutzen. Ja, man hatte sogar aufseiten der Herrschaft Interesse bekundet, Rikes so treuen Verehrer und Bräutigam kennenzulernen.
Friederike hatte es fast den Atem verschlagen, als sie in dem Mann in bräunlicher Uniform mit breitem Filzhut, dessen rechte Krempe hochgeschlagen und durch eine schwarz-weiß-rote Kokarde gehalten wurde, ihren Wilhelm erkannte. Mit einem Satz war er aus dem Waggon gesprungen und, ohne rechts oder links zu blicken, schnurstracks auf sie zugeschritten. Wie viel härter, magerer, männlicher war sein Gesicht umrissen als vor seiner Ausreise in den fernen Erdteil, wie viel schöner, fester, blühender und fraulicher trat sie ihm nun entgegen, seine Friedel, die Mutter seiner Tochter! Und Unteroffizier war er auch bereits geworden, wie die silbernen Tressen am Rande seines Rockkragens und am Ärmel bezeugten. Die junge Frau wusste im gleichen Augenblick, dass sie diesem Manne folgen würde bis ans Ende der Welt. Er nahm sie einfach in die Arme, da auf dem Bahnsteig coram publico – wer wollte es ihm verwehren! – und presste sie an sich, dass ihr die Luft ausging, flüsterte ihr ins Ohr: »Friedel, meine Friedel!« …