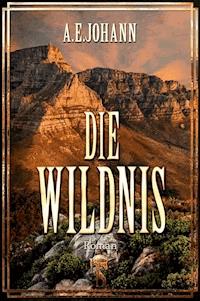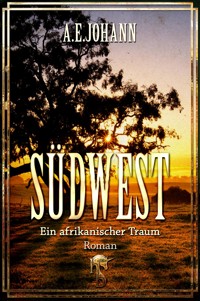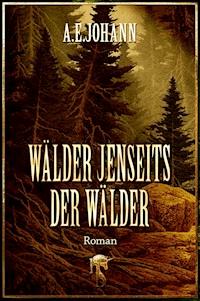4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1749: Die Not in der Heimat, aber auch die Lust auf das große Abenteuer treiben den Bauernsohn Walther Corssen und seine junge Frau Anke dazu, der Heimat den Rücken zu kehren – das Ziel: die unerschlossenen Weiten Kanadas. Dort wollen sie sich ein neues Leben aufbauen und träumen von Freiheit und Unabhängigkeit. In Kanada angekommen, werden die beiden Auswanderer angesichts der harten Wirklichkeit schnell ihrer Hoffnungen beraubt: Frankreich und England kämpfen um die Kolonie Neuschottland, und auch zwischen den Ureinwohnern und den Einwanderern kommt es zu Auseinandersetzungen. Doch für Walther und Anke kommt Aufgeben nicht infrage, die beiden sind fest entschlossen, um ihren großen Traum zu kämpfen. »Ans dunkle Ufer« ist der Auftakt der großen Kanada-Trilogie aus der Feder von A. E. Johann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
A. E. Johann
Ans dunkle Ufer
Roman
Erstes Buch: Abschied
1
Um ein Haar hätte ich ihn totgeschlagen, dachte er.
Er stolperte über eine der Kiefernwurzeln, die quer zum Pfad durch den sandigen Boden zogen. Er hatte das Hindernis kaum wahrgenommen, fing sich wieder und hastete weiter.
Es wäre fürchterlich gewesen, wenn ich ihm etwas angetan hätte! Mein Bruder bleibt Hartwig doch, wenn ich auch nichts mit ihm gemein habe, gar nichts gemein haben will. Das brauchte nicht zu sein. Aber es ist nun einmal so. Es ist nie anders gewesen.
Der elende Zank ist noch glimpflich abgelaufen, es hätte viel schlimmer kommen können. Es ist gut, dass der Vater all dies nicht mehr erlebt hat. Mein Gott, es hätte ihn entsetzlich gekränkt. Er hätte es nicht ertragen. Aber er ist tot. Wenn der Vater dagewesen wäre – er hätte sicherlich einen Ausgleich zwischen mir und Hartwig zustande gebracht. Er hätte auch schließlich zu Anke ja gesagt, ich weiß es. Auch Mutter stammt ja nicht aus unserer Gegend, sondern von weither.
Jetzt ist alles vorbei. Ich gehe fort. Ich komme nie mehr zurück – und wenn ich wieder irgendwo Sold nehmen muss! Dies ist das letzte Mal, dass ich diesen Weg gehe. Das letzte Mal!
Ihm wurde plötzlich bewusst, was er da gedacht hatte. Es war wie ein Stoß vor die Brust.
Er hielt an und setzte das schwere Bündel mit seinen Habseligkeiten von der Schulter auf die Erde. Die Schulter schmerzte, und der Arm, der das Bündel gestützt hatte, war lahm. – Ich werde das anders tragen müssen. So schaffe ich es nicht nach Celle, habe noch gut fünf Stunden Wegs bis dahin.
Konnte das wirklich wahr sein? Sah er dies alles zum letzten Mal?
Der schmale Fahrweg trat hier aus dem dichten Wald hervor. Es duftete nach Harz, jungen Blättern und frischen Kräutern. In den Kronen der Birken und Kiefern sang ein leichter Wind. Auch die Eichen hatten schon ihr Blätterkleid angelegt; sie lassen sich am längsten Zeit damit. Erst wenn der Mai strahlend ins Land kommt, zögern auch sie nicht mehr und zaubern sich goldgrüne Flitter über ihr Astwerk.
Vor den Augen des Mannes breiteten sich weithin wie ein kostbarer Teppich die wilden Moorwiesen der Marloher Heide. Kleine Gehölze hier und da, ein paar Büsche – und über allem der unermessliche Glanz des jungen Tages. Kein Zeichen menschlichen Lebens, so weit das Auge reichte. In der Ferne einige schwärzliche Tupfen: Dort ist Torf gestochen worden und zum Trocknen geschichtet.
Noch funkelt der Tau von abertausend Gräsern. Bald wird die Sonne ihn getrunken haben. Der Himmel blaut ins Unendliche, und die Luft geht süß und herb über das einsame Land – ist wie Wein.
Der Mann, der da regungslos steht, hat nicht allzu oft in den sechsundzwanzig Jahren seines Lebens Wein gekostet – und der hat ihm nicht einmal besonders gut geschmeckt, denn es war ein schlechter Wein. Aber jetzt sagt er sich: Die Luft ist wie Wein, so wie Wein schmecken kann und schmecken sollte.
Dies ist mein Land: Wald und Moor, Heide und Weide, Wiese und Feld. Hier bin ich zu Hause. Es gibt nichts Besseres. Die Rehe dort hinten, die nicht einmal den Kopf nach mir aufwerfen, der Bussard, der in der Höhe segelt. Und der Brachvogel ruft, als läutete wer im Bruch eine süße Glocke – dies alles ist mein Land und rechtens so!
Es ist verloren, als hätte es mir nie gehört. Heute, hier, in diesem Augenblick muss ich es aufgeben, gebe ich es auf.
Um den unerträglichen Jammer zu überwinden – als begänne sein Auszug aus der Heimat erst jetzt – fing er an, sein Bündel, einen Kornsack, der seine Habe enthielt, aufzuschnüren und den Inhalt umzupacken, damit sich die Last besser tragen ließ – auf beiden Schultern und nicht nur auf einer. Sein Sonntagsrock, aus grauschwarzem, grobem Wollstoff, kam zum Vorschein. Die großen silbernen Knöpfe, von denen jeder einen halben Taler wert war, hatte er von seines Vaters Kirchenrock geerbt. Eine silberne Litze zog sich um den Rand des breiten Rockkragens, die schweren Stulpen und die Taschenklappen – ein prächtiges, unverwüstliches Stück. Damit wollte er sich noch viele Jahre wohl herausstaffieren, vielleicht solange er lebte; man musste es nur ein wenig pflegen und vor den Motten schützen. Und dann die gute lederne Hose dazu; sie stammte aus seiner Soldatenzeit und war mit ihm bei Fontenay am 11. Mai 1745 in französische Gefangenschaft geraten. Er hatte sie sehr geschont und sich mit altem Drillichzeug beholfen, wo immer es ging. Schließlich hatte er sie nach Hause, in das heimatliche Dövenbostel an der Wilpe, mitgebracht; sie war nicht mehr neu, aber sie würde ihm noch lange dienen.
Die Gamaschen, die er dazu trug, wenn er sich feiertags fein machte, verrieten ebenfalls ihre Herkunft von der englischen Infanterie, zu der er sich von den kurfürstlich-hannoverschen Werbern hatte anwerben lassen, als die im Sommer 1742 ins Dorf gefahren kamen mit Trommelklang und dem Gequiek der Querpfeifen. Der Vater war damals erst seit wenigen Wochen unter der Erde, und der Hof erbe, der um zehn Jahre ältere Bruder Hartwig, ein Hüne an Gestalt und Kraft, hatte ihn geschlagen, um ihn ›Mores zu lehren‹ und ihm zu zeigen, wer Herr auf dem Corss-Hof wäre. Die Werber hatten Walther Corssen angenommen, obgleich er eigentlich noch zu jung war. Sie nahmen es nicht sehr genau mit dem Alter, und Walther war kräftig und geschickt; man konnte ihn nicht einen ›Bauernflegel‹ nennen wie die meisten anderen Rekruten. Denn er hatte beim Lehrer und Kantor Wiedenholt lesen und schreiben und sogar das kleine und das große Einmaleins, dazu viele Bibelsprüche, den lutherischen Katechismus und zahllose Kirchenlieder mit unglaublich vielen Versen gelernt. Ja, dieser junge Walther Corssen hatte gewiss kein Stroh im Kopf. Die Werber hatten ihn liebend gern für die Royal Fusiliers, die Infanterie Georgs II., des Königs von England und Kurfürsten von Hannover, angenommen und ihm sein Handgeld ausgezahlt – und der böse Bruder Hartwig hatte das Nachsehen gehabt und seinen besten Knecht eingebüßt. Gegen die kurfürstlich-hannoverschen, königlich-englischen Werber kam er nicht an. Die Mutter allerdings hatte geweint. Aber Mütter weinen immer, wenn die Söhne sich selbständig machen, ohne je damit den Lauf der Welt zu ändern.
Dann holte er aus dem Sack Arbeitskleider aus grobem Zwillich einige Paar warme Wollsocken, schweres Unterzeug für den Winter, einen wollenen Schal, zwei Unterwesten und einiges andere, ein Paar grobe Halbschuhe mit Schnallen für den Sonntag, ein Rasiermesser, einen Pinsel und einen großen Riegel Seife, wie sie seit alters auf dem Corss-Hof aus Hammelfett und Holzasche herausgekocht wurde.
Fein säuberlich reihte Walther Corssen den vielfältigen Inhalt seines Reisesacks im frischen Kraut auf – eins neben dem anderen – auch Proviant war nicht vergessen worden: Speck, eine Mettwurst und ein Laib Brot.
Aus der untersten Ecke des Sackes aber förderte schließlich der Mann ein kleines, schweres Beutelchen aus Hirschleder zutage, das mit einer festen Lederschnur verschlossen war. Walther Corssen hob das Säckchen an sein Ohr und schüttelte es ein wenig. Ein leises, metallisches Scheppern wurde vernehmbar. Ein grimmiges Lächeln überzog sein Gesicht:
Mein Erbteil! Ich habe es endlich! Er hat es herausrücken müssen. Von Vater und Mutter mir zugedacht, da ja Hartwig als der Ältere den Hof geerbt hat mit allem, was dazugehört. Zweiundfünfzig Dukaten aus gutem Gold; sie waren sein!
Mutters Mitgift war ungeschmälert in dieser Summe enthalten. Vater hatte nie etwas davon fortgenommen, sondern immer nur hinzugetan, jedes Jahr ein paar Dukaten, je nachdem, was die Hämmel, der Torf, der Buchweizen, die Gerste und der Hafer eingebracht hatten. Aber Walther Corssen hatte nie recht glauben wollen, dass das Geld, das er ererbt und endlich auch bekommen hatte, Dukaten zu Dukaten im Schweiß des Angesichts mühsam zusammengespart worden war.
Den Grundstock hatte der Vater aus dem Türkenkrieg mitgebracht. Auch er war ein zweiter Sohn auf dem Corss-Hof gewesen und war aus Ärger über den Hoferben den österreichischen Fahnen zugelaufen, als die Kunde bis in die Heide drang, dass der Kaiser in Wien Soldaten gegen den türkischen Erbfeind warb.
Irgendwie und -wo war der Vater dann im tiefen Süden über seinen Sold hinaus zu Dukaten gekommen, hatte den Mund gehalten, den Soldatenrock, sobald es ging, wieder ausgezogen und war 1716 in die Lüneburger Heide, in das weltentlegene Dorf Dövenbostel zurückgekehrt. Er hatte nie verraten, wie er seinen kleinen Reichtum erworben hatte.
Der Vater war sicherlich nicht nach Dövenbostel heimgekehrt, um dort zu bleiben, er hatte nur wissen wollen, was die Heimat ihm noch zu sagen hatte nach den Jahren der Abwesenheit. Sie hatte ihm viel zu sagen! Der Bruder des Vaters, der den Hof als der Älteste geerbt hatte, war von seinem Hengst erschlagen worden. Das Pferd hatte in einem Anfall von Jähzorn seinem allzu ungeduldigen Herrn die Hinterhufe in den Unterleib geschmettert. Der Bauer war nach wenigen Tagen voller grässlicher Schmerzen den schweren inneren Verletzungen erlegen. Der aus dem Türkenkrieg heimkehrende Soldat kam gerade noch zurecht, dem sterbenden Bruder ein Vaterunser hinterherzubeten und ihn dann auf dem kleinen Friedhof unter den gewaltigen Eichen zu begraben, wo die zwei Dutzend Dövenbosteler Höfe von jeher ihre Toten begruben – kein Mensch vermochte anzugeben, seit wie vielen Jahrhunderten schon. Denn wahrscheinlich war diese Begräbnisstätte noch viel älter als die wehrhafte, massige Kirche mit den meterdicken Mauern aus Feldsteinen und dem viereckigen, klobigen Turm. Jahrhunderte hindurch war sie katholisch gewesen, in der Reformation jedoch war sie unbeugsam lutherisch geworden und seither diesem Glauben treu geblieben.
Der heimgekehrte Soldat war ganz gegen alle Erwartung zum Hoferben aufgerückt, denn der Verunglückte war zwar schon seit längerer Zeit verlobt, aber noch nicht verheiratet gewesen. Hoferbe – plötzlich hatte das Leben Sinn bekommen, den einzigen wahren Sinn, den es für die Menschen der kargen Heideerde gab.
Der neue Bauer bestellte sein Eigen für eine Weile, so gut es eben ging, und machte sich dann wieder auf die Wanderschaft nach Süden. Er hatte auf dem Rückweg aus dem Südosten Europas einige Wochen bei einem Bauern im Salzburgischen gearbeitet, um sich ein paar Taler für die Weiterreise zu verdienen – und auch, weil ihn schon nach dem dritten Tage die zweite Tochter des Bauern, Judith, auf eine noch nie erlebte Weise in Unruhe versetzt hatte. Seinen verschwiegenen Schatz an Dukaten anzugreifen, daran hatte dieser Sohn der niedersächsischen Erde nie gedacht. Er machte sich keine Illusionen. Dazu fehlte ihm jedes Talent. Ja, er besaß eine Handvoll Dukaten. Aber das war so, als besäße er einen Edelstein. In seinen Verhältnissen konnte man nicht viel damit anfangen. Land musste man haben. Bauer sein. Nichts anderes galt. Und Land hatte er nicht, war nicht viel mehr als ein entlassener Soldat. Was hätte er Judiths Vater anbieten können, um ihm die Tochter abzudringen? Nichts! Denn wenn auch Judiths Familie protestantisch war wie er selbst, so war doch Judiths Vater auch Bauer und vergab seine Tochter nicht an einen fremden, landlosen Mann, mochte der auch sonst noch so gut zu leiden sein.
Jetzt war alles verändert. Der Mann aus dem Norden kam nicht mehr als ein armseliger Landfahrer von irgendwoher und irgendwohin, sondern als ein Bauer mit großem Besitz, der sich zwar nicht an Schönheit, gewiss aber an Gediegenheit mit dem der Familie Steinwanger vergleichen ließ.
So war also die dunkeläugige Judith Steinwanger Bäuerin auf dem Corss-Hof in der Heide geworden, war aber im kargen Nordland nie wieder ganz glücklich gewesen, wenn auch ihr Mann, der Corss-Bauer, sie sein Leben lang wie ein unverdientes Geschenk des Himmels auf Händen getragen und ihr das arbeitsharte Dasein so erträglich wie möglich gestaltet hatte. Einen Sohn hatte sie dem Hof geboren, sie nannten ihn Hartwig. Dann bekam sie Zwillinge, Mädchen, die beide nur wenige Wochen lebten. Erst zehn Jahre nach dem ersten Sohn war die Hoffnung der Eheleute Corssen auf ein weiteres Kind erfüllt worden: Walther hatte das Licht der Welt erblickt – und schon sehr früh wurde deutlich, dass er ganz und gar in die mütterliche Familie zu schlagen schien. Kräftig und sehnig wuchs er heran, war aber kleiner von Wuchs und zierlicher als der ältere Bruder, der sich, nach Dövenbosteler Weise ungeschlacht und riesig, zu einem zähen, listigen und rechthaberischen Heidebauern entwickelte. Seltsamerweise gehörte die Liebe der Mutter dem Erstgeborenen, so als wollte die in eine härtere und dürftigere Welt verschlagene Frau ihm den Mangel an mütterlichem Blut durch ein Mehr an Liebe ersetzen.
Der Vater dagegen hatte in seinem nachgeborenen Sohn Walther das Wesen der geliebten Frau erspürt und schloss das Kind von klein auf in sein Herz. Das Wertvollste, was er besaß, den angestammten Corss-Hof, hätte er sicherlich gern dem Lieblingssohn vermacht. Aber gegen die uralt-starre Regel, dass des erstgeborenen Sohnes Anrecht auf den Hof nicht bestritten werden darf, konnte und wollte er sich nicht auflehnen.
Doch hatte er sich etwas Besonderes ausgedacht, seinen Jüngsten zu entschädigen: Jener Schatz an Golddukaten, die er aus dem Türkenkrieg mitgebracht hatte, der sollte ungeschmälert seinem Walther erhalten bleiben – und die Mitgift seiner Frau, welcher der Sohn so ähnlich war, sollte dazugetan werden; er hatte beides nicht anzugreifen brauchen, denn der Hof war, als er ihn übernahm, gut im Schuss gewesen. Außerdem steckte er jeden Dukaten, der über den Bedarf des Corss’schen Anwesens hinaus verdient wurde, ebenfalls in das Säckchen aus Hirschleder. Das hatte auch seiner Frau eingeleuchtet, sosehr sie auch sonst darauf achtete, dass der weniger liebenswürdige und liebenswerte Hartwig nicht geschmälert wurde.
Die Existenz des Säckchens war in der Familie kein Geheimnis, wenn man auch selbstverständlich allen Außenstehenden, selbst dem altgedienten Großknecht und der Großmagd gegenüber nie auch nur ein Sterbenswörtchen davon verlauten ließ. Der Hof, das war Hartwigs Teil, das schwere kleine Säckchen, das fast von Jahr zu Jahr ein wenig schwerer wurde, das war unbezweifelbar für Walther bestimmt.
Der Vater war allzu früh gestorben. Walther hatte damals erst siebzehn Jahre gezählt – und zunächst war die Welt für ihn untergegangen. Er konnte sie sich ohne den Vater kaum vorstellen. Er merkte auch bald, dass keine Dukaten mehr in das Säckchen gesteckt werden würden; die Mutter hatte den Schatz in Verwahrung genommen. Der geheime, bis dahin stets verdeckt gehaltene Zwist, der in ihren Naturen angelegte Gegensatz zwischen den Brüdern, flammte zum ersten Mal offen auf. Hartwig saß gut im Sattel und würde ein gewissenhafter, ja geiziger Haushalter werden; der Hof sollte dabei florieren. Was aber wurde aus Walther?
Als Walther die Mutter deshalb drängte, verwies sie ihn schließlich an den älteren Bruder, der sei jetzt der Bauer. Walther hatte den Bruder zu stellen versucht, und es war ihm nach einigen vergeblichen Versuchen auch gelungen. Hartwig war viel zu steif und ungelenk, auch im Grunde geistig zu träge, um dem manchmal hitzköpfigen und voreiligen jüngeren Bruder das, was er dachte oder vorhatte, auf sanfte und schonende Weise beizubringen.
Auf dem Scheunenflur polterte er eines Abends heraus – Walther hatte ihn wieder einmal dringlich befragt: »Was mit dir wird, Walther? Was ist da lange drüber zu reden! Du wirst der Großknecht, wenn du weit genug bist und Martin nicht mehr kann. Deinen Platz auf dem Hof wird dir keiner streitig machen. Dein Erbteil geht in den Hof. Wir kaufen Bohns Hof dazu, denn der läuft aus, wenn der alte Bohn stirbt. Der Sohn ist Pfarrer bei Minden und will den Hof nicht haben. Wir bewirtschaften beide Höfe zusammen. Du wirst auf beiden der Großknecht. Aber du kannst nicht heiraten. Damit der Besitz beisammen bleibt. So ist das immer gehalten worden, und so soll es bleiben. Was willst du also? Es ist alles schon vorbestimmt. Es braucht nichts geändert zu werden.«
Der jüngere Bruder hatte dagestanden wie vom Donner gerührt. Dann war es aus ihm herausgebrochen, zornig und maßlos: »Ich? Knecht bei dir? Niemals! Ich gehe fort!«
Hartwig hatte nur mit den Achseln gezuckt: »Du wirst es dir noch überlegen. Sprich nur erst mit der Mutter!«
Aber auch die Mutter hatte ihm nicht helfen können. Auch sie hielt das alte, wenn auch ungeschriebene Gesetz für heilig, dass der Älteste ›der Bauer‹ werden, dass der Besitz ›zusammengehalten‹, möglichst vergrößert werden müsste. Die nachgeborenen Söhne, wenn sie ihre ureigentliche Pflicht erfüllen wollten, hatten dem Hof als Knechte zu dienen. Sie durften keine Nachkommen zeugen, die vielleicht einmal Ansprüche auf den Hof erheben und ihn damit zersplittern würden.
Walther Corssen war also wie sein Vater der Trommel der Soldatenwerber gefolgt. Dass die Mutter ihm sein Säcklein mit den Dukaten, sein Erbteil, sicher verwahren würde, daran zweifelte er nicht. Anders aber als sein Vater brauchte Walther nicht fremden Fahnen zuzulaufen. Die Kurfürsten von Hannover waren auf den verschlungenen Wegen dynastischer Erbfolge Könige von England geworden und suchten Soldaten, sowohl für ihre hannoverschen wie für ihre englischen Regimenter. Mehr aus Zufall als mit Absicht war Walther in Gifhorn auf die englischen Werber gestoßen und merkte zu spät, dass er nicht in ein hannoversches, sondern in ein englisches Regiment Georgs II. geraten war. Es bedeutete nicht viel. Er war nicht der Einzige, dem es so ergangen war, und es stellte sich auch schnell heraus, dass sich das Plattdeutsch, das Walther zu sprechen gewohnt war, von dem einfachen Soldaten-Englisch nicht allzu sehr unterschied. Da er einen hellen Kopf hatte und der Drill und Dienst wenig Gnade kannten, blieb ihm gar nichts anderes übrig, als die neue Sprache zu lernen.
In der Schlacht bei Dettingen zwischen Aschaffenburg und Hanau erhielt der junge Soldat aus der Lüneburger Heide seine Feuertaufe. Da es schlecht stand um den Ausgang der Schlacht gegen die an Zahl überlegenen Franzosen unter dem Herzog von Noailles, hatte sich König Georg II. mit gezogenem Degen zu Fuß selbst an die Spitze der hannoverschen Garde gesetzt und hatte gerufen: »Jetzt, Burschen, lasst uns für Englands Ehre fechten!«, und hatte sich mit den Seinen in die Schlacht geworfen. Walther hatte den später berühmt gewordenen Ausruf nicht gehört. Aber auch der Herzog von Cumberland, Wilhelm August, der Sohn Georgs II., hatte die englische Garde und die englisch-hannoversche Infanterie mit kaltem Blut vorangebracht, darunter auch den zunächst ängstlichen, dann grimmig entschlossenen Walther Corssen: Die Schlacht war unter schweren Verlusten auf beiden Seiten von den englisch-hannoverschen und österreichischen Truppen gewonnen worden; die Franzosen, die sich in wilder Flucht befanden, warf man über den Main.
Aus dem hübschen, geschickten und gescheiten Knaben Walther Corssen hatte die Einsicht, wie bitter blutig mit Menschen Schindluder getrieben werden kann, einen Mann werden lassen. Obwohl der Stock der Drillmeister ihm schon in den Monaten der Rekrutenausbildung ins junge Fell gebläut hatte, dass Soldatsein alles andere als Zuckerlecken war und dass am Ende ein schmutziger und qualvoller Tod auf dem Schlachtfeld stehen konnte – das Erleben selbst war doch noch anders: Die neun Stunden währende Schlacht, das schonungslose Gemetzel, das Gebrüll der Offiziere und Feldwebel, das Schreien, Stöhnen und Jammern der Verwundeten und Sterbenden, der Donner der Kanonen, das Krachen der Musketen und dieser entsetzliche Zwang, entweder in andere Menschenleiber zu stechen – oder selbst abgestochen zu werden. Und es gab kein Zurück.
Allerdings musste er die fünf Jahre, zu denen er sich verpflichtet hatte, nicht ganz abdienen. Das englisch-hannoverisch-österreichische Heer, anstatt den Sieg über die Franzosen auszunutzen, hatte in den österreichischen Niederlanden, also etwa dem heutigen Belgien, Winterquartiere bezogen. Die Franzosen erklärten nun auch England in aller Form den Krieg. Louis XV. ließ ein Heer von hunderttausend Mann in die österreichischen Niederlande vordringen. Der französische Marschall Moritz Graf von Sachsen stellte die Verbündeten zur Schlacht und errang dank seiner starken Überlegenheit am 11. Mai 1745 bei Fontenay einen vollständigen Sieg. Tausende von Engländern, Hannoveranern, Österreichern und Holländern – und gewiss auch viele Franzosen blieben als Leichen auf dem Schlachtfeld zurück. Allein über zweitausend Hannoveraner fielen verwundet in französische Gefangenschaft.
Unter ihnen gab es auch einen Walther Corssen, dem ein Bajonettstich die linke Schulter durchstoßen hatte und ein Granatsplitter in den linken Oberschenkel geprallt war. Er war zusammengebrochen und liegengeblieben. Die gegen die französischen Garden und Schweizer Regimenter mit wütender Bravour anrennende hannoversche und englische Infanterie unter dem Herzog von Cumberland war weiter vorgedrungen. Walther Corssen war wieder zu sich gekommen und hatte sich an den Rand des Schlachtfeldes in den Schutz eines mit einer Hecke bestandenen Erdwalls geschleppt. Hier übermannte ihn abermals der Blutverlust; er wurde bewusstlos. Er konnte von großem Glück sagen, dass er am Tage darauf gefunden wurde, als der Sieger die nicht allzu schwer verwundeten Gegner einsammelte. Was hoffnungslos schien, blieb liegen, starb einen elenden Tod und wurde schließlich von den Bauern, die ja wieder ihre Felder bestellen mussten, verscharrt, nachdem sie sich für die Schäden, die ihnen zugefügt worden waren, an den Resten der Montur und des Lederzeugs schadlos gehalten hatten. Die leichter Verwundeten aber ließen sich vielleicht zurechtflicken und dann in das französische Heer einreihen.
Des jungen Corssen Schulterwunde heilte schnell. Aber das faustgroße Loch im linken Oberschenkel wollte sich nicht schließen. Die Wunde eiterte hartnäckig; wildes Fleisch musste mehrfach weggeschnitten werden. Der französische Feldscher verlor schließlich die Geduld und jagte den englischen Infanteristen, der als solcher kaum mehr zu erkennen war, davon: »Scher dich, Kerl! Bist nicht zu gebrauchen. Wirst ewig humpeln. Weg mit dir!«
Der abgemagerte Bursche ließ sich das nicht zweimal sagen und machte sich noch am gleichen Tage davon. Er wollte nichts weiter als nach Hause, nach Hause.
So humpelte er aus der Gegend von Roubaix, wo man ihn entlassen hatte, ostwärts davon, ein abgezehrtes, gelbgesichtiges Wrack, dem man seine jungen Jahre nicht mehr ansah. Er bettelte und stahl sich irgendwie durch, vermied die großen Städte, schlich sich an Wesel, wo ihn ein mitleidiger Fischer über den Rhein setzte, an Münster, an Minden vorbei. Er war längst klug genug geworden, um sein Humpeln, seinen Stock, auf den er sich bei jedem Schritt stützte, sein abgerissenes und abgezehrtes Aussehen als einen Schutzmantel zu benutzen. Er erregte keinen Verdacht, wenn er sich abseits über die vielen Grenzen schlich, die er zu überqueren hatte. Er war ganz offenbar außerstande, irgendwem ein Leid anzutun. Bauern, die selbst erfahren hatten, was Krieg und Elend bedeutet, halfen ihm weiter. Nur aufhalten, das sollte er sich nicht bei ihnen, höchstens einmal über einen Sonntag; ihr Misstrauen blieb immer wach. Aber der Heimkehrer war weit davon entfernt, verweilen zu wollen.
Merkwürdigerweise begann die Beinwunde unterwegs von selber zu heilen. Vielleicht tat es dem verletzten Bein wohl, sich trotz aller Schmerzen ständig bewegen zu müssen. Seine zähe Natur trug schließlich den Sieg über die schwere Verletzung davon. Die Wunde eiterte zwar immer noch, begann aber von den Rändern her langsam zu vernarben. Doch behielt Walther Corssen das schwere Humpeln bei, mit dem er aus Flandern abgezogen war. Es bewahrte ihn vor Werbern, vor Konstablern und Gendarmen – und auch vor Räubern. Wer wollte einem hinkenden, als unbrauchbar davongejagten Soldaten mit schwärender Wunde den Weg in den einzigen Hafen verwehren, der sich ihm noch bot: nach Hause.
Bis dann kurz vor dem Ziel das Schicksal abermals zuschlug, wenn auch auf eine ganz andere Art.
Der Mann auf dem Wege nach der Stadt Celle, der eigentlich seinen Reisesack hatte umpacken wollen und dabei schließlich auf das Beutelchen mit Goldstücken gestoßen war, hatte vergessen, was er verrichten wollte. Er hatte auch den Tag vergessen, der um ihn leuchtete mit allem Glanz der grünen Einsamkeit, der ihn an Heimweh schon leiden ließ, bevor er die Heimat überhaupt verlassen hatte, so als wollte er ihn warnen, Unersetzliches aufzugeben. Walther Corssen hatte auch das Beutelchen vergessen. Er hatte sich lang ins frische Gras und Kraut gestreckt im Schatten eines Postbusches – ach, er brauchte nicht zu hetzen, er würde Celle allemal am Nachmittag erreichen. Was bedeutete eine Stunde mehr oder weniger! Bisher war es nur darauf angekommen, sich mit Anstand und unter Wahrung des Seinigen vom heimatlichen Hof zu lösen. Das war geschafft. Was nun weiter? Wohin?
Noch nie, so wollte es ihm scheinen, war er so verlassen gewesen. Bisher hatte er jederzeit und immer noch auf den väterlichen Hof zurückkehren können. Ein Obdach wenigstens wäre ihm dort nie verweigert worden. Jetzt hatte er die Herausgabe seines Erbteils erzwungen und damit das Band gelöst, das den Hof mit ihm und ihn mit dem Hof verknüpft hatte.
Wieder Soldat werden? Das kann ich jeden Tag! Dummköpfe, die Soldat werden wollten, die waren überall gesucht, bekamen ein stolzes Handgeld, wenn sie unterschrieben hatten, und saßen dann in der bösen Falle, aus der es für Jahre kein Entrinnen gab – es sei denn, zu entlaufen und mit großer Sicherheit wieder eingefangen und durch die Spießruten gejagt zu werden, eine schreckliche und manchmal tödliche Marter. Nein, Soldat zu werden und sich von den Drillmeistern schinden zu lassen – so dumm darf man nur einmal sein! Aber was sonst?
Hinter den festgeschlossenen, zitternden Lidern des Mannes, der im Grase liegt wie gefällt, tanzen die Bilder.
War das überhaupt noch er selbst gewesen, der in namenloser Wut dem Bruder gegenübergestanden und zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorgeknurrt hatte wie eine bedrängte Raubkatze kurz vor dem tödlichen Ansprung: »Du willst sie mich nicht heiraten lassen, Hartwig, damit dein Sohn den Hof bekommt! Dabei hast du noch gar keinen Sohn, bist noch nicht einmal verheiratet! Neidest mir die Frau. Dich will ja keine haben, grob und mürrisch wie du bist. Aber wirst dir schon irgendeine reiche einhandeln früher oder später. Und mein Erbteil, Vaters und Mutters Dukaten, willst du mir vorenthalten, damit der Hof, dein Hof, größer wird. Und was bietest du mir dafür? Arbeit tagein, tagaus, jahrein, jahraus – und wenn ich keinen Forkenstiel mehr halten kann: ein schäbiges Gnadenbrot noch hinter deinen Kindern am Tisch und eine kalte Kammer im Gesindehaus. Nein, nichts da, Hartwig, und wenn es zehnmal hier in der Gegend so üblich ist, wie du und Mutter sagen! Lieber verzichte ich auf mein Heimatrecht. Gib mir mein Erbe heraus – und du wirst mich niemals wiedersehen!«
Sie hatten sich neben dem riesigen Eichentisch in der Deele gegeneinandergestellt. Ein kümmerliches Talglicht hatte den braundunklen hohen Raum nur spärlich erhellt. Hartwig stand dem um eine Handbreit kleineren Bruder mit halbgesenktem Kopf gegenüber, ein gereizter Stier, ein Gebirge von einem Mann, gewohnt, dass alle sich vor ihm fürchteten. Er hatte nur einmal den Kopf geschüttelt und gemurrt: »Das Geld bleibt, und du bleibst. Ich bin der Bauer. Ich allein habe zu sagen!«
»Das werden wir sehen!«, hatte Walther gezischt und den anderen im gleichen Augenblick wie ein Tiger angesprungen. Er hatte ihm den Unterarm unters Kinn geschmettert und das Knie in den Unterleib gerannt, ein sehr gefährlicher Angriff, den er von den Schotten in seinem Regiment gelernt hatte. Hartwig, ohnehin langsam und schwer, hatte der urplötzlichen Attacke nichts entgegenzusetzen gehabt, war zu Boden gestürzt wie ein Mehlsack. Sein Hinterkopf schlug auf die harte Tenne der Deele. Die Sinne schwanden ihm.
Als er wieder zu sich kam, mit dröhnendem Schädel und stechenden Schmerzen in den Eingeweiden, hatte der Bruder hoch über ihm gestanden, das Messer gezückt. Die Füße des Gefällten waren mit einem Strick an das Tischbein gefesselt. Als Hartwig begriff, dass er nur um den schmalen Rücken dieser Messerklinge vom Tode entfernt war, packte den ungefügen Mann zu aller Übelkeit ein tiefes Entsetzen. Er war kein Soldat gewesen, ihm hatte der Tod noch nie um die Ohren gepfiffen, hatte noch nie haarscharf an seinem Leben vorbeigestoßen. Zum ersten Mal in seinem engen Dasein blinzelte ihn das Ende an, eine kurze Spiegelung des Lichts der Kerzenflamme in der Messerklinge – und in den weitaufgerissenen Augen des über ihn gebeugten Bruders, den er, wie alles andere, den Hof, die Tiere, die Mägde und Knechte, wie auch die betagte Mutter, unter seinen Willen hatte zwingen wollen.
Er spürte: Diesmal habe ich den Kürzeren gezogen. Er stößt zu, wenn ich mich wehre – so wie ich zustoßen würde! Er hörte den Bruder fragen, mit einer Stimme, wie er sie noch nie von ihm gehört hatte: »Zum letzten Mal, Hartwig: Wo ist der Beutel mit meinem Erbteil? Her damit! Und ich gehe fort, heute Nacht – und wir sind quitt! Oder du bist des Todes, das schwöre ich dir!«
Der Sieger hatte noch gar nicht verstanden, dass er gewonnen hatte, so schnell gab Hartwig Bescheid: »Über dem zweiten Balken, rechts vom Herd, ist ein Ziegel lose. Dahinter ist der Beutel. Geh du nur! Kannst alle deine Sachen mitnehmen. Aber komm nie wieder!«
Walther hatte das Beutelchen schnell gefunden. Es war prall und erstaunlich schwer. In fliegender Hast hatte er seine Kleider und was ihm sonst noch wichtig erschien in einen Hafersack gestopft, hatte nach einer Sekunde des Zögerns auch noch Gesangbuch und Katechismus dazugetan; sie hatten ihn auch in seinen Soldatenjahren begleitet. Er hatte nicht mehr nachgesehen, ob der Bruder sich von seiner Fußfessel befreite. Er hatte das große Haus mit dem hohen rietgedeckten Giebel und den gekreuzten Pferdeköpfen durch den Stall verlassen, war noch einmal um das Haus herumgetappt und hatte auf der anderen Seite an das niedrige Fenster geklopft, hinter dem die Mutter schlief: »Ich bin es, Mutter: Walther! Kannst du ans Fenster kommen?«
Kurze Zeit danach schlug das Fenster nach außen auf. »Was ist, Walther, um Gottes willen? Warum klopfst du mich aus dem Schlaf, mitten in der Nacht?«
»Die Sterne werden schon blass, Mutter. Ich habe mich mit Hartwig auseinandergesetzt, Mutter. Ich gehe fort, Mutter, für immer.«
»Ich wusste, dass es so kommen würde!«, jammerte die alte Frau leise; schattenhaft erschien ihr Antlitz unter der großen Nachthaube im dunklen Fensterviereck. Dann: »Hast du dein Erbteil mitbekommen, Walther?«
»Ja, er hat es mir geben müssen!«
»Das ist gut. Das erleichtert mein Gewissen. Vater hat immer gewollt, dass du allein darüber bestimmen und entscheiden sollst.«
»Ja, das hat er wohl, Mutter. Aber das ist nun alles vorbei und hinter mir. Leb wohl, Mutter!« Er sagte es härter als nötig. Die alte Frau empfand, wie sie zurückgewiesen wurde. Sie flüsterte kaum hörbar: »Leb wohl, mein Jüngster! Jeden Tag werde ich für dich beten!«
Walther deckte für einen Augenblick seine Hand auf die verarbeiteten alten Hände, die auf der Fensterbank gefaltet lagen, schulterte mit einem Schwung seinen Reisesack und stapfte durch den eben erst zu ahnenden Morgen davon.
Walther richtete sich verwirrt auf. Eine Weile hatten dichte Kräuter sein Gesicht beschattet. Aber dann hatte die volle Sonne seine Augen getroffen und ihn geweckt. Ihm war wohlig und warm zumute. Die Stunde tiefen Schlafs hatte ihn erfrischt und ihn die durchwachte Nacht vergessen lassen.
Er blickte sich um und musste den Kopf schütteln über sich selbst. Der Schlaf hatte ihn so leise und plötzlich angefallen wie die Katze die Maus. Alles lag noch da, wie er es aus seinem Beutel ausgepackt hatte: sein Sonntagszeug, die Wäsche, die Schuhe, das Gesangbuch und – ja, wo waren seine Dukaten? Ein heißer Schreck durchfuhr ihn. Aber alles war da! Das Säckchen aus Hirschleder hatte dicht an seinem Körper gelegen. Er atmete auf und sprach laut aus, was ihm im Schlaf, im Unbewussten, zum Entschluss geworden war: »Ich nehme sie mit! Ich nehme meine Anke mit!«
Während er sorgfältig seine Habseligkeiten wieder in den harten Leinensack zurückpackte, das Hirschlederbeutelchen ganz nach unten in den rechten Zipfel, Gesangbuch und Katechismus obenauf, überlegte er die Entwicklung seiner Beziehung zu Anke Hörblacher, ohne die er sich eine sinnvolle Zukunft nicht vorzustellen vermochte. Auch diese Einsicht hatte sich ihm erst in der stillen Stunde geschenkt, die er am Wegrand im duftenden Gras und Kraut verschlafen hatte. Ganz klar sah er es nun, was sein Bruder mit ihm vorgehabt hatte: Knecht auf dem väterlichen Hof hatte er sein sollen – der Hof ging vor; ihm hatte jeder zu dienen, der darauf geboren wurde. Auch sein Geld hätte nur den Hof begünstigt – was wäre sonst mit ihm anzufangen gewesen? Der Hof sog alles wieder an sich, er war das Beständige: der Corss-Hof – beständig wie die Corssens auch. Nur ihre Vornamen wechselten, wiederholten sich aber gewöhnlich nach jeder zweiten oder dritten Generation mit Hartwig und Walther, Heinrich, Karl und Dietrich.
Aber auf Anke verzichten, das ging nicht. Dann lieber auf Heimat und Heimatrecht. Sie hatte ihm damals das Leben neu geschenkt. Ohne sie gäbe es Walther Corssen gar nicht mehr!
Was war damals geschehen, spät im November 1746?
Im Dorfe Mandelsloh mit seiner uralten, dem heiligen Osdacus geweihten Kirche, hatten die Leute dem Soldaten, der nach Hause wollte, gesagt, es wären noch sieben bis acht Stunden Weges nach Celle, wenn man den Weg durch den Wietzenbruch nähme, über Lindwedel und Wieckenberg. Sie selber benutzten um diese Jahreszeit lieber den gut zwei Stunden längeren Umweg über Schwarmstedt. Denn von da ab bliebe die Straße nach Celle einigermaßen auf dem Trockenen und Festen, wäre auch reichlicher begangen und befahren. Aber der Wietzenbruch sei jetzt im November, nachdem es so viel geregnet hatte, nicht zu empfehlen. Es sei ja auch schon kalt, es habe schon zweimal nassen Schnee gegeben – und mit dem Weg sei auch nicht viel los, schmal und mit vielen Sumpflöchern und nur an den allerschlimmsten Stellen ein wenig aufgeschüttet. Die Leute aus der Gegend befuhren ihn nur, wenn es lange trocken gewesen war; dann kam man mit Pferd und Wagen ganz gut durch. Zu Fuß oder im Sattel gäbe es natürlich immer ein Fortkommen, wenn man sich in den Tücken der Moorwege auskannte. Aber dazu musste man sehen können. Der Wietzenbruch aber sei weit und breit berüchtigt wegen des dichten Nebels, und manchmal weiche der den ganzen Tag nicht von seinen Torfstichen und weiten, weglosen Mooren, seinen dunkelbraunen Wassertümpeln und den raschelnden Schilfwiesen. Wenn er nun also den Weg über Schwarmstedt nehmen wolle –, so rieten es ihm die guten Leute von Mandelsloh – dann käme er vielleicht nicht mehr vor Dunkelheit nach Celle; aber das brauche ihn nicht besorgt zu machen, denn in Wietze oder Hambühren finde er sicherlich ohne große Mühe ein Unterkommen für die Nacht. Er sei ja nun nicht mehr in fremder Herren Land, sondern in heimatlichen Gefilden – und es habe sich längst herumgesprochen, wie hart und grausam die Franzosen nach der unglücklichen Schlacht bei Fontenay die englischen und hannoverschen Gefangenen und Verwundeten geschunden hätten.
Ja, es waren gute Leute gewesen, damals in Mandelsloh, die ihm erlaubt hatten, seine Beine unter ihren Tisch zu strecken. Sie hatten ihn zu ihrer Hafergrütze und Milch, ihrem Brot und Speck eingeladen und dann in der Scheune warm und trocken im Stroh schlafen lassen.
Aber Walther Corssen hatte ihren Rat nicht befolgen mögen. Es war auf dem weiten Weg von Roubaix bis hierher, trotz vieler Aufenthalte und Umwege, die ihm Misstrauen und Vorsicht aufgenötigt hatten, alles merkwürdig glatt und gefahrlos verlaufen. Die Wunde am Bein machte ihm kaum noch Beschwer; sie würde über kurz oder lang zu einer faustgroßen Narbengrube verheilen – wie auch die Schulterwunde schon verheilt war; sie schmerzte ihn nur noch, wenn er nass und kalt wurde.
Nein, Walther Corssen konnte die Sehnsucht, das lang entbehrte Dach mit den zwei gekreuzten Pferdeköpfen zwischen den hohen Eichen um den Corss-Hof auftauchen zu sehen, nicht mehr bezähmen. Wenn er es an einem Tag nach Celle schaffte – in Celle war eine Schwester seines Vaters an einen der Schlossgärtner verheiratet –, dann brauchte er nur noch einen weiteren Tag bis nach Hause zu rechnen, einen langen Tag zwar, aber in einer Gegend, in welcher ihm jeder Weg und Steg vertraut sein würde.
Anstatt sich also nordwärts zu wenden, war er gleich ostwärts über die hochgehende Leine auf Vesbeck und dann auf Hope zu marschiert und hatte sich dort noch einmal nach dem Weg über Wieckenberg nach Celle erkundigt. Wieder hatten die Leute gemeint: »Das machst du besser über Schwarmstedt oder Marklendorf. Durch den Bruch – das ist um diese Jahreszeit nicht geheuer!«
Auch ihnen hatte er gesagt, dass er noch am gleichen Tag Celle erreichen müsse. Sie hatten erwidert: »Wenn du immer die Nase gegen Sonnenaufgang steckst, dann kannst du nicht fehlgehen. Es gibt nur diesen einen Weg, und er bringt dich nach Wietze oder nach Wieckenberg. Das ist beides gleich gut, wenn du nach Celle willst. Und sieh zu, dass dich nicht die Nacht erwischt oder der Nebel, bevor du den Bruch hinter dir hast! Wir haben gerade Neumond, und, Junge, dann ist es finster, dass du die Hand vor Augen nicht siehst!«
Am Vormittag machte sich Walther Corssen von dem Dörfchen Hope aus ostwärts auf den Weg. Es ging ein bitterkalter Wind aus Nordwest. Der Himmel hing grau in grau über der trostlos öden Heide mit ihren armseligen kleinen Föhrenwäldern, den braunen sandigen Heideflächen mit dem harten Kraut und den Wacholdern, die verloren und ratlos umherstanden wie frierende, eng in schwarze Tücher gewickelte trauernde Weiber.
Dem einsamen Wanderer war dies ein heimatlich anmutendes Bild. Er fürchtete sich nicht in dieser grenzenlosen Einsamkeit. Die Wagenspuren des unbefestigten Weges zogen unverkennbar deutlich vor ihm her. Was hatten ihm die Leute in Hope gesagt?
»Halte dich nur an die am tiefsten ausgefahrene Spur und immer ostwärts, dann kannst du nicht fehlgehen!«
Das war leicht zu befolgen. – War es das wirklich?
Solange der Weg durch die trockene, sandige Heide kroch und durch schütteren Kiefernwald, der nur hier und da durch einige Birken, die ihr goldenes Herbstkleid schon verschlissen hatten, erhellt wurde, solange brauchten dem Wanderer keine Zweifel über den richtigen Weg zu kommen. Am Nachmittag – so war ihm geraten worden – sollte er sich an der Wegegabelung links halten. Dann käme er schnurstracks nach Wietze und vermiede den Übergang über das Flüsschen gleichen Namens. Das würde er dann erst später im Verlauf der größeren Fahrstraße von Nienburg nach Celle überqueren.
Der Weg senkte sich, verließ Wald und Heide und trat in das Bruch hinaus: weite, verwachsene Wildwiesen mit grobem Kraut, Schilfinseln hier und da in Tümpeln mit schwarzbraunem Wasser, Sumpfstrecken, wo dicke, runde Bülten aus storrem Gras auf dem Morast zu treiben schienen. Dann wieder undurchdringliches Erlen- und Weidengestrüpp. Der Weg, der an den tiefsten Stellen aufgeschüttet war, folgte einem schmalen, auf dem unsicheren Grund gleichsam schwimmenden Damm.
Walther gelang es nun nicht mehr, so kräftig auszuschreiten wie bisher. In den tiefen Radspuren stand Wasser, und die Stiefel wollten bei jedem Schritt im schwarzen Schlamm haftenbleiben.
Walther Corssen geriet trotz der feuchtkalten Luft ins Schwitzen. Er war nun schon manche Stunde unterwegs. Der Mittag hatte sich unmerklich ins Grau des lastenden Himmels davongestohlen. Eigentlich hätten nun die ersten Höfe von Wietze auftauchen müssen. Hatte er eine falsche Richtung eingeschlagen? Der Weg, auf dem er mühselig entlangstolperte, mochte nur deswegen so tief zerfahren sein, weil er zu den Torfstichen von Hope oder Esperke oder Lindwedel führte. Die Bauern drangen manchmal sehr, sehr weit in die Moore vor, wenn sie guten Torf abbauen wollten; das kannte er ja aus seinem Heimatdorf Dövenbostel an der Wilpe gut genug.
Dies alles ängstigte ihn kaum. Verlaufen kann man sich zwar in der Heide leicht, wenn der Tag eintönig grau ist und man nicht erkennt, ob man sich nach Süden oder Norden, Westen oder Osten bewegt. Aber früher oder später findet man sich auch wieder zurecht, weil sich dann doch ein Anhaltspunkt bietet. Dies allerdings nur, solange es Tag ist oder wenn des Nachts Mond und Sterne heraustreten mit der nach Norden weisenden Polaris.
Etwas anderes trieb Walther Corssen voran: Zu seiner Rechten, über feuchteren Niederungen, lagerte mit silbernem Grau, heller als das des Himmels, eine Nebelbank und verhüllte die Landschaft vollkommen.
Walther schickte ein Stoßgebet zum Himmel: O Gott, keinen Nebel! Es wird bald dunkel! O Herr im Himmel, bewahre mich vor Nebel! Lass mich nicht den Weg verlieren! Vater im Himmel, keinen Nebel! Aber hatte er nicht selber die gut gemeinten Ratschläge und Warnungen der Einheimischen in den Wind geschlagen?
Und plötzlich hatte ihn der Nebel überwältigt. Er verschluckte jede Ferne, jede Richtung, jedes Merkmal, verdunkelte den ohnehin nicht mehr sehr hellen Tag, entwandelte jeden Busch und jede sich an den Wegrand duckende Weide zu blassen Schemen.
Wenn jetzt die Nacht mich einholt, bin ich verloren, kann die Spur nicht halten, gerate – verhüte das Gott! – ins Moor, am besten lasse ich mich dann an einer leidlich trockenen Stelle nieder und warte den Morgen ab. Aber vierzehn Stunden in dieser Dunkelheit und Nässe! Das halte ich nicht aus. Vielleicht wird es klar über Nacht. Unsinn! Ich kann mich nicht verlaufen haben. Es muss bald ein Hof auftauchen. Immer sind die Wege länger, als man gesagt bekommt. Das ist mir schon ein Dutzendmal passiert. Es wird ja noch nicht dunkel. So weit kann der Tag nicht vorgeschritten sein!
Er war es doch. Unmerklich langsam, doch mit erbarmungsloser Beharrlichkeit senkte sich die Nacht durch den sachte ziehenden Nebel und verschluckte schließlich auch die blasseste Linie. Der Wanderer fühlte den Weg nur noch, sehen konnte er ihn nicht mehr. Er hob sich sein mageres Bündel vor die Augen: nichts! Es war nicht einmal zu ahnen. Oben, unten, rechts, links, nichts war mehr wahr und wirklich. Er hatte die Augen weit aufgerissen, aber das half ihm nichts.
Der Mann, der nach Hause wollte, gab nicht auf. Die tief in den Boden geklüfteten Radspuren waren der einzige Hinweis, wie der Weg sich fortsetzte. Walther Corssen zog den linken Fuß in der Kerbe der Räderspur nach und hielt sich mit dem rechten Fuß auf dem wesentlich höheren Mittelrücken zwischen den beiden Radspuren, eine beschwerliche Fortbewegung, aber die Einzige, die ihm in der Finsternis die Gewähr gab, dass er sich noch immer auf dem vorgezeichneten Karrenweg befand.
Die Welt hatte aufgehört. In der vollkommenen Dunkelheit, die sich dicht wie schwarze, feuchte Watte um den mit schmerzenden Füßen und Beinen durch formloses Nichts hinkenden Wanderer legte, wurden Zeit und Raum nach und nach ganz unwirklich. Angestrengt überlegte der Verirrte, ob eine, drei oder fünf Stunden vergangen waren, seit der Tag erloschen war.
Schließlich vermochte er keinen klaren Gedanken mehr zu fassen. Nur eine vage Formel blieb noch übrig: Ich darf die Spur nicht verlieren, ich darf die Spur nicht verlieren! Manchmal verlor er sie, schreckte auf aus seinem Stolpern, tastete verzweifelt mit dem Fuß umher in der Schwärze: Da war sie wieder, war sie es wirklich? Hatte er eine andere erwischt? Aber irgendwohin musste sie schließlich führen. Irgendwo musste dieser fürchterliche Marsch, dieser taube, blinde Maulwurfsgang ein Ende nehmen!
Bis er zum ersten Mal wirklich stolperte. Sein linker Fuß verfing sich hinter einer Wurzel, an einem Stein, oder was sonst es gewesen sein mochte. Er versuchte verzweifelt für ein paar Sekunden, sein Gleichgewicht zu wahren mit wild fuchtelnden Armen – dann stürzte er doch der Länge nach zu Boden, während sein linker Fuß noch immer gefangensaß, mit schmerzhaft überdehnten Sehnen. Er war platschend in ein unsichtbares Wasser gefallen. Als er sich aufrichten und aufstützen wollte, fand er keinen Halt. Die Hände versanken in zähem, nachgebendem Morast. Panik ergriff ihn: Zur Rechten musste der aufgeschüttete Weg zu finden sein. So war es. Er fand fester eingewurzelte Grasbüschel und zerrte sich auf den Weg zurück. Auch sein Bündel ließ sich wieder ertasten. Sonderbar benommen blieb er im nassen Grase hocken. Seine Hände waren mit klebrigem Schlamm bedeckt. Sehen konnte er sie nicht. Wenn die Augen nicht prüfen können, was die Hände tun, dann scheint nichts zu gelingen. Ob er seine Augen nun offen hielt oder geschlossen, nichts um ihn her war auszumachen.
Als er wieder zu sich gekommen war, fragte er sich abermals, ob es nicht ratsamer wäre, einfach hockenzubleiben und abzuwarten, ob der Nebel sich über Nacht heben würde. Manchmal geschah das unerwartet. Aber schon nach kurzer Zeit fror er in seinem zerschlissenen Soldatenrock, fror in den formlosen, dicken Wollhosen, die er einem flämischen Bauern verdankte, fror bis ins Mark. Er hatte keinen trockenen Fetzen mehr am Leibe. Stöhnend stellte er sich wieder auf die Beine. Er schwankte, die Finsternis machte es ihm schwer, das Gleichgewicht zu gewinnen. Sein linker Fuß schmerzte.
In der Radfurche humpelte er weiter. Er war nun nicht mehr so fest auf den Beinen. Er taumelte zum zweiten Mal, konnte sich nicht fangen und rollte mit dem ganzen Unterkörper in den Sumpf. Mit aller Gewalt hatte er sich, plötzlich wieder hellwach, nach rechts geworfen, um nicht ganz vom Wege abzukommen; so konnte er sich wieder auf festeren Grund zurückarbeiten. Grenzenlos erschöpft lag er lang im Gras des Wegrückens. Wo ist mein Bündel? Mein Bündel! Er fühlte umher, fand es wieder, betastete es; er hatte es gut verschnürt. Es war unversehrt geblieben.
Er versuchte gar nicht, sich klarzumachen, dass die Vernunft gebot, auf diesem leidlich festen Grund sitzen zu bleiben. Irgendwann musste es wieder hell werden!
Als sein Herz sich einigermaßen beruhigt hatte, quälte er sich abermals hoch und humpelte weiter. Er geriet an einen besonders tief gelegenen Abschnitt des Weges; das Wasser schien die Radfurchen ganz zu füllen. Aber er torkelte weiter durch das Nichts.
Beim dritten Fall fing er sich nicht mehr und landete in ganzer Länge in einem grundlosen Moorloch. Zu Tode erschrocken versuchte er sich freizuzerren. Aber wenn er sich auf ein Bein stützen wollte, um das andere aus dem saugenden Schlamm zu ziehen, so sank er nur noch tiefer. Bald stak er bis zu den Schenkeln im stickenden Morast.
Quälend langsam sank er und sank er. Er tobte dagegen an; es nutzte nichts. Schon hatte der Schlamm seine Lenden erreicht. In der fruchtlosen, wütenden Anstrengung fiel er vornüber. Die Arme, die ihn stützen wollten, sanken ins Weiche, tiefer und tiefer …
Endlich stießen die Hände auf etwas Hartes. Eine Wurzel, ein vergessenes Brett, ein Pfahl? Was es auch sein mochte, es war endlich ein Halt. Er griff zu, zog und brachte das Holz an die Oberfläche. Bemüht, die Planke aus dem Schlamm zu lösen, war er noch tiefer gesunken, nun schon bis über die Hüften. Mit einer Anstrengung, die ihn fast zerriss, schwenkte er den Knüppel in die Richtung, aus der er nach seiner Erinnerung gefallen war, zum Weg also, der ihn bis dahin notdürftig getragen hatte. Als er sich mit den abgespreizten Ellenbogen auf den Pfahl stützte, überkam ihn ein Gefühl unsagbarer Erleichterung, als sei er bereits gerettet. Der Pfahl hielt stand, er trug.
Und plötzlich schrie er – schrie wie ein Tier, das die Todesfurcht überwunden hat und sich zu neuem Angriff stellt. Dass er nicht mehr tiefer sank, dass dem erbarmungslosen Saugen des Moores Einhalt geboten war, flößte dem Verunglückten die trügerische Hoffnung ein, dass seine Not nun bald ein Ende nehmen würde.
Walther Corssen hatte begriffen, dass jede gewaltsame Bewegung ihn nur tiefer sinken ließ, dass er sich mit eigener Kraft aus der Umschlingung des Sumpfes nicht zu lösen vermochte, dass ihm nichts weiter übrigblieb, als sich so breit wie möglich auf seinen rettenden Pfahl zu stützen. Deshalb verhielt er sich jetzt ganz still. Die Kälte des nächtlichen Moors drang von allen Seiten in ihn ein, trübte ihm das Bewusstsein, machte den zu Tode erschöpften Mann schläfrig. Aber wenn die Muskeln der Arme erlahmten, dann sank er sofort wieder tiefer – und schreckte jählings auf.
Ins Unendliche dehnte sich die lichtlose Nacht, ohne oben und unten, ohne vorher und nachher. Er nahm nicht wahr, dass er ständig matter wurde, dass er sich gar nicht mehr auf den Pfahl stützte, dass er nur noch über ihm hing.
Jenseits der Mitternacht ereignete sich das Wunder, das im späten Herbst über dem Moor zuweilen geschieht. Ein Wind kam auf, brachte Wallung in die Nebelschwaden. Sie zerrissen, verwehten, vergingen, als hätte es sie nie gegeben. Die Sterne tauchten aus dem Nichts, funkelten wie im Triumph und schütteten ihr zartes Licht zur Erde. Ganz lautlos vollzog sich die Verwandlung, so dass der zu Tode erschöpfte Mann im Sumpf zunächst nicht erfasste, wo er sich befand, als er nach einer langen Zeit des Hindämmerns wieder aufschreckte. Vielleicht hatte ihn der eisige Wind geweckt, der den Nebel vertrieb.
Und dann sah er die Sterne! Das entsetzliche Gefängnis absoluter Finsternis war zerbrochen. Der furchtbare Alpdruck, keine Augen mehr zu haben, war von ihm genommen. Es war, als werde dem Mann im Sumpf ein Zeichen des Lebens gegeben. Er kehrte aus der verzehrenden Kälte für ein paar Herzschläge lang in die Wirklichkeit zurück. Er sah: Da war der Damm des Weges, von dem er in dies gar nicht sehr große Moorloch hinabgetaumelt war. Und der rettende Pfahl war wohl ein Heubaum, der einem Bauern vom Wagen gerutscht sein mochte, als er die Ernte von den sauren Wildwiesen im Moor einbrachte. Und dort vor ihm, was war das? Dort stieg der schmale Karrenweg plötzlich an und schwang sich zu einer hölzernen Brücke auf. Dort musste der Weg also ein Gewässer kreuzen. Das konnte nur die Wietze sein! Also hatte er den richtigen Weg verfehlt. Er begriff es nur noch halb – etwas anderes jedoch ganz deutlich: Wenn er am Abend zuvor nur noch zwanzig, dreißig Schritt weitermarschiert wäre, hätte er von der geländerlosen Brücke ins Wasser des Flusses hinunterstürzen können. Das Sumpfloch, in dem er steckte, hatte ihn also vor dem sicheren Tod bewahrt.
Der leichte Wind, der nun wehte, machte die Kälte noch eisiger. Seine Zähne klirrten aufeinander, unaufhörlich. Im Osten, geradeaus vor seinen Augen, dämmerte es, dort erblassten die Sterne schon. Ein neuer Tag kündigte sich an. Er dachte: Wenn einer jetzt den Weg entlangkommt und findet mich, dann holen sie mich heraus, und ich komme davon, wie damals in der Schlacht. O mein Gott im Himmel, sei mir gnädig! Vergib mir alle meine Sünden! Hilf mir noch einmal zum Leben, Vater im Himmel!
Bald darauf übermannte ihn die bleierne Müdigkeit. Er nahm nichts mehr wahr, er verlor das Bewusstsein.
Doch ein heller, gellender Schreckensschrei von der Brücke her weckte ihn aus der Ohnmacht. Er riss die verkrusteten Augen auf:
Dort auf der Brücke stand sie, scharf gegen die Morgensonne abgezeichnet, hatte die Hände entsetzt vor den Mund gehoben und im ersten Schrecken laut aufgeschrien. Ein Toter aufrecht im Sumpf?! Nein, er lebt noch, hebt den Kopf, winkt und versucht zu rufen, bringt aber keinen Laut heraus. Sie erkennt sofort, was geschehen ist und dass sie Hilfe braucht, um helfen zu können, dass sie allein nichts auszurichten vermag.
Sie schreit, so laut sie kann: »Halte noch aus! Ich hole meinen Vater! Und ein Pferd. Und Stricke!«
Er nimmt noch wahr, wie eine weibliche Gestalt mit fliegenden Haaren und Röcken in weiten Sprüngen davonhetzt, drüben, auf der anderen Seite des Flusses. Und in der Ferne sieht er das hohe, riedgedeckte Dach eines Bauernhofes, dort, wo der Boden aus der Niederung des Bruches aufsteigt und wieder fest wird.
Jetzt erst gibt Walther Corssen nach. Gott hat ihm Gnade erwiesen, wie er es ihm im lutherischen Katechismus und in den Versen aus dem Psalter und den Evangelien, die er im Konfirmanden-Unterricht gelernt hat, so oft zugesagt hat. Er denkt nur noch: Dies Mädchen hat Er geschickt …
Und verliert abermals das Bewusstsein.
Es dauerte Tage und Wochen, bis Walther Corssen seinen Rettern Auskunft darüber geben konnte, wer er wäre. Bei den verzweifelten Versuchen, ihm einen Strick unter den Armen um die Brust zu schlingen und ihn von einem Pferd vorsichtig aus dem Sumpf ziehen zu lassen, waren die beiden kaum vernarbten Wunden wieder aufgeplatzt, und er hatte viel Blut verloren. Dazu kam eine schwere Lungenentzündung. Es war ein Wunder, dass er mit dem Leben davonkam. Seine Rettung verdankte er einzig und allein dem jungen Mädchen, das ihn auf der Suche nach zwei verlaufenen Kälbern im Bruch jenseits der Wietze entdeckt hatte.
Dies Mädchen war die ältere der beiden Töchter des Bauern. Karl Hörblacher saß auf dem abgelegenen Lüders’schen Hof am Rand des Bruchs, der aber noch zur Wieckenberg’schen Gemarkung gehörte. Der Bauer hatte nicht daran geglaubt, dass der zu Tode erschöpfte Mann aus dem Moor am Leben bleiben würde. Da er ein enttäuschter, vom Schicksal misshandelter Mann war, dachte er, es wäre vielleicht besser und auch barmherziger gewesen, wenn das Moor den fremden Mann verschlungen hätte – wie es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder einen unvorsichtigen, glücklosen Menschen in seine feuchten Arme zwingt und auf Nimmerwiedersehen verschwinden lässt.
Er hatte der Tochter schon am Abend des Tages, an dem Walther Corssen gerettet worden war, auf seine harte, aber nicht unfreundliche Art bedeutet: »Er wird nicht mit dem Leben davonkommen, Anke. Aber er gehört dir, und ich werde dem lieben Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Wenn du willst, kannst du versuchen, ihn gesund zu pflegen. Aber ins Haus kommt er uns nicht. Man weiß nicht, wer er ist und wo er hingehört. Hier im Kuhstall ist es warm, da kann er liegen und in Frieden sterben.«
Die Tochter hatte den Vater aus blassem Antlitz angeschaut und geflüstert: »Er wird nicht sterben. Er hat ja ausgehalten, bis ich kam!«
Der Bauer hatte mit den Achseln gezuckt und sich abgewendet. Die Tür des Kuhstalls schlug hinter ihm zu. Das Mädchen Anke hob die Laterne mit dem Talglicht vom harten Lehmboden des Stalles auf und leuchtete dem fiebernden Mann auf dem Strohlager ins Gesicht. Es war eine peinliche und schmutzige Arbeit gewesen, den Bewusstlosen von seinen verschlammten Kleidern zu befreien, mit einigen Eimern Wassers notdürftig zu säubern, die sickernden Wunden mit altem Leinen zu verbinden, schließlich den hilflosen Körper auf das Strohlager zu betten und mit einer wollenen Decke vor der Zugluft im Stall zu schützen. Auf einem abgelegenen Bauernhof ist für Zimperlichkeit kein Platz, es wird getan, was getan werden muss.
Den beiden Töchtern Hörblacher, Anke und Irmgard, war die Mutter schon früh gestorben, ein Verlust, den die Kinder verwunden hatten, mit dem der Vater jedoch nicht fertig wurde. Im Alter nur durch ein Jahr getrennt, hatten sie schon früh in die Rolle der Bäuerin hineinwachsen müssen. In die Dorfschule nach Wietze zu wandern, dazu hatten sie, außer im Winter, wenn der Schnee nicht zu hoch lag, kaum Gelegenheit gehabt, doch hatten sie immerhin gelernt, zu lesen, zu schreiben und ein wenig zu rechnen, dazu viele Kirchenlieder und Bibelsprüche.
Die Luthersche Bibel war das einzige ›Lesebuch‹, das auf dem Hof am Bruch zu finden war.
Die achtzehnjährige Anke, viel zierlicher gewachsen als sonst die Weiblichkeit in Niedersachsen, ein Mädchen ›bräunlich und schön‹, aber zugleich durch frühe und harte Arbeit gekräftigt und so zäh wie echte Seide, diese Anke hatte aus den Worten des verehrten, aber auch gefürchteten Vaters nur einen einzigen Satz herausgehört, nämlich:
»Er gehört dir!«
Der Vater hatte wahrscheinlich – ohne sich viel oder gar Feierliches dabei zu denken – nur zum Ausdruck bringen wollen, dass der Mann verloren gewesen wäre, hätte das Mädchen nicht für schnelle Hilfe gesorgt. Anke aber, der in ihrem Dasein, in der Stille des Lüders’schen Einöd-Hofes, das Außerordentliche bis dahin nur sehr selten, wenn überhaupt je, begegnet war – jenes Außerordentliche, nach welchem jeder junge Mensch sich sehnt –, Anke war wie von einem elektrischen Schlag getroffen worden.
»Er gehört mir! Er darf nicht sterben!«
Zunächst sah Anke nichts weiter als die Aufgabe, dieses fiebernde, schmutzige, blutende Stück Mensch. Noch nie in ihrem bisherigen Dasein war sie von den Umständen und Ereignissen so hart herausgefordert worden wie in dem Augenblick, als sie von der Brücke die schwarz verschlammten Schultern, den verschmierten, matt zur Seite hängenden Schädel des Mannes in der Moorlache wahrgenommen hatte. Ein Anblick, der ihr das Herz für Sekunden hatte stocken lassen, um ihr dann die Worte auf die Lippen zu drängen: »Jetzt fängt es an …«
Was sollte da anfangen? Das Leben? Das Schicksal? Sie hatte keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, musste all ihre Aufmerksamkeit sammeln, den Versinkenden zu retten.
So fanden sowohl Anke als auch der alte Hörblacher keinen Widerspruch darin, dass sie sich, als gelte es ihr eigenes Leben, abmühte, dies fremde, erschöpfte Leben zu bewahren.
Sie war dem Sohn des zum Dorf hin anschließenden Hofes, den die Leute in der Gegend den ›lüttjen‹ Lüders-Hof nannten, versprochen: dem Heinrich Lüders, mit dem sie winters zur Schule gepilgert war, den sie auch gern mochte und den sie, nachdem die Väter sich beredet hatten, ohne viel Aufhebens als ihren Verlobten hinnahm. All dies war Anke vernünftig und richtig vorgekommen, wenn es ihr auch noch nicht sehr dringlich schien. Irgendwann würde sie dem scheuen und ungeschickten Werben von Lüders’ Heinrich nachgeben – und wenn dann nicht mehr zu bezweifeln war, dass ein Kind in ihr wuchs, der Hof also nicht ohne Nachkommenschaft bleiben würde, dann konnte auch mit großem Pomp und Trara geheiratet werden, und der Herr Pastor hatte sich damit abzufinden, dass über gewisse Dinge, vor allem, wenn es sich um den Fortbestand der Höfe und Geschlechter handelte, mit den Bauern nicht zu reden war. Fand er sich nicht damit ab, so hatte er sich die Folgen selbst zuzuschreiben und, um es lutherisch auszudrücken, ›Gesetz und Evangelium‹ nahmen nur noch ärgeren Schaden …
Anke wusste, dass es der geheime, ihn ganz beherrschende Herzenswunsch des Vaters war, die beiden Lüders-Höfe, den eigenen ›groten‹ und den benachbarten ›lüttjen‹, wieder zu ›dem‹ Lüders-Hof zu vereinen. Damit würde zwar der Name Hörblacher aus der Gegend verschwinden, aber dem eigenen Blut wäre dann der Lüders-Hof für alle Zeiten gesichert.
Denn Hörblacher – ein solcher Name musste ewig fremd bleiben in diesem Land der dunkeln Wälder, der Moore, der weiten Heide, der gemächlich wandernden Schafherden, der tief zerfahrenen Sandwege mit den wehenden Birken, diesen einsamen, endlosen Wegen in dem menschenarmen Land, in dem die Sachsenstämme weit verstreut unter ihren hohen Giebeln mit den gekreuzten Pferdeköpfen siedelten und Heinrich der Löwe immer noch durch die Geschichten am Herdfeuer geisterte.
Im Dreißigjährigen Krieg, der schon mehr als hundert Jahre zurücklag, war auch diese Landschaft von der Kriegsfurie fürchterlich verwüstet worden. Nach dem Westfälischen Frieden lagen auch hier unzählige Höfe in Schutt und Asche. Vielen Menschen fehlte der Mut, wiederaufzubauen und das Feld zu bestellen. Allzu oft schon waren sie in den vorausgegangenen Jahrzehnten um die Früchte ihrer Arbeit geprellt worden.
Den großen alten Lüders-Hof am entlegenen Rand der Wieckenbergschen Dorfgemarkung hatten die Soldaten der protestantischen und der ligistischen und kaiserlichen Armeen nicht gefunden; selbst für die Schweden hatte er allzu weit abseits hinter seinem Eichenwald gelegen, in dem zur Herbstzeit die Schweine sich mit Eicheln ihren kernigen Speck anmästeten. Wenn auch der Hof noch stand wie seit je, so war doch der Bauer vom Kriege hart geschlagen worden. Der einzige Sohn hatte sich von der Lust am Abenteuer verführen lassen, den Werbetrommeln des Bernhard von Weimar nachzulaufen, und war nie wieder aufgetaucht. Die Bäuerin war aus Gram über den verlorenen Sohn früh gestorben und hatte den Lüders-Bauern mit der einzigen Tochter alleingelassen.
Auf dem Lüders-Hof hatte sich im letzten Viertel des Dreißigjährigen Krieges ein entlaufener Landsknecht angefunden, der nach seinen Erzählungen von einem unterfränkischen Bauernhof stammte. Den väterlichen Hof, so berichtete er, hätten die Schweden ebenso verbrannt wie das ganze Dorf. Vater, Mutter und Geschwister seien grausig vom Leben zum Tode gekommen; er selber sei dem Gemetzel durch einen bloßen Zufall entgangen. Schließlich habe er keine andere Wahl gehabt, als bei den Kaiserlichen Sold zu nehmen. Aber das Kriegshandwerk sei ihm bald fürchterlich zuwider geworden. Er habe sich bei guter Gelegenheit davongemacht, sei weit gewandert, alle Städte nach Möglichkeit meidend, stets in der Hoffnung, irgendwo und irgendwann wieder zu bäuerlicher Arbeit zurückkehren zu können. Als seinen Namen hatte er Michel Hörblacher aus der Gegend von Kitzingen angegeben. Oder hatte er sich nur Michel genannt und Hörblach als den Ort seiner Herkunft bezeichnet?
Hundert Jahre später wusste das in der Heide am Wietzenbruch niemand mehr mit Sicherheit anzugeben. Jener Mann aus der Fremde hatte sich auf dem Lüders-Hof bewährt. Es hatte sich dann beinahe von selbst so gemacht, dass er die Tochter des Hofes heiratete und bald dem alten, längst müde gewordenen Lüders als neuer Lüders-Bauer folgte. Hörblacher war mit seiner Frau in den lutherischen Gottesdienst gegangen, als es erst wieder einen Pfarrer und eine Kirche in der Gegend gab – und keiner hatte gefragt, ob der Mann, der auf den Lüders-Hof geheiratet hatte, nicht vielleicht als Katholik auf die Welt gekommen war. Ein solches Gerücht kam erst sehr viel später auf, als die Leute allmählich gewahr wurden, dass es mit Gewalttat, mit Recht- und Gesetzlosigkeit vorbei war. Doch da hatten sich die Leute, deren Sippen seit alters in der Gegend ansässig waren, schon an den arbeitsamen, freundlichen Fremdling auf dem Lüders-Hof gewöhnt. Gab er sich doch redliche Mühe, wenn auch ohne viel Erfolg, das in der Südheide übliche Plattdeutsch zu sprechen. Überhaupt bewies er sich als ein heiterer, gesprächiger, umgänglicher Mann, der Spaß an Späßen hatte und bei allem Fleiß und aller Ehrbarkeit auch gern einmal fünfe gerade sein ließ.
Eben deshalb blieb er Zeit seines Lebens ein Fremder unter den starrsinnigen, im Grunde nur sich selbst achtenden, misstrauischen, ja missgünstigen Heidjern, diesen Leuten vom alten Sachsenstamm, die mit zusammengekniffenen Augen auf alles Fremde und Ungewohnte wie auf etwas Urfeindliches schauen und denen schon verdächtig ist, wer gerne laut und herzlich lacht.