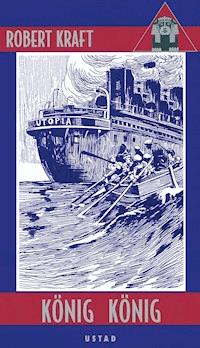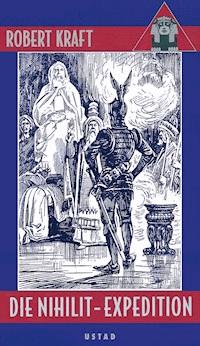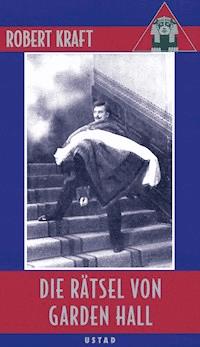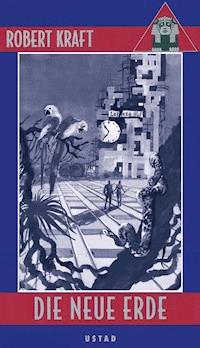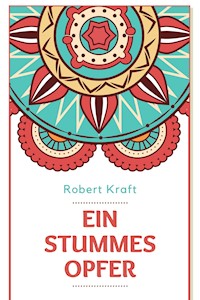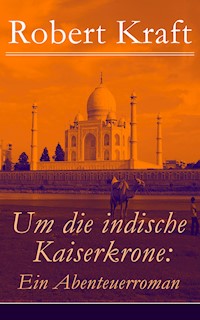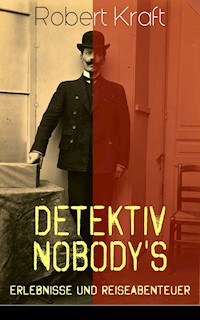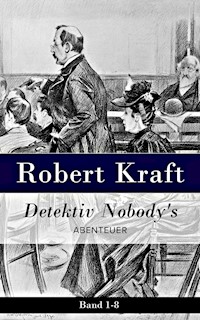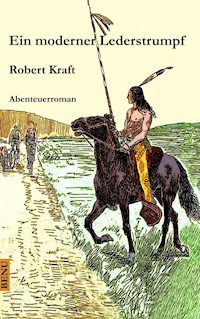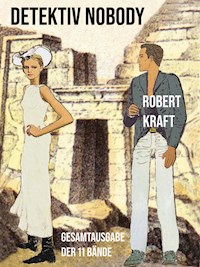Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wildschützen vom Kilimandscharo Robert Kraft - Ein oberbayerisches Dorf liegt verborgen im Innern Schwarzafrikas. Auf den unzugänglichen Höhen des Kilimandscharo leben die deutschen Auswanderer wie einst in der alten Heimat. Doch die Idylle ist bedroht, denn skrupellose Wilderer, die auch vor Mord nicht zurückschrecken, machen das Land unsicher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HINWEISE DES HERAUSGEBERS:
Nehmen Sie unser kostenloses
Schnelles Quiz und herausfinden, welches
Best Side Hustle ist ✓das Beste für Sie.
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
→ LYFREEDOM.COM ← ← HIER KLICKEN ←
Kapitel 1
1
»Waren Sie im Hippodrom? Haben Sie die Geschwister Richter mit ihrer Truppe gesehen?«
So wurde ohne Ausnahme gefragt, wenn sich zwei Bekannte, die einander einige Tage nicht gesehen hatten, auf der Straße begegneten. Reinhold Richters Reitertruppe bildete die letzte Sensation des Tages, und wer sie nicht gesehen hatte, konnte nicht mitsprechen.
Der Londoner Hippodrom ist ein Zirkus, dessen Arena aber zehnmal so groß ist wie die gewöhnlichen Zirkusmanegen, die allüberall in der Welt genau den gleichen Durchmesser von dreizehn Metern haben müssen, wegen der Schrägstellung der Pferde beim Laufen, weil sich schon bei einem Unterschied von einem Viertelmeter Pferd und Künstler verspringen würden.
Im Hippodrom treten also nicht solche eigentlichen Zirkuskünstler auf. Es werden darin große Reiterfeste abgehalten, fremde Völkerrassen vorgeführt, bei denen, wie schon der Name Hippodrom sagt, das equestrische Element vorherrschen muß, Beduinen oder Kalmücken; auch Buffalo Bill führt seinen wilden Westen, wenn er in London gastiert, stets im Hippodrom vor.
Versetzen wir uns nun in diesen Zirkus, um einer Abendvorstellung von Reinhold Richters Reitertruppe beizuwohnen, und zwar wollen wir die Augen eines Zuschauers haben, der noch nichts davon gehört hat, noch nicht einmal weiß, daß diese Reitertruppe das Tagesgespräch Londons bildet und bald das von ganz Europa bilden wird. Denn die Truppe gastiert nur wenige Tage hier, dann geht die Reise weiter.
Reinhold Richters Reitertruppe! Das hört sich ja ganz hübsch an, besonders wenn das ›R‹ dabei recht schnarrt, aber – hätte sich denn die Gesellschaft keinen anderen Namen zulegen können? Der Name tut etwas zur Sache. Reinhold Richter – wenn ich ein echter Engländer bin, habe ich gleich ein gewisses Vorurteil, denn das ist doch natürlich ein Deutscher. Und doch muß es etwas ganz Außergewöhnliches sein, denn das sich quetschende Publikum beginnt vor Spannung zu zittern, weil jetzt die Musik einsetzt.
Unter einem leisen, faszinierenden Marsch reiten auf prächtigen Rossen vier Herren und vier Damen ein – Schulreiter, die Herren in schwarzem Frack und Zylinder, die Damen in langem Reiterkostüm, auf dem hochtoupierten Haar gleichfalls den Zylinder.
Es scheinen Südländer zu sein. Ihre Gesichter, auch die der Damen, sind so braun, schon mehr bronzefarben. Mit Ausnahme das des führenden Herren, dieses ist viel heller, sein blondes Haar schlicht gescheitelt. Das gilt auch von der führenden Dame, und wenn jener Reinhold Richter ist, dann ist diese unbedingt seine Schwester, die Ähnlichkeit ist eine ganz auffallende.
Sie begrüßen das Publikum, und dessen frenetischer Jubel beim Einreiten der Kavalkade will kein Ende nehmen.
In der Tat, es ist ein prachtvolles Pferdematerial, aufs eleganteste gesattelt und gezäumt – elegant, nicht etwa prunkvoll – so vornehm einfach wie die Reiter und Reiterinnen selbst sind, vom Zylinder an bis zur Reitgerte im weißen Glacéhandschuh.
Ja, ist denn aber wirklich jeder Engländer solch ein gediegener Pferdekenner, daß sich selbst die obersten Galerien für derartige Schulreiter begeistern können, daß sich der Arbeiter das Abendbrot abspart, nur um diese Schulreitertruppe ein zweites Mal sehen zu können?
Der Begrüßungsjubel, von den Galerien kräftig durch gellendes Pfeifen unterstützt, was in England als ein Zeichen des größten Beifalls gilt, hat sich gelegt, das letzte ›Hipp, hipp, hurra für Reinhold Richter und seine Schwester!‹ ist verklungen.
Sie reiten die ganze hohe Schule durch. Prachtvoll! Kein Pferd hat ein Klopfen mit der Gerte nötig, um gleichmäßig mit den anderen nach dem Takt der Musik in spanischem Tritt zu gehen, sie marschieren wie die Soldaten in Reih und Glied und machen wie auf Kommando zum Abschied den Kniefall.
Der zweite Teil beginnt. Die beiden Parteien reiten sich entgegen, die Herren ziehen den Zylinder, die Damen verneigen sich graziös im Sattel. Es wird Quadrille geritten, im Trab, im Galopp.
Jetzt aber scheint sich die Sache zu ändern. Der Galopp wird immer rasender, wird zur Karriere, und so etwas gibt es bei der Quadrille nicht.
Aha, jetzt geht es los! Die Pferde jagen langgestreckt in der Arena herum, die Herren und Damen lösen das Zaumzeug ab und werfen es weg. Sie lösen die Sättel und werfen sie weg. Jetzt springen sie auf, stehen auf den Rücken der wild ausgreifenden Rosse. Sie werfen die Zylinder weg. Die Herren ziehen den Frack aus, die Damen die langen Reitkleider, werfen sie weg. Jetzt kommen zunächst die Stiefel dran. Die Damen in Unterröcken, in denen sie sich aber schließlich auch auf der Straße sehen lassen könnten, setzen dabei den Fuß auf den Pferdehals. Man sieht, wie sie mit einem Instrument die zierlichen Stiefelchen aufknöpfen, unter denen sie doch noch immer eine andere Fußbekleidung tragen, und zwar nicht nur dünne Trikotstrümpfe. All diese Damen müssen äußerst kleine Füße haben.
Die Herren in Hemdsärmeln bieten den Damen ihre Hilfe an, werden abgewiesen, die Damen helfen höchstens einander, und die Herren haben auch genug mit sich selbst zu tun; denn sie tragen Stiefeletten mit Gummizug, und die sind manchmal nicht so leicht abzubekommen. Mancher zieht vergebens im Stehen, er setzt sich, er steht wieder auf und reißt an seinem Stiefel, immer auf dem rasenden Roß – es geht nicht.
»He, Jonny, zieh doch mal!«
Wie schon die Damen ihre Pferde nebeneinander getrieben haben, um einander beim Aufknöpfen der Stiefel behilflich zu sein, so tun jetzt auch die Herren.
Der eine, der von der Fußfessel befreit sein will, sitzt auf dem nackten Pferderücken, der andere steht auf dem seinen, und es wird gezogen, wie sich eben zwei um den Besitz eines widerborstigen Stiefels streiten, ganz wie auf festem Boden.
Endlich siegen Kraft und Beharrlichkeit – aber auch hier geht es zu, wie es beim Stiefelziehen eben manchmal zugeht – ein gellender Schrei des Schreckens geht durch den ganzen Hippodrom – beide sind rücklings von ihren Pferden gestürzt.
Das hat man gesehen – aber nicht, wie sie weder hinaufgekommen sind. Urplötzlich stehen beide wieder auf ihren Pferden und schütteln einander lachend die Hand.
Ein anderer Herr läßt sich lieber einen Stiefelknecht zuwerfen. Wie er es fertigbringt, auf dem Rücken des rasend galoppierenden Pferdes sich ganz sachgemäß des Stiefelknechts zu bedienen, ist schon ganz unbegreiflich. Er zieht und zieht, endlich glückt es ihm – und wieder erschallt ein vieltausendstimmiger Schrei des Entsetzens, diesmal noch ein ganz anderer als vorhin.
Der Stiefelzieher ist rücklings vom Pferd gestürzt. Und dicht hinter ihm waren gerade zwei Damen, die, ihre Pferde zusammenhaltend, sich eben gegenseitig das Korsett aufschnürten. Gegen diese prallte der Stürzende, auch die beiden Damen stürzten, dann noch ein anderer Reiter – es war ein furchtbarer Massensturz, und nicht nur von Menschen, sondern auch drei Pferde waren zusammengebrochen, wälzten sich mit windenden Leibern und um sich schlagenden Hufen über- und durcheinander, und zwischen und unter ihnen die Reiter und Reiterinnen. Und da kam noch ein vierter angesaust, der sich gerade die Hosen auszog – und so, in dieser Stellung, nur auf einem Bein balancierend, setzte sein Roß mit einem mächtigen Sprung über den wirren Knäuel von Menschen- und Pferdeleibern hinweg – plötzlich hatte sich auch dieses gefährliche Durcheinander in Wohlgefallen aufgelöst, acht Pferde jagten wieder im Kreis herum, auf ihren Rücken die jubelnden und lachenden Reiter und Reiterinnen.
Und das Publikum, das noch eben vor Entsetzen laut aufgeschrien hatte, lachte und jubelte mit – das war das Eigentümlichste bei der Sache! Hier schwand immer mehr das Bewußtsein, daß denen dort unten etwas passieren könnte. Das war doch alles eine lustige Spielerei. Wenn einmal drei oder vier Pferde zusammen stürzen, die Reiter unter sich begraben – so ist doch weiter nichts dabei, da steht man eben wieder auf.
Die Entkleidung ging weiter, nun bloß noch die Perücken weggeworfen, die Damen das frisierte Haar aufgelöst, und – die Verwandlung war geschehen, die Gesellschaft präsentierte sich in ihrem eigentlichen Charakter.
Es waren mit Ausnahme der beiden blondhaarigen Geschwister Indianer und Indianerinnen, und zwar echte. Um dies zu erkennen, war nicht nötig, daß zwei der Männer Skalplocken trugen, ein besseres Zeichen war vielleicht noch das schwarze, straffe Haar des dritten – und überhaupt, jetzt, wo sie sich in ihren heimatlichen Kostümen präsentierten, die Männer in Leggins und fransenbesetztem Jagdhemd, die Weiber in kurzen, perlenbestickten Röckchen, ebenfalls ein ledernes Jagdhemd tragend, erkannte man das Charakteristikum der nordamerikanischen Rasse sofort. Ebenso gekleidet waren auch ihre Führer, die Geschwister Richter.
Was nun diese Reitertruppe aus dem Wilden Westen an equestrischen Kunststückchen leistete, läßt sich nichtbeschreiben. Das sagten auch immer die Zeitungen, wenn sie sich mit den einzelnen Personen beschäftigten. Die Vorstellung selbst könne man nicht schildern, das müsse man sehen.
Es war fabelhaft. Die acht Reiter und Reiterinnen leisteten das Menschenmöglichste und sogar Menschenunmöglichste. Die Pferde waren ihnen bewegliche Turngeräte. Und doch eigentlich nicht, daß sie sich als Artisten produziert hätten! Salti mortali und dergleichen Kunstsprünge kamen gar nicht vor. Die nackten Rücken der rasenden Rosse bedeuteten für sie den festen Boden, auf dem sie herumspazierten, durcheinandersprangen, sich gegenseitig besuchten, und so weiter.
Das klingt wohl sehr einfach, aber in Wirklichkeit war es haarsträubend. Personen mit nicht ganz starken Nerven durften manchmal gar nicht hinblicken. Denn es erfolgten oft genug die furchtbarsten Einzel- und Massenstürze.
Und dennoch hallte der ganze Hippodrom von einer Lachsalve nach der anderen wider. Das war eben das Merkwürdige dabei. Der Gedanke, daß da einmal ein Unglück passieren könne, ging immer mehr verloren. Den ersten Anlaß dazu gaben die tollen Reiter selbst. Alles der ausgelassenste Jubel, alles Lachen und Necken. Und beging einmal jemand eine Ungeschicklichkeit, überschlug er sich mit seinem Roß, dann war des Lachens kein Ende.
Es handelte sich darum, einen getriebenen Ball zu ergreifen. Einmal prallten die acht Pferde gleichzeitig zusammen, alle acht stürzten, ihre Reiter unter sich begrabend, ein fürchterlicher Knäuel – diesmal war es geschehen, jetzt hatte das Geschick sie erreicht, es war dennoch Frevel, der bestraft werden mußte – schwupp, da standen sie schon wieder auf ihren galoppierenden Pferden, lachend und jubelnd wie die Kinder.
Der Ball wurde durch ein Wickelkind ersetzt, das man ihnen zuwarf. Jetzt ging es um das Wickelkind, nur in anderer Weise, zu zwei und zwei. Immer ein Reiter und eine Reiterin warfen es sich zu, die anderen Paare machten es ihnen streitig. Wieder ging es dabei haarsträubend zu.
Natürlich war es nur eine Puppe. Da, hoch oben in der Luft, platzten die Kissen, lachend wurde der Inhalt aufgefangen, ein richtiges, lebendiges Kind, offenbar ein kleines Indianermädchen, und die Entfernung täuschte doch sehr, im Säuglingsalter war es nicht mehr, es konnte schon recht tüchtig laufen, und dieses Kind hatte hundertmal unter den Hufen der Pferde gelegen.
Und um zu zeigen, daß es sich nicht etwa um eine schnelle Vertauschung gehandelt habe, die ursprüngliche Puppe nur im letzten Moment mit einem lebendigen Kind ausgewechselt worden sei, wurden jetzt mit dem zappelnden und immer vor Lust kreischenden Mädchen dieselben haarsträubenden Manöver ausgeführt.
Dann sprangen alle ab, die acht Pferde rannten hinaus, auf dem letzten das kleine Indianermädchen lustig tanzend, und herein galoppierte ein einzelnes Pferd, ein riesenhafter Gaul, dabei aber doch vom schönsten Ebenmaß.
Es war die Schlußszene, nur noch eine Gratiszugabe, ein letzter Spektakelakt.
Die Musikkapelle schmetterte den faszinierendsten Radaumarsch, über den ihr Repertoire gebot, immer mächtiger griff der ungeheure Schimmel aus. Die im engeren Kreis herumrennenden Männer und Mädchen brüllten und quiekten, wie nur Indianer und Indianerinnen brüllen und quieken können. Der blondhaarige Führer der Truppe löste sich ab, nahm einen Anlauf und stand mit einem Satz auf dem nackten Rücken des galoppierenden Rosses – dann kam die Schwester und stand neben dem Bruder – dann kam ein Indianer angesetzt und stand hinter Käthe Richter – dann kam eine Indianerin und stand wieder hinter dem roten Krieger.
›Genug, genug!‹ hörte man im Publikum staunend und angstvoll rufen. Ja, es war genug, diese vier Menschen auf dem im Gebiß schäumenden Pferd, und so mächtig dieses auch sein mochte, es war doch nur ein irdisches Pferd.
Nein, es war eben noch nicht genug, das war erst die Hälfte – und auch noch die vier anderen sprangen nacheinander hinauf, hielten lachend einander fest, der erste vorn auf dem Hals, die letzte Indianerin hinten schon mehr auf dem Schwanz als auf dem Rücken des Schimmels stehend, der mit unverminderter Schnelligkeit im Kreis herumjagte, und man konnte ihm wahrhaftig nicht anmerken, daß diese acht erwachsenen Menschen für ihn eine Last bedeuteten.
Gleichzeitig sprangen die acht herab, rannten durch die Arena, drehten wie auf Kommando um, faßten sich bei den Händen, rannten zurück, alle gleichzeitig einen kolossalen Ansatz, und mit geschlossenen Händen standen alle gleichzeitig wieder auf dem Pferderücken.
Wieder herunter, wieder durch die Arena gerannt, umgedreht, an den Händen gefaßt, zurückgerannt – und mit einem Satz waren alle acht gleichzeitig, mit angefaßten Händen, über den ganzen Riesengaul hinweggesprungen.
Noch einmal einen Anlauf genommen, immer brüllend und lachend, noch einmal hinaufgesprungen, diesmal oben stehengeblieben, und so jagte der Schimmel mit seinen acht Reitern und Reiterinnen hinaus, begleitet von dem tosenden Beifall des vieltausendköpfigen Publikums.
Ja, man hatte das Fabelhafteste gesehen, was die exzentrische Reitkunst je geboten hat!
Die brauchten sich keine pomphaften Namen zu geben, ›Reinhold Richters Reitertruppe‹ genügte, um jede weitere Reklame wäre es nur schade gewesen. – – –
Die Zeitungen, welche auch ohne Bezahlung dem Publikum gegenüber ihre Pflichten haben, sagten also gleich, daß sie über die Vorstellungen von Reinhold Richters Reitertruppe im Hippodrom nicht berichten könnten. Das müsse man sich mit eigenen Augen ansehen, und wer das nicht getan hätte, der habe nichts gesehen.
Dagegen erzählten die Zeitungen sehr viel von den Mitgliedern der Truppe, und das war sensationell genug, und dabei war ganz deutlich herauszulesen, daß es sich hier nicht um bezahlte Reklameartikel handelte.
Ja, sensationell und abenteuerlich genug, dabei höchst tragisch, wie ein Roman zu lesen.
Das war keine Zirkustruppe, die ein Impressario zusammengetrommelt hatte, sondern es gehörten noch andere Indianer dazu, die aber schon zu alt oder noch zu jung waren, um da mitmachen zu können, und alle zusammen waren die letzten Reste des einst so mächtigen Stammes der Navajos, deren ungeheure Jagdgebiete im Arizona-Territorium vom Colorado bis zum Chaco reichten, und dieser blonde, schlichtgescheitelte Reinhold Richter war als Titlisatwa oder als der Springende Hirsch ihr Häuptling, wie ihn nur jemals ein Jugendschriftsteller seinen Lesern glaubhaft machen möchte.
Anfang der siebziger Jahre war Gottfried Richter, über dessen Nationalität bei diesem Namen wohl keine weitere Auskunft gegeben zu werden braucht, mit seiner ihm soeben erst angetrauten jungen Frau nach Amerika ausgewandert, zusammen mit noch anderen Familien, die schon in den heimatlichen Bergen getreue Nachbarn gewesen waren.
Bis nach dem äußersten Westen, bis nach Arizona hatte der Fahrschein gelautet, den sie schon in der Heimat gelöst, wie sie auch gleich in der Heimat den Grund und Boden gekauft hatten, ungeheure Areale für billiges Geld, und auf diesen floß dennoch Milch und Honig, vier Ernten im Jahr, die Goldklumpen mußte man nicht erst ausgraben, sondern brauchte sie nur aufzuheben.
Wer die Verhältnisse kennt, der weiß, wie diese biederen deutschen Bauern hereingefallen waren. Die Milch war nur in unausrottbarem Unkraut vorhanden, der Honig hatte sich inzwischen in Kiefernpech verwandelt, und die Goldklumpen sahen schwarz aus und machten alle Pflüge zuschanden.
Trotzdem, sie siedelten sich an und waren überhaupt anfangs recht zufrieden. Mit den auszurodenden Bäumen wußten sie Bescheid, denn es waren Waldbauern, und es waren, wie wir später erfahren werden, noch ganz besondere Bauern Deutschlands, sie waren hocherfreut über die Unmenge von Wild, das es hier gab, da konnten sie ja nach getaner Arbeit noch nach Herzenslust jagen.
Jawohl, jagen!
Bald waren es die Hirsche, welche die Bauern jagten. In einer einzigen Nacht fraßen die Wanderhirsche die ganze grüne Saat ab.
Und dann merkten die Navajos, daß sich die Bleichgesichter in ihren Jagdgründen niedergelassen hatten. Und nun begann ein endloser Kampf zwischen Rot und Weiß, mit allen Abenteuern, wie sie so oft geschildert worden sind, aber auch mit allen blutigen Schrecken, mit verzweifelt kämpfenden Männern und mit die Hände ringenden Müttern.
Unter solchen Verhältnissen wuchsen der gleich nach der Ankunft geborene Reinhold und seine zwei Jahre später nachfolgende Schwester Käthe auf. Schon als zartes Kind mußte auch das blonde Käthchen die Büchse auf den roten Feind abdrücken, mußte dem auf dem Vater knienden Indianer mit dem Beil den Kopf spalten – recht hübsch in der Mitte.
So wurde Reinhold achtzehn Jahre, und der junge Grenzmann, dessen Befehlen während des Kampfes sich all die alten Bauern unterwarfen, war der einzige, der noch die Navajos etwas im Zaum halten konnte. Sie hatten ihm schon längst Ehrennamen gegeben wie Tod der Prärie, die Blitzende Büchse und dergleichen, immer Bezug nehmend auf seine Treffsicherheit – am meisten aber imponierte den Rothäuten, die stets auch einen gediegenen Feind bewundern, seine fabelhafte Springfertigkeit, und so war er der Titlisatwa geworden, der Springende Hirsch.
Eines Tages wurde Titlisatwa Zeuge, wie der Häuptling der Navajos von einem herumstromernden Blaßgesicht hinterlistig ermordet wurde. Retten konnte er den Häuptling nicht mehr, der Mann war schon tot – aber Reinhold jagte dem schurkischen Blaßgesicht nach, bis er es hatte und noch viel blasser machte.
Als die Navajos das erfuhren, sagten sie: »Uff, der große Geist hat uns mit Blindheit geschlagen, daß wir unseren Freund für einen Feind halten – uff, warum kämpfen wir gegen ihn, uff? – Uff, wir müssen einen neuen Häuptling haben – uff, Titlisatwa soll unser Häuptling sein, howgh.«
Und sie zündeten ein großes Feuer an, und obgleich der Stamm schon damals nur noch sieben Krieger zählte, die noch über gute Zähne verfügten, so fraßen diese sieben Krieger mit den guten Zähnen doch innerhalb dreier Tage fünf Hirsche, drei Wildschweine, einen Bären und einen halben Büffel – das kleinere Viehzeug gar nicht mitgezählt – und nachdem sie ihren Appetit fürs erste gestillt hatten, wurde Titlisatwa, der die Ehre angenommen und dem dreitägigen Frühstück beigewohnt hatte, zum Häuptling gestempelt, mit glühenden Nadeln und Schießpulver – und dann wurde unter seinem Präsidium erst der richtige Festschmaus abgehalten, wobei acht Hirsche, zwei Bären … Doch diese Zahlen interessieren den Leser wohl nicht.
Kurz vor diesem Ereignis, das die größte Umwälzung in der Existenz der Kolonien bedeutete, hatten diese beschlossen, dem heillosen Arizona mit all seiner Milch und seinem Honig doch endlich den Rücken zu kehren, hatten schon anderen Grundbesitz gekauft, mit dem sie, nun gewitzigt, nicht wieder so hereingefallen waren.
Da sie den neuen Boden schon bezahlt hatten, mußten sie nun auch gehen, und überhaupt – die bösen Erinnerungen! Die Eltern Reinholds und Käthes gingen aber nicht mit – die waren beide schon tot, ohne Skalp begraben, nicht unter der Erde, sondern unter den brennenden Balken ihres Blockhauses.
Reinhold hatte einen Plan. Er war zwar ganz richtiger Häuptling der Navajos, wollte es auch bleiben, aber doch so mehr z. D. Er hatte schon immer an eine Pferdezucht gedacht – wenn diese roten Schufte nur nicht alle Pferde mausen würden. Na, diese Eventualität war ja jetzt überwunden, er hatte doch jetzt die Ehre, der Häuptling dieser roten Schufte zu sein, die würden doch nicht ihren Landesvater bemausen.
Also Reinhold kaufte den Bauern ihr gesamtes Areal ab – ohne einen Cent Anzahlung – dann sah er sich nach geeigneten Tieren zur Pferdezucht um. Denn die indianischen Klepper konnte er, wenn er wirklich Geld verdienen wollte, zu so etwas nicht brauchen, so große Vorzüge diese Klepper auch für gewisse Zwecke haben mögen.
Nun, er brauchte nicht lange zu suchen. Seine treuen Navajos gingen für ihn auf die Suche, und alsbald brachten sie ihm einige wirklich prachtvolle Hengste und Stuten, die sie irgendwo gekauft hatten – ohne einen Cent Anzahlung – und es ist auch niemals herausgekommen, wem die herrlichen Tiere früher gehört hatten. Die treuen Navajos hatten auch ein paar ganz frische Skalpe am Gürtel hängen, ohne daß ihnen ihr Häuptling deshalb Vorwürfe machte. Denn man befand sich im Wilden Westen Amerikas, wo der Witz blutig sein muß, wenn man darüber lachen soll, und deshalb ist hier auch dieser Ton gewählt.
Und die Pferdezucht florierte glänzend. Reinhold Richter stand auf dem Punkt, ein schwerreicher Mann zu werden. Allerdings arbeitete er vorläufig nur mit fremdem Geld. Aber das tut ja nichts. Es ist doch schon fein, wenn man viel Geld geborgt bekommt – zumal in Amerika. Seine einstigen Nachbarn hatte er schon ausgezahlt eine ganz erkleckliche Summe – und die geborgten Gelder verwendete er zum Bau großartiger Stallungen und anderer notwendiger Gebäude, es gehört überhaupt ein großes Betriebskapital dazu.
Also Reinhold stand auf dem Punkt, ein schwerreicher Mann zu werden. Aber über diesen Punkt sollte er trotz all seiner Springfertigkeit nicht hinauskommen. Denn gerade in dem Moment, da er zum Sprung ansetzte, erschienen einige schwarze Herren, legitimierten sich als Staatsbeamte und bewiesen ihm klipp und klar, daß er gar kein Recht habe, hier herumzuwirtschaften, denn dieser Grund und Boden gehörte schon seit der Entdeckung Amerikas oder noch früher einer New Yorker Aktiengesellschaft mit unbeschränkter Hoffnung, und die Kaufkontrakte, die Reinhold vorzeigte, hätten absolut keine Gültigkeit, solche Wische könne jeder deutsche Schwindler machen.
Kurz und gut, der springende Hirsch war bankrott. Und dann gingen die schwarzen Herren zu den roten Männern und bewiesen ihnen ebenso klipp und klar, daß sie schon längst ins Indianerterritorium gehörten, und wenn sie nicht innerhalb von vierzehn Tagen hier spurlos verschwunden wären, dann würden sie von uniformierten Männern mit langen Säbeln und Karabinern bei den Schweinsohren dorthingeführt, wohin sie gehörten.
Reinhold Richter kratzte sich in den Haaren, dann rief er sein Volk zusammen, und nachdem am Beratungsfeuer das Kalumet herumgegangen war, sagte er ungefähr folgendes:
»Wir wollen den Tomahawk nicht ausgraben gegen die Blaßgesichter, die uns aus der Heimat verjagen wollen. Es hat keinen Zweck, da würden wir den kürzeren ziehen. Das seht ihr wohl selbst ein, ich bin doch nicht umsonst drei Jahre euer Häuptling gewesen und habe euch belehrt. Wir wollen uns ehrlich durch die Welt schlagen. Es ist ja nicht unbedingt nötig, daß wir gerade ins Territorium gehen, so mache ich euch einen Vorschlag. Einige von euch waren doch mit mir in Santa Fe, und da haben wir den Mann gesehen, der sich Buffalo Bill nennt. Was der kann, können wir auch, haben es schon gelernt, noch viel mehr. – Auf! Als solch eine Reitertruppe wollen wir in die weite Welt gehen. Uff, der Springende Hirsch hat gesprochen!«
»Howgh, howgh!« bellten die Navajos begeistert, und sie packten ihre Siebensachen zusammen.
Da muß noch etwas nachgetragen werden.
Als Reinhold den ersten Transport junger Pferde eigener Zucht zum Verkauf nach der nächsten größeren Stadt gebracht hatte, nach Santa Fe, nur kleine dreihundert Meilen von seiner Züchterei entfernt, begleitet von seiner Schwester und einigen Navajos, hatte dort gerade Buffalo Bill mit seiner Truppe gastiert.
Reinhold und seine Schwester staunten nicht minder als die Indianer über das, was sie da zu sehen bekamen. Sie waren ganz voll Begeisterung, versäumten während ihres Aufenthalts in Santa Fe keine Vorstellung, hätten am liebsten gleich mitgemacht.
Sie mußten zurück. Aber das Geschaute hatte einen nachhaltigen Eindruck auf sie gemacht. Sie hatten gesehen, daß es noch eine andere Art des Reitens gibt, als nur die Beine über dem Pferderücken zu spreizen. Sie versuchten nachzumachen, was sie gesehen hatten, und sie konnten es eigentlich sofort. Der Pferderücken war ja von jeher ihr wahrer Aufenthaltsort gewesen, Käthe nicht ausgeschlossen. Und bei Buffalo Bills Truppe waren schon damals Cowgirls gewesen, also Weiber, die es den Cowboys im Reiten und Schießen gleichtun, auch einige Indianerinnen.
Es ist ja sonst nicht üblich, daß die jungen Indianermädchen mit ihren Brüdern um die Wette reiten. Reiten können sie wohl alle, in der Not auch einen Gegner zu Boden strecken, aber sonst ist die Squaw doch nur eine Arbeitssklavin;
Jetzt aber nahm sich Käthe, durch das Gesehene begeistert, die noch vorhandenen jungen Mädchen der Navajos vor. Was andere konnten, mußten die Töchter ihres Volkes auch können. Sie selbst konnte es, ohne es gelernt zu haben. Das heißt, sie hatte bisher nur noch gar nicht probiert, ob es möglich sei, mit einem Anlauf auf den Rücken eines rennenden Pferdes zu springen und oben stehenzubleiben. Aber sie hatte wie ihr Bruder von irgendeinem Ahnen eine fabelhafte Sprungkraft geerbt, und als sie es das erste Mal probierte, gelang es ihr eben, und der schwankende Pferderücken hatte ihr ja von jeher festen Boden bedeutet.
So bildete sie jetzt auch die Indianermädchen in solchen Kunststücken aus, und die jungen Männer wollten doch ihren Schwestern nicht nachstehen, und die beiden Geschwister besaßen Phantasie, sie erfanden immer neue Spiele und Tricks zu Pferde, die sie bei Buffalo Bills Truppe nicht gesehen hatten. Kurz und gut, so entwickelte sich aus der Pferdezüchterei nebenbei im Spiel eine Artistentruppe, die in jedem Zirkus hätte auftreten können.
Bisher war das also nur zum eigenen Vergnügen getan worden. Jetzt sollte das Gelernte zum Lebensunterhalt dienen, und so in der Welt herumreisen, das war gerade nach Reinholds Geschmack, und Käthe machte selbstverständlich mit.
Also, die jungen Krieger der Navajos packten zusammen, was sie mitnehmen wollten, ihre Waffen und Skalpe, ihre Pfeifen und den Federschmuck, die Greise und die alten Weiber und die kleinen Kinder. Reinhold suchte unter den Pferden, die ihm geblieben waren, die besten aus, und so zog die neugebackene Artistengesellschaft nach Santa Fe.
Was ein Impressario ist, wußte Reinhold, und er wußte auch, daß irgendeine Truppe, die sich öffentlich produzieren will, ohne Impressario, ohne Geschäftsleiter, gar nicht mehr auskommt. Selbst der einzelne Künstler, der gar nichts weiter bedarf, nimmt, wenn er schlau ist, einen Impressario, mit dem er den Gewinn teilt, nur daß er nichts mit den geschäftlichen Angelegenheiten zu tun hat. Denn dazu gehört eine Erfahrung, von der sich der Laie gar nichts träumen läßt. Und wenn eine Schauspielerin auch Sarah Bernhardt heißt, sie kann ohne solch einen mit allen Hunden gehetzten Impressario und Entrepreneur nicht auf Gastreisen gehen. Sie würde nicht den zehnten Teil dessen einnehmen, was sie auch nach der Teilung noch behält, und allüberall würde man sie übers Ohr hauen.
Dies alles hatte Reinhold erfahren, als er sich mit Mitgliedern von Buffalos Truppe befreundet hatte.
Doch wie solch einen schneidigen Impressario finden? Nun, der intelligente Reinhold wußte Rat. Das Annoncieren und Reklamemachen in Zeitungen ist bereits veraltet. Er machte es, ohne etwas davon zu wissen, genauso wie die englischen Taratabumdiecmädchen, als sie den europäischen Kontinent bereisen wollten. Als ihr Dampfer nach Hamburg kam, führten diese sieben Mädchen ihre tollen Tänze gleich auf der Straße auf, wurden, als sie nicht nachließen, von der Polizei prompt eingesperrt. Vor den Polizeioffizier zur Verantwortung geführt, quirlten sie dem mit den Beinen vor der Nase herum, und nun mußten sie wirklich brummen. Aber machte nichts, jetzt brauchten sie keine Reklame mehr, die Zeitungen hatten nun schon genug von ihnen erzählt, jetzt rissen sich die Varietés um sie.
Reinhold gab seine erste Vorstellung mitten auf dem Marktplatz von Santa Fe, ohne Eintrittsgeld zu erheben, und schon am anderen Tag fand zwischen mehreren herbeigeeilten Impressarios eine förmliche Auktion statt.
Nur ein Jahr lang reiste die Truppe in Amerika von Stadt zu Stadt. Damals führte sie noch einen pomphaften Namen, die Vorstellungen waren auch ganz anders als jetzt hier in London, nicht so ernst als Schulreiter, sie traten nur als Indianer auf, machten Überfälle und dergleichen, wobei auch alle alten Männer und Weiber und Kinder mitwirken mußten – ein zweites ›Wildwest‹, und der Impressario kündigte immer pomphaft an, daß Buffalo Bills Truppe durch die seine hier weit übertroffen werde, was aber durchaus nicht der Fall war.
In New York entzweite sich Reinhold mit seinem Impressario, er übernahm die Führung allein, begab sich nach London, um hier unter dem Namen ›Reinhold Richters Reitertruppe‹ in dem Fach der exzentrischen Reitervorstellungen eine ganz neue Spezialität einzuführen. –
So erzählten die englischen Zeitungen. Daher kam es auch, daß man noch gar nichts von dieser amerikanischen Truppe gehört hatte. In Amerika waren sie als Buffalo Bills Nachahmer eben gänzlich unbedeutend gewesen, nur so eine Art Jahrmarktstruppe, die sich doch mit keinem Zirkus vergleichen kann. Hier in London hatten sie sich gehäutet, jetzt waren sie einzig dastehend.
Merkwürdig nur, daß die Zeitungen gar nicht berichteten, was Reinhold Richter pro Woche oder Abend bekam. Denn das will das englische Publikum immer wissen, und je größer die Gage, desto häufiger nennen die Zeitungen diese Zahlen, noch eine Null dazumachend.
Kapitel 2
2
Die vierte Abendvorstellung von Reinhold Richters Reitertruppe fand statt. Es gingen ihr stets erst einige andere Nummern voraus, der beste Bissen wurde bis zuletzt aufgespart.
Endlich war alles andere überstanden, was das Publikum gar nicht mehr interessierte.
Endlich setzte der leise, faszinierende Marsch ein, jetzt, jetzt mußten die Schulreiter auf ihren prächtigen Rossen kommen …
Nein, sie kamen nicht, und der Marsch war schon weit fortgeschritten.
Das Publikum wurde unruhig.
Da verstummte auch noch die Musik mitten im Ton, und in der Manege erschien Mr. Menoni, der wohlbekannte Direktor des Hippodroms, der auch manchmal als Schulreiter und als Stallmeister auftrat.
»Ladies und Gentlemen, God save the King. Leider muß ich mitteilen, daß die nächste Nummer ausfällt. Reinhold Richters Reitertruppe ist von einem großen Unfall betroffen worden, nicht nur Mr. Reinhold Richter ist schwer erkrankt … «
»Gott bewahre«, ließ sich da eine sonore Stimme, die den ganzen ungeheuren Zirkus beherrschte, vernehmen, und neben den Direktor war schnellen Schrittes Reinhold Richter getreten, schon im Reitfrack und Zylinder. »Ich bin kerngesund, die Sache ist nur die, daß mir der Broker soeben meine Pferde und alles gepfändet hat, bis auf diesen Anzug, den ich auf dem Leibe hatte … «
Auch er kam nicht weiter. Die Unruhe im Publikum wurde zu groß, und da es nun einmal so weit war, kam es auch gleich zum Tumult.
Mr. Richter kümmerte sich nicht weiter darum, er zuckte die Achseln und ging zurück.
Das Publikum verhielt sich wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten. Anstatt den Direktor anzuhören, der zu sprechen begehrte, tobte es immer mehr, verlangte die Fortsetzung oder das Geld zurück, die Klügsten machten schon jetzt, daß sie hinauskamen, denn hier gab es noch Prügel.
In einer Loge hatte einsam ein alter Herr gesessen. Die sechzig hatte er gewiß schon überschritten, sein Haupthaar war auch schneeweiß, trotzdem konnte man ihn noch nicht alt nennen, er machte noch einen sehr stattlichen, rüstigen Eindruck, das alte Gesicht war etwas sehr gerötet, und den Schnurrbart hatte er sich schwarz gefärbt, was aber von dem weißen Haupthaar sehr wirksam abstach. Er war, wie man sagt, ein schöner Mann, trotz seines Alters, und das wußte er, danach kleidete er sich auch, obgleich er nur einen schwarzen Gesellschaftsanzug trug, aber die Orchidee im Knopfloch durfte nicht fehlen.
Bei jeder Gelegenheit waren die Operngläser von den anderen Logen und besseren Plätzen auf ihn gerichtet gewesen, aber auch in den obersten Galerien wußte man seinen Namen zu nennen.
Jetzt erhob sich der Gentleman schnell, Zylinder, Sommerüberzieher und Stock hatte er neben sich liegen gehabt, und noch ehe das Gedränge begann, hatte er schon den Ausgang erreicht.
Aber er nahm einen anderen Weg als den nach der Straße, schwenkte links ab und betrat den Korridor, der nach den Ställen und nach den anderen inneren Räumen des Hippodroms führte.
Dem Publikum war hier der Zutritt verboten. Personal war genug vorhanden, einige wollten den Eindringling denn auch zurückweisen, aber gleich nach einem genaueren Blick auf diesen Herrn wurden sie unsicher, und dann brauchte ihnen von den anderen nur etwas zugeflüstert zu werden, und sie zogen sich ehrerbietig zurück.
Wie noch manch anderer, so schlug auch ein alter Bereiter mit ellenlangem Schnurrbart vor dem vorübergehenden Herrn die Hacken sporenklirrend zusammen und salutierte.
Der Herr blieb vor ihm stehen.
»Unter mir gedient?«
»Zu Befehl, mein General – Mac O'Harrly, Korporal im 4. Lancierregiment, 2. Schwadron, Waterhills, Ladysmith und Maseking.«
Es waren einige Schlachtfelder, die der Mann nannte, auf denen sich die Engländer allerdings nicht mit besonderem Ruhm bedeckt haben – wenigstens nicht in den Augen der anderen Welt, sie selbst setzen ja aber dazu ihre eigene Brille auf.
»Richtig, ich entsinne mich – Mac O'Harrly – Korporal im – im … «
»4. Lancierregiment, 2. Schwadron.«
»Richtig, richtig, ich entsinne mich«, wiederholte der General, der aber kein Alexander der Große war, der jeden Soldaten mit Namen anreden konnte. Dieser hier hatte schon wieder die Nummer des ganzen Regiments vergessen.
Aber der ehemalige Korporal begann vor Freude zu strahlen, und er mußte seinem Herzen Luft machen.
»Mein General, wenn diese blutig gottverrrrrdammten Bur… «
»Schon gut, schon gut! Was ist das eigentlich mit Reinhold Richters Reitertruppe?«
Der Bereiter erstattete Bericht über Rrrreinhold Rrrrichters Rrrreitertruppe.
Wir sagen gleich, was auch dieser Mann vielleicht noch nicht wußte.
Reinhold Richter hatte damals mit seinem amerikanischen Impressario gebrochen, weil er immer mehr einsah, wie sehr dieser ihn ausnützte, und zwar in noch ganz anderer Weise, als Impressarios es sonst tun. Daß diese den Löwenanteil nehmen, ist eigentlich ganz selbstverständlich. Den jungen Mann hatte jener bei dem Kontrakt aber ganz einfach übers Ohr gehauen.
Zweitens gefiel es Reinhold nicht, daß der Impressario solche Reklame mit ihm machte, und zwar auf eine ganz ungeschickte Weise, Broschüren über ihn und die anderen Mitglieder der Truppe herausgab, deren furchtbar übertriebener Inhalt ganz auf Unwahrheit beruhte.
Drittens wollte er nicht immer mit Buffalo Bill verglichen werden, dem er als Schausteller ja auch tatsächlich nicht das Wasser reichen konnte, er wollte seine eigenen Wege gehen.
Kurz und gut, der junge Mann hatte seinem Impressario weniger gekündigt als ihn vielmehr einfach hinausgeschmissen, und dann hatte er selbst die ganze Leitung in die Hände genommen, so war er mit seiner Truppe nach England gefahren, und auch das erste Auftreten als Schulreiter war seine eigene Erfindung und Einstudierung.
Allerdings wußte Reinhold, daß er dem Kontrakt nach drei Jahre lang nur unter der Leitung dieses Impressarios arbeiten, nicht für eigene Rechnung auftreten durfte, oder er hatte eine Konventionalstrafe von 100 000 Dollar zu zahlen.
Reinhold aber glaubte sich in seinem guten Recht, und der unschuldige Jüngling befand sich noch in dem holden Wahn, daß es in der Welt noch etwas weit Höheres gebe als die geschriebenen Gesetze, er träumte noch von einer idealen Gerechtigkeit, die nur vom Herzen diktiert wird, und die auch alle Richter anerkennen, träumte vielleicht sogar noch, daß die Bitte ›und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern‹ von der allgemeinen Menschheit als Richtschnur ihres Handelns akzeptiert worden sei.
Nun, der amerikanische Impressario belehrte ihn schnell eines anderen. Nur drei Tage länger als die Überfahrt hatte es gedauert, um die Angelegenheit den englischen Gerichten zu übergeben und auch gleich rechtskräftig zu machen.
Jetzt, fünf Minuten vor der Vorstellung, war der Gerichtsvollzieher erschienen, der Broker.
»Hier ist das Urteil. Kannst du die 20 000 Pfund Sterling bezahlen? Nein? Dann her mit allem, was du hast!«
In England kann nichts gepfändet werden, was man zur erfolgreichen Ausübung seines Berufs braucht, der Näherin nicht die Nähmaschine, dem Schriftsteller nicht die Schreibmaschine, und behauptet er, am Klavier phantasieren zu müssen, um Ideen zu bekommen, so auch dieses nicht.
Hier lag aber etwas ganz anderes vor. Die Truppe durfte überhaupt nicht eher wieder auftreten, als bis Reinhold Richter die 100 000 Dollar gezahlt hatte, und da er es nicht konnte, wurden ihm die Pferde und alles andere weggenommen, und da dies nach Ansicht des Gerichtsvollziehers noch nicht langte, ihm und seiner Schwester, die gleichfalls mit haftbar war, die Uhr aus der Tasche und der Ring vom Finger.
Wenn der Herr dies nicht alles so ausführlich erfahren hatte, so wußte er jetzt doch genug.
»Was sagt denn Direktor Menoni dazu?«
Der faßte die Sache höchst kaltblütig auf. Der hatte von allem Anfang an gewußt, daß es so kommen würde. Deshalb hatte er die Truppe auch nur von Abend zu Abend engagiert, und mit den ersten drei Abenden war er zufrieden, er hatte ein Bombengeschäft gemacht.
»Wo wird Mr. Richter zu finden sein?«
»Der ist gewiß im Wigwam, der Broker ist ja noch drin.«
»Im Wigwam?«
»So nennen wir den Raum, in dem sich die ganze Indianergesellschaft eingerichtet hat.«
»Führen Sie mich hin!«
Der große Raum, den er betrat, glich allerdings wenig einem indianischen Wigwam, war aber ganz so eingerichtet, indem die Wände mit bemalten Fellen behangen waren, überall hingen und lagen andere Gegenstände herum, die man in jedem indianischen Wigwam findet, und auch die Menschengruppen paßten ganz dazu, mit einigen Ausnahmen, die dazu in seltsamem Kontrast standen und fast humoristisch wirkten.
Der Broker war noch bei der Arbeit, hatte es gerade mit Reinhold und seiner Schwester persönlich zu tun.
Wie schon erwähnt, gehörten außer den acht auftretenden Personen noch siebzehn weitere zu der ganzen Gesellschaft. Eben der ganze Stamm war mitgekommen. Reinhold fütterte alle mit durch, und sie konnten ja auch im Pferdestall und sonstwie hinter den Kulissen beschäftigt werden.
Es waren ältere Männer und Frauen und halbwüchsige Kinder, von denen nur das eine, ein vierjähriges Mädchen, schon als Fangball mitwirken mußte. Sie hatten ihre heimatliche Kleidung beibehalten, ebenso ihre Sitten, und so lungerten sie nach alter Weise in dem Wigwam herum. Die Alten rauchten ihr Kalumet, eine jüngere Frau gab ihrem Kindchen die Brust, und obgleich sie wußten, was der uniformierte Mann wollte, daß er ihren Vorstellungen ein Ende bereitete, ihnen Pferde und alles nahm, so regten sie sich deshalb doch nicht im geringsten auf. Es waren eben stoische Indianer.
Seltsam aber nahmen sich die sechs Indianer und Indianerinnen aus, die sich schon im modernen Reitkostüm befunden hatten.
Wenn man sie so als vollendete Ladies und Gentlemen in die Manege einreiten sah, glaubte man doch, wirklich solche Ladies und Gentlemen vor sich zu haben, und entpuppten sie sich dann als Indianer, so wurde an dieser Meinung noch immer nichts geändert. Wohl mochten es echte Rothäute sein, aber die waren doch schon längst von der Kultur vollkommen beleckt, unterschieden sich von zivilisierten Europäern nur durch die Hautfarbe.
So dachte man, und hier zeigte sich, daß man da ganz falsch gedacht hatte. Es waren noch immer ganz waschechte Indianer, Söhne und Töchter der amerikanischen Wildnis, die all ihre Sitten und Lebensansichten auch hierher in den Londoner Hippodrom mitgebracht hatten.
Sie befanden sich also schon im modernen Reitanzug. In diesem steckten aber echte Indianer, und wie solche hatten sich die befrackten Herren niedergekauert und rauchten gleichmütig ihre lange, federgeschmückte Pfeife, den Zylinder noch auf dem Kopf, mit Ausnahme des einen, der auch die Perücke abgenommen hatte und so eine prächtige ölgetränkte Skalplocke auf dem sonst nackten Schädel zeigte, was in dem Frackanzug nun erst recht einen possierlichen Eindruck machte.
Ganz genauso betrugen sich auch die drei Schulreiterinnen. Auch sie hatten sich in ihren langen Schleppkleidern hingehockt, teilnahmslos vor sich hinstarrend, dem pfändenden Broker nicht den geringsten Blick schenkend. Die eine, so hübsch wie alle anderen, war, obgleich selbst fast noch ein Kind, ebenfalls schon glückliche Mutter. Und die elegante Schulreiterin hatte, am Boden hockend und den Zylinder auf dem hochfrisierten Haar, die Taille aufgeknöpft und reichte dem Baby die schwellende Brust, wie alle übrigen bereit, in der nächsten Minute wieder aufs Pferd zu steigen und darauf die halsbrecherischsten Evolutionen zu machen, oder ins Gefängnis zu gehen, oder sich begraben zu lassen – ganz wie es dem Großen Geist und Reinhold Richter beliebte.
Die Geschwister Richter zeigten sich etwas lebendiger, aber auch sie faßten den ganzen Fall eher humoristisch als tragisch auf.
Soeben hatte der Broker ihm die goldene Uhr mit Kette abgenommen, dann die wertvollen Ringe, die so ein Artist nun einmal haben muß. Die Barschaft war natürlich das erste, das mit Beschlag belegt wurde – etwas über hundert Pfund Sterling.
Jetzt kam Miß Käthe Richter dran.
»Haben Sie bares Geld bei sich?«
»Nicht einen roten Cent!« lachte das blühende, jetzt zwanzigjährige Mädchen, und die Lustigkeit klang durchaus nicht gekünstelt.
»Bitte, Ihre Ringe!« sagte der höfliche englische Gerichtsvollzieher, der aber sonst nur noch hartnäckiger ist als jeder deutsche.
»Bitte, hier!«
Sie streifte zwei Diamantringe und einen mit einem Rubin ab. Sie mußten doch schon Geld verdient haben.
»Und hier meine Diamantbrosche!«
Sie wollte sie ablösen, eine Brosche, so groß wie ein Taler, ganz mit Diamanten übersät.
»Die lassen Sie nur stecken, die ist nichts wert.«
»Was? Für die haben wir 5 000 Dollar bezahlt, und dabei war es noch ein Gelegenheitskauf… «
»Ja, eine Gelegenheit für den Verkäufer. Das sind falsche Steine, selbst die Fassung ist nur Double!«
»Hören Sie, machen Sie uns doch nichts weis!«
»Na, denken Sie, ich werde das nicht unterscheiden können? Auf zehn Meter Entfernung. Die ist einen Dollar wert. Aber um diesen Ring mit der Koralle möchte ich noch bitten. Zwar nichts Besonderes, aber doch immer Gold.«
»Nein, nein, den Ring bekommen Sie nicht!«
»Geben Sie mir den Ring!«
»Das ist ein teures Andenken von meiner Mutter, das einzige, was ich von ihr besitze!«
Oje, mit so etwas kommt man bei einem englischen Broker gerade an den Richtigen!
»Geben Sie mir den Ring, Miß!«
»Aber bitte, es ist ein Andenken von meiner lieben Mutter… «
»Im Namen des Gesetzes: Geben Sie mir den Ring!«
Da war es mit dem Humor vorbei. Das eben noch lachende Mädchen brach plötzlich in bittere Tränen aus, und beim Weinen vergaß es auch die englische Sprache.
»O Reinhold, Reinhold, wenn des unser liabs Mütterl im Grab schaun würd!« schluchzte sie.
»Geh, sei gscheit, Kathi!« tröstete der Bruder in demselben deutschen Dialekt, ihr das blonde Haar streichelnd, aber plötzlich selbst mit feuchten Augen. »Unser Mütterl schaut's ja net, und wir können ja nimmer was dafür … «
»Und nun zum letzten Mal, Miß: den Korallenring!«
»Halt, einen Augenblick!«
Der fremde Herr hatte es gesagt, dessen Eintreten nicht bemerkt worden war – vielleicht von den Indianern, obgleich diese starr geradeaus blickten, aber die waren doch über jede Neugier erhaben.
Einen Blick in das rote, schwarzbärtige Gesicht des weißköpfigen Herrn, und auch der Gerichtsvollzieher klappte die Hacken zusammen und richtete sich stramm auf.
»Sie kennen mich, denke ich.«
»Gewiß, Mylord.«
»Gehen Sie hinaus, bis ich Sie wieder rufe!«
»Zu Befehl, Mylord!«
Der Broker hatte den Wigwam verlassen.
»Sie werden gepfändet, Mr. Richter, wie ich gehört habe und sehe?« wandte sich der Herr jetzt an den jungen Mann.
»Ja, leider. Mit wem habe ich die Ehre?«
»Lord Warwick.«
»Sie können die Pfändung rückgängig machen?«
»Das nicht, das heißt, aufheben kann ich den Befehl nicht, wohl aber alles wieder auslösen.«
»Hören Sie, wenn Sie mir aus dieser Klemme helfen könnten!« rief Reinhold, auf den dies einen viel größeren Eindruck machte als der Lordtitel, freudig.
»Kann ich Sie unter vier Augen sprechen?«
»Unter vier Augen? Darf meine Schwester nicht dabeisein?«
Der Lord warf einen Blick auf die herumlungernden Indianer, die noch immer nicht das geringste Interesse zeigten.
»O gewiß, es kann gleich hier geschehen.«
»Bitte, darf ich Ihnen einen Sitz anbieten?«
Und Reinhold holte einen Pferdeschädel herbei, dachte auch nicht daran, erst eine Decke darüberzulegen, machte nur eine einladende Handbewegung nach dem skelettierten Pferdeschädel.
»Oder ein Lehnstuhl ist dem Herrn wohl lieber«, sagte Käthe eilfertig und brachte aus einem Winkel einen Ochsenschädel mit ansehnlichen Hörnern herbeigeschleift, welche letzteren ja ungefähr Armlehnen vertreten konnten.
Der alte Herr verzog keine Miene, zog nur einen goldenen Klemmer aus der Westentasche und setzte ihn auf die Nase, dann zog er die Hosen hoch, bis das obere Ende der gelben Gamaschen sichtbar wurde, und setzte sich auf den ›Lehnstuhl‹, wobei er sich allerdings sehr kauern mußte.
Reinhold hatte auf dem Pferdeschädelstuhl Platz genommen, nachdem sich seine Schwester, im eleganten Reitkostüm mit dem Zylinder auf dem Kopf, bereits der Länge nach auf den Boden geworfen hatte, das Kinn in die aufgestemmten Arme gestützt, und so lauschte sie der Unterhaltung – ein ganz merkwürdiges Bild bietend.
Das junge Mädchen gehörte eben trotz des modernen Reitkostüms und trotz der Diamantringe noch immer mehr in den Wigwam oder ins Blockhaus als in den Salon.
Die beiden Männer verstanden sich zu unterhalten.
»Hunderttausend Dollar?«
»Ja.«
»Können Sie nicht aufbringen?«
»Nein.«
»Was werden Sie tun?«
»Weiß absolut noch nicht.«
»In andere Dienste treten?«
»Muß wohl.«
»Und wenn Sie die 100 000 Dollar nun bezahlen könnten?«
»Was soll das? Ich habe sie nicht.«
»Wenn ein anderer sie für Sie auslegte?«
»Dann schulde ich sie dem anderen.«
»Ich wäre bereit, die Summe für Sie zu bezahlen.«
»Unter welchen Bedingungen?«
»Wenn Sie in meine Dienste treten.«
»Was für Dienste sind das?«
Der Lord putzte zunächst erst einmal seinen Klemmer und schaute dann den anderen durch die Gläser prüfend an.
»Gefällt Ihnen eigentlich dieses Artistenleben?«
»Nein«, erklang es prompt gleichzeitig aus dem Mund der Geschwister.
»Sie möchten doch lieber in Ihre Urwälder und Prärien zurück, was?«
»Ach, hätten wir doch gar nicht erst so etwas angefangen!« erklang es seufzend wiederum gleichzeitig.
»Hm, dachte ich mir. Kenne ich. Immer die alte Geschichte. Weshalb gehen Sie nicht zurück nach Amerika, als Farmer oder Jäger?«
»Der Impressario würde mich überallhin verfolgen, mir meine Jagdbeute und alles andere stets abzunehmen wissen.«
»Hm, das würde wohl sein. Kenne ich. Alles schon mal erlebt. Wieviel erhalten Sie eigentlich hier?«
»Freie Kost und Logis und Stall und pro Abend zwanzig Pfund.«
»Zwanzig Pfund, alles in allem, nicht mehr?«
»Alles in allem, für fünf Vorstellungen. Dann wäre ein neuer Kontrakt gemacht worden.«
»Direktor Menoni hat gewußt, daß Sie bald gepfändet würden, nicht mehr auftreten können.«
»Das habe ich jetzt auch erfahren – er ist ein Spitzbube.«
»Hm. Zwanzig Pfund kann ich Ihnen freilich nicht pro Tag zahlen, das ist die Geschichte nicht wert. Wären Sie mit fünfzig Pfund pro Monat zufrieden?«
»Ja, wofür denn?«
»Erst eine andere Frage. Daß Sie reiten können, habe ich ja schon gesehen. Stimmen aber auch sonst die Zeitungsberichte? Sind Sie ein echter Hinterwäldler, der mit der Büchse umzugehen und jede Spur zu verfolgen versteht?«
Reinhold lächelte nur und ließ aus dem Mundwinkel einen Pfiff ertönen, und genau dasselbe hatte seine Schwester getan.
Und für den Lord schien das ebenfalls vollständig zu genügen.
»Kennen Sie Afrika?«
»Habe gehört davon.«
»Ich bin der Gouverneur von Ostafrika.«
»Soso.«
Der Lord zog eine Karte hervor und breitete sie auf seinen Knien aus.
»Hier, das rotumgrenzte Gebiet ist englischer Besitz. Hier grenzt eine deutsche Kolonie daran. Dieses ganze Gebirge hier, durch das die Grenze geht, wird nach dem höchsten Berg Kilimandscharo genannt. Die Geographen haben ihm einen anderen Namen gegeben, den Sie aber in Afrika selbst niemals zu hören bekommen werden. Es ist das Kilimandscharogebirge, die höchste Erhebung ist der Kilimandscharoberg. Nur diese nördliche Fortsetzung wird speziell Mondgebirge genannt. Kommt für uns nicht in Betracht. Hier nun, zwischen Kilimandscharo und dem Viktoria-Nyansa-See haben wir auf einem Areal von rund 25 000 Quadratmeilen, da diese uns sonst nichts weiter einbringen, ein Reservat geschaffen – ein Tier-Reservat. Wissen Sie, was das ist?«
Das wußte der Amerikaner um so mehr, als in Amerika auch das Indianer-Territorium allgemein Reservat genannt wird.
»Die Tiere darin dürfen nicht belästigt werden.«
»Ja, es darf darin nicht gejagt werden. Zwischen diesen Grenzen ist ewige Schonzeit, es ist ein heiliges Asyl für alles, was da kreucht und fleucht.«
»Bravo!« ließ sich Käthe vernehmen. »Ach, hätte man doch in Amerika auch beizeiten solch ein heiliges Tierasyl eingerichtet, dann gäbe es dort auch noch Buffalos.«
Es war, als ob es durch die ganze Gesellschaft der stumpfsinnig rauchenden Indianer wie ein elektrischer Schlag ginge, so waren sie plötzlich alle zusammengezuckt. Im nächsten Moment freilich hatten sie sich wieder in Statuen verwandelt.
»Gibt es denn darin aber auch wirklich Wild?« fragte Reinhold.
»Massenhaft! Was meinen Sie wohl! Herden von Tausenden von Giraffen, Zebras, von Gnus und Hartebeests und allen anderen Antilopenarten, auch Strauße und selbst Elefanten noch zu Hunderten, und wo ein Sumpf ist, da trifft man ganz bestimmt auch noch das Flußpferd an, im Urwald das Rhinozeros.«
»Auch Buffalos?«
»Büffel zu Tausenden.«
Reinhold wandte den Kopf, und seine Augen leuchteten seltsam.
»Hört ihr? Es gibt ein Land, in dem noch Tausende von Buffalos weiden.«
Schon vorher war wiederum so ein elektrischer Schlag durch alle die roten Söhne des großen Geistes gegangen, ganz offenbar war nur das Wort ›Buffalo‹ die elektrische Batterie, von der der Strom ausging, und jetzt nahm ein uralter, zusammengeschrumpelter Greis die federgeschmückte Pfeife langsam aus dem zahnlosen Mund.
»Uff, Buffalo«, sagte er, nichts weiter, dafür aber reckte er aus dem zahnlosen Mund noch die Zunge, leckte sich über die Lippen und leckte sogar noch den Tropfen von der Nasenspitze ab.
»Wäre das nichts für Sie?«
»Was soll für mich sein?«
»Ich würde Sie und die ganze Indianergesellschaft in diesem Reservat ansässig machen.«
Hoch fuhr Reinhold empor.
»Uns dort ansässig machen? Ja, aber wozu denn?«
»Als Wildhüter.«
»Als Wildhüter?«
»Lassen Sie es sich näher erklären. Die Sache ist die: Auf diesem ganzen Gebiet darf also nicht gejagt werden. Mit Ausnahme von den Beamten, die auf den einsamen Stationen leben – Sie sehen, hier mittendurch geht bis nach Mombasa die Eisenbahn – die sind ja auf das Wild angewiesen, und dann gibt es noch einige andere Ausnahmen. Im allgemeinen darf aber doch im Reservat kein einziges Tier geschossen oder gefangen werden, auch nicht eine Lerche.
Sie sehen, hier durch das Gebirge geht die Grenze, auf der anderen Seite ist deutsches Gebiet. Weiter wird die Grenze durch den sogenannten zentralafrikanischen Graben gebildet, eine ungeheure Schlucht, überall mindestens 6 000 Fuß tief, vom Gebirge an durch Steppen und Urwälder laufend bis ziemlich an den Viktoriasee. Das ist einmal ein Abfluß gewesen, der sich verstopft hat.
Von diesem deutschen Gebiet herüber brechen nun schon seit Jahren fortgesetzt Wilddiebe in das Reservat, die schonungslos alles zusammenschießen, was ihnen vor den Lauf ihrer unfehlbaren Büchse kommt … «
»Wilddiebe?« unterbrach Reinhold aufmerksam.
»Wilddiebe.«
»Ich denke, sie schießen das Wild.«
»Nun ja.«
»Dann sind es keine Wilddiebe, sondern Wildschützen.«
»Machen Sie denn zwischen beiden einen Unterschied?«
»Gewiß. Unter einem Wilddieb kann ich mir eigentlich nur einen elenden Wicht von Schlingensteller denken, ein Wildschütz dagegen … «
»Wilddieb oder Wildschütz, mir ganz egal. Diese Hundsfotte schießen also alles zusammen … «
»Es sind Deutsche?«
»Nein, jedenfalls sind es Engländer.«
»Aber sie kommen von dem deutschen Gebiet herüber?«
»Ja, es sind zweifellos Buren, denen die deutsche Regierung leider gestattet hat, sich dort an der Grenze anzusiedeln, vielleicht gar, um uns … «
»Buren sind es?«
»Zweifellos.«
Ja, das sind aber doch keine Engländer?«
»Nicht? Was sind sie denn sonst? Die Buren sind doch englische Untertanen, auch wenn sie aus Südafrika ausgewandert oder durch den Krieg vertrieben worden sind.«
Der geneigte Leser braucht hierzu wohl keine besondere Erklärung. Für die Engländer sind alle in Südafrika lebenden Buren ganz einfach englische Untertanen und sind es von jeher gewesen.
Man darf da übrigens nicht allzu scharf ins Gericht gehen. Betrachten wir nicht alle in Elsaß-Lothringen Wohnenden ebenfalls als deutsche Untertanen, ob sie wollen oder nicht, auch wenn sie durch Abstammung und Charakter noch so gute Franzosen sind? Da muß man gerecht sein! Nun kommt hier noch hinzu, daß die englische Nationalität sehr schwer erlischt. Auf der einen Seite hat das sehr viel Gutes. Die Engländerin, die im Ausland einen Ausländer heiratet, bleibt trotz alledem noch immer Engländerin – ein Fall, den keine andere Nation kennt – sie kann sich jederzeit unter den Schutz des englischen Konsuls stellen – und das gilt sogar für ihre im Ausland geborenen Kinder!
Alle von einer Engländerin abstammenden Kinder sind echte Engländer! Ganz gleichgültig, wo sie geboren sind. Vom englischen Vater gilt das natürlich erst recht.
Hier käme das englische Gesetz mit dem deutschen in Konflikt, indem jedes in Deutschland geborene Kind mit wenig Ausnahmen – als deutscher Staatsangehöriger gilt, die männliche Jugend zum Militärdienst herangezogen wird, während so ein Jüngling jederzeit von England als englischer Untertan reklamiert werden kann.
Ein solcher Rechtsstreit ist wohl noch nicht ausgetragen worden. Jedenfalls deshalb nicht, weil bei derartig unklaren Verhältnissen der Betreffende von Deutschland einfach nach England abgeschoben wird. Der Klügere gibt nach. Aber diese Verhältnisse sind tatsächlich so, sie sind nur sehr wenig bekannt.
Andererseits ist es ein drückender Zwang, indem man unter Umständen ein englischer Untertan sein soll, ohne daß man es will. So bleibt also auch der aus seiner Heimat ausgewanderte Bure für den Engländer immer ein englischer Untertan, er mag sich aufhalten, wo er will.
Freilich ist er das ja nur dem Namen nach. Immerhin, es zeigt den englischen Stolz und die englische Konsequenz im glänzendsten Licht.
»Ja«, nahm der Lord wieder das Wort, und zwar jetzt ganz anders sprechend als bisher, »und diese blutig gottverrrrrdammten Buren … Pardon, Miß, ich bitte tausendmal um Verzeihung.«
Der alte Herr hatte sich vergessen. Seine immer steigende Erregung war schon vorher bemerkbar gewesen, auf ihrem Höhepunkt hatte er die Worte gebraucht, die er vorher von dem Stallmeister gehört, die sich in sein Gedächtnis eingegraben hatten.
Im Nu war er sich seines Vergehens bewußt, sofort hatte er sich gebändigt – nun aber trat die Reaktion ein, ganz die gegenteilige Stimmung.
Er stemmte den Arm auf das Ochsenhorn und seinen Kopf in die Hand, und so niedergeschlagen wie seine Stimme war, sah er auch aus, wirklich schmerzhaft traurig, als er fortfuhr:
»Ach, was habe ich schon alles versucht, um diese Wilddiebe, die mir mein ganzes Leben vergiften, unschädlich zu machen! Die dort einheimischen schwarzen und europäischen Jäger sind machtlos. Gegen diese jagdgeübten, mit allen Hunden gehetzten Buren können sie nicht aufkommen. Ich habe aus Südafrika Kaffern kommen lassen, Zulus, die großartigsten Jäger, die es im schwarzen Erdteil gibt – sie haben gegen diese schattenhaften Wildschützen nichts ausrichten können. Ich habe den berühmten Elefantenjäger David Harrison engagiert, daß er diesen Wilddieben das Handwerk lege nach einem halben Jahr, das mich 20 000 Pfund Sterling kostete, hat er die Sache als hoffnungslos aufgegeben. Der noch berühmtere französische Löwenjäger Bodard meldete sich von selbst, er brachte seinen ganzen Apparat mit, eine aus zwei Dutzend Nubiern und Arabern bestehende Treibertruppe, von denen jeder einzelne ein Fährtensucher und ein Jäger par excellence sein soll, und ich sehe noch den verwitterten Franzosen, wie er mir mit geringschätzendem Lächeln erklärte, innerhalb von vier Wochen sei das ganze Reservat von jedem Wilderer gesäubert – und schon zwei Wochen später schlich er mit seiner Treiberbande beschämt in seine Heimat zurück, sogar verängstigt, Kreuze schlagend. Diese Wilderer müssen ihm irgendeinen Streich gespielt haben. Mit solchen leibhaftigen Teufeln wolle er nichts zu tun haben. Das war das letzte Wort, das ich von dem sonst so löwenkühnen Franzosen hörte.
Ja, es müssen Teufel sein. Aus meinem eigenen Vermögen habe ich tausend Pfund Sterling für jeden einzelnen Wilderer ausgesetzt, der mir tot oder lebendig ausgeliefert wird. Ich habe während der drei Jahre noch nie in die Tasche zu greifen brauchen. Sie scheinen selbst mit dem Teufel im Bunde zu stehen, wie Schwarze und selbst die aufgeklärtesten Europäer dort es behaupten. Sie müssen sich unsichtbar machen können. Nicht nur, daß sie immer in dem großen Graben verschwinden, wo sie allein alle Abstiege wissen, wohin ihnen niemand folgen kann, sondern auch, wenn man sie auf frischer Tat ertappt, wenn man sie umzingelt hat, scheinen sie plötzlich von der Erde verschluckt worden zu sein.
Ach, und immer wieder muß ich mich im Parlament höhnisch fragen lassen, ob ich denn noch nicht endlich diese Wilddiebe in meinem Reservat beseitigt habe, und immer wieder seit drei Jahren schon muß ich versichern, daß es mir noch gelingen werde, und stets muß ich dann das spöttische Gelächter meiner Gegner vernehmen – ach, in bin dadurch recht alt geworden!«
So, nun wußte man, wie dieser Lord sagen konnte, daß diese paar armseligen Wilddiebe sein ganzes Leben vergifteten.
Als vor drei Jahren sein Vorgänger abgedankt hatte, waren im Parlament die Mißstände in Ostafrika erörtert worden, unter anderem waren – nur so nebenbei als Kleinigkeit – die im Reservat hausenden Wilderer zur Sprache gekommen.
Der neue Gouverneur von Ostafrika, hier Lord Warwick, hatte in seiner Programmrede gelobt, nach allen Kräften sein Bestes zu tun, um alle vorhandenen Mißstände zu beseitigen – und was die Wilderer betreffe, das sei doch eine Kleinigkeit, die wolle er noch in diesem Jahr dingfest gemacht haben, dafür könne er garantieren.
Und hiermit hatte Lord Warwick einen Fluch auf sich geladen – den Fluch der Großsprecherei, der Prophezeiung. Man soll durchaus nichts prophezeien, man soll nicht eher über einen einzigen Pfennig verfügen, als bis man ihn im Sack hat.
Alle Schwierigkeiten hatte der neue Gouverneur durch seine Energie und Geisteskraft zu beseitigen gewußt, die allergrößten – nur mit diesen jämmerlichen Wilderern war er nicht fertig geworden. Dabei war ja von einem eigentlichen Schaden gar nicht zu sprechen. Und wenn es hundert Wildschützen gewesen wären, was konnten die denn auf einem Areal von 25 000 englischen Quadratmeilen abschießen? Da war von einer Verminderung des Wildbestands doch durchaus nichts zu merken.
Nein, es handelte sich nur um die Ehre.
Denn gerade weil er alle anderen größeren Schwierigkeiten so glänzend gelöst hatte, hatten seine Neider und sonstigen Gegner ihm nichts weiter vorzuwerfen, als daß er damals für Beseitigung der Wilddiebe innerhalb Jahresfrist garantiert habe, und da ließen sie sich nun keine Gelegenheit entgehen, um den Gouverneur zu stacheln und zu hänseln und zu verhöhnen, und wer da weiß, wie es in diplomatischen Kreisen zugeht, der glaubt wohl, daß es wirklich genügte, um das ganze Leben eines Mannes zu vergiften, so daß Lord Warwick wegen dieser an sich lächerlichen Kleinigkeit schon seinen Posten niederzulegen gedachte.
»Teufel noch einmal!« fuhr da Reinhold empor. »Da müssen mal ein paar richtige amerikanische Jäger hin, die sollen diesen afrikanischen Buren aber bald das Handwerk gelegt haben!«
Freudig blickte der Lord auf.
»Das ist es! Mit amerikanischen Trappern wollte ich es noch einmal versuchen, mit Wald- und Präriejägern, und wenn auch die nichts erreichen könnten, dann – würde ich selbst zurücktreten. Meinen Sie, daß solche amerikanischen Hinterwäldler afrikanischen Jägern überlegen sind?«
»Na, schicken Sie mich mal hin, mich und meine Schwester – und meine Navajos – auch die Mädels sind nicht zu verachten – wie wir mit diesen Wilderern schnell aufgeräumt haben werden!«
Immer verklärter blickte der Lord. Doch auch noch einiger Zweifel war in seinen Zügen zu lesen.
»Sie kennen aber Afrika noch gar nicht.«
»Was meinen Sie damit?«
»Sie kommen in ganz neue Verhältnisse.«
»Ah bah! Land bleibt Land, und Wild bleibt Wild, und Jäger bleibt Jäger. Ich will mit dem ersten Rhinozeros, das mich anrennt, doch genauso gut fertig werden wie der erfahrenste Afrikaner.«
»Die Gegend dort ist sehr gebirgig.«
»Nun, in Arizona ist auch ein nettes Felsengebirge.«
»Die Steppe mag der Prärie sehr ähneln, aber da sind Wüsten … «
»Kann man darin, wie in Arizona, bis an den Hals versinken?«
»Da ist ein Strom … «
»Ist das afrikanische Wasser anders als das amerikanische?«
»Der trocknet manchmal ganz aus, und dann gibt es dort überhaupt kein Wasser.«
»Na, da kommen Sie erst mal nach Arizona! Lebt dort nicht auch während der trockensten Jahreszeit Wild?«
»Das weiß schon Wasser zu finden.«
»Dann weiß auch ich das. Ach, das sind doch alles Kleinigkeiten! Also fünfzig Pfund pro Monat, wenn wir alle zusammen hinübergehen?«
»Oh, daß mir zehn Pfund pro Tag, das wären dreihundert Pfund pro Monat, zuviel wären, wie ich vorhin sagte, das war ja nicht so gemeint – stellen Sie Ihre Forderungen.«
Der junge Mann hatte hiermit einen glänzenden Beweis dafür geliefert, wie schlecht er sich zum Impressario eignete.
Aber Lord Warwick wußte nun auch, wen er vor sich hatte, und er war nicht als Knauserer und Halsabschneider bekannt, wenn er auch nicht gerade das Geld unnötig zum Fenster hinauswarf.
»Also fünfzig Pfund pro Monat festes Gehalt.«
»Abgemacht!«
»Und Ihr Fräulein Schwester – alle übrigen Mitglieder der Truppe?«
»Ach, die brauchen nichts. In den fünfzig Pfund ist alles mit inbegriffen.«
»Gut, wie Sie wünschen«, erklärte sich der Auftraggeber ganz mit Recht hiermit einverstanden.
»Aber natürlich freie Reise.«
»Selbstverständlich, und eventuell auch wieder freie Rückfahrt, wohin Sie wollen.«
»Wie lange soll das gelten?«
»Auf ein Jahr.«
»Abgemacht. Ja, wie ist es denn nun aber mit den 100 000 Dollar?« schrak jetzt Reinhold etwas auf.
»Die bezahle ich für Sie, sofort«, entgegnete der Lord, schon sein Scheckbuch ziehend.
»Dann schulde ich die aber doch Ihnen.«
»O nein, das soll das … «
»Sie sprachen doch vorhin von einer Prämie, die Sie für jeden ausgelieferten Wilderer zahlen wollten.«
»Allerdings, tausend Pfund pro Mann, das habe ich ausgesetzt und das nehme ich auch nicht zurück, diese Prämie sollen also auch Sie und Ihre Leute erhalten.«
»Tausend Pfund pro Mann, fünftausend Dollar, sapperlot!« staunte Reinhold. Und die am Boden liegende Schwester machte ein ebensolches Gesicht wie er. »Ist denn das Ihr Ernst?«
»Selbstverständlich. Das gebe ich Ihnen noch schriftlich.«
»Wie viele Wilderer sind denn da?«
Ja, wenn ich das wüßte! Mindestens ein Dutzend, das hat man schon beurteilen können. Vielleicht aber sind es auch hundert.«
»Und Sie wären bereit, zwölftausend Pfund zu zahlen?«
»Hunderttausend, wenn Sie mir hundert Wilderer tot oder lebendig ausliefern.«
»Diese Prämie bezahlt die Regierung?«
»Nein, die bezahle ich aus meiner Tasche.«
»Himmelherrgott, müssen Sie aber viel Geld haben!«
»Ja, ich hab's schon dazu«, lächelte der Lord über solche Naivität. »Liefern Sie mir nur diese Wilderer aus, daß meine – hm … Also abgemacht?«
» … daß meine Ehre wiederhergestellt wird«, hatte er offenbar sagen wollen.