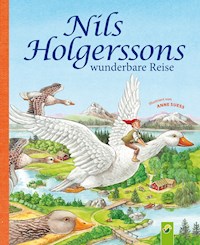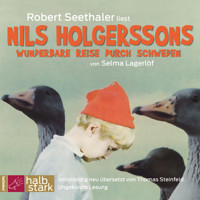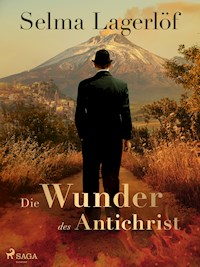
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wunder des Jesus Christus, verlagert in das Italien des 19. Jahrhunderts. Eine Nachahmung von Jesus, der Antichrist, vollbringt Wunder in Sizilien. Aus verschiedenen Episoden webt Lagerlöf in ihrem zweiten Roman eine Geschichte von Christentum und Sozialismus, in denen sich ihre eigenen Italienerlebnisse mit starker christlicher Aufladung vereinen. Vor anschaulicher sizilianischer Kulisse schildert sie in den verschiedenen Episoden die Schicksale der dort lebenden Menschen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Die Wunder des Antichrist
Übersezt von Pauline Klaiber-Gottschau
Saga
Die Wunder des Antichrist
Übersezt von Pauline Klaiber-Gottschau
Titel der Originalausgabe: Antikrists mirakler
Originalsprache: Schwedisch
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1897, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728094440
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Einleitung
»Aber wenn der Antichrist
kommt, wird er Christus in allen
Dingen ganz gleich scheinen.«
I. Das Gesicht des Kaisers
Zu der Zeit, da Augustus Kaiser war in Rom und Herodes König in Jerusalem, da geschah es, daß sich eine große heilige Nacht auf die Erde herabsenkte. Es war die dunkelste Nacht, die man je gesehen hatte, man hätte glauben können, die ganze Erde sei in ein Gewölbe versunken. Es war unmöglich, Wasser und Land zu unterscheiden, und man konnte sich auf dem vertrautesten Wege nicht zurechtfinden. Und es konnte auch gar nicht anders sein, denn vom Himmel kam nicht ein einziger Lichtstrahl. Kein Stern war zu sehen, und der freundliche Mond hatte sein Antlitz abgewandt.
Und ebenso tief wie das Dunkel war auch die Stille und das Schweigen. Die Flüsse hatten haltgemacht in ihrem Lauf, kein Lufthauch rührte sich, selbst die Blätter der Espe hatten aufgehört zu beben. Wäre man ans Meer gegangen, dann hätte man entdeckt, daß die Wellen nicht mehr gegen den Strand schlugen, und wäre man in die Wüste gegangen, so hätte der Sand unter den Tritten des Wanderers nicht mehr geknirscht. Alles war wie versteinert und unbeweglich, um die heilige Nacht nicht zu stören. Das Gras durfte nicht wachsen, der Nebel konnte sich nicht herabsenken, die Blumen wagten nicht, ihren Duft auszuatmen.
In jener Nacht ging kein Raubtier auf Beute aus, es stach keine Schlange, es bellte kein Hund. Und was noch herrlicher war, keines der leblosen Dinge hätte die Heiligkeit der Nacht dadurch stören mögen, daß es sich zu einer bösen Tat hätte benützen lassen. Kein Dietrich hätte ein Schloß geöffnet, kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu vergießen. Und gerade in der Nacht zog in Rom eine kleine Schar Menschen vom Kaiserschloß auf dem Palatin herab und nahm ihren Weg über das Forum hinauf zum Kapitol. An dem soeben vergangenen Tage hatten nämlich die Ratsherren den Kaiser gefragt, ob er etwas dagegen habe, wenn sie ihm auf Roms heiligen Berg einen Tempel errichten würden. Aber Augustus hatte nicht sogleich seine Einwilligung gegeben, denn er war nicht sicher, ob es den Göttern angenehm wäre, wenn er einen Tempel neben dem ihrigen erhielte, und er hatte geantwortet, daß er zuerst seinem Genius ein nächtliches Opfer bringen wolle, um den Willen der Götter in dieser Sache zu erforschen. Und nun eben wollte er in Begleitung einiger Vertrauter dieses Opfer darbringen.
Augustus ließ sich in einer Sänfte tragen, denn er war schon alt, und die vielen Stufen, die zum Kapitol führten, fielen ihm schwer. Er hielt den Käfig mit den Tauben, die geopfert werden sollten, selbst in der Hand. Keine Priester, keine Ratsherren noch Soldaten begleiteten ihn, nur seine nächsten Freunde. Fackelträger schritten voran, wie um einen Weg in die Tiefe des nächtlichen Dunkels zu bahnen, und hinter ihm folgten Sklaven, die den dreifüßigen Altar, das Opfergewand, die Messer, das heilige Feuer und alle anderen Geräte trugen, die zum Opfer nötig waren.
Unterwegs plauderte der Kaiser munter mit seinen Vertrauten, und deshalb fiel keinem von ihnen die unendliche Ruhe und Stille der Nacht auf. Erst als sie ganz oben auf dem Kapitol den leeren Platz erreicht hatten, der für den neuen Tempel ins Auge gefaßt worden war, erkannten sie, daß etwas Ungewöhnliches vor sich ging.
Dies konnte keine Nacht sein wie alle anderen Nächte, denn oben am Felsenrand sahen sie eine wunderbare Erscheinung. Sie glaubten zuerst, es sei ein alter verwachsener Olivenstamm, dann meinten sie, ein uraltes Steinbild aus dem Jupitertempel sei an den Felsen herausgewandert. Schließlich jedoch schien es ihnen, als könne es nichts anderes sein als die alte Sibylle.
Etwas so Altes, so Verwittertes und so Riesenhaftes hatten sie noch nie gesehen. Dieses alte Weib war fürchterlich. Wenn der Kaiser nicht dagewesen wäre, hätten sie sich alle nach Hause in ihre Betten geflüchtet.
»Das ist sie«, flüsterten sie einander zu, »sie, die so viele Jahre zählt, als es Sandkörner am Strande ihrer Heimat gibt. Warum ist sie denn gerade heute nacht aus ihrer Höhle herausgekommen? Was will sie dem Kaiser und dem Reich verkündigen? Sie, die ihre Prophezeiungen auf die Blätter der Bäume schreibt und weiß, daß der Wind das Orakelwort zu dem hinführt, für den es bestimmt ist?«
Sie waren so erschreckt, daß sie sicher mit vorgeneigter Stirn auf die Knie gesunken wären, wenn die Sibylle nur eine einzige Bewegung gemacht hätte. Aber sie verhielt sich so ruhig, als sei sie ohne Leben. Sie saß zusammengekauert auf dem äußersten Felsenrand und spähte, indem sie die Augen mit der Hand beschattete, in die Nacht hinaus. Es sah aus, als sei sie an den Felsenrand getreten, um etwas, das sich in weiter Ferne zutrug, besser sehen zu können. Sie konnte also etwas sehen, in einer solchen Nacht!
Plötzlich wurden sich der Kaiser und sein Gefolge bewußt, welch tiefe Finsternis herrschte. Niemand konnte auch nur seine Hand vor den Augen sehen. Und welche Stille, welches Schweigen! Nicht einmal das dumpfe Rauschen des Tibers konnten sie hören. Aber die Luft war erstickend, kalter Schweiß trat ihnen auf die Stirn, und ihre Hände waren starr und kraftlos. Sie fühlten, daß etwas Furchtbares bevorstehen mußte.
Aber keiner der Männer wollte zeigen, daß er sich fürchtete, sondern alle versicherten dem Kaiser, das sei ein gutes Omen; die ganze Natur halte den Atem an, um seinen Genius zu begrüßen.
Die Wahrheit aber war, daß die alte Sibylle von einer Erscheinung ganz hingenommen war und nicht einmal wußte, daß der Kaiser Augustus aufs Kapitol gekommen war. Sie war im Geist in ein fernes Land entrückt, und es war ihr, als wandere sie dort über eine große Ebene hin. In der Dunkelheit stieß sie beständig mit dem Fuß an etwas, das ihr kleine Erdhaufen zu sein schienen. Sie bückte sich und tastete mit der Hand danach. Nein, es waren keine Erdhaufen, sondern Schafe. Sie wandelte zwischen vielen schlafenden Schafen hin.
Nun bemerkte sie auch das Feuer der Hirten. Es brannte mitten auf dem Felde, und sie tastete sich bis zu ihm hin. Die Hirten lagen am Feuer und schliefen; neben ihnen lagen die langen, spitzigen Stäbe, mit denen sie die Herden gegen wilde Tiere zu verteidigen pflegten. Aber die kleinen Tiere dort mit den funkelnden Augen und den buschigen Schwänzen, die sich zum Feuer hinschlichen, waren das nicht Schakale? Und doch warfen die Hirten nicht die Stäbe nach ihnen, die Hunde schliefen weiter, die Schafe flohen nicht, und die wilden Tiere legten sich neben den Menschen zur Ruhe nieder.
Dies sah die Sibylle; aber sie wußte nichts von dem, was hinter ihr auf dem Berge vorging. Sie wußte nicht, daß man da einen Altar errichtete, Kohlen anzündete, das Räucherwerk darauf streute und daß der Kaiser die eine der beiden Tauben aus dem Käfig nahm, um sie zu opfern. Aber seine Hände waren so leblos, daß er sie nicht festhalten konnte.
Mit einem einzigen Flügelschlag machte sich die Taube frei und verschwand im Dunkel der Nacht. Als dies geschah, sahen die Hofleute mißtrauisch nach der alten Sibylle hin. Sie dachten, sie sei schuld an dem Unglück. Sie wußten ja nicht, daß die Sibylle noch an dem Kohlenfeuer der Hirten zu stehen meinte und daß sie einem leisen Tone lauschte, der durch die Totenstille der Nacht drang. Sie lauschte ihm lange, ehe sie erkannte, daß er nicht von der Erde herauf, sondern aus den Wolken herabkam. Aber schließlich erhob sie den Kopf, und da sah sie helle, schimmernde Gestalten droben aus dem Dunkel hervorgleiten. Es waren kleine Engelscharen, die selig sangen und wie suchend über der weiten Ebene hin- und herflogen. Während die Sibylle gerade diesem Engelgesang lauschte, bereitete sich der Kaiser zu einem neuen Opfer. Er wusch seine Hände, reinigte den Altar und ließ sich die zweite Taube geben. Aber obgleich er sich nun aufs äußerste anstrengte, sie festzuhalten, entglitt der weiche Körper doch seiner Hand, und der Vogel flog davon in die undurchdringliche Nacht.
Da entsetzte sich der Kaiser. Er stürzte vor dem leeren Altar auf die Knie und flehte zu seinem Genius. Er betete um Kraft, um das Unglück, das diese Nacht anzukünden schien, abwenden zu können.
Auch davon hatte die Sibylle nichts gehört. Sie lauschte mit ganzer Seele auf den Engelgesang, der immer lauter ertönte. Schließlich wurde er so mächtig, daß die Hirten erwachten. Sie richteten sich auf den Ellbogen auf und sahen, daß sich da droben im Dunkel leuchtende Scharen silberweißer Engel in langen flatternden Reihen, Zugvögeln gleich bewegten. Einige hatten Lauten und Violinen in den Händen, andere Harfen und Zithern, und ihr Gesang klang so fröhlich wie Kinderlachen und so sorglos wie Lerchengezwitscher. Als die Hirten den Gesang hörten, standen sie auf, um zur Stadt auf dem Berge zu gehen, wo sie zu Hause waren, und von dem Wunder zu erzählen.
Sie stiegen mühsam einen schmalen Zickzackweg hinan, und die alte Sibylle sah ihnen nach. Plötzlich wurde es licht dort droben auf dem Berge. Gerade über ihm leuchtete ein großer klarer Stern auf, und die Stadt auf dem Gipfel strahlte in dem Sternenschein wie Silber. Alle die umherirrenden Engelscharen eilten mit Jubelrufen dorthin, und die Hirten beschleunigten ihre Schritte, so daß sie fast rannten. Als sie die Stadt erreichten, fanden sie, daß die Engel sich über einem niedrigen Stall in der Nähe des Stadttores versammelt hatten. Es war ein ärmliches Gebäude mit einem Strohdach und dem kahlen Felsen als Rückwand. Gerade darüber stand der Stern, und hier scharten sich immer noch mehr Engel zusammen. Einige von ihnen setzten sich auf das Strohdach oder ließen sich auf der steilen Bergwand hinter dem Haus nieder, andere hielten sich mit flatternden Schwingen schwebend darüber.
In demselben Augenblick, wo der Stern über der Stadt auf dem Berge aufflammte, erwachte die ganze Natur, und die Männer, die auf der Höhe des Kapitols standen, nahmen es unwillkürlich auch wahr. Sie fühlten frische, aber sanfte Winde durch den Weltraum ziehen, süße Düfte stiegen ringsum empor, die Bäume rauschten, der Tiber begann zu brausen, die Sterne strahlten, und der Mond stand plötzlich hoch am Himmel und erhellte die Erde. Aus den Wolken aber kamen die beiden Tauben herniedergeflattert und ließen sich auf den Schultern des Kaisers nieder.
Als dieses Wunder geschah, richtete sich Augustus in stolzer Freude hoch auf; aber seine Freunde und Sklaven stürzten auf die Knie nieder. »Ave Cäsar!« riefen sie. »Dein Genius hat dir geantwortet! Du bist der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden soll!«
Und die entzückten Männer jubelten diese Huldigung dem Kaiser so laut zu, daß die Sibylle sie hörte. Und dies erweckte sie aus ihrem Schauen. Sie stand auf, verließ den Felsenrand, und wie eine dunkle Wolke, die, einem tiefen Abgrund entstiegen, über den Berggipfel herwogt, trat sie unter die Männer. Sie sah fürchterlich aus durch ihr Alter; struppiges Haar hing ihr in dünnen Strähnen um den Kopf, die Gelenke hatten sich verdickt, und die unzähligen Runzeln der dunkel gewordenen Haut bedeckten den Körper wie eine harte Rinde.
Aber gewaltig und ehrfurchtgebietend schritt sie auf den Kaiser zu. Mit der einen Hand erfaßte sie ihn am Handgelenk, mit der anderen deutete sie nach dem fernen Osten. »Sieh!« gebot sie ihm. Und der Kaiser hob seine Augen auf und sah. Der Weltenraum öffnete sich vor seinen Blicken, und er konnte bis in das ferne Morgenland hineinschauen. Und er sah einen ärmlichen Stall unter einer steilen Felsenwand und in der offenen Tür einige kniende Hirten. Im Stall selbst sah er eine junge Mutter, die vor einem kleinen Kind kniete, das in einer Krippe auf dem Boden lag.
Und die großen, knochigen Finger der Sibylle deuteten auf dies arme Kind.
»Ave Cäsar!« sagte die Sibylle mit einem Hohnlachen. »Das ist der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden soll.«
Da wich Augustus vor ihr zurück wie vor einer Wahnsinnigen.
Aber über die Sibylle kam der mächtige Sehergeist. Ihre trüben Augen begannen zu leuchten; sie streckte die Arme zum Himmel empor, ihre Stimme verwandelte sich, so daß es war, als sei es gar nicht mehr ihre eigene; denn sie bekam einen solchen Klang und eine solche Kraft, daß man sie auf der ganzen Welt hätte hören können. Und sie sprach die Worte, die sie da droben zwischen den Sternen gelesen zu haben schien:
»Auf der Höhe des Kapitols wird man beten zum Welterneuerer, Christ oder Antichrist, doch niemals zu sterblichen Menschen!«
Als sie dies gesagt hatte, schritt sie durch die Reihen der entsetzten Männer, stieg langsam den Berg hinab und verschwand.
Augustus aber ließ am nächsten Tag dem Volk streng verbieten, ihm auf dem Kapitol einen Tempel zu errichten. Statt dessen erbaute er dort ein Heiligtum für das neugeborene Götterkind und nannte es »Altar des Himmels«, Aracoeli.
II. Roms heiliges Kind
Auf der Höhe des Kapitols erhob sich ein Kloster, das von Franziskanermönchen bewohnt war. Aber man würde es kaum für ein Kloster gehalten haben, viel eher für eine Festung. Es war wie ein Wachtturm am Meeresstrand, von dem man nach herannahenden Feinden ausschaut und umherspäht.
Neben dem Kloster stand die prächtige Kirche Santa Maria von Aracoeli. Die Kirche war erbaut worden zur Erinnerung daran, daß die Sibylle dem Kaiser Augustus einst von hier aus Christus hatte erscheinen lassen. Das Kloster aber war gebaut worden, weil man fürchtete, die Prophezeiung der Sibylle könne in Erfüllung gehen und der Antichrist auf dem Kapitol angebetet werden.
Und die Mönche von Aracoeli fühlten sich als Krieger. Wenn sie in die Kirche gingen, um zu singen und zu beten, war es ihnen, als wanderten sie auf Festungswällen umher und als ließen sie große Mengen von Pfeilen über den anstürmenden Antichrist hinabregnen.
Sie lebten ständig in dem Gedanken an den Antichrist, und ihr ganzer Gottesdienst war ein fortgesetzter Kampf, ihn vom Kapitol fernzuhalten.
Sie zogen die Kapuzen über die Stirn, daß sie ihnen die Augen beschatteten, und spähten so unablässig in die Welt hinaus. Ihre Blicke bekamen etwas Fieberhaftes von all dem Ausschauen, und stets glaubten sie den Antichrist zu entdecken. »Er ist da! Er ist da!« riefen sie; sie sprangen auf in ihren braunen Kutten und erhoben sich zum Streit wie Krähen, die auf einer Felsenspitze versammelt sind und plötzlich einen Adler erblicken.
Einige der Mönche aber sagten: »Was nützen Gebete und Bußübungen? Die Sibylle hat gesagt, der Antichrist müsse kommen.«
Doch die anderen entgegneten: »Gott kann ein Wunder tun. Wenn das Kämpfen nichts nützen würde, hätte er uns nicht durch die Sibylle warnen lassen.«
Jahr für Jahr verteidigten die Franziskaner das Kapitol durch Bußübungen und Werke der Barmherzigkeit und durch die Verkündigung des Wortes Gottes.
Sie schützten es ein Jahrhundert nach dem anderen, aber je länger es dauerte, desto kraftloser und schwächer wurden die Menschen. Die Mönche sagten untereinander: »Bald kann das Reich dieser Welt nicht mehr bestehen. Es müßte ein Welterneuerer kommen wie zur Zeit des Augustus.«
Und sie rauften sich die Haare und geißelten sich, denn sie wußten, daß dieser Erneuerer der Antichrist sein würde und daß es eine Wiedergeburt von Macht und Gewalt werden mußte.
Wie Kranke von ihrem Leiden verfolgt werden, so wurden die Mönche von dem Gedanken an den Antichrist verfolgt. Sie sahen ihn vor sich: Er war ebenso reich wie Christus arm gewesen war, ebenso böse wie Christus gut und ebenso geehrt wie Christus erniedrigt gewesen war. Er führte starke Waffen und kam an der Spitze blutbefleckter Übeltäter daher. Er zerstörte die Kirchen, ermordete die Priester und bewaffnete die Menschen zum Kampf, daß Bruder gegen Bruder kämpfte, daß der eine sich vor dem andern fürchtete und sich niemand eines ungestörten Friedens erfreute.
Und jedem Träger von Macht und Gewalt, der im Strom der Zeit auftauchte, schallte vom Wachtturm auf dem Kapitol der Ruf entgegen: »Antichrist! Antichrist!«
Und sooft einer von ihnen verschwand und unterging, riefen die Mönche: »Hosianna!« und sangen: »Te Deum!« Und sie sagten: »Um unsrer Gebete willen fallen die Bösen, ehe sie imstande sind, das Kapitol zu besteigen.«
Es war aber ein hartes Strafgericht für das schöne Kloster, daß dessen Mönche nie Ruhe finden konnten. Ihre Nächte waren noch schwerer als ihre Tage. Da sahen sie wilde Tiere in die Zellen hereindringen und sich neben ihnen auf den Pritschen ausstrecken. Und jedes wilde Tier war der Antichrist. Die einen sahen ihn als Drachen, andere als Greis und noch andere als eine Sphinx. Wenn die Mönche nach solchen Träumen aufstanden, waren sie so matt wie nach einer schweren Krankheit.
Der einzige Trost, den diese armen Mönche hatten, war das wundertätige Christusbild, das in der Kirche Aracoeli aufbewahrt wurde. Wenn ein Mönch vor Angst am Rande der Verzweiflung angekommen war, ging er in die Kirche, um bei ihm Trost zu finden. Er durchschritt dann die ganze Kirche und ging in eine wohlverschlossene Kapelle neben dem Hochaltar. Da zündete er geweihte Wachskerzen an und sprach ein Gebet, ehe er den Altarschrein öffnete, der ein doppeltes Schloß und eiserne Türen hatte. Und er lag auf den Knien, solange er das Christuskind betrachtete.
Dieses stellte ein kleines Wickelkind dar, hatte aber eine goldene Krone auf dem Kopf, goldene Schuhe an den Füßen, und das ganze Kind strahlte von all dem Schmuck, den ihm die Notleidenden, die es um seine Hilfe anflehten, geschenkt hatten. Und die Wände der Kapelle waren über und über mit Tafeln bedeckt, die darüber berichteten, wie es aus Feuersgefahr und Wassersnot errettet, wie es Kranke geheilt und Unglücklichen der unterschiedlichsten Art geholfen hatte. Wenn der Mönch dieses Kind sah, jubelte er und sagte zu sich selbst: »Gott sei gepriesen! Noch immer wird auf dem Kapitol Christus verehrt.«
Der Mönch sah, wie ihm das Bild mit mystisch bewußter Macht entgegenlächelte, und sogleich schwang sich sein Geist empor zu den heiligen Regionen der Zuversicht. »Was könnte dich stürzen, du Gewaltiger?« sagte er. »Was könnte dich stürzen? Vor dir beugt die ewige Stadt ihr Knie. Du bist Roms heiliges Kind. Du bist der Gekrönte, den das Volk anbetet. Du bist der Mächtige, der mit Hilfe, Kraft und Trost kommt. Du allein sollst auf der Höhe des Kapitols angebetet werden.«
Der Mönch sah, wie die Krone des Bildes sich in einen Glorienschein verwandelte, der seine Strahlen über die ganze Welt aussandte. Und nach welcher Seite er auch der Richtung der Strahlen folgte, überall auf der Erde sah er Kirchen, in denen Christus angebetet wurde. Es war, als habe ein mächtiger Herrscher ihm alle Burgen und Festen gezeigt, die sein Reich verteidigten.
»Sicherlich kannst du nicht fallen«, sagte der Mönch. »Dein Reich muß bestehen.«
Und der Mönch, der das Bildwerk sah, genoß einige Stunden der Ruhe und des Friedens, bis ihn die Furcht von neuem ergriff. Hätten die Mönche das Bild nicht besessen, ihre Seelen hätten nicht einen einzigen Augenblick Ruhe gefunden.
So hatten Aracoelis Mönche sich unter Gebet und Kämpfen durch die Zeiten hindurchgerungen, und es hatte dem Christuskind niemals an Wächtern gefehlt. Sobald einer seiner Angst erlegen war, hatten andere sich beeilt, seinen Platz einzunehmen.
Und obgleich die meisten, die in dieses Kloster gingen, in Wahnsinn verfielen oder eines frühzeitigen Todes starben, hatte die Zahl der Mönche doch nie abgenommen; denn es wurde als eine große Ehre vor Gott betrachtet, auf Aracoeli zu kämpfen. So kam es, daß dieser Kampf vor sechzig Jahren noch in vollem Gang war, und um der Schwäche der Zeit willen kämpften die Mönche mit größerem Eifer als je und erwarteten den Antichrist so sicher wie noch nie. Um jene Zeit kam eine reiche englische Dame nach Rom. Sie ging hinauf nach Aracoeli und besah das Christusbild. Und das Bild gefiel ihr so ungemein, daß sie meinte, nicht weiterleben zu können, wenn es nicht ihr Eigentum würde. Wieder und immer wieder ging sie hinauf nach Aracoeli, um das Bild anzusehen, und zuletzt bat sie die Mönche, ihr das Bild zu verkaufen.
Aber wenn sie auch den ganzen Mosaikboden in der großen Kirche mit Goldstücken ausgelegt hätte, die Mönche hätten ihr das Bild, das ihr einziger Trost war, doch nicht verkauft. Aber die Engländerin war so über alle Maßen von dem Bild hingerissen, daß sie außer ihm weder Freude noch Friede fand. Und da sie auf keine andere Weise ihr Ziel erreichen konnte, beschloß sie, das Bild zu stehlen. Sie dachte nicht an die Sünde, die sie damit beging, sie fühlte nur einen brennenden Durst und einen mächtigen Drang, lieber ihre Seele daran zu geben, als ihrem Herzen die Freude zu versagen, das Begehrte zu besitzen. Um nun ihr Ziel zu erreichen, ließ sie zuerst ein Bild machen, das mit dem völlig übereinstimmte, das sich auf Aracoeli befand.
Das Bildwerk auf Aracoeli ist aus Olivenholz aus dem Garten Getsemane geschnitzt; aber die Engländerin wagte es, ein Bild aus Ulmenholz schnitzen zu lassen, das jenem vollkommen ähnlich war. Das Bild auf Aracoeli ist nicht von Menschenhand bemalt. Als der Mönch, der es geschnitzt hatte, Pinsel und Farben zur Hand nahm, schlief er über der Arbeit ein, und als er erwachte, hatte das Bild Farben bekommen. Es hatte sich selbst angemalt zum Zeichen, daß Gott es liebe. Aber die Engländerin erkühnte sich, ihr Ulmenholzbild von einem irdischen Maler so anmalen zu lassen, daß es dem Heiligenbild völlig gleich war.
Für das gefälschte Bild kaufte sie nun Krone und Schuhe, aber sie waren nicht aus Gold, sondern nur aus vergoldetem Eisenblech. Sie sorgte auch für den Schmuck, kaufte Ringe und Halsbänder und Uhrketten und Juwelensterne – aber es war alles nur aus Messing und Glas – und sie kleidete das Bild so an, wie die Hilfesuchenden das rechte und richtige Christuskind angekleidet hatten.
Als das Bild fertig war, nahm sie eine Nadel und ritzte damit in die Krone die Worte: »Mein Reich ist nur von dieser Welt.« Es war, als fürchte sie selbst, sie könnte die Bilder sonst nicht mehr voneinander unterscheiden. Es hatte den Anschein, als wolle sie damit ihr Gewissen beruhigen. »Ich habe ja kein falsches Christusbild machen wollen. Ich habe ihm ja auf die Krone geschrieben: Mein Reich ist nur von dieser Welt.« Daraufhin hüllte sie sich in einen großen Mantel, verbarg das Bild darunter und ging hinauf nach Aracoeli. Und sie bat, ihre Andacht vor dem Christusbild verrichten zu dürfen.
Als sie nun in dem Heiligtum stand, als die Lichter angezündet und die eisernen Türen geöffnet waren und das Bild ihr entgegenleuchtete, da begann sie zu zittern und zu beben, und sie sah aus, als sei sie einer Ohnmacht nahe. Der Mönch, der sie begleitet hatte, eilte daher in die Sakristei nach Wasser, und sie blieb allein in der Kapelle. Und als er wieder zurückkehrte, hatte sie den Kirchenraub begangen. Sie hatte das heilige, wundertätige Bild weggenommen und an seine Stelle das falsche, ohnmächtige gesetzt.
Der Mönch wußte nichts von dem Tausch. Er verschloß das falsche Bild mit der eisernen Tür und dem doppelten Schloß, und die Engländerin wanderte mit dem Schatz von Aracoeli nach Hause. Sie stellte ihn in ihrem Palast auf einen Marmorsockel und war so glücklich wie noch nie in ihrem ganzen Leben. Droben in Aracoeli, wo man keine Ahnung hatte von dem Verlust, den man erlitten hatte, betete man nun das falsche Christuskind ebenso an, wie man einst das richtige angebetet hatte, und als Weihnachten herbeikam, baute man ihm, wie es Sitte war, draußen in der Kirche eine wunderschöne Grotte. Da lag es auf Marias Schoß, strahlend wie ein Edelstein, und um es herum waren die Hirten und die Engel und die Weisen aus dem Morgenland aufgestellt. Und solange die Grotte errichtet war, kamen die Kinder aus Rom und aus der Campagna herauf; sie wurden auf eine kleine Kanzel in der Kirche Aracoeli gestellt und predigten dann von der Holdseligkeit und Lieblichkeit und Heiligkeit und Macht des kleinen Christuskindes. Die Engländerin aber lebte in großer Angst, es könnte jemand entdecken, daß sie das Christuskind von Aracoeli gestohlen hatte. Deshalb gestand sie niemandem, daß das Bild, das sie hatte, das wirkliche war. »Es ist ein nachgemachtes Bild«, sagte sie, »es ist zwar dem wirklichen zum Verwechseln ähnlich, aber es ist trotzdem nur eine Nachahmung.«
Nun hatte aber die Engländerin ein kleines italienisches Dienstmädchen. Als dieses eines Tages durchs Zimmer ging, blieb es vor dem Bild stehen und sprach mit ihm.
»Du armes Christuskind, das doch kein richtiges Christuskind ist«, sagte sie, »wenn du nur wüßtest, wie prächtig das echte Kind in seiner Grotte zu Aracoeli liegt, und wie dort die Maria und San Guiseppe und die Hirten vor ihm auf den Knien liegen. Und wenn du nur wußtest, daß Kinder ihm gegenüber auf einer kleinen Kanzel stehen, sich vor ihm verneigen, ihm Handküsse zuwerfen und so schön von ihm predigen, wie es ihnen nur möglich ist.«
Einige Tage später trat das kleine Dienstmädchen wieder vor das Bild und sprach wieder mit ihm.
»Du armes Christusbild, das gar kein Christusbild ist«, sagte sie, »weißt du, daß ich heute in Aracoeli gewesen bin und gesehen habe, wie das richtige Kind in der Prozession getragen wurde? Ein Thronhimmel wurde über ihm gehalten, das ganze Volk fiel vor ihm auf die Knie, und man sang und spielte vor ihm. Niemals wirst du bei etwas so Herrlichem dabei sein.«
Und siehe da, einige Tage später kam das kleine Dienstmädchen wieder herbei und sprach mit dem Bild.
»O du Christuskind, das kein rechtes Christuskind ist, ich sage dir, es ist viel besser für dich, daß du hier stehst. Denn das rechte Kind wird zu den Kranken gerufen und fährt zu ihnen in einer goldenen Kutsche, aber es kann ihnen nicht helfen, sondern sie sterben in Verzweiflung. Und man fängt an zu behaupten, daß das heilige Kind von Aracoeli seine Wunderkraft verloren habe und daß Gebete und Tränen es nicht mehr rühren können. Es ist besser für dich, daß du hier stehst, als wenn du angerufen würdest und doch nicht helfen könntest.«
In der darauffolgenden Nacht aber geschah ein Wunder. Gegen Mitternacht klingelte es heftig an der Klosterpforte von Aracoeli. Und als der Torhüter nicht schnell genug öffnete, begann es zu poltern. Es polterte mit einem klirrenden Ton wie von Metall, und man hörte es im ganzen Kloster. Alle Mönche fuhren gleichzeitig aus dem Schlaf auf. Alle, die von schweren Träumen geplagt gewesen waren, fuhren aus ihren Betten auf und meinten, der Antichrist sei gekommen.
Aber als man öffnete – als man öffnete! Da stand das kleine Christusbild auf der Schwelle. Sein Händchen hatte an dem Glockenzug gezogen, sein kleiner goldbeschuhter Fuß hatte sich ausgestreckt, um an die Tür zu stoßen.
Der Torwächter nahm sogleich das heilige Kind auf seine Arme. Da sah er, daß Tränen in dessen Augen standen. Ach, das arme heilige Kind war bei Nacht durch die Stadt gewandert! Was hatte es da nicht alles sehen müssen! Soviel Armut und soviel Not und soviel Laster und soviel Verbrechen! Es war schrecklich, nur daran zu denken, was es dabei gelitten haben mußte.
Der Torwächter ging sogleich zum Prior und zeigte ihm das Bild. Und sie fragten sich, wie es denn in der Nacht habe hinauskommen können.
Aber der Prior ließ die Kirchenglocke läuten und die Mönche zu einem Gottesdienst zusammenrufen. Und alle Mönche von Aracoeli zogen in die große dämmrige Kirche, um mit aller Feierlichkeit das Bild auf seinen Platz zurückzustellen.
Abgezehrt und von Schmerzen geplagt, schritten sie in den schweren härenen Kutten zitternd zur Kirche. Mehrere weinten, als seien sie einer Lebensgefahr entronnen.
»Wie wäre es uns ergangen«, sagten sie, »wenn uns unser einziger Trost genommen worden wäre? Ist es nicht am Ende der Antichrist, der Roms heiliges Kind aus dem schützenden Heiligtum hinausgelockt hatte?«
Als sie aber das Christusbild in den Heiligenschrein der Kapelle hineinstellen wollten, fanden sie da das falsche Bild, dessen Krone die Inschrift trug: »Mein Reich ist nur von dieser Welt.«
Und als sie das Bild näher betrachteten, fanden sie diese Inschrift. Da wandte sich der Prior an die Mönche und sagte zu ihnen: »Brüder, wir wollen ein Te Deum singen und die Pfeiler der Kirche mit Seide drapieren und alle Wachskerzen und alle Hängelampen anzünden und ein großes Fest feiern. Seit das Kloster steht, ist es eine Heimat der Angst und die Stätte des Fluchs gewesen, aber um der Leiden derer willen, die hier gelebt haben, hat Gott uns jetzt Gnade erwiesen. Und nun ist alle Gefahr vorüber.
Gott hat den Kampf mit Sieg gekrönt, und was ihr hier sehet, ist das Zeichen, daß der Antichrist nicht auf dem Kapitol verehrt werden wird.
Denn auf daß nicht das Wort der Sibylle unerfüllt bleibe, hat Gott dieses falsche Christusbild gesandt, das die Worte des Antichrist in seiner Krone führt, und er hat uns zu ihm beten lassen und es von uns verehren lassen, als sei es wirklich der große Wundertäter.
Aber nun können wir in Freude und in Frieden ausruhen, denn das dunkle Wort der Sibylle ist erfüllt, der Antichrist ist hier angebetet worden.
Groß ist Gott der Allmächtige, der unsere schreckliche Furcht zunichte gemacht und seinen Willen durchgeführt hat, ohne daß die Welt das Zerrbild des Menschensohnes zu schauen brauchte!
Glücklich ist Aracoeli, das Kloster, das unter dem Schutze Gottes ruht, wo man seinen Willen tut und von seiner überfließenden Gnade gesegnet wird!«
Als der Prior diese Worte gesprochen hatte, ergriff er das falsche Bild mit beiden Händen, durchschritt die Kirche und öffnete das große Hauptportal. Er trat hinaus auf die Plattform. Unter ihm lag die hohe, breite Treppe mit ihren hundertundneunzehn Marmorstufen, die vom Kapitol wie in einen Abgrund hinabführt.
Und er hob das Bild hoch über sein Haupt empor und rief laut: »Anatema, Antikristo!« und schleuderte es vom Kapitol hinab in die Welt.
III. Auf der Barrikade
Als die reiche englische Dame am nächsten Morgen erwachte, vermißte sie das Bild und fragte sich, wo sie es suchen solle. Sie dachte, niemand anders als die Mönche von Aracoeli könnten es ihr genommen haben. Und sie ging eilig zum Kapitol, um es zu suchen und danach zu forschen. So kam sie zu der großen Marmortreppe, die zu der Kirche Aracoeli hinaufführt, und ihr Herz begann in wilder Freude zu klopfen, denn da auf der untersten Stufe lag gerade, was sie suchte. Sie riß das Bild an sich, verbarg es unter ihrem Mantel, eilte damit nach Hause und stellte es wieder in ihrem Festsaal auf.
Als sie sich dann aber in die Betrachtung seiner Schönheit versenkte, entdeckte sie, daß die Krone eine Beule bekommen hatte. Sie nahm sie vom Bild ab, um zu sehen, wie groß der Schaden sei, und dabei fiel ihr Blick auf die Inschrift, die sie selbst hineingeritzt hatte: »Mein Reich ist nur von dieser Welt.« Da wußte sie, daß dies das falsche Christusbild war und daß das echte wieder nach Aracoeli gekommen sein mußte.
Sie zweifelte daran, jemals wieder in den Besitz des echten Bildes zu kommen, und beschloß daher, Rom am nächsten Tage zu verlassen, denn sie wollte nicht mehr dableiben, nachdem sie das Bild nicht mehr hatte. Aber als sie abreiste, nahm sie das gefälschte Bild mit, weil es sie an das erinnerte, das sie liebte, und es begleitete sie von nun an auf allen ihren Reisen.
Sie hatte nämlich nirgends Ruhe, sondern reiste ständig umher, und auf diese Weise wurde das Bild in der ganzen Welt umhergeführt.
Aber überall, wohin das Bild kam, schien die Macht Christi abzunehmen, ohne daß jemand so recht begriff, warum. Denn nichts sah so machtlos aus wie dies ärmliche Bildwerk aus Ulmenholz, das mit Messingringen und Glasperlen geschmückt war.
Als die reiche Engländerin, der das Bild zuerst gehört hatte, starb, fiel es als Erbschaft an eine andere reiche Engländerin, die auch immer reiste, und von dieser an eine dritte –. Einmal, und zwar noch zur Zeit der ersten Engländerin, kam das Bild nach Paris.
Als es in die mächtige Stadt einfuhr, war dort gerade Revolution. Volkshaufen zogen wild schreiend durch die Straßen und warfen mit Steinen nach den Palästen der Reichen. Das Militär rückte gegen sie aus; da rissen sie das Straßenpflaster auf, türmten Wagen und Hausrat darauf und bauten Barrikaden.
Als nun die reiche Engländerin in ihrem großen Wagen dahergefahren kam, stürzte sich die Volksmenge auf den Wagen, zwang die Engländerin auszusteigen und schleppte den Wagen dann zu einer der Barrikaden hin.
Als man versuchte, ihn auf all die tausenderlei Dinge, aus denen die Barrikaden gebaut worden waren, hinaufzuwälzen, fiel einer der großen Koffer zu Boden, der Deckel sprang auf, und mit vielem anderen rollte auch das weggeworfene Christusbild heraus.
Die Leute stürzten sich darauf, um es zu plündern, aber sie sahen bald, daß der glänzende Schmuck unecht und vollkommen wertlos war; da begannen sie über das Bild zu lachen und es zu verspotten.
Es ging von Hand zu Hand unter den Aufrührern, bis einer von ihnen sich vorbeugte, um die Krone zu betrachten. Da sah er die Worte, die darauf eingeritzt waren: »Mein Reich ist nur von dieser Welt.«
Der Mann las diese Inschrift ganz laut, und alle Umstehenden schrien, das kleine Bild solle ihr Feldzeichen sein. Sie stellten es oben auf die Barrikade und hißten es gleichsam als ein Banner auf.
Unter denen, die die Barrikade verteidigten, war auch ein Mann, der kein armer Arbeiter war, sondern ein Gelehrter, der sein ganzes Leben in seinem Studierzimmer zugebracht hatte. Er kannte all die Not, von der die Menschen heimgesucht waren, und sein Herz war voller Mitleid für sie, so daß er beständig nach einem Mittel suchte, um ihr Los zu verbessern. Dreißig Jahre lang hatte er schon darüber nachgegrübelt und auch geschrieben, ohne einen Ausweg gefunden zu haben. Als er nun die Sturmglocke vernahm, stürzte er hinaus auf die Straße.
Er hatte eine Waffe ergriffen und sich den Kämpfenden angeschlossen in dem Gedanken, daß das Rätsel, das er nicht zu lösen vermocht hatte, vielleicht durch Gewalt und Macht zu lösen sei und daß sich die Armen vielleicht ein besseres Los erkämpfen könnten.
Kämpfend stand er den ganzen Tag; die Menschen um ihn herum fielen, Blut spritzte ihm ins Gesicht, und da erschien ihm das Elend des Lebens größer und jammervoller denn je. Aber sooft der Pulverdampf sich verzog, leuchtete vor seinen Augen das kleine Bild, das bei all dem Kampfgetümmel unerschüttert hoch oben auf der Barrikade stand. Und sooft der Mann das Bild ansah, gingen ihm die Worte durch den Kopf: Mein Reich ist nur von dieser Welt. Schließlich war es, als stünden sie vor ihm in der Luft und als tanzten sie vor seinen Augen hin und her, bald in Feuer, bald in Blut, bald in Rauch.
Er wurde ganz still. Noch hielt er das Gewehr in der Hand, aber er hörte auf zu kämpfen. Plötzlich wußte er es: Das war das Wort, wonach er sein Leben lang gesucht hatte. Nun wußte er, was er den Menschen sagen sollte, siehe, das armselige Bild dort oben hatte ihm die Lösung eingegeben. Er wollte hinausziehen in die weite Welt und verkünden: »Euer Reich ist nur von dieser Welt.
Deshalb müßt ihr für dieses Leben sorgen und wie Brüder miteinander leben. Und ihr sollt eure Reichtümer miteinander teilen, damit keiner reich und keiner arm sei. Ihr sollt alle arbeiten, und die Erde soll allen gehören, und ihr sollt alle gleich sein.
Niemand soll hungern, niemand soll zur Üppigkeit verführt werden, und niemand soll Not leiden in seinem Alter. Und euer Bestreben soll das Glück aller sein, denn es wartet euer kein Ersatz. Euer Reich ist nur von dieser Welt!«
Alles das ging ihm durch den Kopf, während er da auf der Barrikade stand, und als ihm der Gedanke klargeworden war, legte er die Waffe nieder und erhob sie nicht mehr zu Kampf und Blutvergießen.
Aber gleich darauf wurde die Barrikade abermals gestürmt, und nun auch genommen; die Truppen rückten siegreich vor und unterdrückten den Aufruhr, und ehe der Abend anbrach, herrschte schon Ordnung und Ruhe in der ganzen großen Stadt.
Da sandte die Engländerin einige Diener aus, um nach ihrem verlorenen Eigentum zu suchen, und sie fanden Verschiedenes, wenn auch nicht alles. Was sie auf der erstürmten Barrikade zuerst fanden, war das aus Aracoeli hinausgeworfene Bild.
Aber der Mann, der während des Kampfes durch das Bild klug geworden war, begann der Welt eine neue Lehre zu verkünden, die Sozialismus genannt wird, aber in Wirklichkeit das Antichristentum ist.
Und diese Lehre liebt und entsagt und duldet und leidet wie das Christentum, so daß sie alle Ähnlichkeit mit diesem hat, so wie das falsche Christusbild von Aracoeli auch alle Ähnlichkeit mit dem echten hatte.
Und ebenso wie das falsche Christusbild sagt die neue Lehre: »Mein Reich ist nur von dieser Welt.«
Und während das Bild, das die Lehre verkündigte, unbeachtet und unbekannt ist, ist es mit seiner Lehre nicht so; diese geht durch die Welt, um sie zu erlösen und umzuschaffen.
Sie verbreitet sich mit jedem Tag weiter. Sie geht hin über alle Lande; sie hat vielerlei Namen und wirkt dadurch so verführerisch, daß sie allen ihren Anhängern irdisches Glück und Genuß verspricht; deshalb zieht sie mehr Anhänger an sich als irgend sonst etwas seit der Zeit Christi.
Erstes Buch
»Da wird große Not herrschen.«
I. Mongibello
Gegen Ende der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts lebte in Palermo ein armer Junge namens Gaetano Alagona. Dieser Name war sein Glück! Wenn er nicht einer der alten Alagonas gewesen wäre, hätte man ihn wohl verhungern lassen. Er war ja nur ein Kind und hatte weder Geld noch Eltern. Aber nun hatten die Jesuiten von Santa Maria in Gesù ihn in die Klosterschule aufgenommen.
Eines Tages, als er gerade sehr eifrig an seinen Aufgaben lernte, kam ein Pater ins Schulzimmer herein und rief ihn heraus, weil eine Verwandte ihn zu sprechen wünschte. Was, eine Verwandte? Gaetano hatte immer gehört, daß alle seine Verwandten tot seien. Aber Pater Joseph behauptete, es sei eine leibhaftige Signora da, die mit ihm verwandt sei und ihn aus dem Kloster nehmen wolle. Es wurde immer schlimmer. Sie wollte ihn aus dem Kloster nehmen? Dazu hatte sie doch wohl kein Recht! Er sollte ja Mönch werden.
Er wollte die Signora gar nicht sehen und meinte, Pater Joseph solle ihr nur sagen, Gaetano dürfe das Kloster nicht verlassen und deshalb könne es auch nichts nützen, wenn sie ihn selbst darum bitte. Aber Pater Joseph erwiderte, daß es durchaus nicht angehe, sie abreisen zu lassen, ohne daß Gaetano sie gesehen habe; und er zog den widerwilligen Gaetano ins Sprechzimmer.
Da stand die Signora an einem Fenster. Sie hatte graues Haar, eine braune Gesichtsfarbe und schwarze Augen, so rund wie Perlen. Sie hatte einen Spitzenschleier auf dem Kopf, und ihr schwarzes Kleid war fadenscheinig und schimmerte ein wenig ins grünliche, gerade wie Pater Josephs älteste Soutane. Als sie Gaetano erblickte, machte sie das Zeichen des Kreuzes.
»Gott sei gelobt, er ist ein echter Alagona!« sagte sie und küßte ihm die Hand.
Sie sagte, es tue ihr sehr leid, daß Gaetano zwölf Jahre alt geworden sei, ohne daß jemand von seinen Angehörigen sich um ihn gekümmert habe. Aber sie habe nicht gewußt, daß von der anderen Linie noch jemand am Leben sei. Wie sie es dann erfahren habe? Ja, Luca habe den Namen in einer Zeitung gelesen. Er habe in der Liste derer gestanden, die eine Prämie erhalten hätten. Es sei nun etwa ein halbes Jahr her, aber die Reise von Palermo hierher sei sehr weit. Sie habe sparen und sparen müssen, um das Reisegeld zusammenzubringen. Deshalb habe sie nicht früher kommen können. Aber herreisen und ihn sehen, das habe sie durchaus müssen. Santissima Madre, wie glücklich sie jetzt sei! Sie, Donna Elisa, sei auch eine Alagona. Ihr verstorbener Mann, der sei ein Antonelli gewesen. Es gebe übrigens noch einen Alagona, ihren Bruder. Der wohne auch in Diamante. Aber Gaetano wisse wohl gar nicht, wo Diamante liege?
Der Junge schüttelte den Kopf.
Ja, das könne sie sich schon denken, erwiderte sie und lachte.
»Diamante liegt auf dem Monte Chiaro. Weißt du, wo der Monte Chiaro liegt?
»Nein.«
Sie zog die Augenbrauen in die Höhe und machte ein sehr schelmisches Gesicht.
»Der Monte Chiaro liegt auf dem Ätna, wenn du weißt, wo der Ätna liegt.«
Das klang so betrübt, als sei es allzuviel verlangt, daß Gaetano etwas vom Ätna wisse. Und sie brachen alle drei in helles Lachen aus, Donna Elisa, Pater Joseph und Gaetano.
Donna Elisa wurde ein ganz anderer Mensch, nachdem sie die beiden einmal zum Lachen gebracht hatte.
»Willst du nun kommen und Diamante und den Ätna und den Monte Chiaro sehen?« fragte sie schnell. »Den Ätna mußt du sehen. Das ist der größte Berg der Welt. Der Ätna ist ein König; die Berge rings um ihn her liegen auf den Knien vor ihm und wagen es nicht, die Augen zu seinem Gesicht zu erheben.«
Dann begann sie, alles mögliche vom Ätna zu erzählen. Sie glaubte gewiß, sie würde Gaetano damit locken.
Und Gaetano hatte auch wirklich noch niemals darüber nachgedacht, was der Ätna für ein Berg ist. Er hatte noch nie erwogen, daß er Schnee auf dem Scheitel, einen Eichenwald im Bart und Weinlaub um die Hüften trägt und daß er bis an die Knie in Orangenhainen watet.
Und mitten aus dem Ätna kommen große, breite, schwarze Ströme herausgestürzt. Diese Ströme seien ganz merkwürdig; sie fließen dahin, ohne zu rauchen, sie bilden Wogen ohne Sturm, und die schlechtesten Schwimmer können ohne eine Brücke hinüberkommen. Gaetano erriet, daß sie die Lava meinte. Und sie freute sich, daß er dies erraten hatte. Er hatte also einen guten Kopf. Er war ein echter Alagona.
Und wie groß der Ätna ist! Denkt euch, man braucht volle drei Tage, um herumzufahren, und drei Tage, um auf den Gipfel hinauf und wieder herunter zu reiten. Und daß es außer Diamante dort noch fünfzehn Ortschaften und vierzehn große Wälder und zweihundert kleine Berge gibt! Die Berge sind eigentlich gar nicht so klein, aber der Ätna ist so groß, daß sie neben diesem wie ein Schwarm Fliegen auf einem Kirchendach aussehen. Und daß es dort auch Höhlen gibt, in denen ein ganzes Kriegsheer Platz hat, und alte hohle Bäume, in denen eine große Schafherde bei einem Gewitter einen Unterschlupf findet! Alles, was es nur Merkwürdiges gibt, scheint sich auf dem Ätna zusammenzufinden. Es sind Flüsse da, vor denen man sich in acht nehmen muß. Ihr Wasser ist so kalt, daß man stirbt, wenn man davon trinkt. Und es sind andere Flüsse da, die nur am Tag, und wieder andere, die nur im Winter, und wieder andere, die fast nur unterirdisch fließen. Und es gibt dort auch warme Quellen und Schwefelquellen und Schlammvulkane.
Es wäre wirklich schade, wenn Gaetano diesen Berg, der gar so großartig sei, gar nicht zu sehen bekäme. Wie ein prächtiges Zelt hebe er sich vom Himmel ab, und er sei gerade so bunt wie ein Karussell. Gaetano müßte ihn nur morgens und abends ansehen, da sei der Berg ganz rot, und er müßte ihn bei Nacht sehen, da sei er ganz weiß. Da würde Gaetano dann schon erfahren, ob es wahr sei, daß er alle Farben annehmen, daß er blau, schwarz, braun und veilchenfarbig aussehen könne. Oder ob er einen Schönheitsschleier trage wie eine Signora. Oder daß er einem Tisch gleiche, der mit Plüschdecken überzogen sei. Oder ob er wirklich eine aus Gold gewebte Tunika und einen Mantel aus Pfauenfedern habe.
Und Gaetano werde doch gewiß auch gerne wissen wollen, wie es sich damit verhalte, daß der alte König Artus dort in einer Höhle sitzen solle. Donna Elisa versicherte, es sei die volle Wahrheit, und er wohne auch jetzt noch im Ätna, denn als der Bischof von Catania einmal über den Berg ritt, seien ihm drei Esel davongelaufen, und der Knecht, der auf der Suche nach ihnen war, habe sie dann bei König Artus in der Höhle gefunden. Da habe der König dem Knecht befohlen, dem Bischof zu sagen, daß er, weil seine Wunden nun geheilt seien, mit den Rittern von der Tafelrunde kommen wolle, um in Sizilien alles, was in Unordnung geraten sei, wieder in Ordnung zu bringen. »Und wer Augen hat zu sehen, der weiß wohl, daß der König bis jetzt die Höhle noch nicht verlassen hat«, sagte Donna Elisa.
Gaetano wollte sich nicht von ihr fangen lassen, aber er dachte, er müsse ein wenig freundlich zu ihr sein. Sie stand noch immer, aber nun holte er einen Stuhl für sie herbei. Nur sollte sie deshalb nicht glauben, daß er mit ihr gehen wolle.
Es gefiel ihm wirklich, sie von ihrem Berg erzählen zu hören. Es war so lustig, daß der Berg so vielerlei Künste konnte. Er war offenbar gar nicht wie der Monte Pellegrino bei Palermo, der ganz einfach dasteht und nichts tut. Der Ätna konnte rauchen wie ein Schornstein und sprühen wie eine Gaslaterne. Er konnte rollen, zittern, Lava ausspeien, Steine auswerfen, Asche säen, das Wetter prophezeien und Regen sammeln. Wenn der Mongibello sich nur rührte, fiel ein Ort nach dem andern zusammen, als ob die Gebäude nur Kartenhäuser wären.
Mongibello heiße der Ätna auch, sagte Donna Elisa. Das bedeute »Berg der Berge«. Und diesen Namen habe er auch wirklich verdient.
Gaetano sah, daß sie fest davon überzeugt war, er werde ihr nicht widerstehen können. Sie hatte sehr viele Runzeln im Gesicht, und wenn sie lachte, liefen diese durcheinander wie die Maschen eines Netzes. Er beobachtete es eifrig, denn es sah gar so sonderbar aus. Aber er war in dem Netz noch nicht gefangen.
Jetzt aber fragte sie, ob Gaetano auch wirklich den Mut hätte, den Ätna zu besuchen, denn in dem Berg selbst gebe es viele gefesselte Riesen und ein schwarzes Schloß, das von einem Hund mit vielen Köpfen bewacht werde. Auch eine große Schmiede sei dort drinnen mit einem hinkenden Schmied, der nur ein Auge habe, das ihm mitten auf der Stirn sitze. Das schlimmste von allem aber sei, daß auf dem Grund des Berges ein Schwefelsee sei, in dem es wie in einem Kessel mit Öl koche, und in diesem Schwefelsee liege Luzifer mit allen Verdammten. Nein, er werde den Mut nicht haben, dahin zu kommen, sagte sie.
Sonst ist es allerdings nicht gefährlich, dort zu wohnen, denn der Berg fürchte die Heiligen. Ja, er fürchte sogar viele Heilige, sagte Donna Elisa, am meisten aber die Santa Agata von Catania. Wenn die Leute von Catania die Heiligen gebührend ehren würden, dann könnten ihnen weder Erdbeben noch Lava Schaden zufügen.
Gaetano stand ganz dicht vor ihr und lachte über alles, was sie sagte. Warum war sie nur hergekommen, und warum mußte er über alles lachen? Diese Donna Elisa war doch eine ganz merkwürdige Signora.
Plötzlich sagte er, damit sie sich nicht falsche Hoffnungen machte:
»Donna Elisa, ich muß Mönch werden.«
»So, mußt du das?« sagte sie. Aber dann begann sie ohne weiteres wieder von dem Berg zu reden.
Sie sagte, er solle jetzt recht gut aufpassen, denn nun komme sie zum Allerwichtigsten. Er solle sie zur Südseite des Berges begleiten, und zwar so weit hinab, daß sie in der Nähe der großen Ebene von Catania seien, und da werde er ein Tal sehen, ein sehr großes, weites, halbrundes Tal. Es sei vollständig schwarz, denn die Lavaströme seien von allen Seiten hineingeflossen, und es gebe da nicht einen einzigen Grashalm, nur Steine.
Aber wie stelle sich Gaetano nun eigentlich die Lava vor? Donna Elisa vermutete, er glaube, sie liege so glatt und eben auf dem Ätna, wie sie auf der Straße liegt. Aber am Ätna gebe es eine ganze Menge Ungetüme. Er solle sich einmal vorstellen, daß all die Schlangen und Drachen und Hexen, die in der glühenden Lava kochten, mit hinausfließen, sobald es einen Ausbruch gibt. Da liegen sie dann und kriechen herum, schlingen sich ineinander und versuchen, auf die kalte Erde zu kriechen, halten einander aber doch in dem Elend zurück, bis die Lava um sie her erstarrt ist. Frei machen können sie sich dann nie mehr. Ach nein!
Die Lava selbst sei auch gar nicht so einförmig, wie er sich wohl denke. Obgleich dort kein Gras wachse, sei doch anderes zu sehen. Aber er könne sich gewiß nicht denken, was das ist. Es bäume sich auf und falle zusammen, es stürze übereinander und krieche weiter, es krieche auf den Knien, auf dem Kopf und auf den Ellbogen. Es klettere die Wände des Tales hinauf und die Wände wieder hinab, es habe nur Zacken und Knochen, es habe einen Mantel aus Spinnengewebe und Staub in der Perücke und viele Glieder wie ein Wurm. Was könne das anderes sein als der Kaktus? Ob er wisse, daß der Kaktus auf die Lava hinausgehe und den Boden urbar mache wie ein Bauer? Ja, ob er wisse, daß nichts als der Kaktus über die Lava Herr werden könne?
Nun sah sie Pater Joseph an und lachte dabei. Der Kaktus, das sei der beste Kobold, den es auf dem Ätna gebe, aber ein Kobold sei und bleibe eben doch ein Kobold. Der Kaktus sei ein Sarazene, denn erhalte sich Sklavinnen. Ganz gewiß, sobald er an irgendeinem Ort festen Fuß gefaßt habe, müsse er auch einen Mandelbaum haben. Die Mandelbäume aber seien feine, junge Damen, sie wollen sich nur ungern auf das Schwarze hinauswagen, aber es helfe ihnen alles nichts. Hinaus müssen sie, und hinaus kommen sie. Gaetano werde es schon sehen, wenn er dorthin komme. Wenn im Frühjahr die Mandelbäume mit ihrer weißen Blütenpracht auf dem schwarzen Feld zwischen den grauen Kaktuspflanzen stehen, dann sehen sie so unschuldig und wunderschön aus, daß man über sie weinen könnte wie über verwünschte Prinzessinnen.
Nun solle er aber endlich erfahren, wo der Monte Chiaro liege. Aus dem Grunde dieses schwarzen Tales steige er auf. – Sie versuchte ihren Regenschirm auf dem Fußboden zum Stehen zu bringen. – So stehe er da, ganz aufrecht, er habe nie ans Niederlegen oder Sitzen gedacht. Und ebenso schwarz wie das Tal, ebenso grün sei der Monte Chiaro. Da sei Palme an Palme, Ranke an Ranke, er sei ein Herr in einem großgeblümten Schlafrock, ein König mit einer Krone auf dem Kopf. Er trage ganz Diamante wie eine Krone auf seinem Scheitel.
Schon seit einer Weile hatte Gaetano die größte Lust verspürt, Donna Elisas Hand zu ergreifen. Ob er es sich wohl traute? Ja, er traute es sich. Er zog ihre Hand an sich. Aber was sollte er nun damit anfangen? Vielleicht sie streicheln? Wenn er es ganz leicht mit einem Finger versuchte, vielleicht würde sie es dann gar nicht merken. Vielleicht würde sie es auch nicht merken, wenn er zwei Finger nähme. Vielleicht würde sie es nicht einmal merken, wenn er ihr die Hand küßte. Sie sprach und sprach; sie merkte es gar nicht.
Sie habe ihm noch viel zu sagen, fuhr sie fort. Aber die Geschichte von Diamante, die sei die allerschönste.
Sie sagte, die Stadt habe einst unten im Tal gelegen. Da sei die Lava gekommen, feuerrot habe sie über den Rand des Tales hinabgesehen. Was – was, war der jüngste Tag angebrochen? Die Stadt nahm in aller Eile ihre Häuser auf den Rücken, auf den Kopf und unter die Arme und lief den Monte Chiaro hinauf, der ganz nahe war.
Im Zickzack lief die Stadt den Berg hinauf. Als sie weit genug oben war, warf sie ein Stadttor und ein Stückchen Stadtmauer ab. Dann sprang sie spiralförmig um den Berg herum und warf überall Häuser hin. Die Häuser der armen Leute mochten fallen, wie sie eben gerade fielen. Man hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern. Man konnte nichts besseres verlangen als unregelmäßige krumme Straßen, nein, mehr konnte man nicht erwarten. Die große Stadt lief rund um den Berg, ganz so, wie die Stadt den Berg hinaufgelaufen war, und an die Straße hatte sie bald eine Kirche, bald einen Platz hingeworfen. Aber so viel Ordnung war doch gewesen, daß das Beste am höchsten hinaufgekommen war. Und als die Stadt den Berggipfel erreichte, breitete sie da einen Marktplatz aus, und hier stellte sie auch das Rathaus und die Domkirche und den alten Palazzo Geraci hin.
Aber wenn er, Gaetano Alagona, mit ihr nach Diamante gehe, dann werde sie ihn auf den Marktplatz droben auf dem Berggipfel mitnehmen und ihm zeigen, welche Ländereien die alten Alagonas auf dem Ätna und auf der Ebene von Catania einst besessen hatten und wo sie ihre Burg auf dem Gebirge weit drin im Land errichtet hatten. Denn dort oben sehe man alles das und noch vieles andere, nämlich das ganze Meer.
Gaetano war es nicht aufgefallen, daß sie lange sprach, aber Pater Joseph war offensichtlich etwas ungeduldig. »Nun sind wir ja endlich an Ihrem eigenen Hause angekommen«, sagte er ganz freundlich.
Aber sie versicherte Pater Joseph, daß es bei ihr selbst gar nichts zu sehen gebe. Was sie Gaetano vor allem in Diamante zeigen möchte, sei das große Haus am Korso, das der Sommerpalast genannt werde. Es sei zwar nicht so schön wie der Palazzo Geraci; aber es sei groß, und solange die alten Alagonas auf der Höhe ihres Glanzes standen, hätten sie im Sommer dort gewohnt, um dem Schnee des Ätna näher zu sein.
Ja, wie gesagt, von der Gasse aus machte er keinen großartigen Eindruck. Aber er habe einen herrlichen Hof mit offenen Säulengängen auf beiden Stockwerken. Und auf dem Dach sei eine Terrasse, die mit blauen und weißen Ziegeln ausgelegt sei, und in jedem Stein sei das Wappen der Alagonas eingebrannt. Das würde Gaetano gewiß gerne sehen. Gaetano kam der Gedanke, daß gewiß daheim in Diamante öfters Kinder zu Donna Elisa kämen und sich auf ihren Schoß setzten. Vielleicht würde sie es gar nicht merken, wenn er es auch täte. Ob er es versuchte? Ja, es war so, sie war daran gewöhnt, sie merkte es gar nicht.
Sie fuhr nun fort, den Palast zu beschreiben. Da sei ein großes Prunkzimmer, in dem die alten Alagonas getanzt und gespielt hätten. Da sei auch ein großer Saal mit einer Musikgalerie, da seien alte Möbel und Standuhren in kleinen weißen Alabastertempeln, die auf schwarzen Ebenholzsockeln stünden. Die Prunkzimmer bewohnte niemand, aber sie werde sie ihm zeigen. Er meine wohl, sie selbst wohne in dem Sommerpalast? Ach nein, da wohne ihr Bruder, Don Ferrante. Der sei ein Kaufmann und habe seinen Laden im Erdgeschoß, und da er sich noch keine Frau genommen habe, stehe da droben alles, wie es von jeher gestanden habe. Gaetano überlegte, ob er wohl noch länger auf ihrem Schoß sitzen bleiben dürfe. Es war doch sonderbar, daß sie nichts davon merkte. Und das war ein Glück, denn sonst käme sie am Ende auf den Gedanken, daß er sich das Mönchwerden aus dem Kopf geschlagen habe.
Aber sie war jetzt mehr als je mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Ihre Wangen röteten sich ein wenig unter der braunen Farbe, und sie zog ein paarmal in der allerkomischsten Weise die Augenbrauen in die Höhe. Dann begann sie zu erzählen, wie sie selbst lebte.
Offenbar wohnte Donna Elisa in dem allerkleinsten Haus der ganzen Stadt. Es lag dem Sommerpalast gerade gegenüber, aber das war auch sein einziger Vorteil. Sie hatte einen kleinen Laden, in dem sie Medaillen und Wachskerzen und alles, was zum Gottesdienst gehört, verkaufte. Aber, sagte sie, unbeschadet des Respekts für Pater Joseph sei bei dem Handel zur Zeit nicht viel zu verdienen, wie dies früher vielleicht der Fall gewesen sei. Hinter dem Laden war eine kleine Werkstätte. Dort hatte sich früher ihr Mann aufgehalten und Heiligenbilder und Rosenkranzkugeln geschnitzt, denn der Signor Antonelli war ein Künstler gewesen. Und neben der Werkstatt waren ein paar Rattenlöcher, in denen man sich kaum umdrehen konnte, man mußte so zusammengekauert sitzen, wie in den Gefängnissen der alten Könige, und eine Stiege höher waren ein paar Hühnerställe. In dem einen hatte sie etwas Stroh zu einem Nest gebreitet und ein paar Sitzstäbe angebracht. Da dürfe Gaetano schlafen, wenn er zu ihr komme.
Gaetano hatte große Lust, ihr die Wangen zu streicheln; sie würde wohl sehr betrübt sein, wenn sie erfuhr, daß er nicht mitreise. Vielleicht durfte er sie ein wenig streicheln? Er schielte zu Pater Joseph hinüber. Pater Joseph sah zu Boden und seufzte, wie es seine Gewohnheit war. Er dachte nicht an Gaetano, und Donna Elisa merkte es gar nicht.
Sie sprach davon, daß sie ein Mädchen habe, die Pacifica heiße, und einen Diener namens Luca. Aber sie habe nur sehr wenig Hilfe von ihnen, denn Pacifica werde alt, und seit sie nicht mehr höre, sei sie so reizbar, daß man sie nicht mehr im Laden helfen lassen könne. Und Luca, der eigentlich Holzschnitzer sei und Heilige schnitzen sollte, die sie verkaufen könnte, sitze nie ordentlich in der Werkstatt, sondern gehe hinaus in den Garten und pflege die Blumen. Ja, sie habe auch einen Garten in dem steinigen Land auf dem Monte Chiaro. Aber er solle ja nicht glauben, daß etwas Besonderes dran sei. Bei ihr sei es nicht so schön wie im Kloster, das werde sich Gaetano wohl denken können. Aber sie möchte ihn eben sehr gerne bei sich haben, weil er einer der alten Alagona sei. Und zu Hause hätten sie und Pacifica und Luca zueinander gesagt: »Was fragen wir danach, ob wir noch mehr Sorgen bekommen, wenn wir ihn nur hier haben.« Nein, die Madonna wußte, daß sie sich aus den Sorgen nichts machten. Es handle sich jetzt nur darum, ob er, um zu ihnen kommen zu können, bereit sei, manches zu entbehren.
Nun war sie fertig, und nun fragte Pater Joseph, was Gaetano antworten wolle. Es sei der Wille des Priors, sagte Pater Joseph, daß Gaetano selbst entscheide. Man habe nichts dagegen, wenn er in die Welt hinausgehe, weil er der Letzte seines Geschlechts sei.
Gaetano glitt leise von Donna Elisas Schoß herab. Aber antworten! Das war keine so leichte Sache, ja, es war sehr schwer, zu der Signora nein zu sagen.
Pater Joseph kam ihm zu Hilfe.
»Bitte die Signora, daß du ihr in ein paar Stunden antworten darfst. Der Junge hat nie einen andern Gedanken gehabt als den, Mönch zu werden«, sagte er zu Donna Elisa als Erklärung. Sie stand auf, nahm ihren Regenschirm und versuchte, vergnügt auszusehen, aber die Tränen standen ihr in den Augen.
Ja gewiß, gewiß solle er es sich überlegen, sagte sie. Aber wenn er Diamante kennte, dann wäre dies nicht nötig. Jetzt wohnten allerdings nur Bauern dort, aber es hätten einst auch ein Bischof und viele Priester und eine ganze Menge Mönche dort gewohnt. Die seien jetzt nicht mehr da, aber sie seien noch nicht vergessen. Von jener Zeit her sei Diamante auch heute noch eine heilige Stadt. Es würden da fast mehr Festtage gefeiert als an irgendeinem andern Ort, es gebe auch eine Menge Heilige da, und noch heute komme eine große Zahl Pilger nach Diamante. Wer in Diamante wohne, könne Gott nie vergessen, ja, er sei schon ein halber Priester. Deswegen also könnte er ruhig mitkommen. Aber er solle sich die Sache nur überlegen, wenn dies sein Wunsch sei. Sie werde morgen wiederkommen.
Gaetano benahm sich sehr ungezogen. Er wandte sich von ihr ab und rannte zur Tür hinaus. Er sagte auch kein Wort, daß er ihr für ihr Kommen dankbar sei.
Er wußte, daß Pater Joseph dies von ihm erwartete, aber er konnte nicht. Wenn er an den großen Mongibello dachte, den er niemals sehen würde, und an Donna Elisa, die nie wiederkommen würde, und an die Schule und an den ummauerten Klostergarten und an ein ganzes eingeengtes Leben! Pater Joseph mochte von ihm denken, was er wollte, er mußte davonlaufen. Es war ganz einerlei, was Pater Joseph von ihm erwartete, er mußte davonlaufen.
Es war auch höchste Zeit; kaum war er vor der Tür draußen, so überkam ihn das Weinen. Donna Elisa tat ihm so leid. Ach, daß sie so allein nach Hause fahren mußte! Daß er sie nicht begleiten konnte!
Jetzt hörte er Pater Joseph kommen, und er drehte rasch sein Gesicht gegen die Wand. Wenn er nur das Schluchzen hätte unterdrücken können!
Pater Joseph seufzte und murmelte vor sich hin, wie das seine Gewohnheit war. Als er bei Gaetano angekommen war, blieb er stehen und seufzte schwerer als zuvor.
»Es ist der Mongibello, der Mongibello«, sagte Pater Joseph, »niemand kann dem Mongibello widerstehen.«