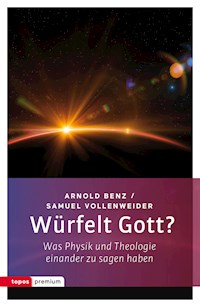Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse in Astronomie, Physik und Biologie stellt Arnold Benz Fragen nach Wesen und Zukunft des Universums. Auf leicht verständliche Art fasst er die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen und führt uns an deren Grenze. Alle Prognosen gehen auf Zerfall: Die Sonne wird erkalten, die Materie wird radioaktiv zerfallen - es gibt naturwissenschaftlich keine begründete Hoffnung. Aber gerade hier wird der Dialog mit der Religion reizvoll und interessant. Auch der naturwissenschaftlich analysierte Kosmos kann Schöpfung sein, durchdrungen von der Intelligenz göttlichen Geistes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
BUCH LESEN
COVER
HAUPTTITEL
INHALT
ANMERKUNGEN
ÜBER DEN AUTOR
ÜBER DAS BUCH
IMPRESSUM
HINWEISE DES VERLAGS
Wüssten wir wahrzunehmen, wer weiß, ob das Wahre nicht hie und da doch im Wirklichen erschiene.
Kurt Marti, Im Sternzeichen des Esels, 1995
Arnold Benz
Die Zukunft des Universums
Zufall, Chaos, Gott
Patmos Verlag
Für unsere Kinder Renate, Christoph, Pascal und Simon zum Anfang des neuen Jahrtausends
INHALT
Einleitung
1. Teil Universum, Zeit und Schöpfung
Eine Nacht am Very Large Array
Die Zeit der Sterne
Ein Stern entsteht
Das Endstadium eines Sterns
Neue Generationen von Sternen
Das Universum entwickelt sich
Konflikt oder Distanz?
Kausalität und Zeit in der Naturwissenschaft
Religiöse Wahrnehmungen
Schöpfungsgeschichten wollen Werte vermitteln
Scheiden, was nicht zusammengehört
Zwei Sprachebenen
Wahrnehmen, erfahren, glauben: Was ist Wahrheit?
Konsequenzen der Trennung von Glaube und Naturwissenschaft
Notwendige Annäherung
Begegnungspunkt Staunen
Krise der Metaphysik
Das biblische Vorbild
Das Universum als Schöpfung
Ein neues Loblied
Fazit
2. Teil Physik und Wirklichkeit
Eine astronomische Atemmeditation
Zum Verhältnis von Subjekt und Objekt
Die Unschärfe der Quantenmechanik
Was ist physikalische Wirklichkeit?
Wie materiell ist Materie?
Teilchen und Feldquanten
Das Vakuum ist nicht nichts
Der Anfang des Universums
Die Vakuumshypothese
Dunkelmaterie: wichtiger, als man dachte
Entwicklungen im frühen Universum
Warum gerade dieses Universum?
Die Feinabstimmung des Universums
Das Anthropische Prinzip
Gott als Naturkraft, Lückenbüßer oder Transzendenz?
3. Teil Leben und Sterben
Leben am Teich
Altes und Neues
Leben und Tod
Wie Neues entsteht
Neues im Universum
Evolution der Lebewesen
Warum gibt es Leben auf der Erde?
Evolution der Evolutionstheorie
Die Rolle des Todes
Begegnungspunkt Tod
Die zwei Ebenen der Auferstehung
Gottesvorstellungen
Teilnehmender Glaube
These
4. Teil Zukunft
Zukunftsgefühle
Die Zukunft ist offen
Der Zufall ist Teil der Physik
Chaos begrenzt unser Wissen
Selbstorganisation ohne Selbst
Offenheit und Freiheit
Die Zukunft des Universums
Sonne und Erde werden vergehen
Das Universum wird nicht bleiben, wie es ist
Eine andere Sicht der Zukunft
Ich-bin-Worte
Christologische Deutungen sind Modelle
Hoffen trotz Prognosen?
Mit Mustern die Wirklichkeit erkennen
Metaphern ersetzen Begriffe
Zeit und Hoffnung
Danksagungen
Nachwort zur Neuauflage 2012
Einleitung
Als junger Physikstudent hörte ich zum ersten Mal vom Theologen Karl Barth, der postulierte, Naturwissenschaft und Glaube hätten nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Wie diese These zu mir drang, weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich an das Gefühl, das sie in mir hervorrief, als sei es gestern gewesen: Ich fühlte mich befreit vom Zwang aufdringlicher Gottesbeweise. Denn die Argumente einer sogenannten natürlichen Theologie, die aus Erkenntnissen über die Natur Gottes Existenz beweisen und seine Eigenschaften ergründen will, fand ich bemühend, unaufrichtig und vereinnahmend. Und nun sagte ein Theologe, dass Gott »ganz anders« sei und dass man ihn nicht wie den Energiesatz aus Messungen und Beobachtungen herleiten könne. Genau das entsprach auch meinem Empfinden angesichts der täglichen Flut von Formeln und Experimenten. Was ist dann aber dieser Gott? Ist Gott in unserer naturwissenschaftlich geprägten Zeit überhaupt noch denkbar? Diese Fragen haben mich weiterhin beschäftigt, und um sie geht es in diesem Buch.
Die Trennung von Theologie und Naturwissenschaft hat sich zumindest von Seiten der Theologie durchgesetzt. Die großen Dispute, verbunden mit den Namen Galilei und Darwin, sind in den Hörsälen verklungen. Galilei ist rehabilitiert. Es gelten die Regeln der höflichen Distanz. Dennoch tauchte das Wort Gott in allgemein verständlichen Werken über die moderne Physik wieder auf. Der Begriff erscheint dort meistens im Zusammenhang mit ungelösten Fragen der Kosmologie, des Lebens, des menschlichen Bewusstseins oder der Deutung der physikalischen Wirklichkeit, welche heute die großen Rätsel der Natur und die Leitziele der naturwissenschaftlichen Forschung darstellen. Diese zwar naheliegenden Berührungsorte haben aber den Dialog nicht in Fahrt gebracht und sind offensichtlich nicht die richtigen Startpunkte für Kontakte. Der Grund liegt darin, dass von physikalischer Seite1 häufig ein Gottesbild der natürlichen Theologie vorausgesetzt wird, von dem sich die heutigen Theologinnen und Theologen längst distanziert haben. Ich gehe hier nicht davon aus, dass Gott ein geheimnisvoller Schlüssel ist, um wissenschaftliche Resultate noch weiter zu entziffern, wie einige übereifrige Wissenschaftler behaupten und andere ebenso leidenschaftlich verneinen. Ich nehme vielmehr an, dass Gott ein Begriff ist, der von anderen Wahrnehmungen und Erfahrungen ausgeht. Im Gegensatz zum jungen Barth, kann diese andere Realität nicht vollständig von der Naturwissenschaft getrennt werden.
Vermehrt gibt es auch von der Theologie her wieder Interesse an der anderen Seite, nicht zuletzt, weil sich ethische und weltanschauliche Werte heute nur in einer Sprache vermitteln lassen, welche die Naturwissenschaften einbezieht. Auch ist die Vorstellung von einem, wenn vielleicht auch nicht erkennbaren, gemeinsamen Ganzen der Wirklichkeit tief in der religiösen Tradition verwurzelt.
Es ist nicht das Ziel dieses kleinen Buches, eine vereinheitlichte Theorie von Glaube und Naturwissenschaft zu entwerfen. Die beiden Bereiche menschlicher Erfahrung, will man sie beide ernst nehmen, sperren sich gegen nahtlose Übergänge und völlige Harmonisierung. Die Grenze bleibt bestehen, aber sie soll überschritten werden. Dabei müssen die Regeln im jeweiligen Gebiet beachtet werden. Ist diese meine abenteuerliche Exkursion in fremdes Territorium nicht ein halsbrecherisches Unterfangen? Sollten Naturwissenschaftler ihre bescheidenen und oft laienhaften Einsichten in Kultur und Religion nicht besser für sich behalten? Solche Fragen und Bedenken habe ich viele gehabt, aber schließlich hinter mir gelassen, denn sie versperren wie Grenzwälle die Sicht aus dem eigenen Gebiet und auf die eigentliche Aufgabe in der Gesellschaft: Die Naturwissenschaft hat in den vergangenen vierhundert Jahren grundlegende Umwälzungen im menschlichen Selbstverständnis und in unserer Gesellschaft bewirkt und verändert sie weiter. Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler können sich aus ihrer Verantwortung dafür nicht herausstehlen. Sie sind aufgerufen, ihre subjektiven und auch vorläufigen Ansichten preiszugeben.
Bei meinen häufigen populärwissenschaftlichen Vorträgen fällt mir auf, wie Zuhörerinnen und Zuhörer mir nach den präsentierten Fakten und Zahlen unbeirrt weltanschauliche und religiöse Fragen stellen. Beim Hinausgehen sagte mir einmal ein junger Mann: »Wenn das Universum so groß ist, wie Sie es dargestellt haben, muss Gott ja noch viel größer sein.« Nicht die subtilen Probleme der Sternentwicklung noch die ungelösten Fragen der Galaxien-Entstehung haben ihn berührt, sondern eine Glaubensfrage, über die ich kein Wort verloren hatte. Wenn Fachleute ihr Wissen rational vortragen, fühlen sich Laien durch dieses Wissen oft existentiell angesprochen und erleben ihr Ich als einen Teil des Kosmos. Einige entwickeln sogar eine persönliche Beziehung zu den Himmelskörpern. Sie wollen nicht nur ursächliche Erklärungen der Naturphänomene hören, sondern wünschen eine emotionale Verbindung, ein kommunikatives Erlebnis mit dem Kosmos oder möchten ganz einfach staunen.
Ich gehe in diesem Buch von der Annahme aus, dass Glaube und Naturwissenschaft zwei verschiedene Wege sind, Wirklichkeit zu erfahren. Mit Karl Barth bin ich auch heute noch der Meinung, dass sich Glaubensaussagen und wissenschaftliche Theorien nicht in ein direktes Verhältnis setzen lassen: Das eine folgt nicht zwingend aus dem anderen, das eine kann das andere weder beweisen noch widerlegen. Beide beruhen auf menschlichen Erfahrungen, keines kann sich als die volle Wahrheit ausgeben. Glaube und Naturwissenschaft bewegen sich auf verschiedenen Ebenen, die sich nicht schneiden. Von einer übergeordneten Warte aus, mathematisch gesagt in einem Metaraum, können sie jedoch eingeordnet und von einem beidseitig aufgeschlossenen Betrachter in Beziehung gebracht werden. Wirkliche Vermittlung geschieht jedoch am besten auf einer pragmatischen Ebene. Aus diesem Grund ist die Zukunft des Universums und von uns selbst, wie sie Glauben und Naturwissenschaft erwarten, ein praktisches und sehr relevantes Beispiel und das Thema dieses Buches.
In diesem Buch sollen beide, Glauben und Naturwissenschaft, ernst genommen werden. Mit Glauben meine ich die je persönliche Verfahrensweise, Gott, die Welt und die eigene menschliche Existenz in Verbindung zu bringen. Ich bediene mich dabei des Religionssystems des Christentums, dessen theologische Konzepte mir wichtige Werkzeuge und tiefe Erkenntnisse liefern. Ernst nehmen bedeutet hier, dass ich mich nicht nur auf die mir in meiner Jugend vermittelten Kenntnisse verlasse, sondern mich nach Möglichkeit auf den neusten Stand der Theologie beziehe. Damit grenze ich mich auch ab gegen eine ganze Reihe von Physikern vor allem aus dem angelsächsischen Bereich, welche Religion auf eine bescheidene Metaphysik reduzieren, um Fragen zu beantworten, auf welche die Naturwissenschaft keine Antwort weiß, oder auch nur, um dann zu zeigen, dass es diesen metaphysischen Gott nicht braucht. Unausgesprochen übernehmen sie damit ein Gottesbild aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welches weder das einzig mögliche noch ein theologisch zeitgemäßes ist.
Auch die Naturwissenschaft will ernst genommen werden. Wenngleich wir seit Karl Popper wissen, dass alle naturwissenschaftliche Erkenntnis und alle Theorien falsifizierbar und vielleicht mit Irrtum behaftet sind, bewähren sie sich doch gut genug, um auf den Mond zu fliegen und gesund zurückzukehren. Die Naturwissenschaft lässt sich ihre Wirksamkeit nicht nehmen; es sei auch an ihre bisweilen gefährlichen Anwendungen in Atomwaffen und Gentechnologie erinnert. Eine andere Art des Nichternstnehmens ist das Herauspicken jener naturwissenschaftlichen Befunde, welche mit vorgefassten Meinungen scheinbar verträglich sind. Das Ausblenden missliebiger Teile ist dabei keineswegs auf fundamentalistische Kreise beschränkt.
In diesem Buch wird die These vertreten, dass es sinnlos ist, Gott im ersten Augenblick des Urknalls zu suchen. Die meisten uns wichtigen Dinge sind erst nachher und nicht deterministisch aus den Anfangsbedingungen entstanden. Ich bezweifle auch, dass Gott in den Beobachtungen und Gleichungen der Naturwissenschaft erscheinen kann, nicht einmal in einer der noch bestehenden Erklärungslücken. Gotteserfahrungen verlangen vielmehr eine ganz andere Art der Wahrnehmung als die naturwissenschaftliche Forschung.
Beim Schreiben habe ich an Leserinnen und Leser gedacht, die fasziniert sind von der überwältigenden Fülle neuer Erkenntnisse der Naturwissenschaft unserer Tage, aber weder auf dem allerneusten Wissensstand sind, noch alle Details erfahren wollen. Mein vorgestelltes Gegenüber interessiert sich auch für unsere hergebrachte Kultur und insbesondere ihren Kern, die Religion, die angesichts der weltweiten kulturellen Umwälzungen nicht konserviert, sondern neu entdeckt werden soll. Ich habe versucht, kein Fachwissen vorauszusetzen. Wo Fachwörter nicht näher erklärt werden, ist anzunehmen, dass ihre lexikalische Bedeutung unwichtig ist oder in einem späteren Zusammenhang eingeführt wird. Zuweilen habe ich auch mit mir selber als Gegenüber gesprochen und vielleicht am meisten dabei gelernt. Wenn ich davon etwas zum Nachdenken oder zur Diskussion weitergeben kann, freut es mich.
Es geht hier nicht um erkenntnistheoretische Unverbindlichkeiten. Echte Religion betrifft den innersten Bereich des Menschen, ansonsten bleibt sie eine belanglose Metaphysik. Ich bin mir bewusst, dass ich mit diesem sehr persönlichen Buch den sicheren Konsens abgeschlossener Wissenschaftskommunitäten verlasse, und lade Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ein, mich auf dieser Reise in kaum erforschtes und doch menschlich nahe liegendes Grenzgebiet zu begleiten. Die Vermittlung zwischen den beiden Wahrnehmungsebenen von Naturwissenschaft und Religion ist wohl das größte geistige Abenteuer unserer Zeit. Dabei geht es darum, sich in der modernen Welt zu orientieren, dem Sinn des Ganzen nachzuspüren, um dadurch das riesige, von den Naturwissenschaften prospektierte Neuland geistig zu kultivieren und damit erst für uns Menschen bewohnbar zu machen. Es ist eine Reise der verschiedenen Wahrnehmungen, die uns auch an den Graben führen wird, der Glaube und Naturwissenschaft trennt. Im Mittelpunkt steht die entscheidende Frage: Was haben wir von der Zukunft zu erwarten und zu erhoffen?
1. TeilUniversum, Zeit und Schöpfung
Eine Nacht am Very Large Array
Es geht nichts mehr, ich muss weg. Wir haben den ganzen Tag versucht, mit dem Very Large Array2 Radiowellen des engen Doppelsterns EM Cygni zu empfangen. Die Quelle ist schwach, und noch weiß ich nicht, ob das Interferometer das Sternsystem überhaupt entdeckt hat. In klimatisierten Räumen ohne Fenster irgendwo im amerikanischen Bundesstaat New Mexico haben wir Millionen von Zahlen eingelesen, kontrolliert, geeicht, addiert, transformiert, auf Band gesichert, Fehler gemacht, wieder neu begonnen und haben immer noch kein Bild. LISTR, FILLM, UVLOD, UCAT, SETJY, MX – die Computerprogramme schwirren mir durch den Kopf.
Mit dem Besucherwagen fahre ich allein gegen Süden, bis kein Teleskop, kein Strommast mehr zu sehen ist, und steige aus. Es ist eine mondlose Nacht, ich gehe gemächlich bergauf.
Als sich die Augen ans Dunkel gewöhnen, sehe ich die grandiose San Augustin-Ebene mit den Bergen am Horizont. Horizont? Darüber wölbt sich ein prachtvoller Sternenhimmel, wie man ihn nur in der Wüste und in den Bergen erlebt. Nein, mein Horizont ist weiter weg: Noch leuchtet Cygnus im Westen, das Sternbild des Schwans. Darin müssen irgendwo meine beiden Sterne sein in rund tausend Lichtjahren Entfernung und mit Leuchtstärke 14,2 – fürs Auge nicht sichtbar. Ich kann sie mir gut vorstellen: Der winzige, grell leuchtende Weiße Zwerg, so groß wie die Erde, ist umgeben von einer Akkretionsscheibe und erinnert an Saturn. Die Farbe der Scheibe ist innen grell violett und geht nach außen wie beim Regenbogen über Blau und Grün zu Rot. Unweit daneben, im Abstand von Erde und Mond, kreist ein tausendmal größerer, von der mächtigen Anziehung des Zwergs etwas verformter, rötlicher Begleiter, von dem dauernd Materie auf die Scheibe fällt, die sie wiederum an den Zwerg verliert. Viele andere Sterne sind in dieser Himmelsgegend. Der Schwan liegt in der von Sternen funkelnden Milchstraße. Mein Fachwissen sagt mir, dass das Auge nur dreitausend Sterne unterscheiden kann, aber ich ahne, dass es Milliarden sind.
Ich komme zum Gipfel, gespannt darauf, die andere Seite zu sehen und eine vielleicht ganz andere Sicht zu erleben.
Das Zentrum der Milchstraße liegt etwas unter dem Schwan und ist bereits untergegangen. Die dreihundert Milliarden Sterne unserer Galaxie drehen sich um dieses Zentrum wie auf einem Karussell. Ich glaube zu fühlen, wie ich zusammen mit dem Sonnensystem und den Nachbarsternen mit der rasenden Geschwindigkeit von über zweihundert Kilometern pro Sekunde gegen Westen genau auf diesen Schwan zufliege.
Zweihundertvierzig Millionen Jahre braucht die Sonne für einen Umlauf in der Milchstraße, für ein »galaktisches Jahr«. Als sie das letzte Mal ihre jetzige Stelle durchflog, löste auf der Erde die Triaszeit eben die Permzeit ab, und nach einer Eiszeit und großen Überflutungen begannen sich die Dinosaurier gerade erst zu entwickeln. Das Karussell beginnt sich zu drehen. Jahrzehnte, meine Lebenszeit und zukünftige Jahrhunderte fliegen dahin. Bis zur nächsten Jahrtausendwende wird sich die Milchstraße noch nicht stark ändern. Nach einer Million Jahren wird das Sonnensystem ungefähr dort sein, wo jetzt EM Cygni steht. Der kleine Weiße Zwerg wird dann von seinem Begleiter schon so weit gefüttert sein, dass er als Supernova explodiert. Natürlich sind die beiden dann nicht mehr an der gleichen Stelle. Sie haben sich mitgedreht. Aber wenige Millionen Jahre später explodiert unser Nachbarstern Beteigeuze. Auf dem Karussell regt es sich, die Mitreiter verändern sich, verschwinden, neue entstehen. Bunte Gasnebel tauchen auf und werden zu Sternhaufen. Es ist ein einziges Kommen und Gehen. Durch die Entwicklung der Sterne häufen sich die schweren chemischen Elemente immer mehr an und die Farben wechseln. Die Milchstraße selbst verändert sich. Ihre Spiralstruktur mit den vier Hauptarmen öffnet sich, Spiralsegmente entstehen und vergehen. Nach vielen Umläufen wird die Scheibe flacher und kontrahiert. Ich fühle mich in den Strudel hineingerissen und werde ein Teil der gewaltigen Dynamik. Meine innere Uhr scheint nach einer anderen Zeit zu laufen, synchron mit der Milchstraße. Ich bin klein gegen die stellaren Riesen und gleichzeitig groß in meinem Geist, dem dieses Schauspiel bewusst wird. Aber die Größe spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, denn ich bin eins mit dem Universum. Für einen Augenblick spüre ich die Grenze meiner Person fallen; der Intellekt, der den ganzen Tag im selben Hirnwinkel verbracht hat, scheint sich grenzenlos auszubreiten. Ich bin mit der Natur versöhnt und muss ihr keine Geheimnisse entreißen. Das staunende Ah ist meine sprachlose Antwort in diesem Dialog mit dem All. Für einen Augenblick trennen mich keine objektivierende Distanz und kein Erklärungsdrang vom Ganzen.
Bergab gehend frage ich mich, was am Erlebten wirklich war. Was bedeuten diese Gefühle, dieses mystische Verschmelzen? Fraglos hat das Erlebnis etwas bewirkt, denn ich bin verändert, glücklich, auch neu motiviert zur wissenschaftlichen Arbeit von morgen. Diese psychische Realität ist objektiv feststellbar und lässt sich nicht abstreiten.
War da noch mehr als nur Sterne, Galaxien und das Universum? War das eine Gotteserfahrung? Worin unterscheidet sich eine Gotteserfahrung von anderen Erfahrungen? Merkwürdigerweise stellten sich diese Fragen erst im Nachhinein, in der Reflexion des Verstandes. Sie waren im Moment des Erlebens nicht wichtig.
Die Zeit der Sterne
Abbildung 1: In vierzehnhundert Lichtjahren Entfernung, entlang dem lokalen Spiralarm, liegt der Orion-Nebel. Dieses Gebiet mit hoher interstellarer Gasdichte wird durch einige sehr helle, große Sterne zum Leuchten angeregt. Neue Sterne sind in der dunklen Molekülwolke links unten am Entstehen (Foto: Hale Observatorien).
Die Beobachtungsmöglichkeiten der Astronomie haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Radiowellen und Infrarotstrahlung durchdringen das interstellare Gas, aus dem Sterne entstehen, und zeigen Geburtsbilder von Sternen. Stern- und Gasbewegungen werden heute auf wenige Meter pro Sekunde genau gemessen. Weltraumteleskope produzieren Bilder in noch nie dagewesener Schärfe und fangen Röntgenstrahlen, ultraviolettes und infrarotes Licht aus dem Weltall auf. Interkontinentale Radiointerferometrie sieht räumliche Details bis zu einem Tausendstel einer Bogensekunde scharf. Aus hundert Kilometer Distanz betrachtet könnte man mit dieser Auflösung die Haare auf dem Kopf eines Menschen zählen und auf dem Mond würde man Astronauten erkennen.
Die Astrophysik hat in den vergangenen Jahren begonnen zu verstehen, wie Sterne entstehen und vergehen. Sie erkennt in Sternen nicht ewige Gebilde ohne zeitlichen Wandel, sondern den Glanz energetischer Abläufe ungeheuren Ausmaßes. Die Entstehungs- und Verweilzeit von Sternen misst man in Millionen und Milliarden von Jahren. Aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium und im Spätstadium zu schwereren Elementen bezieht ein Stern seine Energie. Je nach Größe geben Sterne einen beträchtlichen Teil der Masse im Laufe ihrer Entwicklung wieder ans interstellare Gas in der Milchstraße zurück. Daher ist ein Stern nicht ein rein lokaler Prozess. Sterne verändern unsere Milchstraße und damit das Umfeld zukünftiger Sterngenerationen. In der Physik der Sterne hat der Faktor Zeit eine eigentümliche Dynamik erhalten.
Die Entwicklungszeit der Sterne übersteigt das menschliche Maß bei weitem und zwingt die Astronomie, den zeitlichen Verlauf aus Momentaufnahmen herzuleiten. Zum Teil gruppieren sich Sterne zu Sternhaufen mit Hunderten bis Millionen von Sternen, die innerhalb weniger Jahrmillionen, also für astronomische Verhältnisse praktisch gleichzeitig, entstanden sind. Ein Sternhaufen ist daher einer Schulklasse von Kindern vergleichbar, die gleichaltrig, aber in Größe und Entwicklung verschieden sind. In Sternhaufen beobachtet man, dass sich massivere Sterne schneller entwickeln. Interessanterweise fehlen zum Beispiel, je nach Alter des Haufens, die großen Sterne ab einer gewissen Masse. Was aus ihnen geworden ist, soll im Folgenden geschildert werden.
Ein Stern entsteht
In unserer Milchstraße beginnen gegenwärtig pro Jahr etwa zehn Protosterne mit der Wasserstoffverschmelzung. Die Geburt von Sternen und ihre Vorgeschichte dauern rund zehn Millionen Jahre, und rund hundert Millionen Sterne sind folglich in unserer astronomischen Nachbarschaft am Entstehen. Im Ganzen umfasst die Milchstraße heute etwa zweihundert Milliarden Sterne. Es gibt Hunderte von Milliarden ähnlicher Sternansammlungen im Universum, die man Galaxien nennt nach dem griechischen Wort galaxis für Milchstraße.
Sterne entstehen in interstellaren Molekülwolken, die für ihre wunderschönen, wolkenartigen Dunkelstrukturen bekannt sind. Das Gas dieser Nebel ist so dünn, dass nur tausend Atome oder weniger in einem Kubikzentimeter enthalten sind. Gelegentlich kann die Dichte auch tausend Mal höher sein, aber sie ist dann immer noch etwa eine Billion Mal geringer als in irdischen Wolken. Die Dichte des interstellaren Gases ist vergleichbar mit den dünnsten Vakuen in irdischen Labors. An Orten, wo das Gas dichter ist als nebenan, zieht die Schwerkraft der Dichtefluktuation das umgebende Gas an. Dadurch wird die Verdichtung stärker und verleibt sich noch weiteres Gas ein. Der Prozess verstärkt sich selber. Die Materie konzentriert sich allmählich in dichten Wolkenkernen, bis diese unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Das Gas fällt im freien Fall ins Zentrum des Kerns. Die anfänglichen Bewegungen im kollabierenden Gas sind zufällig und mitteln sich größtenteils, aber nicht ganz heraus. Der Rest geht in einer gemächlichen Kreisbewegung auf, die sich im Laufe der Kontraktion beschleunigt wie bei der Pirouette einer Eiskunstläuferin. Es bildet sich ein Wirbel, der immer schneller rotiert, je mehr er sich zusammenzieht. Der Drehimpuls des Wirbels zwingt die Gasmasse in die Form einer rotierenden Scheibe. Diese sogenannten Akkretionsscheiben3 sind typisch für entstehende Himmelskörper.
Nach zehn Millionen Jahren werden Temperatur und Dichte im Zentrum der Scheibe so groß, dass die Fusion von Wasserstoff zu Helium einsetzt und Kernenergie in einem gewaltigen Ausmaß entfesselt wird. Der zusätzliche Gasdruck, der durch die neue Energiequelle entsteht, stoppt die Kontraktion. Im innersten Teil des Wirbels bildet sich ein Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Gasdruck: Der Stern ist geboren. Noch sind von ihm nur Infrarot- und Radiowellen zu empfangen. Das umgebende dichte Gas absorbiert das optische Licht vollständig und wird dabei aufgeheizt. Diese heiße Atmosphäre des jungen Sterns verhindert das weitere Anwachsen und damit die Bildung eines übermäßig massiven Sterns. Aus diesem Grund übertrifft die Masse des größten bekannten Sterns den kleinsten nur um den Faktor tausend. Es dauert noch einige Jahrmillionen, bis die Hülle des überschüssigen Gases wie der Kokon einer Raupe vollends abgeworfen wird, so dass der Stern nun auch optisch sichtbar wird. Aus dem abgestoßenen Gas entstehen weitere Sterne, unter Umständen ein ganzer Sternhaufen.
Abbildung 2: In Molekülwolken mit einigen hundert Lichtjahren Durchmesser, hier im Adlernebel, bilden sich Verdichtungen, aus denen Sterne entstehen. Oben rechts gibt es bereits helle Sterne. Sie heizen das interstellare Gas und blasen es aus ihrer Umgebung weg. Verdichtungskerne widerstehen dem Druck und ragen aus dem heutigen Wolkenrand heraus (Foto: NASA).
Die Entstehung eines Sterns ist ein gutes Beispiel für einen sich selbst organisierenden Prozess, der ohne direkten äußeren Einfluss beginnt und sich chaotisch entwickelt. Der Begriff Chaos4 wird in Kapitel »Chaos begrenzt unser Wissen« erklärt und bedeutet, dass man die Detailentwicklung nicht für längere Zeit voraussagen kann. Die Sternentstehung wird von der eigenen Gravitationsenergie angetrieben und entledigt sich ihrer Abwärme in Form von Wärmestrahlung. Schließlich stabilisiert sich der Kontraktionsvorgang als Protostern. Man könnte diesen Zustand als Sättigung der Konzentrationsprozesse in interstellaren Molekülwolken bezeichnen. Diese stationäre Lösung eines Gleichungssystems die sich nach langer Zeit asymptotisch einstellt, nennt man »Attraktor« in der Mathematik. Er ist der vorläufige Gleichgewichtszustand, auf den alle Sternentwicklungen hinlaufen.
Auch nachdem ein Stern entstanden ist, entwickelt er sich weiter. Rund hundert Lichtjahre von uns entfernt liegt zum Beispiel EK Draconis, ein junger Bruder der Sonne. Dieser Stern von der gleichen Masse und ähnlichem inneren Aufbau ist erst siebzig Millionen Jahre alt. Er unterscheidet sich wesentlich von der 4,6 Milliarden Jahre alten Sonne durch seine viel größere Aktivität. Gewaltige Eruptionen erschüttern ihn fast pausenlos, und eine zehn Millionen Grad heiße Korona umgibt ihn, deren Ultraviolettstrahlung hundertmal stärker ist als jene der Sonne. Beides wird von starken Magnetfeldern verursacht, welche durch die kurze Rotationsdauer von nur 2,8 Tagen entstehen. Der Energieverlust bremst die Rotation, so dass die Sonne heute gut zehnmal langsamer dreht als der quirlige EK Draconis. Die ebenso intensive UV-Strahlung der Sonne in jüngeren Jahren hat vermutlich die biologische Entwicklung auf der Erde zunächst ermöglicht und später maßgeblich beeinflusst. Viele der höher entwickelten Lebewesen einschließlich der Menschen wären dagegen jener Strahlenbelastung nicht mehr gewachsen. Zum Glück ist die Sonne nicht stehen geblieben und hat sich weiter entwickelt. Allerdings werden wir im folgenden Unterkapitel und einem späteren Kapitel sehen, wie die Entwicklung weitergehen und die Erde langfristig unbewohnbar machen wird.
Das Endstadium eines Sterns
In weiteren 4,8 Milliarden Jahren wird die Sonne dem Stern Beta Hydri ähnlich sein. Obwohl nur zwanzig Lichtjahre entfernt, kann man auf ihm keine Anzeichen von Aktivität mehr entdecken. Der Stern hat bereits etwa zwanzig Prozent seines Wasserstoffvorrats verbraucht und ist 1,6-mal so groß wie die Sonne. Weil sich die Brennzone von ihrem ursprünglichen Platz im Zentrum des Sterns nach außen verschob, änderte sich der Aufbau des Sterns. Der Kern wurde dichter, so dass der Stern jetzt mehr Wärme produziert als die Sonne. Die Sternoberfläche hat sich deswegen ausgedehnt. Sobald ein noch etwas größerer Teil des Wasserstoffs verbraucht ist, wird der Stern so groß, dass sich die Oberfläche abkühlt und rot wird. Der alternde Stern wird ein Roter Riese. In der Atmosphäre Roter Riesen herrscht Überdruck, der einen starken Sternwind5 antreibt. Manchmal verliert der Stern ganze Schichten seiner Atmosphäre. Diese dehnen sich im Laufe der Zeit aus und bilden Kugelschalen, welche farbenprächtige sogenannte planetarische Nebel bilden; sie haben jedoch nichts mit Planeten zu tun. Im Kern wird nun die Heliumschlacke zum Brennstoff eines neuen nuklearen Feuers, in dem Helium zu schwereren Elementen wie Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff verschmilzt. Nach einigen weiteren zehn Millionen Jahren schrumpfen Rote Riesen zu Weißen Zwergen. Die bildhaften Namen sollen nicht zur Annahme verleiten, es handle sich um eine niedliche Märchenwelt; die Oberfläche eines Weißen Zwergs wird über zehntausend Grad heiß und ist daher von weißer Farbe. Weiße Zwerge kühlen über einen Zeitraum von vielen Billionen Jahren langsam aus.
Abbildung 3: Wenn Sterne ihre äußeren Schichten abwerfen, bleiben kühle Verdichtungen etwas zurück. Das Bild zeigt solche »kometarischen Knoten« eines planetarischen Nebels. In ihnen bilden sich vermutlich interstellare Staubteilchen (Foto: NASA).
Abbildung 4: Im Sternhaufen des Siebengestirns (Plejaden) sind alle Sterne rund siebzig Millionen Jahre alt. Das interstellare Gas wurde bis auf wenige Überreste von jungen Sternen weggeblasen. In ihrem Sternwind haben sich Staubteilchen gebildet. Sie bleiben zurück als zirrenartige Schleier, die im Sternlicht leuchten (Foto: Mount Palomar).
Die Entwicklung von Sternen, die massiver als die Sonne sind, läuft dramatischer ab. Weil der durch die Schwerkraft erzeugte Druck im Inneren höher ist, verschmelzen die Atomkerne viel schneller, und die Entwicklung bleibt nicht bei Sauerstoff stehen. Immer schwerere Elemente bilden sich, zum Beispiel Silizium und Magnesium. Ist der Stern genügend massereich, geht die Nukleosynthese bis hin zu Eisen. Der Stern hat in dieser Entwicklungsstufe eine Zwiebelschalen-Struktur. Unter der äußersten Wasserstoffschicht liegen Schalen von Helium, Kohlenstoff, Silizium usw., wo je die entsprechenden Kernreaktionen stattfinden. Diese Prozesse liefern zwar nicht mehr viel Energie, sind aber wichtig für die chemische Entwicklung des Universums. Alte Sterne sind wie Druckkochtöpfe, in denen die schweren Elemente gebraut werden. Sie sind die einzigen Entstehungsorte dieser wichtigen Aufbaustoffe von Planeten und Lebewesen. In ihrer Spätphase entfesseln massive Sterne äußerst starke Sternwinde, die nur wenige tausend Grad warm und genügend dicht sind, dass sich aus Kohlenstoffatomen und anderen schweren Elementen Moleküle und sogar Staubteilchen bilden, die mitgerissen werden. Die Sterne rauchen auf diese Weise oft mehr als die Hälfte ihrer Masse in den interstellaren Raum hinaus. Der größte Teil des Kohlenstoffs, Stickstoffs und Sauerstoffs im Universum ist auf diese Weise entstanden und in Umlauf gebracht worden.
Nachdem der massereiche Stern auch noch diese neuen Energiereserven der Nukleosynthese verbraucht hat, kontrahiert er weiter. Der Druck der Schwerkraft steigt so weit, bis ihn der Gasdruck nicht mehr aufwiegen kann. Der Stern bricht dann in seinem Inneren plötzlich zusammen. Noch im Zusammenfallen und unter riesigem Druck erschließt sich seine letzte Energiequelle. Nun können Atomkerne fast beliebiger Größe aufgebaut werden. Die meisten sind instabil und zerfallen sofort wieder, doch ist diese Implosion der einzige Augenblick, in dem Elemente schwerer als Eisen entstehen können. Alles Gold, Blei und Uran im Universum muss sich so gebildet haben.
Abbildung 5: Eta Carina ist ein Stern mit hundertfünfzig Sonnenmassen und entwickelte sich entsprechend schnell innerhalb weniger Millionen Jahre. Die ihn umgebenden Wolken wurden bei einem von der Erde aus im Jahre 1843 beobachteten Ausbruch ausgestoßen und expandieren immer noch. Vielleicht ist der Stern schon vollends als Supernova explodiert, aber ihr Licht hat uns noch nicht erreicht (Foto: NASA).
Diese letzte Entladung der Kernkräfte geschieht in weniger als einer Sekunde und treibt den Gasdruck so hoch, dass der Stern als Supernova explodiert. Der größte Teil seiner Masse, ein hoch radioaktives Gas, wird in den Weltraum geschleudert. In unserer Milchstraße ereignet sich etwa eine Supernova pro Jahrhundert. Zurück bleibt ein Neutronenstern, eine Art riesiger Atomkern etwa von der Masse der Sonne, jedoch mit einem Durchmesser von nur zwanzig Kilometern. Hat er noch mehr als zweieinhalbmal diese Masse, fällt der Kern zusammen und bildet ein Schwarzes Loch6 , das heißt eine Region großer Schwerkraft, aus der nichts, selbst keine Strahlung mehr entweichen kann. Neutronensterne und Schwarze Löcher entwickeln sich praktisch nicht mehr weiter, sofern keine neue Materie zugeführt wird.
Neue Generationen von Sternen
Es mag nicht überraschen, dass Sterne verlöschen und als Weiße Zwerge, Neutronensterne oder Schwarze Löcher unsichtbar durch die Milchstraße geistern, hat doch jeder Glanz und jede Energiefreisetzung irgendwann ein Ende. Aber gerade die Spätphase der Sterne ist erstaunlich kreativ. Sterne verlöschen nicht einfach vor sich hin wie eine Kerze, sondern geben einen großen Teil ihrer Materie wieder ins interstellare Gas zurück. Von Bedeutung ist, dass dieses Material nicht mehr der ursprüngliche, reine Wasserstoff mit etwas Helium aus der Urzeit des Universums ist, sondern ein mit schweren Elementen angereichertes Gas, das auch Staubkörner aus Kohlenstoff, Silikaten und Eisen einschließt. Sterne entstehen und vergehen nicht in einem ewigen Kreislauf, sondern verursachen eine chemische Veränderung und Entwicklung des interstellaren Gases.