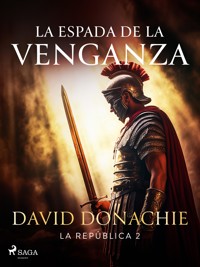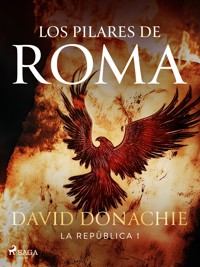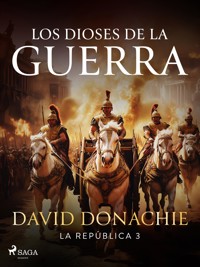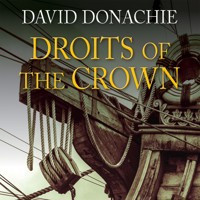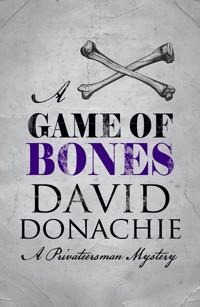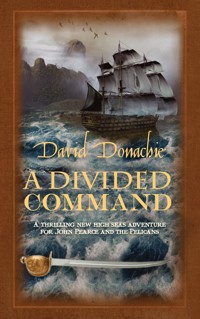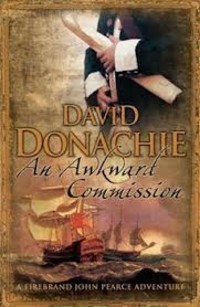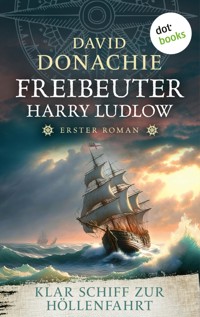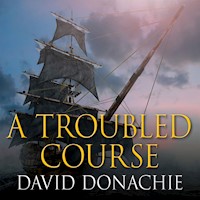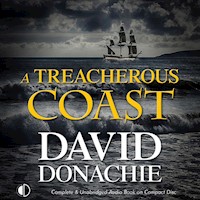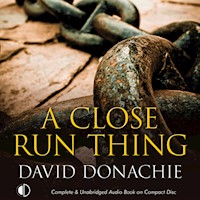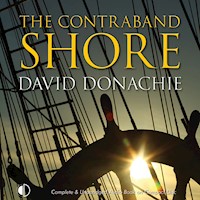Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Freibeuter Harry Ludlow
- Sprache: Deutsch
Ehre, wem Ehre gebührt: Der Seefahrerroman »Freibeuter Harry Ludlow: Die zweite Chance« von David Donachie jetzt als eBook bei dotbooks. Die französische Küste im Jahre 1795. Während die Feuer des Krieges sich auf dem Festland immer weiter ausbreiten, tobt auch auf See ein Kampf um die Vorherrschaft. Doch nicht alle kämpfen mit so fairen Mitteln wie der ehrenhafte Freibeuter Harry Ludlow und sein Bruder James: Als der skrupellose Kapitän Toner von der Royal Navy ihn unrechtmäßig zwingt, ihm die Hälfte seiner Crew zu überlassen, schwört Harry, seine Männer zu retten – und nimmt allen Widrigkeiten zum Trotz die Verfolgung von dessen Fregatte auf. Als er Toners Schiff auf der Höhe der Westindischen Inseln einholt, beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben … »Donachie versteht es meisterhaft, lebendige Figuren und Atmosphäre zu schaffen!« Kent Messenger Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der nautische Kriminalroman »Freibeuter Harry Ludlow: Die zweite Chance« von David Donachie wird Fans von C.S. Forester und Patrick O'Brian begeistern; das Hörbuch ist bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die französische Küste im Jahre 1795. Während die Feuer des Krieges sich auf dem Festland immer weiter ausbreiten, tobt auch auf See ein Kampf um die Vorherrschaft. Doch nicht alle kämpfen mit so fairen Mitteln wie der ehrenhafte Freibeuter Harry Ludlow und sein Bruder James: Als der skrupellose Kapitän Toner von der Royal Navy ihn unrechtmäßig zwingt, ihm die Hälfte seiner Crew zu überlassen, schwört Harry, seine Männer zu retten – und nimmt allen Widrigkeiten zum Trotz die Verfolgung von dessen Fregatte auf. Als er Toners Schiff auf der Höhe der Westindischen Inseln einholt, beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben …
Über den Autor:
David Donachie, 1944 in Edinburgh geboren, ist ein schottischer Autor, der auch unter den Pseudonymen Tom Connery und Jack Ludlow Bekanntkeit erlangte. Sein Werk umfasst zahlreiche Veröffentlichungen; besonders beliebt sind seine historischen Seefahrerromane.
David Donachie veröffentlichte bei dotbooks seine Serie historischer Abenteuerromane um den Freibeuter Harry Ludlow mit den Bänden »Klar Schiff zur Höllenfahrt«, »Im Windschatten des Schreckens«, »Kurs ins Ungewisse«, »Die zweite Chance«, »Im Kielwasser: Verrat« und »Abstieg zu den Fischen«. Die Hörbücher sind bei SAGA Egmont scheinen.
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »An Element of Chance« bei Macmillan Publishers, New York
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 by David Donachie
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999, Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin.
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/Abstractor, Vector Tradition, paseven, MF production, brickrena und AdobeStock/yj
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ys)
ISBN 978-3-98690-687-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die zweite Chance« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Donachie
Die zweite Chance
Roman - Freibeuter Harry Ludlow 4
Aus dem Englischen von Carsten Grau
dotbooks.
Prolog
Angesichts der Knappheit an Kanonieren waren die Artilleriesalven zu schwach, um den französischen Vorstoß aufhalten zu können. Hinzu kamen noch die Pulverdampfschwaden, die über den anrennenden Infanteristen hingen und dadurch deren Bewegungen in Richtung auf das gegenüberliegende Ufer des Rivière Salée vernebelten. Währenddessen versuchten sich die Rotröcke am diesseitigen Flußufer zu formieren, getrieben von ihren Offizieren und unter ständigem Beschuß von Heckenschützen. Aus ihrer fest eingerichteten Stellung gezwungen, war die Garnison Guadeloupe dem Feind nun schutzlos ausgeliefert. Durch Krankheiten und Erschöpfung, die das westindische Klima mit sich gebracht hatte, waren mehr Leute zu Tode gekommen als durch die feindlichen Musketen. Viele ihrer Kameraden lagen nun in dichtgedrängten Reihen, einige bereits tot, andere noch mit dem Tode ringend, dazu diejenigen, die zwar überleben, jedoch für immer kampfunfähig bleiben würden. Eine zuvor zahlenmäßig überlegene Armee sah sich dezimiert auf ein Zahlenverhältnis von eins zu zwei dem Feind gegenüber. Deshalb jetzt dieser Vorstoß auf das Flußufer. Wenn der Feind im Wasser gehalten werden könnte, wo ihn die Strömung in seinen Bewegungen behindern würde, wäre die Situation vielleicht noch zu retten. Gerade frisch aus Europa eingetroffen, hatten die Franzosen nichts von den Strapazen erdulden müssen, denen die britischen Truppen ausgesetzt waren. Belastungen, die noch verstärkt wurden durch die Entscheidung des Kommandeurs, kurz vor der Schlacht die Zelte in unmittelbarer Nähe eines übelriechenden Sumpfes aufschlagen zu lassen.
Vor dem Kommandeurszelt hielten nun die Stabsoffiziere ihren Blick auf General Trethgowan gerichtet, jeder im Geiste einen entlastenden Brief formulierend, der die Schuld für die drohende Niederlage diesem in der Verantwortung stehenden Mann aufladen würde. Gegen ihre Empfehlungen, die französischen Invasoren bereits am Strand abzufangen, hatte General Trethgowan sich dazu entschlossen, den Feind in eines seiner Standardgefechtsmodelle zu verwickeln. Alle Warnungen, daß die französischen Revolutionstruppen sich nicht an die allgemeinen Regeln der Kriegskunst halten würden, waren bei ihm auf taube Ohren gestoßen. Vielmehr hatte er den Anführer der Franzosen als typischen, durch die Revolution emporgespülten Abschaum verspottet, einen ehemaligen Bäcker namens Victor Hugues, und er hatte seinen Untergebenen einen leichten Sieg über diese bestenfalls als armselig geführten Haufen zu bezeichnende Truppe prophezeit.
Hauptmann Elliot Haldane, Verbindungsoffizier zu den örtlichen Milizen, sprach in sehr ungehaltenem Ton, kaum noch im Rahmen der militärischen Disziplin, und forderte die Erlaubnis für seine Männer, den Feind anzugreifen.
»Dies sind die einzigen Leute, die wir haben, Sir, denen das Klima nichts ausmacht. Ich wiederhole meine Bitte, ihnen zu erlauben ...«
»Hol Sie der Teufel!« schrie Trethgowan, wobei seine ohnehin schon rote Gesichtsfarbe angesichts solchen Ungehorsams eine noch dunklere Tönung bekam. »Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, daß wir es hier mit Franzosen zu tun haben, denen man nicht trauen kann. Lassen Sie sich doch von diesen weißen bourbonischen Uniformen und der Flagge der Bourbonen nicht verwirren. Sobald sie den Fluß überquert haben, werden sie ihre Uniformjacken umkrempeln und zum Feind überlaufen.«
»Sie verachten die Revolution ebenso, wie jeder Engländer es tut, Sir. Als Pflanzer, deren Familien hier auf Guadeloupe ansässig sind, steht für sie wesentlich mehr auf dem Spiel als für uns. Dies sind dieselben Männer, die Admiral Jarvis damals geholfen haben, die Insel zum erstenmal einzunehmen.«
»Herr Hauptmann, Sie haben Ihre Befehle. Die Leute bleiben in der Defensive. Und stellen Sie bitte sicher, daß sie nicht ausbrechen und beim ersten Anzeichen von Gefahr davonlaufen.«
»Wo sollten sie schon hinlaufen, Herr General?« antwortete Haldane traurig. »Die Leute wohnen schließlich hier.«
Der Franzose konnte an Haldanes Gesichtsausdruck ablesen, daß dessen Bemühungen gescheitert waren. Innerhalb einer überseeischen Einheit herrschten nicht die gleichen Disziplinarstrukturen wie in einer normalen Armee. Bei all der ihm wesenseigenen Loyalität war Haldane gezwungen, zahlreiche Fehltritte Trethgowans und dessen mangelnde militärische Führungsqualitäten zu erdulden. Er nahm dies alles stillschweigend hin, da er wenig Sinn darin sah, vor diesen Siedlern eine Lanze für seine Landsleute zu brechen. Der meiste Haß entlud sich ohnehin auf den General, der demonstrativ jede Hilfe abgelehnt hatte, die sie ihm angeboten hatten. Tief in ihren Herzen jedoch wußten sie trotz aller erlittenenen Erniedrigungen, daß die Rotröcke bei Gesundheit und unter besserem Kommando dem Feind vom gegenüberliegenden Flußufer Paroli würden bieten können.
»Ich muß Sie in aller Form auffordern, Messieurs, auf die Ihnen angewiesenen Posten zu gehen und dieses Ufer des Rivière Salée nach besten Kräften zu verteidigen.«
»Regardez!« Einer der Siedler, der am seeseitigen Ende der Stellung einen guten Überblick über die Bucht hatte, zeigte in Richtung Wasser. Andere wiederholten wild gestikulierend seinen freudigen Ausruf.
Haldane bahnte sich einen Weg durch die entstandene Menschentraube und fühlte seinen pochenden Herzschlag beim Anblick eines Kriegsschiffs unter vollen Segeln. Vor dem Wind bot es einen majestätischen Anblick und schob sich langsam vorwärts unter der roten Flagge der Admiralität.
»Monsieur de la Mery«, rief Haldane einen der weißberockten Offiziere an, »Sie sind doch Seemann. Welche Hilfe können wir von dem Schiff erhoffen?«
An dem verdrießlichen Gesichtsausdruck des Franzosen konnte Hauptmann Haldane bereits ablesen, daß die Antwort wenig Anlaß zum Jubeln geben würde.
»Sie werden wohl zu spät kommen, um noch rechtzeitig Truppen zu unserer Hilfe anlanden zu können.«
»Wie steht es mit dem Geschütz? Könnten Sie nicht die Flanke des Feindes damit bestreichen?«
»Durch die Untiefen in der Flußmündung werden sie gezwungen sein, sich gut frei von Land zu halten. Soweit sie nicht größere Geschütze tragen als jede Fregatte, die ich kenne, werden Sie nicht auf Schußweite herankommen können.«
Plötzliche Trommelwirbel drangen durch den Pulverqualm und kündigten den Verteidigern den unmittelbar bevorstehenden Angriff an.
Haldane mußte sich zwingen, seiner Stimme einen optimistischen Klang zu geben: »Ich bezweifle, ob unsere Feinde das auch wissen, Monsieur. Ich vermute, der bloße Anblick des Schiffes hat sie veranlaßt, vorher mit ihrem Angriff loszuschlagen. Ich ersuche Sie nunmehr eindringlich, Messieurs, Ihre Posten einzunehmen.«
Trotz der unterschiedlichsten Umstände, die zur Musterung jedes einzelnen Mannes geführt hatten, hatte sich doch eine schlagkräftige Truppe gebildet. Ermutigt durch den Anblick eines britischen Kriegsschiffes stürmten sie mit einer gehörigen Portion Elan hinunter zum Flußufer. Haldane wollte ihnen gerade folgen, als er von de la Mery aufgehalten wurde.
»Hauptmann Haldane, meine Leute und ich haben sich nicht freiwillig gemeldet, um als Kriegsgefangene zu enden. Und Guadeloupe ist nicht unser Heimatland.«
»Ich weiß, Monsieur«, antwortete Haldane.
Es war ihm schon von mehreren Seiten berichtet worden, wie dieser Mann nach dem Sklavenaufstand gezwungen worden war, Santo Domingo mit einem Kontingent an Seeleuten zu verlassen. Trethgowan hatte sich einen weiteren Affront diesen Seeleuten gegenüber geleistet, als er ihnen untersagte, vor der Küste Patrouille zu fahren.
»Wie meinen Sie, wird Ihr General reagieren, wenn er merkt, daß die Schlacht verloren ist?«
Haldane war versucht zu lügen und zu antworten, das Blatt würde sich sicher zu ihren Gunsten wenden. Ein Blick in die dunklen, durchdringenden Augen des Franzosen hielt ihn jedoch davon ab. Beide Männer wußten ebensogut, wie es um ihre Armee stand und daß Trethgowan von Victor Hugues in jeder Hinsicht ausmanövriert worden war. Würde der ehemalige Bäcker heute nicht triumphieren, dann würde es morgen soweit sein.
»Er wird kapitulieren.«
»Für seine gesamten Truppen?«
»Natürlich.«
»Sie meinen für die Gesamtheit seiner Soldaten?« fragte der Franzose mit deutlicher Betonung auf dem letzten Wort.
Ihre Blicke hafteten sekundenlang aneinander, bevor Haldane antwortete: »Was immer Sie tun werden, Monsieur, vorausgesetzt Sie können es mit Ihrer Ehre vereinbaren, wird unzweifelhaft auch in meinem und im Sinne meiner Landsleute sein.«
Das Quieken eines zahmen Mungos, der seinen schmalen kleinen Kopf aus de la Merys Jackentasche streckte, beendete die Verbindung ihrer Blicke. Unmittelbar darauf peitschte eine Musketensalve über sie hinweg, während die Franzosen bereits in den Fluß wateten. Haldane und de la Mery liefen auf ihre Positionen und reihten sich in die dichtgeschlossene Formation der weißberockten Siedler ein. Der Qualm und der Lärm der Schlacht schienen die Hitze noch zu steigern. Schon bald war jeder Mann, der die Salve überlebt hatte, in einen Zweikampf verwickelt. Bajonette wurden vorangestoßen, getroffen und pariert durch Spieße und Schwerter. Das Schreien der Verwundeten und Sterbenden erhob sich über das metallische Scheppern der Waffen, einzig übertönt vom Donner der Feldhaubitzen, mit denen sich Hugues und Trethgowan über die Köpfe der Kämpfenden hinweg gegenseitig beharkten.
Großes Jubelgeschrei von der Binnenflanke und das langsam vorwärtsdrängende Blau genügten, um Haldane zu signalisieren, daß die geschwächten und entkräfteten Rotröcke dort nicht hatten standhalten können. Der Druck auf den Abschnitt der Siedler verringerte sich, als Hugues hier Kräfte abzog, um den Durchbrucheffekt besser ausnutzen zu können. Gewarnt durch de la Mery, wichen Haldane und seine Männer augenblicklich zurück. Mit einem Wink seines Schwertes hinüber zu dem tapferen britischen Offizier führte der Franzose seine Abteilung fort in Richtung auf die Stadt Point-à-Pitre.
Das rhythmische Stakkato des Zapfenstreichtrommelns wehte über die Bucht hinüber zu der ankernden Fregatte. Obwohl die Überlebenden unter den besiegten Rotröcken kaum noch zu stehen vermochten, wurde die Kapitulation an Land mit strenger militärischer Präzision abgewickelt. Vor General Trethgowan stand der Urheber dieser einzigartigen Niederlage, in der korpulenten Gestalt eines Mannes, der von Paris aus entsandt worden war, um die französischen Zuckerinseln zurückzuerobern. Aus zwei Kabellängen2 Entfernung war sein Gesicht selbst durch das Fernrohr nur als verschwommener Fleck zu erkennen. Seine Uniform jedoch sprach Bände. Anders als seine prächtig ausstaffierten militärischen Ratgeber war Victor Hugues ganz in schwarz gekleidet. Um seine Taille trug er eine breite dreifarbige Schärpe, und sein hoher schwarzer Hut war geschmückt mit einer riesigen Kokarde in rot-weiß-blau, den Farben des jakobinischen Republikanismus. Hinter ihm überquerte seine kleine Streitmacht, angeführt von einer Artilleriekompanie, in geordneten Reihen die über den Rivière Salée geschlagene Pontonbrücke. Ein Großteil seiner Truppen blieb zurück, um einen großen rechteckigen, von einer Plane verhüllten Gegenstand zu bewachen. Dieses Ausrüstungsteil hatte an Bord der Fregatte besondere Neugier erregt. Auf dem Quarterdeck der Diomede hatten sich die Offiziere unter dem Sonnensegel versammelt und spekulierten offen darüber, was unter der Plane verborgen sein konnte. Bessborough stand unbewegt wie ein Fels, als ob er durch seine Unbeweglichkeit den Ansehensverlust seines Landes würde vermindern können. Er reagierte nicht auf die plötzliche Unruhe hinter ihm und hielt sein Fernrohr auf die Vorgänge an Land gerichtet. Sich umzudrehen und sich zu erkundigen wäre unter seiner Würde als Vizeadmiral der britischen Krone gewesen. Hierzu bestand darüber hinaus auch kein Anlaß. Der Midshipman überbrachte Kapitän Marcus Sandford in klarer und durchdringender Stimme die Nachricht.
»Eine Frischwasserschute, vollbeladen mit Franzosen, kommt soeben aus der Hafeneinfahrt von Point-à-Pitre, Sir. Ihr Anführer sagt, sie wären keine Soldaten, sondern Seeleute und deshalb ausgenommen von der Kapitulationsverpflichtung.«
»Wie viele sind es?« fragte Sandford.
»40, Sir. Müssen sich irgendwie davongemacht haben.«
»Glauben Sie, daß sie von Land aus beobachtet worden sind?«
Die Stimme, die darauf in einem Englisch mit starkem Akzent antwortete, veranlaßte Bessborough schließlich doch dazu, sich umzudrehen. Die Leute waren unaufgefordert an Bord gekommen, ihr Anführer näherte sich mit dem Hut in der Hand. Der Admiral erblickte vor sich einen hochgewachsenen, jungen Mann in weißem Uniformrock, dunkelhäutig und gutaussehend, mit dunkelbraunen Augen und festem Blick. Die Aufmerksamkeit des Admirals wurde dann auf die plötzliche Bewegung eines Mungos gelenkt, offensichtlich das Haustier des Mannes, das seinen Kopf aus der Manteltasche streckte und sich nach links und rechts zuckend an Deck umschaute.
»Die Canaille am Strand hat uns nicht gesehen, Kapitän.«
»General Trethgowan hat die Kapitulation erklärt, Monsieur«, sagte Sandford. »Dies betrifft insbesondere alle Franzosen, die auf britischer Seite gekämpft haben.«
»Alle französischen Soldaten, um genau zu sein, Kapitän.«
Sandford blickte demonstrativ auf den Uniformrock des Mannes, der den gleichen Schnitt und die gleiche Farbe hatte wie die Uniformen seiner Landsleute, die nun hinter den Rotröcken an Land angetreten waren.
»In der kurzen Zeit konnten wir uns den Luxus einer eigenen Identität nicht zulegen.«
»Dillon?« sagte Bessborough, als Sandford in der Erwartung einer Entscheidung zu ihm herüberblickte. Der politische Berater des Admirals hüstelte kurz, bevor er antwortete. Er war groß, mager und drahtig, mit schmalen Gesichtszügen und leicht hervorspringenden blauen Augen. Sein dünnes, rötliches Haar war sorgfältig gelegt, um den zunehmend spärlicher werdenden Haarwuchs zu verdecken. Er sprach mit einer weichen Stimme mit südirischem Klang.
»Es scheint mir, Sir, als ob unsere Soldaten für heute schon genug aufgegeben haben. Meiner Ansicht nach hätte General Trethgowan ruhig noch ein Weilchen länger standhalten können. Wenigstens bis Monsieur Hugues sich einverstanden erklärt hätte, die Royalisten zusammen mit unseren Leuten ziehen zu lassen. Nur zum Zwecke der Demütigung kann Hugues sie noch festzuhalten wünschen. Hierzu sollten wir keine Beihilfe leisten.«
Bessborough gab keinen Penny darauf, ob die Franzosen gedemütigt werden sollten oder nicht. Alles, was ihn beschäftigte, war die Art und Weise, wie Trethgowan und seine Armee ihn im Stich gelassen hatten. »Hat er aber nun mal nicht, Dillon, wodurch wir in diese vortreffliche Lage geraten sind. Gott allein weiß, wie Ihre Lordschaften auf dieses Fiasko reagieren werden.«
Trethgowans militärische Karriere war zweifellos so gut wie beendet. Die Horse Guards1 würden ihm eine solche Niederlage niemals verzeihen. Aber es war mehr als bloß ein militärisches Desaster. Als hiesiger Marinekommandeur würde Bessborough nicht ohne Makel aus der Sache herauskommen. Man würde ihn fragen, wie es geschehen konnte, daß ein Mann mit zwei Fregatten, einer Brigg und fünf Transportschiffen unbehelligt von Frankreich bis zu den Westindischen Inseln segeln und dort Truppen anlanden konnte, ohne jegliches Einschreiten der Royal Navy. Das strenge Urteil der Admiralität würde aber angesichts gewisser Umstände etwas milder ausfallen: Admiral Lord Howe hatte es mit seiner Abneigung gegen totale Blockaden fertiggebracht, diesen Burschen aus Brest entwischen zu lassen; Hugues war zum Beginn der Hurrikansaison eingetroffen, mehr als ungewöhnlich für einen Franzosen, und hatte hierdurch alle in der Region überrascht; nach der Landung hatte er dann proklamiert, daß alle Sklaven gemäß den Grundsätzen der Revolution ihre Freiheit erhalten würden, eine Ankündigung, die kaum geeignet war, den Unruhen ein Ende zu bereiten.
Vor allem aber hatte er frische Truppen aus Europa mitgebracht, und alle Maßnahmen Trethgowans hatten diesen unschätzbaren Vorteil noch verstärkt. Indem er sich für die Einrichtung seiner Hauptstellung am Rivière Salée entschieden hatte, wurde er an der rechten Flanke durch die Sümpfe und an der linken durch die See begrenzt. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät, um dem Holzkopf klarzumachen, daß es einen elementaren taktischen Fehler bedeutete, in diesem Teil der Erde in unmittelbarer Nähe eines Sumpfes zu kampieren. Als Hugues schließlich angriff, hatten die Augusthitze und die stinkende Sumpfatmosphäre die Kräfte von Trethgowans Truppen bereits auf ein Zehntel ihrer normalen Stärke reduziert. Die Einheiten, die Bessborough in English Harbour zusammengestellt hatte, waren da noch hinter dem Horizont, viel zu weit entfernt, um den Rotröcken an Land zu Hilfe eilen zu können, während angesichts der Untiefen in der Flußmündung jeder Plan, den Franzosen mit der Fregatte als schwimmender Batterie zu Leibe zu rücken, von vornherein zum Scheitern verurteilt sein mußte. Man würde die 32-Pfund-Kanone des 74-geschützigen Schlachtschiffes benötigen, um irgend etwas in dieser Richtung unternehmen zu können. Dieses war jedoch in einiger Entfernung zur Begleitung der schwerfälligen Truppentransportschiffe eingesetzt. Daß von den beiden französischen Fregatten weit und breit nichts zu sehen war, konnte die Schmach der Niederlage nur noch vergrößern. Die einzigen beiden Schiffe in der Bucht waren Hugues’ Truppentransporter und die wurden ausschließlich durch Trethgowans Waffenruhe bedroht.
Als ein letzter rascher Trommelwirbel erscholl, blickte jeder hinüber zum Strand, wo jetzt die Farben des Regiments zum Zeichen der Kapitulation in den weißen Sand fielen. Dahinter wurde, vor den Reihen der weißberockten Soldaten, auch die fleur-de-lis des Königreichs Frankreich niedergeholt. Trethgowan überreichte Hugues sein Schwert, dies wurde durch den Franzosen akzeptiert. Als allerdings der Befehlshaber der Royalisten dasselbe Angebot machte, weigerte sich der Jakobiner, es anzunehmen. Es war ein bitterer Moment. Es gab keinen Offizier an Bord der Diomede, der nicht die Verpflichtung Britanniens diesen Franzosen gegenüber empfand. Doch General Trethgowan hatte sich in seiner Besorgnis um das Wohl seiner Männer und angesichts der Unnachgiebigkeit Hugues’ darauf eingelassen, die Royalisten mit dem Versprechen des neuen Gouverneurs von Guadeloupe zurückzulassen, daß sie gut behandelt werden würden.
»Ich hatte gedacht, es könnte schlimmer nicht mehr kommen«, bemerkte Dillon, als die Truppen im Takt der Regimentspfeifer und -trommler hinunter zum Wasser marschierten, »aber jetzt hat Trethgowan diesen Hundsfott auch noch um die Benutzung seiner Transportschiffe gebeten. Konnte er nicht warten, bis wir ihm welche besorgt hätten?«
Bessborough blickte finster drein. Die Vorgänge an Land hatten seinen Plan zunichte gemacht, die Transportschiffe des Franzosen zu versenken. »Alles, was er noch im Kopf hat, glaube ich, ist, sich so weit und so schnell wie möglich von Guadeloupe zu entfernen. Immerhin gestattet ihm sein Freund den Rückzug unter unbeschädigten Waffen und Farben.«
»Sehr geschickt«, bemerkte Kapitän Sandford düster, »solange unsere Truppen auf diesen Transportschiffen sind, können wir wohl kaum seine Fregatten angreifen.«
»Sie senden am besten ein Boot an Land, Sandford. Trethgowan wird erwarten, daß wir ihn und seinen Stab an Bord nehmen.«
Dies begeisterte keinen der beiden Männer. Sandford hatte bereits seine Kapitänskajüte an den Admiral abgeben müssen. Mit hochrangigen Heeresoffizieren an Bord würde er wahrscheinlich erneut umziehen müssen. Und Bessborough verspürte keinen Drang, auch nur eine Sekunde mit einem Mann zu verschwenden, der es seiner Ansicht nach verdient hätte, nach English Harbour zu schwimmen. Es verging noch einige Zeit, bis die Truppen durch die Brandung watend – manche mußten getragen werden – sich an Bord der Transportschiffe geschleppt hatten.
»Segel in Sicht«, kam die Meldung des Ausgucks in der Mastspitze. »Die Redoubtable, Sir.«
»Gott sei Dank«, sagte Bessborough. »Sandford, geben Sie Flaggensignal: Flaggschiff an Redoubtable. Vom Konvoi lösen und eiligst zum Flaggschiff aufschließen. Sobald sie hier ist, werde ich übersteigen. Sie werden allein das Vergnügen haben, Trethgowans Gesellschaft heute nacht zu teilen.«
»Vielen Dank, Sir«, antwortete der Kapitän, ohne seinen ironischen Unterton zu verbergen.
»Unter keinen Umständen, Sandford, werden Sie ihm Ihre Kajüte zur Verfügung stellen. Dies ist ein Befehl. Lassen Sie meinetwegen Hängematten in der Bilge für den General und seinen Stab herrichten.«
Als wollte er dem beipflichten, ließ der Mungo aus der Jackentasche des Franzosen ein lautes und durchdringendes Quieken vernehmen.
Es war etwa eine Stunde vergangen, während der Bessborough auf dem Quarterdeck auf und ab ging und seine sorgenvollen Gedanken nur gelegentlich durch einen milden Fluch unterbrach. Die Redoubtable war immer noch eine Meile entfernt, als der letzte der französischen Truppentransporter das Signal gab, voll abgeladen zu sein. Bessboroughs Hoffnung, daß es ihm erspart bleiben würde, den Soldaten von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, hatte sich also nicht erfüllt. Er hielt inne, als er die Bootsmannspfeifen hörte, die den General mit einem seinem Rang angemessenen Salut an Bord begrüßten. Dies und der Anblick der ankerhievenden und reisebereiten Transportschiffe verfinsterten seine Miene noch mehr. Derselbe düstere Blick traf auch den General, als er endlich an Deck erschien. Das erste, was Trethgowan erblickte, war die Gruppe französischer Soldaten. Durch ihre weißen Uniformen mußten sie jedem sofort auffallen.
»Was zum Teufel machen diese Kerle hier?« wollte er wissen, wobei sich mit seiner Wut auch seine hochrote Gesichtsfarbe steigerte.
Sandford antwortete ihm darauf: »Sie sind vom Hafen aus an Bord gekommen, Sir, in weitem Bogen hergerudert. Keiner hat sie gesehen.«
»Gesehen oder nicht gesehen, das spielt hier keine Rolle, Sir«, brüllte Trethgowan, während ihm seine blauen Augen aus dem Gesicht zu quellen drohten, das inzwischen die Farbe seines ordentlich zugeknöpften, roten Uniformrocks angenommen hatte. »Ich habe mich verpflichtet, alle bourbonischen Truppen an Monsieur Hugues auszuliefern. Ich werde es nicht hinnehmen, daß mein Ehrenwort hier unterlaufen werden soll.«
»Sagen Sie, General«, unterbrach ihn Dillon, »was macht es für einen Unterschied, wenn Hugues ein paar Dutzend weniger Gefangene macht?«
»Was bilden Sie sich ein, verdammt, Sir! Sie sind Zivilist! Es wäre besser, wenn Sie sich hier heraushielten. Dies ist eine Frage der militärischen Ehre.«
Bessborough explodierte. »Dieses Wort aus Ihrem Munde, Sir, am heutigen Tag, ist eine Schande! Wie können Sie von militärischer Ehre sprechen, obwohl Sie soeben von einem Zivilisten gehörige Prügel einstecken mußten?«
»Um Gottes willen! Ich hatte recht«, sagte Dillon plötzlich scharf, seine leise irische Stimme gerade weit genug anhebend, um jedermanns Aufmerksamkeit zu erregen. »Es ist eine Guillotine.«
Diese furchtbare Erkenntnis ließ Trethgowan in seiner Antwort verstummen. Alle Augen waren nun in Richtung Land gerichtet. Die Plane war inzwischen von dem massigen rechteckigen Monstrum entfernt worden. Eine angeschrägte Klinge schimmerte oben zwischen den beiden Laufschienen matt in der Sonne. Die Soldaten, die zum Transport abgestellt waren, brachten gerade Seitenstützen an, um der Hinrichtungsmaschine die notwendige Standfestigkeit zu verleihen.
»Schauen Sie, Sir«, sagte Sandford und zeigte auf die Reihen der royalistischen Truppen, die inzwischen ohne Kopfbedeckung und Waffen angetreten waren. Hugues’ Soldaten hielten sie umringt, ihre Musketen drohend im Anschlag. Der neue Gouverneur von Guadeloupe stand außerhalb des Kreises, während zwölf Gefangene, einer nach dem anderen, mit gefesselten Händen aus der Menge gezogen wurden, um zur Guillotine geführt zu werden.
»Was hat er vor?« fragte Trethgowan.
Die Wirkung von Dillons Worten wurde durch seine gewohnt leise Art nicht beeinträchtigt: »Es sieht so aus, General Trethgowan, als ob dieser Mann Ihnen sogleich demonstrieren wird, daß auch er ein Zivilist ist.«
Das erste Opfer wurde jetzt die Treppe zur Guillotine hinaufgestoßen. Seine Kameraden an Bord der Diomede drängten sich durch die Gruppe der britischen Offiziere, um mit eigenen Augen die bevorstehende Barbarei beobachten zu können. Niemand sprach, als der Mann auf die Knie gezwungen und sein Kopf auf den Sockel der infernalischen Maschine hinuntergedrückt wurde. Hugues stand etwas abseits, sein kokardengeschmückter Hut ragte hoch in die Luft. Auf sein Handzeichen hin wurde die Klinge ausgelöst. Jeder an Bord hatte sich dieses Geräusch bereits einmal vorzustellen versucht – diese Begleitmusik der französischen Schreckensherrschaft. Aber die wirkliche Stimme von Madame Guillotine hörten sie alle in diesem Moment zum erstenmal. Niemand war darauf vorbereitet. Sie hielten den Atem an, als die schwere Stahlklinge in den hölzernen Führungsschienen niedersauste. Das dumpfe Aufschlaggeräusch erschütterte sie alle ebensosehr wie der Anblick des abgetrennten Kopfes, der in den bereitgestellten Bastkorb rollte. Ein dicker Blutstrahl schoß aus dem Torso des Hingerichteten, während die Klinge wieder emporgezogen wurde, grausig begleitet von dem Jubel, der nun angesichts des Todes des Royalisten an Land ausbrach. Zwei Mann hatten kaum die Füße ergriffen und den kopflosen Leichnam fortgeschleppt, da wurde schon das nächste Opfer über die Treppe seinem traurigen Schicksal zugeführt.
»Er hat mir sein Wort gegeben«, sagte Trethgowan.
»Sie sind ein Affenarsch, Sir«, entgegnete Bessborough, dessen hoher Rang es ihm gestattete, solch eine Verbalinjurie zu verwenden. Daß er sich zu einer derart gewöhnlichen Ausdrucksweise hatte hinreißen lassen, zeigte deutlich, wie nah ihm die Sache ging. Er war von wesentlich größerer Statur als sein Offizierskollege vom Heer, dies wurde um so offensichtlicher, als der Admiral ganz nah an ihn herantrat. »Sie sind ein Idiot, weil Sie ihn ungehindert an Land gehen ließen, ein Hanswurst, weil Sie ihn zuerst angreifen ließen, ein Narr, dort gegen ihn zu kämpfen, wo Sie es getan haben, und eine Memme, sich auf sein Wort zu verlassen. Dieser ehemalige Bäcker aus Marseille hat Sie in den Ofen geschoben, Trethgowan, und Ihren guten Ruf bis zur Perfektion durchgebacken.«
»Ich verbitte mir diesen Ton«, stotterte Trethgowan, während erneut Jubelgeschrei vom Strand herüberscholl.
»Ahoi, Diomede«, rief Kapitän Vandegut vom Deck der Redoubtable herüber, die herangesegelt war, ohne daß jemand Notiz davon genommen hatte. »Warum zur Hölle lassen wir ihre Transportschiffe entkommen?«
Bessborough wandte sich von seinem cholerischen Gegenüber ab und griff sich das Sprechrohr eines Midshipman: »Sandford, lassen Sie ankerauf gehen und bringen Sie uns aus dem Gefahrenbereich.«
»Gefahr, Sir?«
Bessborough hob wieder das Sprechrohr: »Vandegut, achten Sie auf Ihre Manieren, Sir, wenn Sie einen Flaggoffizier anreden. Lassen Sie Ihre Unterdeckgeschütze ausrennen. Nehmen Sie Kurs auf die Bucht. Versuchen Sie, so dicht wie möglich heranzukommen und zerstören Sie diese Guillotine. Wenn Sie dabei das Schwein mit der Kokarde am Hut miterledigen können, um so besser.«
Trethgowan protestierte, als er zur Seite geschoben wurde; das ganze Deck der Fregatte war nun mit umherrennenden Männern bevölkert. »Admiral Bessborough, darf ich Sie daran erinnern, daß meine Soldaten sich an Bord dieser französischen Transportschiffe befinden? Wollen Sie mit ansehen, wie sie umgebracht werden, Sir?«
Bessborough drehte sich um, um ihn anzuschreien, wozu er extra tief Luft holte. Er brachte jedoch keinen Laut heraus, und sein Körper ließ die Luft langsam wieder entweichen. Als er dann sprach, tat er es sehr leise. »Sandford, bitten Sie Kapitän Vandegut, eine Leine herüberzugeben. Und streichen Sie meine Flagge. Ich steige über auf die Redoubtable.«
Wieder hörte man Jubelschreie. Dillon näherte sich dem Admiral und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der ältere Mann nickte langsam, ging dann zu der Gruppe Franzosen hinüber und zog einen Mann am Ellenbogen beiseite, mit dem er bereits zuvor gesprochen hatte. Er fühlte die kalte Nase des zahmen Mungos an seinem Handrücken.
»Wie heißt du, Junge?«
Der junge Mann wirbelte herum, nach Fassung ringend und ohne die Tränen in seinen Augen zu verbergen. »Leutnant de Vaisseu Antoine de la Mery.«
»Und wer sind die anderen Männer hier?«
»Siedler, die nun Seeleute sind, Monsieur. Handwerker und einfache Bauern aus Santo Domingo. Wir sind nach Guadeloupe gekommen, nachdem die Schwarzen die Herrschaft über unsere Insel übernommen hatten.« Wieder Jubelgeschrei, wieder ein Opfer, während der junge Mann gerade mit dem Kopf nickte. Er griff in seine Jackentasche, zog seinen Mungo hervor und streichelte ihm über das forschende Köpfchen. »Eines Tages, petit ami, wird die Stunde unserer Rache gekommen sein.«
Immer noch ertönten die Jubelschreie, während der Admiral auf die Redoubtable überwechselte. Die Leute an Bord der 74er waren genauso entsetzt wie die Besatzung auf der Fregatte. Aber Hugues hatte sein schreckliches Handwerk noch nicht vollendet. Offensichtlich hatte ihn das langsame Voranschreiten der blutigen Arbeit der Guillotine ungeduldig gemacht, so daß er die Royalisten vor ihren Verteidigungsgräben in einer Reihe antreten ließ. Auf seinen Wink mit dem kokardengeschmückten Hut wurde den wehrlosen Männern eine Musketensalve in den Rücken gefeuert. Die getroffenen Franzosen fielen kopfüber in den Graben. Erst jetzt war für die Beobachter zu erkennen, daß die Delinquenten aneinander gefesselt waren. Die unverletzten Männer wurden daher von den getroffenen mit in den Graben hinuntergezogen. Die nächste Reihe armer Teufel mußte dann die freien Plätze einnehmen, wurden ebenfalls niedergeschossen und fielen auf die bereits im Graben liegenden Körper. Manche würden an ihren Verletzungen sterben, andere an Erstickung, jedenfalls war allen klar, daß sie dem Tode geweiht waren. Victor Hugues war in Guadeloupe eingetroffen und hatte seine Absichten bereits am allerersten Tag deutlich gezeigt. Der Schrecken der Revolution mit seiner ganzen Unerbittlichkeit hatte Einzug gehalten, um seine dunklen Schatten über die Westindischen Inseln zu werfen.
Kapitel 1
Schwere Regengüsse wuschen über die Back, so als wollten sie wie ein Vorhang alle Spuren des französischen Schiffes verdecken, das sich eben zwei Kabel voraus der Bucaphalas durch die See arbeitete. In einem einzigen weißen Tosen kamen die Wassermassen derart heftig hernieder, daß sie sogar die Wellen der See zu glätten imstande waren. Harry Ludlow stand am Steuer und bog sich unter der Wucht des Regens, der gegen sein Ölzeug peitschte, während er nur den Gedanken hatte, Kurs zu halten, da die Küste gefährlich nahe war. Schwerer hatten es allerdings die Männer oben in der Takelage, die mit ihren Füßen auf dem glitschigen Tauwerk der unter den Rahen befestigten Fußpferde mühsam ihr Gleichgewicht zu halten versuchten. Sie hatten mit dem strömenden Regen und dem heulenden Wind zu kämpfen, während sie versuchten, die Marssegel zu reffen. Sollte ihnen das nicht gelingen, so würde ihr Kapitän größte Mühe haben, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Alles andere als ein perfektes Manöver konnte angesichts der unsteten und ständig drehenden Sturmböen bedeuten, daß sie samt und sonders aus dem Mast geblasen würden.
»Wie lange wird das noch dauern, Kapitän?« brüllte Pender unter seinem Südwester hervor.
Es war nicht der erste Sturm, den sie an diesem Tag abzureiten hatten. Trotzdem würden die weniger Erfahrenen der Mannschaft verblüfft sein über die Friedlichkeit der See, wenn der Regen sich verzog und der Wind nachließ. Die älteren Decksleute hingegen, die mit ihrem Kapitän schon früher durch die Biskaya gesegelt waren, würden nur leicht den Kopf schütteln über die Streiche, die das Wetter dem Seemann zu spielen in der Lage war.
»Hoffentlich klart es auf, bevor der Kerl den Goulet zu sehen bekommt.« Während Harry seinem Diener antwortete, hob er den Kopf, um sich vom Regen das Salzwasser aus dem Gesicht waschen zu lassen, obwohl ihm dabei eine ganze Ladung Regenwasser unter seine Jacke lief. »Unter diesen Bedingungen würde ich nicht einmal eine spanische Silbergaleone verfolgen.«
»Es wäre schade, ihn nach allem zu verlieren.«
»Wir werden ihn nicht verlieren, Pender, keine Angst.«
Harry Ludlow hörte sich selbstbewußter an, als er sich tatsächlich fühlte, denn diese Verfolgungsjagd hätte schon vor Stunden beendet sein können. Der Kapitän dieses Handelsschiffs hatte sich jedoch als kluger Gegner erwiesen und verfügte über eine zuverlässige Mannschaft. Obwohl die nagelneue Bucephalas, soeben in Blackwall Reach vom Stapel gelaufen, ein pfeilschnelles Schiff war, hatte ihr die Beute bisher entwischen können. Der Franzose hatte alle Register der Segelkunst gezogen und das unberechenbare Wetter geschickt ausnützen können, um einer Kaperung zu entgehen. Ohne Zweifel kannte er sich in diesen Gewässern gut aus, wahrscheinlich handelte es sich um einen Seefahrer auf dem Weg in seinen Heimathafen.
Gesichtet hatte Ludlow ihn um einiges weiter südlich, als er eben die große Bucht von Douarnenez erreichte, hart am Nordwestwind segelnd mit Kurs auf Pointe du Raz, und wahrscheinlich die Loiremündung ansteuerte, um den Hafen von Nantes anzulaufen. Das vermutlich aus Westindien kommende und voll abgeladene Handelsschiff hatte nicht lange versucht herauszufinden, ob die sich auf kreuzendem Kurs nähernde Bucephalas ihm freundlich oder feindlich gesinnt war. Sofort hatte es Ruder gelegt und geradewegs in den Wind gedreht, um kreuzend und halsend um die Landzunge herumzukommen. Später am Tage hatte sich die Beschaffenheit der Küstenlinie verändert, von weißen Sandstränden mit flachen, grasbewachsenen Dünen zu grauen, zackigen Klippen mit spitzen Felsen, die vereinzelt aus der weißen Gischt vor den Abhängen hervorragten. Falls der Franzose mit den Gefahren an der bretonischen Küste vertraut war, ließ er sich jedenfalls nicht davon beeindrucken. Unter Mißachtung jeglichen Sicherheitsabstandes hielt er sich dicht unter Land, entweder aus Leichtsinn oder die drohende Gefahr bewußt in Kauf nehmend. An ihm dran zu bleiben würde keine leichte Aufgabe sein, eine Situation, die sich am frühen Morgen noch ganz anders dargestellt hatte.
»Wir werden ihn vor dem Abendessen haben, James.«
Harry hatte diese Bemerkung seinem Bruder gegenüber gemacht, als die Sonne an einem wolkenlosen Himmel strahlte und zu einer Zeit, als ihnen der Nervenkitzel einer Verfolgungsjagd noch Spaß bereitete. Der jüngere der beiden Ludlowbrüder saß in Hemdsärmeln in einem Decksstuhl unter dem Skylight3 und genoß die warme Herbstsonne. Selbst in dieser Aufmachung erweckte James Ludlow noch den leicht deplazierten Eindruck eines für das Bordleben eigentlich zu vornehmen Mannes. Er lächelte als Antwort, um sein großes Vertrauen in die seemännischen Fähigkeiten seines Bruders zum Ausdruck zu bringen.
»Ich meine, wir sollten Flagge zeigen, James. Ich möchte nicht, daß unsere Jagdbeute daran zweifelt, daß wir Briten sind.«
Sein Bruder beeilte sich keineswegs mit einer Antwort, weshalb nun auch Harry lächeln mußte. An Bord der Bucephalas würden alle Männer auf jeden Befehl ihres Kapitäns sofort gehorsam loseilen, und das Geräusch ihrer nackten Füße würde hierbei auf dem makellosen Holzdeck wie ein schneller Trommelwirbel erklingen. Jedwede Eile jedoch war James Ludlow ein Greuel. Er versah seine selbsterwählte Aufgabe als Verwalter des Flaggenspinds in einer Seelenruhe, die eigentlich völlig unpassend an Bord eines Freibeuters war, eines einzig zu Kriegszwecken bestimmten Schiffes.
»Hoffentlich hat er eine anständige Ladung, Bruderherz, eine, die uns allen die Taschen mit Gold auskleiden wird.«
Diese absichtlich laut ausgesprochene Bemerkung veranlaßte die umstehende Besatzung zu grimmigem Lachen. Seit sie im Juli von den Downs losgesegelt waren, hatten sie herzlich wenig Ladung erbeuten können. Jeder der Männer hatte zwar als Freiwilliger mit festem Salär bei Harry angeheuert, jedoch mit dem Ziel, sich seinen Anteil an den aufgebrachten Prisen zu verdienen. Von vielen wurde ihr Geschäft als gemeine Piraterie betrachtet, nicht zuletzt von den Offizieren der Kriegsmarine, zu denen sie in direkter Konkurrenz standen. Jedoch war Harry Ludlow im Besitz eines Kaperbriefs, der das königliche Siegel Seiner Majestät König Georg III. trug. Solch ein Dokument erlaubte seinem Inhaber, die Schiffe von Feinden der Krone zu verfolgen, zu kapern und gegebenenfalls zu zerstören oder das Kapergut inklusive der Ladung gewinnbringend zu verkaufen.
Die lockere Stimmung an Deck hielt auch nach Tagesanbruch noch an. Jeder an Bord wußte, daß sie einem feinen Segler auf den Fersen waren. Die Bucephalas lief jetzt härter am Wind als der Gejagte und konnte so den Abstand zusehends verringern. Harry beobachtete den Franzosen und dessen zehnte Kursänderung sehr genau, hierbei im Geiste die Anzahl der Schläge kalkulierend, die noch nötig sein würden, um dem Franzosen einen Schuß vor den Bug setzen zu können. In diesem Moment allerdings brach der Gejagte überraschend sein Kreuzmanöver ab, um statt dessen Kurs zu halten und auf die Küste zuzusteuern, mitten in die bedrohlichen grauen Felsen hinein.
»Verdammt, Pender, was hat er bloß vor? Wenn er sich nicht frei von der Küste hält, wird er sich den Boden an einem der Riffs aufreißen. Es ist wohl das klügste, schon mal die Boote klarzumachen, sonst müssen wir noch zusehen, wie seine gesamte Besatzung absäuft.«
Harry hatte diesen Satz an den Mann gerichtet, der neben ihm das Steuerrad hielt. Klein, drahtig, mit dunklem Teint und freundlichem Gesicht, war Pious Pender stolz darauf, als persönlicher Diener von Harry Ludlow zu gelten, obwohl jeder an Bord wußte, daß er viel mehr als ein gewöhnlicher Diener war. Durch Zufall war er an seine jetzige Stellung gekommen, um dem langen Arm des Gesetzes zu entgehen, während er auf einem Schlachtschiff Dienst tat. Und nur wenige an Bord der Bucephalas wußten, daß er zuvor als Dieb gearbeitet hatte, und zwar als guter Dieb, der nur durch den Neid anderer ins Visier des Staatsanwaltes geraten war. Seit seiner ersten Begegnung mit den Ludlowbrüdern hatte er ihnen unschätzbare Dienste geleistet, unter anderem hatte er soger einmal Harry das Leben gerettet. Deshalb hatte sich eine Beziehung zwischen den drei Männern entwickelt, die das normale Maß zwischen Herr und Diener weit überschritt. Pender war zugleich Freund und Vertrauter der Ludlows und der Mann an Bord, dem der Kapitän der Bucephalas das Kommando über seine Entermannschaften anvertraut hatte.
Die Mannschaft wunderte sich über den neuen Befehl, der ihr soeben von Pender übermittelt wurde. Nichtsdestotrotz beeilten sie sich, den Auftrag auszuführen, freilich ohne den Franzosen dabei aus den Augen zu lassen. Jeder der Männer war sicher, daß der Franzose Vernunft walten lassen und von der Küste wieder weghalten würde, um dem felsigen Hexenkessel zu entgehen – um sich damit aber auch geradewegs in die Reichweite der feuerbereiten Geschütze zu begeben.
Doch alsbald zeigte sich, daß der Handelsschiffskapitän sein Geschäft verstand. Er hatte haargenau das Ansteigen der Tide einkalkuliert, als er sich unter Land begab. Eine halbe Stunde, nachdem das Hochwasser seinen Höchststand erreicht hatte, begann es wieder zu fallen. Die hierdurch verursachte ablandige Strömung würde ihm für die nächste Zeit jeden Feind vom Halse halten. Und im Laufe des Tages veränderte sich die Lage noch weiter zu seinem Vorteil. Als hätte er es mit einem sechsten Sinn vorausgeahnt, drehte der Wind auf West, und das Wetter verschlechterte sich von strahlendem Sonnenschein zu graubedecktem Himmel mit plötzlichen Schauern von solcher Intensität, daß es James Ludlow und jeden anderen Müßiggänger an Bord der Bucephalas unter Deck trieb. Trotz seiner guten seemännischen Fähigkeiten, über die Harry Ludlow zweifellos verfügte, war es dem Franzosen gelungen, sie alle an der Nase herumzuführen und seinen Verfolgern ein Schnippchen zu schlagen. Der Mann kannte diesen zerklüfteten Küstenabschnitt offensichtlich ebensogut wie den Rücken seiner eigenen Hand. Und er war ihnen nicht einfach nur entwischt. Zugleich hatte er ständig versucht, die Bucephalas auf unsichtbare Riffs zu locken und ihr hierdurch das Schicksal zu bereiten, das Harry ihm zugedacht hatte.
Bereits zum drittenmal war die Bucephalas nun gezwungen beizudrehen, während Harry fest entschlossen war, seine Beute festzunageln und mit Hilfe der scharfen Augen seines Ausgucks und seinem eigenen Riecher den gefährlichen Untiefen und verborgenen Riffs rechtzeitig auszuweichen. Seine Frustration mischte sich mit Bewunderung für den Gegner. Die navigatorischen Fähigkeiten des Franzosen waren wirklich beeindruckend. Wer versucht war, hier nicht von Fähigkeiten, sondern von Glück zu sprechen, mußte sich folgendes vor Augen halten: Dieses Schiff hatte bereits die gesamten Blockadelinien der Royal Navy durchsegelt, deren Aufgabe es war, jegliche Annäherung an den französischen Hauptmarinestützpunkt Brest zu unterbinden. Nachdem er ihnen nun das Heck gezeigt hatte, näherte er sich dem Goulet, jener tückischen Enge vor dem Hafen, und lockte Harry Ludlow mit der Bucephalas in sein Kielwasser. Die Männer warfen vereinzelte Blicke zu Harry hinüber, gespannt auf sein nächstes Manöver. Ihr Kapitän war allerdings keiner, der seine Anweisungen auf dem Quarterdeck mit der Mannschaft auszudiskutieren pflegte. Lediglich Pender, der dicht bei ihm stand, genoß das Privileg, an den Absichten des Kapitäns sofort teilhaben zu können.
»Ich hoffe, daß er sich freisegelt, wenn die Tide gefallen ist. Diese Enge würde kein vernünftiger Mensch bei Niedrigwasser befahren. Ich würde niemals ohne genügend Wasser unter dem Kiel in den Goulet einfahren, selbst wenn ich ihn so genau kennen würde wie einer der Krabbenfischer hier von der Küste.«
Harry brauchte seinem Diener nicht zu erklären, daß mit diesem felsigen Küstenstrich nicht zu spaßen war. In den vergangenen drei Monaten hatte Pender jede Menge Felsenküste gesehen, und er hatte auch genügend Katastrophengeschichten gehört, um zu wissen, daß es sich um einen tatsächlichen Schiffsfriedhof handelte. Aber Pender wußte ebensogut, daß Harry Ludlow diese Prise bitter nötig hatte. Denn obwohl er bei Ausbruch des Revolutionskrieges glänzende Erfolge als Freibeuter feiern konnte, waren die Erträge im dritten Jahr der Auseinandersetzungen ausgesprochen dürftig geblieben.
Damals, vor zwei Jahren, war Harry vor dieser Küste aufgetaucht, bevor die meisten ankommenden Schiffe überhaupt wahrgenommen hatten, daß England sich wieder im Krieg mit Frankreich befand, daß die jakobinischen Despoten in Paris ihrem König und ihrer Königin die Köpfe abgeschlagen hatten und nun dasselbe Schicksal einer steigenden Anzahl ihrer Landsleute angedeihen ließen. Zwei Jahre zuvor, mit einigen Prisen im Rücken und angesichts der Geschicklichkeit dieses Burschen, hätte Harry Ludlow diese Beute vielleicht entkommen lassen.
Doch den Umständen nach war er inzwischen gezwungen, in einem erheblich kleineren Seegebiet zu operieren, um nicht den Schiffen der Royal Navy in die Quere zu kommen, die vor Brest und La Rochelle kreuzten. Seine Taktik des schnellen Rückzugs, sobald er ihre Mastspitzen sichtete, diente nicht nur dazu, keinen Mißfallen bei der Royal Navy zu erregen. Jedes Kriegsschiff auf See war knapp an ausgebildeten Seeleuten. Und Harry hatte zwar eine schriftliche Ausnahmegenehmigung bei sich, die ihm rechtlich zusicherte, daß seine Leute nicht von den Streitkräften gepreßt werden konnten, jedoch wollte er sich auf See möglichst nicht auf eine juristische Auseinandersetzung einlassen, während außer der Breitseite eines Kriegsschiffs jegliche staatliche Autorität weit entfernt war.
Zu Beginn ihrer Reise hatte seine Mannschaft allen Grund gehabt, ihm eine glückliche Hand nachzusagen. Nun, nach drei Monaten vergeblichen Umherkreuzens, begann sich mancher zu fragen, ob die Glücksgöttin Fortuna ihren Kapitän möglicherweise im Stich gelassen hatte. Manche meinten gar, auf diesem neuen Schiff laste ein Fluch. Wie konnten sie erfolglos bleiben, obwohl das Schiff alles hatte, was sich der Kapitän eines Freibeuters nur wünschen konnte? Die Bucephalas war die reduzierte Version einer Fregatte, bis auf die Höhe ihrer Masten in allem etwas verkleinert. Sie hatte die notwendige Geschwindigkeit für Verfolgungsjagden und war ausreichend bewaffnet, um jeden einsichtigen Gegner, ausgenommen ein Kriegsschiff, zur Aufgabe zu bewegen.
Die Männer, die nun im strömenden Regen arbeiteten, starrten genauso gebannt wie Harry Ludlow in die Richtung, wo sie den Verfolgten zuletzt gesehen hatten, sehnlichst eine Wetterverbesserung herbeiwünschend, um ihr potentielles Opfer wieder im Blickfeld zu haben. An Backbord hellte sich der Himmel soeben etwas auf und nahm eine silbern schimmernde Farbe an, ein untrügliches Zeichen für das Abklingen des Regens. Da Harry damit gerechnet hatte, legte er bereits jetzt Ruder. Er wollte seinem Feind nach diesem Schauer wesentlich näher gekommen sein, wenn möglich sogar längsseits. Es schien, als sollte sein Wunsch schneller in Erfüllung gehen als erwartet. Die Geschwindigkeit, mit der das erste Segel aus dem Regen auftauchte, erschreckte ihn bis aufs Mark.
»Los die Schoten!« brüllte er, als er das Steuerrad drehte, um sein Schiff in den Wind zu bringen.
Es standen ihm weder genug Geschwindigkeit noch ausreichend Wind zur Verfügung, um das Schiff direkt herum auf Backbordbug bringen zu können, eine Tatsache, die ihn Flüche ausstoßen ließ. Der Franzose hatte sich offensichtlich entschlossen, ihn zu rammen, eine Möglichkeit, die Harry hätte vorhersehen müssen. Aber es traf ihn unvorbereitet. Deshalb ging es nun darum, einen Kurs zu wählen, der das Manöver des Gegners am ehesten würde scheitern lassen. Doch trotz seiner gut eingespielten Mannschaft schien sich sein Abwehrmanöver nur in unendlicher Langsamkeit zu vollziehen. Die Zeit schien stillzustehen, während das verfolgte Schiff wie ein Ungeheuer immer größer vor ihnen auftauchte.
»Steuerbordbrassen besetzen und durchholen!«
Die Rahen, die zuvor gelöst worden und in den Wind geschossen waren, wurden nun beigeholt und festgesetzt, damit das Schiff von der Küste frei und auf Steuerbordkurs kommen konnte. Der geisterhafte Schatten des Handelsschiffes schien turmhoch vor der Bucephalas aufzuragen, dicht genug, um die Farbe von der Bordwand zu kratzen. Dann ertönte der erste Kanonendonner. In dem Augenblick, als er dieses vertraute Geräusch gehört hatte, wurde Harry klar, daß dieses Schiff viel zu groß war, um der bisher verfolgte Gegner sein zu können.
Wie auf das Signal des Kanonendonners begann das Wetter aufzuklaren. Plötzlich war der Himmel wieder sichtbar, und ein nur noch schwacher Nieselregen, der sich langsam auf die Felsenküste zu bewegte, gab jetzt den Blick frei auf das erste von drei Schiffen, die sich in dem engen gischtbefleckten Küstengewässer aufhielten. Harry war alles andere als erfreut, als er die Flagge am Großmast des dritten Schiffes erblickte, die es als Fregatte der Royal Navy auswies. Noch weniger erfreute ihn die Tatsache, daß die Fregatte ihre Geschützpforten geöffnet hatte und die Geschütze in Richtung Bucephalas zielten.
Kapitel 2
Dann wurden die Geschütze erneut abgefeuert, allerdings nicht auf der der Bucephalas zugewandten Seite. Der Wind wehte den aufsteigenden Pulverqualm in Richtung des Handelsschiffes. Mit ihren 18-Pfündern konnte das Kriegsschiff den Franzosen in einer Weise bedrohen, wie es Harry nicht möglich war. Seine 12-Pfünder hatten nicht genug Reichweite, und die Mittschiffskarronaden konnten nur in der Nahdistanz ihre durchschlagende Wirkung entfalten. Die Kugel einer 18-Pfund-Kanone hingegen hatte nach einer Flugstrecke von einer halben Meile noch ausreichend Durchschlagskraft, um eine sechs Zoll dicke Eichenbohle zu durchdringen. Der Franzose wußte dies natürlich ebensogut wie jeder andere auf See. Er drehte bei und hielt auf das ruhigere Flachwasser zu. Dann strich er seine Flagge, rechtzeitig bevor die nächsten Schüsse der Fregatte das Wasser um sein Schiff aufwühlen würden.
Geistesabwesend beobachtete Harry die jämmerliche Geschützbedienung. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf etwas ganz anderes. Sehnlich suchte er den Himmel nach dem kleinsten Anzeichen eines neuen heranziehenden Unwetters ab, welches ihm einen unbemerkten Rückzug ermöglichen könnte. Der Franzose interessierte ihn nicht mehr. Es war aussichtslos, mit einer königlichen Fregatte um eine Prise zu streiten. Die Besatzung der Bucephalas würde nichts von der Beute abbekommen, die selbstverständlich zur Gänze von der Royal Navy beansprucht wurde. So sehr sich die Leute über den Ausgang dieser Angelegenheit ärgerten, war aus ihren verdrießlichen Kommentaren doch herauszuhören, daß sie ebenso wie ihr Kapitän schnellstens diesen Schauplatz verlassen wollten. Die meisten von ihnen hatten schon einmal auf einem Kriegsschiff Dienst getan. Keine Erfahrung, die auch nur einer der Männer ein zweites Mal machen wollte. Würden sie jetzt nicht davonkommen, so konnte dies bedeuten, daß sie die Annehmlichkeiten ihres Freibeuters mit der Hölle eines königlichen Kriegsschiffs zu tauschen hatten, mit täglichen Auspeitschungen und einer Verpflegung, die schon seit Kriegsbeginn in den Fässern vor sich hinfaulte.
Der Kommandant auf dem Quarterdeck der Fregatte schien diese Absichten bereits vorausgesehen zu haben, da nun seine Stimme durch ein Sprechrohr in einer Lautstärke ertönte, die James auf dem Niedergang zu seiner Kabine erstarren ließ.
»Behalten Sie Ihre Position bei, Sir, und warten Sie, bis mein Prisenkommando zu Ihnen an Bord kommt.«
»Harry?« fragte James, jedoch ließ ihn die erhobene Hand seines Bruders verstummen.
Pender griff aufmerksam nach Harrys Sprechrohr und befahl der Mannschaft leise, die Rahen zu besetzen.
»Dies ist die Bucephalas, Sir. Mit Kaperbrief aus Deal ausgelaufen, wir kreuzen in diesen Gewässern mit der Genehmigung Seiner Majestät des Königs persönlich. Deshalb können Sie Ihr Prisenkommando an Bord behalten.«
»Verflucht sollen Sie sein, Sir«, kam die schroffe Antwort mit starkem irischen Akzent. »Sie werden einem Offizier Seiner Majestät nicht vorschreiben, was er zu tun hat.«
»Spricht wie ein Schotte«, bemerkte James bissig. Für dieses Volk hatte er wenig übrig, eine Nation, die seit der Union4 bereits zweimal aufbegehrt hatte und der jedesmal so weitreichend vergeben worden war, daß sie nach James’ verbitterter Auffassung inzwischen das ganze Land regierte. Sein Schwager, der dieser Glaubensrichtung angehörte und den er nicht ausstehen konnte, hatte ihn in seinen Vorurteilen noch bestärkt. Angesichts der ungehobelten Art, in der sie nun angeredet wurden, schienen sich alle seine Vorbehalte wieder zu bestätigen.
Harry hob erneut sein Sprechrohr: »Ich bin im Besitz einer Ausnahmegenehmigung für meine gesamte Besatzung, Sir, mit der eigenhändigen Unterschrift des Kriegsministers.«
»Wenn Sie ein Ehrenmann wären, Sir, würde ich Ihnen vielleicht Glauben schenken. Da Sie jedoch nur ein verdammter Freibeuter sind, kann ich Ihr Wort als Marineoffizier nicht akzeptieren.«
»Kann ich das Sprechrohr mal haben?« fragte James, während langsam der Ärger in seinem sonst so ruhigen Gesicht aufstieg.
»Nein, James, kannst du nicht.«
»Ruf deine Leute von den Brassen zurück, Sportsfreund, oder ich jage euch eine Kugel in die Außenhaut.«
Harry mußte sich beherrschen, um seine Stimme ruhig zu halten. Er war genauso verärgert wie James. Aber es würde nichts Gutes dabei herauskommen, mit einem Marineoffizier Beschimpfungen auszutauschen. Diese Herren haßten für gewöhnlich alle Freibeuter, die in ihren Augen nur Profit aus dem Krieg zu schlagen versuchten und sich andererseits den Risiken entzogen, die ein Kampf gegen einen gut bewaffneten Feind mit sich brachte.
»Sie sind willkommen an Bord, sofern Sie der Kapitän sind.«
»Oh, machen Sie sich über meinen Dienstgrad keine Gedanken, Sportsfreund. Es wird Ihnen schon die angemessene Behandlung widerfahren.«
»Dieser Ton gefällt mir nicht, Harry. Was meint er damit?«
Harry antwortete nicht, sondern wandte sich statt dessen an Pender: »Hol die Papiere aus meiner Kabine und laß die Besatzung zur Musterung antreten.«
Dann drehte er sich in Richtung Deck und schaute seinen Leuten in die besorgten Gesichter. »Keine Gewalt und kein falsches Wort, haben wir uns verstanden? Unsere Papiere sind in Ordnung, und das hat er trotz seiner schlechten Manieren zu akzeptieren. Sollte jedoch einer von uns Hand an seine Leute anlegen, so könnte dies als strafbare Handlung gewertet werden, und er hätte das Recht, den Übeltäter in Eisen legen zu lassen.«
»Boot legt ab, Kapitän«, meldete Patcham, einer der Männer, denen Harry eine Autoritätsstellung unter den Decksleuten an Bord gegeben hatte. Er war soeben aus dem Mast herabgeklettert, wo er als Ausguck Dienst getan hatte. Er hatte sich offenbar so auf das französische Handelsschiff und etwaige Riffs konzentriert, daß er die von See kommende Fregatte vollkommen übersehen hatte. Normalerweise hätte er jetzt einen strengen Verweis über sich ergehen lassen müssen, doch das hatte angesichts der bedrohlichen Situation Zeit bis später.
»Kutter und Beiboot«, ergänzte Patcham. »Jeweils eine Gruppe bewaffneter Seesoldaten an Bord.«
»Sollten wir uns nicht auch bewaffnen, Bruder?«
»Nein, James. Das wäre das letzte, was wir tun sollten.«
Harry konnte erkennen, daß die Gestalt in der Plicht des Beibootes komplett in Ölzeug gehüllt war, eine sinnvolle Maßnahme angesichts der unkoordinierten und spritzenden Ruderweise der Bootsbesatzung; der goldene Besatz an der Kopfbedeckung ließ die Dienststellung als Marineoffizier erkennen. Harry nahm das Teleskop von Patcham und richtete es auf den Ankömmling. Als das Boot dichter kam, waren auch Details genauer zu erkennen. Ein dunkelhäutiges, mürrisches Gesicht, mit dicken schwarzen Augenbrauen, die sich in der Mitte zu verbinden schienen. Darunter zornige Augen und blau-schwarze Kinnbacken, die einen üppigen Bartwuchs vermuten ließen. Man konnte es zwar nicht hören, jedoch an seinen Lippenbewegungen ablesen, daß er mit Nachdruck sprach. Harry war der Kunst des Lippenlesens mächtig genug, um zu verstehen, daß der Kapitän seine unfähigen Bootsgasten verfluchte, gut gezielte Peitschenhiebe mit der Zunge verteilte, die mit stoischem Stillschweigen hingenommen wurden.
James hatte sich ein anderes Teleskop aus der Halterung genommen und verfolgte ebenfalls das Geschehen. Für ihn als Portraitmaler von gewissem Renommee waren menschliche Formen ständiges Objekt professioneller Beobachtung, daher vermochte er diesem Gesicht einiges mehr an Information zu entnehmen, als es seinem Bruder möglich war.
»Er schäumt vor Wut, Harry. Und seinem Auftreten nach zu urteilen, scheint das bei ihm der Normalzustand zu sein.«
Diese Vermutung war kaum ausgesprochen, als der Kapitän an Bord kam, gefolgt von einem pickligen Fähnrich und einer Gruppe Seesoldaten. Er grüßte nicht, berührte noch nicht einmal seine Hutkrempe, sondern fixierte alles mit seinen schwarzen, funkelnden Augen.
Jeder Seemann, der aus welchem Grund auch immer ein gut geführtes Schiff betritt, läßt sich wenigstens zu einem bescheidenen Wort der Anerkennung hinreißen. Nicht so dieser Kamerad.
»Toner«, grunzte er. »Kapitän der Endymion, 32 Geschütze.«
Der unfreundliche Ausdruck seines im Ruhezustand fast quadratischen Gesichtes wurde durch die auffällige obere Zahnreihe noch verstärkt. Sie war etwas zu groß für seinen Mund, jedoch gerade und fehlerfrei, und verlieh seiner Sprechweise etwas Eigentümliches. Wenn er schwieg, schienen die oberen auf den unteren Backenzähnen zu mahlen. Seine blutarmen Lippen spannten sich zu einer Art ständiger Grimasse.
»Harry Ludlow, Eigner und Kapitän der Bucephalas.«
Die schwarzen Augen verengten sich unter einer einzigen dicken Augenbraue und verliehen Toner das Aussehen eines Hogarthschen5 Dämonen. »Ludlow!«
»Dies ist mein Bruder und Partner unserer Seeunternehmung, James Ludlow.«
Der Blick schnellte hinüber zu James und zurück zu Harry, wie um Ähnlichkeiten zwischen den beiden festzustellen. Die Zähne mahlten deutlich hörbar aufeinander, und ihr Besitzer ließ ein tiefes, ungehaltenes Knurren vernehmen.
»Bei meiner Seele, Kapitän Toner«, sagte James in seiner leisen und trägen Art, »Ihnen scheint ja die Galle schon grün im Gesicht zu stehen. Zweifellos bringt das ein Beruf mit sich, bei dem das Drangsalieren Unschuldiger an der Tagesordnung ist. Doch erinnern Sie sich bitte daran, daß wir von Ihnen als Gast an Bord unseres Schiffes bessere Manieren erwarten dürfen.«
Die Provokation hatte nicht den gewünschten Effekt.
Es war Toner nicht möglich, noch zorniger dreinzuschauen, als er es bereits tat. Er spie seine nächste Frage förmlich hinaus: »Ihr seid doch nicht etwa die Bälger von Thomas Ludlow, oder?«
»Das ist unerträglich!« schnappte James nach Luft, durch diese kränkende Bemerkung Toners jetzt doch aus seiner ruhigen Gelassenheit gebracht.
Harry hob zurückhaltend die Hand. »Bitte, Bruder. Merkst du nicht, daß es dem Kapitän Freude bereitet, dich zu reizen? Du solltest ihm diesen Gefallen nicht tun.«
James zwang sich dazu, seinen nasal-lässigen Tonfall wiederzufinden, den er gemeinhin in vernichtender Weise einzusetzen verstand: »Wie dumm von mir. Es war mir tatsächlich entfallen, wie schwer es in diesen Zeiten für die Navy ist, ihre Schiffe mit Ehrenmännern zu besetzen. Solch ein Mangel an Manieren ist natürlich nicht außergewöhnlich, wenn man gezwungen ist, nacktärschige Bauerntrampel in Offiziersränge zu befördern ...«
Toners Zähne mahlten nun so stark, daß Harry sich fragte, ob sie unversehrt bleiben würden. Gleichzeitig ärgerte er sich über James, und der Blick seiner Augen verriet, daß er sich von den Beleidigungen seines Bruders innerlich distanzierte.
»Sie hatten eine Frage gestellt, Kapitän«, fragte Harry, während er Toner den Kaperbrief reichte. »Wenn auch in beleidigender Weise. In der Tat: Wir sind die Söhne des verstorbenen Admirals.«
Toner würdigte die Pergamentrolle kaum eines Blickes, seine Augen zuckten wieder zwischen den beiden Brüdern hin und her. »Ich weiß wirklich nicht, was der alte ›Foulweather‹ Tom Ludlow dazu sagen würde, wenn er seine Söhne bei der Freibeuterei erleben könnte. Wahrscheinlich würde er sich im Grabe herumdrehen, schätze ich.«
Es war lange her, seit Harry zum letztenmal jemand den Spitznamen seines Vaters erwähnen hörte. Normalerweise schwang bei der Anspielung auf die Vorliebe des verstorbenen Admirals für schweres Wetter immer eine gute Portion Hochachtung mit. Toner hingegen hatte es wie ein Schimpfwort benutzt.
Harry antwortete daher nun in einem eher ungemütlichen Tonfall: »Die Ansichten unseres Vaters über uns gehen Sie nichts an, Kapitän Toner. Es ist anmaßend von Ihnen, solche Dinge überhaupt anzusprechen. Soweit Sie unsere Papiere zu kontrollieren wünschen, tun Sie es bitte. Es dürfte wenig Nutzen bringen, hier noch weiter herumzuschwafeln.«
Auf Toners Gesicht machte sich ein Lächeln breit. Die Grimasse mit den blutarmen Lippen spannte sich noch ein bißchen mehr. »Ich denke schon, daß sich hier Nutzen ziehen läßt, Sportsfreund, jedenfalls für denjenigen, der dazu berechtigt ist. Diese Prise ist ein ganz netter Fang, oder was würden Sie sagen?«
»Soweit Sie Ihre Beute nicht zu teilen gedenken, Kapitän Toner, ist sie für mich ohne Interesse.«
»Teilen, verflucht!« brüllte Toner, sein Kinn vorstreckend.
Er riß Harry die Dokumente aus der Hand und überflog sie flüchtig. Das rote Band, das von dem großen königlichen Siegel unter dem Schriftsatz gehalten wurde, flatterte im aufbrisenden Wind. Harry warf einen Blick hinaus auf See. Die Sturmböen, die er etwas früher herbeigesehnt hatte, waren jetzt im Anmarsch und zeichneten sich vor dem grauen Horizont wie eine große Regenwand ab.
»So, Sie haben also einen Kaperbrief, fein, fein«, sagte Toner. Er blickte auf die angetretene Besatzung, um seinen Blick dann zurück auf Harry zu konzentrieren. »Und gut bemannt sind Sie obendrein. Das Problem ist nur, Sportsfreund, daß ich ein Schiff Seiner Majestät führe, das knapp an Besatzung ist. Es wird daher unumgänglich sein, daß Sie sich von einigen Ihrer Leute trennen.«
»Dem kann ich leider nicht stattgeben«, entgegnete Harry kühl.
Toners Zähne blitzten auf, als sich die Lippen zu einer Art Lächeln formten: »Können Sie nicht? Ich bin untröstlich, aber die Bedürfnisse des Königs haben Vorrang.«
»Jeder der Leute hier an Bord ist von der Zwangsverpflichtung freigestellt, Sir. Und mein Schiff, so möchte ich hinzufügen, bedarf keiner Abordnung der Marine, um seine Funktionstüchtigkeit unter Beweis zu stellen.«
»Freigestellt«, japste Toner, die Behörde verwünschend, die Harry die Erlaubnis erteilt hatte, als Freibeuter mit seinen Leuten seinem Geschäft nachgehen zu können.
Harry zeigte auf Pender, der am Bug neben einem der Besatzungsmitglieder stand, die an Deck zur Musterung angetreten waren.
»Mein Diener hat die Liste. Er wird sie verlesen.«
Toner starrte ihn fast zehn Sekunden lang an, drehte sich auf dem Absatz und stiefelte geräuschvoll über Deck. Sein Gang lebte geradezu vom Einsatz der Absätze, und jedes Aufstampfen auf dem makellosen Deck schien sein wütendes Verhalten noch zu betonen.
»Benjamin Flowers aus ...«
Sobald Pender den ersten Namen verlesen hatte, riß Toner ihm das Papier aus der Hand. »Gefälscht!« brüllte er, die Liste wild in der Luft herumwedelnd, und schrie Harry über Deck hinweg an: »Erwarten Sie etwa, daß ich auf diesen plumpen Trick hereinfalle, Sportsfreund?«
»Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ende der Liste richten wollen, Sir, werden Sie den Namen eines Landsmannes entdecken. Sie werden vielleicht von ihm gehört haben, es ist die Unterschrift von Henry Dundas6.«
»Wollen Sie mich für dumm verkaufen?«
Es war nun an James, mit geschliffenen Worten präzise und unmißverständlich zu antworten: »Soweit dies bei einem keltischen Barbaren überhaupt noch erforderlich ist, werden wir Ihnen diese Frage gern beantworten. Sollten Sie allerdings Ihre eigene Intelligenz in Frage gestellt haben, könnte Ihnen die Anwort möglicherweise mißfallen.«
Toner, der zunächst den Mund zur Erklärung geöffnet hatte, klappte ihn angesichts dieser eloquenten Attacke wieder zu. Als er sich daraufhin wieder dem jüngeren Ludlow zuwandte, bemerkte er, was Harry bereits Minuten zuvor beobachtet hatte: das heranziehende Gewitter.
»Fälschungen, Sir. Da wette ich meinen Namen drauf.« Seine Stimme überschlug sich, als er seinen pickligen Fähnrich anrief: »Hemmings, rufen Sie die Boote längsseits. Seesoldaten, jeder zweite Mann ist ein Freiwilliger.«
»Halt!« rief Harry in einem Kommandoton, der die Rotröcke einhalten ließ. »Dazu haben Sie kein Recht.«
»Habe ich nicht, guter Mann? Ich bin knapp an Leuten, die ich zur Kriegführung dringend benötige. Und Sie haben hier all diese nichtswürdigen Drückeberger, die sich hinter diesem Stück Papier verstecken wollen.« Toner hob die Liste in die Luft und zerriß sie in zwei Stücke. »Sehen Sie, das ist es, was ich mit Ihrer verdammten Ausnahmegenehmigung mache, Sir. Sie existiert schlichtweg nicht mehr.«
Obwohl sich die Seesoldaten auf Harrys Kommando hin zurückgehalten hatten, bedrohten sie jetzt mit noch gesenkten Musketen jeden Mann an Bord. Sich unbewaffnet mit ihnen auf einen Kampf einzulassen, wäre töricht gewesen. Sollte es zu Verletzungen kommen, könnten sie sich auf ihre Pflichterfüllung berufen. Andererseits würde jede Verwundung, die einem Seesoldaten im Dienst beigebracht wurde, ein Strafverfahren vor einem Gericht der Admiralität nach sich ziehen.
Harry hatte kein großes Vertrauen auf die Gerechtigkeit solcher Verfahren.
Toner bemerkte sein Zögern. Seine schwarz behaarte Hand schoß hervor und überraschte Pender. Er hatte ihn an der Jacke gepackt und schleuderte ihn quer über Deck, bevor irgend jemand dazwischengehen konnte.
»Den hier nehmen wir als ersten.«
Harry pflegte zwar immer Besonnenheit zu predigen, aber gegen plötzliche Temperamentsausbrüche war auch er nicht immun. Er war bekannt für die Fürsorge um seine Besatzung und konnte nicht tatenlos zusehen, wie ein Mann, den er seinen Freund nannte, so grob angepackt wurde. Eher instinktiv als vernunftgesteuert rannte er über Deck, griff sich einen Marlspieker und stürmte damit auf Toner zu. Der Marineoffizier blieb ruhig stehen, schlug seine Öljacke zur Seite und zog seine Handfeuerwaffe. Harry war zwar ziemlich aufgebracht, jedoch glücklicherweise nicht völlig außer sich. Einen bewaffneten Mann aus so kurzer Distanz anzugreifen wäre Selbstmord gewesen. Er hielt kurz vor dem Kapitän ein.