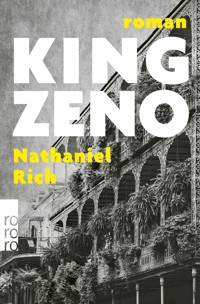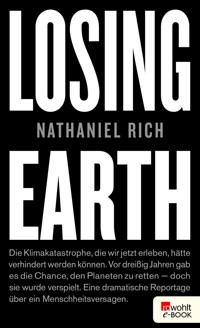19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Mikroplastik in unseren Körpern über neu entfesselte Naturgewalten bis hin zur Erforschung der Unsterblichkeit: Nathaniel Richs Reportagen zeichnen ein eindrucksvolles Panorama unserer hochtechnisierten Welt. Wie unheilvoll menschliches Wirken und Natur miteinander verflochten sind, erleben wir, wenn Rich spannend wie in einer True-Crime-Novel von einem Dorf in den USA erzählt, das gegen einen Chemiekonzern und dabei buchstäblich um Leben und Tod kämpft. Weniger apokalyptisch und vielmehr futuristisch wirkt die Begegnung mit einem Fleischer aus Illinois, der sich als einer der Ersten auf die Züchtung von Laborfleisch verlegt hat. Und wie Science-Fiction wirkt die Geschichte eines weißen Hasen, der genetisch so verändert wurde, dass sein Fell im Dunkeln fluoresziert – was die Frage aufwirft, ob wir uns nicht schon längst, als Schöpfer der Natur, zu neuen Göttern aufgeschwungen haben. Nathaniel Rich führt uns fesselnd und mit großer erzählerischer Kraft eine Welt vor Augen, wie wir sie noch nicht gesehen haben – und die doch nichts ist als die pure Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nathaniel Rich
Die zweite Schöpfung
Wie der Mensch die Natur für immer verändert
Über dieses Buch
Von synthetischen Giftstoffen in unseren Körpern über neu entfesselte Naturgewalten bis hin zur Erforschung der Unsterblichkeit: Nathaniel Richs Reportagen zeichnen ein eindrucksvolles Panorama unserer hochtechnisierten Welt. Wie unheilvoll menschliches Wirken und Natur miteinander verflochten sind, erleben wir, wenn Rich spannend wie in einer True-Crime-Novel von einer Stadt in den USA erzählt, die gegen einen Chemiekonzern und dabei buchstäblich um Leben und Tod kämpft. Weniger apokalyptisch und vielmehr futuristisch wirkt die Begegnung mit einem Koch aus Illinois, der sich als einer der Ersten auf die Züchtung von Laborfleisch verlegt hat. Und wie Science-Fiction liest sich die Geschichte eines weißen Kaninchens, das genetisch so verändert wurde, dass sein Fell grün fluoresziert, was die Frage aufwirft, ob wir uns nicht schon längst, als Schöpfer der Natur, zu neuen Göttern aufgeschwungen haben.
Nathaniel Rich führt uns fesselnd und mit großer erzählerischer Kraft eine Welt vor Augen, wie wir sie noch nicht gesehen haben – und die doch nichts ist als die pure Gegenwart.
Vita
Nathaniel Rich, geboren 1980, zählt zu den bedeutenden Reportern der USA. Er schreibt für das «New York Times Magazine», die «New York Review of Books» und den «Atlantic». Weltweite Bekanntheit erlangte er mit seiner Reportage «Losing Earth», die 2019 als Buch erschien. 2020 folgte der Roman «King Zeno». «Die zweite Schöpfung» wurde für den wichtigsten amerikanischen Preis für Sachbücher zu naturwissenschaftlichen Themen, den PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award, nominiert.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Second Nature: Scenes from a World Remade» bei MCD/Farrar, Straus and Giroux, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2021 by Nathaniel Rich
Liedtexte auf S. 295–296 Copyright © by Shin Kubota
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Getty Images
ISBN 978-3-644-01184-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung Ein seltsamer Sieg – vom Leben in einer menschengemachten Welt
Teil I Tatort
1 Vergiftete Wahrheit – vom Kampf gegen jene, die uns krank machen
2 Das Rätsel der toten Seesterne – über die unbeabsichtigten Folgen unseres Wirkens
3 Unsichtbare Gefahr – ein Gasleck und seine Konsequenzen
Teil II Zeit des Zweifels
4 Die Natur schlägt zurück – ein Hurrikan und das ökologische Monster, das er schuf
5 Hühnchen aus dem Reagenzglas – die Neuerfindung des Essens
6 Aspen rettet den Planeten – wie die reichste Stadt der Welt versucht, den Schnee zurückzuholen
Teil III Wie Götter
7 Taubenapokalypse – die neuen Untoten des Tierreichs
8 Louisiana geht unter – der Versuch einer Rettung
Eine Stadt aus Öl und Gas
Barataria
Die Waldmaschine
9 Die unsterbliche Qualle – von der Suche nach dem ewigen Leben
10 Das grüne Kaninchen – über die Kunst des Unheimlichen
Dank
Editorische Notiz
Für Julian
EinleitungEin seltsamer Sieg – vom Leben in einer menschengemachten Welt
Der Glass Beach bei Fort Bragg ist eine der beliebtesten Attraktionen an der nordkalifornischen Küste. Er zieht mehr Besucher an als die Lost Coast, wo steile Pfade durch Nebelwälder und an Wasserfällen vorbeiführen und einen herrlichen Blick aufs Meer bieten. Am Strand bei Fort Bragg ist viel mehr los als in den Mendocino Coast Botanical Gardens und im Mendocino Headlands State Park. Vom Parkplatz am Glass Beach Drive steigen die Touristen eine steile Treppe zwischen Sandsteinklippen hinunter, um eine schmale Bucht zu fotografieren, in der von der Brandung polierte und rund geschliffene türkisblaue, braune und rubinrote Scherben funkeln. Auf Schildern werden die Besucher – im Sommer an die zweitausend pro Tag – gebeten, keine Glasscherben mitzunehmen, doch die meisten können nicht widerstehen.
2012 führte J.H. «Cass» Forrington, ein pensionierter Schiffskapitän und Besitzer des nahe gelegenen International Sea Glass Museum, in dem mehr als dreitausend vom Strand entwendete Bruchstücke ausgestellt sind, eine Kampagne, den Strand mit mehreren Tonnen Glasscherben «aufzustocken». Forringtons Argumentation war ökologisch begründet. Weil sich das Meerglas, das zum Lebensraum für mikroskopisch kleine Meereslebewesen geworden ist, in das lokale Ökosystem eingefügt habe, müsse es den gleichen Schutz genießen wie die Küstenmammutbäume, das Biberhörnchen oder der Rotbeinfrosch.
Die kalifornische Naturschutzbehörde ist dafür zuständig, «natürliche Lebensräume wegen ihres intrinsischen und ökologischen Werts und ihres Nutzens für den Menschen» zu schützen und zu erhalten. Das Schicksal des Glass Beach hing von der Definition des Begriffs «natürlich» ab. Forrington argumentierte, dass Kalifornien gesetzlich verpflichtet sei, mehr Glas auf den Sand zu kippen. «Die Behauptung, Glas wäre nicht ‹natürlich›, ist schlichtweg falsch», schrieb er in einem Manifest, in dem es von Anführungszeichen wimmelte. «Wegen des Schadens, den wir oft einem gesamten Lebensraum zufügen, neigen wir dazu, uns als irgendwie ‹unnatürlich› zu betrachten, als ‹außerhalb der Natur stehend›, aber wir sind ein integraler Bestandteil der ‹Natur› und können viel Gutes bewirken.»
Das Gute, auf das Forrington sich bezog, geht auf das Jahr 1949 zurück, als der Strand zur Mülldeponie erklärt wurde. Die Unmengen von Glasscherben, die die Bucht übersäten, waren Überreste von Bierflaschen, Rücklichtern und Tupperdosen. In den nächsten beiden Jahrzehnten wurde der Strand von den Einheimischen «die Müllkippe» genannt. Um seine natürliche Schönheit zurückzugewinnen, schrieb Captain Forrington, müsse er Jahr für Jahr unter weiteren Massen von Müll begraben werden.
Letztendlich fand die Naturschutzbehörde Captain Forringtons Definition von «Natur» nicht überzeugend und weigerte sich einzugreifen. Doch so leicht gab sich Forrington nicht geschlagen. Er verkaufte weiterhin Plastiktüten mit Glasscherben an die Touristen, die sie dann die Holztreppe hinunterschleppten und auf dem Sand ausleerten. Captain Forrington glaubte, so seinen Teil zur Rettung der Natur oder wenigstens der «Natur» beizutragen.
Noch lange nachdem das letzte Exemplar der King-James-Bibel sich in seine Bestandteile aufgelöst hat und die Venus von Milo zu Staub zerfallen ist, wird die Pracht unserer Zivilisation in dem unförmigen neonfarbenen Gestein überleben, das man Plastiglomerat nennt: einem Gemisch aus Sand, Muscheln und geschmolzenem Plastik, das entsteht, wo Schokoriegelverpackungen und Kronkorken in Lagerfeuern verbrennen. Weitere Hinweise auf unsere Zivilisation dürften die Allgegenwart von Cäsium-137, dem bei Atomexplosionen freigesetzten synthetischen Isotop, geben, die mehrtausendjährige Abnahme von Kalziumkarbonatablagerungen, eine Folge der Meeresübersäuerung, sowie die dramatische Zunahme atmosphärischen Kohlendioxids in den Gletschereiskernen (falls die Gletscher erhalten bleiben). Künftige Anthropologen können anhand dieser geologischen Marker vielleicht nicht alles über unsere Kultur erfahren, doch es dürfte ein guter Ausgangspunkt sein.
Anfangs betrachtete der Mensch die Natur als seinen Todfeind – begegnete ihr mit Vorsicht, Angst und Aggression. Der Krieg begann, noch bevor wir unserem Feind einen Namen gegeben hatten. Bereits in den frühesten Literaturzeugnissen ist dieser Angriff im Gange, geprägt von roher Kampfeslust, die Gründe dafür werden nicht hinterfragt. In «Gilgamesch und Huwawa» beschließt Gilgamesch aus Angst vor dem Tod, dass er eine Heldentat vollbringen muss, um Unsterblichkeit zu erlangen. Da er sich nichts Ehrenvolleres vorstellen kann, als einen Urwald zu zerstören, reist Gilgamesch zum heiligen Zedernberg, enthauptet den Halbgott, der den Wald schützt, macht alles dem Erdboden gleich und fertigt aus dem stattlichsten Baum ein Tor zu seiner Stadt.
Etwa 1700 Jahre später sagt Sokrates, der nur ungern die Stadtmauern von Athen verlässt, in Platos Phaidros: «Ich bin lernbegierig, und Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt.» Aristoteles ist in Politik direkter: «Wenn nun die Natur nichts unvollendet und nichts nutzlos macht, so muss sie notwendig alles für die Menschen gemacht haben.» Im Alten Testament ist die «Wildnis», die Wüste, ein gottloser Ort, das Anti-Paradies. Wie in: «Er hat dich geleitet durch die große und grausame Wüste, da feurige Schlangen und Skorpione und eitel Dürre und kein Wasser war.»
«Wilderness: aus dem altenglischen -ness + wild + deor, ‹der Ort der wilden Tiere›.» Samuel Johnson definiert sie als ein «Gebiet der Einsamkeit und Rohheit». William Bradford, einer der Gründer der Plymouth-Kolonie, reagierte entsetzt auf die Neue Welt und nannte sie «abscheulich & trostlos … voll wilder Tiere & wilder Menschen». Im am weitesten verbreiteten Werk der Aufklärung, der sechsunddreißigbändigen Naturgeschichte des Comte de Buffon, wimmelt es nur so von Wörtern wie «bizarr», «ekelerregend», «gefährlich», «schrecklich» und «Schmutz».
Die Natur forderte ihre Unterwerfung heraus – zu ihrem eigenen Besten. Diesen Gedanken dehnte der amerikanische Jurist James Kent auch auf die Menschen aus, die jahrtausendelang in Harmonie mit der Natur gelebt hatten, als er eine rechtliche Grundlage dafür zu erstellen versuchte, den indigenen Völkern das Land zu entreißen. Der Kontinent, argumentierte Kent, sei «von der Vorsehung dazu bestimmt, erschlossen, entwickelt und von zivilisierten Völkern bewohnt zu werden». Das Evangelium der Natur war ein Freibrief für ihre Beherrschung, Zerstörung und Ausbeutung – und den Stolz darauf.
Einige dieser Beispiele stammen aus Roderick Nashs ikonischem Geschichtsbuch Wilderness and the American Mind, in dem er schildert, wie im neunzehnten Jahrhundert die Definition der menschlichen Beziehung zur Natur schließlich kippte. Naturwissenschaftler und Philosophen begannen, die Prämisse, dass die Natur eine Bedrohung für die Zivilisation sei, infrage zu stellen. Sie kehrten das Ganze um: Die Zivilisation sei eine Bedrohung für die Natur. Es war nun offensichtlich, dass die Menschheit ihren jahrtausendelangen Krieg gegen die Natur haushoch gewann. Doch es war ein teuer erkaufter Sieg. Der Preis war der Zusammenbruch der Zivilisation.
Diese Auffassung wurde erstmals von Alexander von Humboldt geäußert, der 1769 geboren ist, in einer Zeit, in der die Menschen sich nicht mehr vor der Natur fürchteten und stolz auf ihre Fähigkeit waren, sie zu beherrschen. Es war das Zeitalter der Dampfmaschine, der Pockenimpfung, des Blitzableiters. Zeitmessung und andere Messverfahren wurden standardisiert, die letzten blinden Flecken auf den Weltkarten ausgefüllt. Noch bevor Humboldt seine große Forschungsreise antrat und alles von Windmustern über Wolkenstrukturen und Insektenverhalten bis hin zu Bodeneigenschaften analysierte, erfasste er intuitiv, dass die Erde «ein einziger lebender Organismus» war, in dem alles miteinander verbunden ist. Heutzutage ist es normal, vom «Netz des Lebens» zu sprechen, aber dieses Konzept geht auf Humboldt zurück. Daraus folgte, dass das Schicksal einer einzigen Art vielfältige Auswirkungen auf andere Arten haben konnte. Humboldt war einer der Ersten, die vor den Gefahren von Bewässerung, profitorientierter Landwirtschaft und Waldrodung warnten. Um 1800 war er bereits zu der Erkenntnis gelangt, dass der von der industriellen Zivilisation angerichtete Schaden «unermesslich» war.
Humboldts Erkenntnisse wurden weiterentwickelt von Nachfolgern wie George Perkins Marsh (der davor warnte, dass «klimatischer Exzess» zum Aussterben der Menschheit führen könne), von Charles Darwin (der im letzten, krönenden Absatz von Über die Entstehung der Arten von Humboldt abkupferte), von Ralph Waldo Emerson («die ganze Natur [ist] eine Metapher des menschlichen Bewusstseins») und dem naturverliebten John Muir («Dieses jähe Eintauchen in reine Wildnis – eine Taufe im warmen Herzen der Natur – wie unglaublich glücklich uns das machte!»). Um die Jahrhundertwende begannen die Amerikaner zunehmend, die Wildnis als spirituelle Zuflucht vor der Mechanisierung des modernen Lebens zu betrachten. Der Schrecken hatte sich in Schwärmerei verwandelt.
Doch der romantische Blick auf die Natur erwies sich als kontraproduktiv. Er begünstigte den Schutz von Naturheiligtümern wie Yosemite und Yellowstone, entwertete aber zugleich die Wanderwege in Wäldern, Sümpfen und Grasland, die den größten Teil des Landes ausmachten. Schon bald kamen auch die Heiligtümer in Bedrängnis und fielen politischem Pragmatismus zum Opfer. Theodore Roosevelt und Gifford Pinchot, der erste Leiter der US-Forstverwaltung, verfolgten einen utilitaristischen Ansatz, um sicherzustellen, dass Naturschutzgebiete nicht nur von Wanderern, sondern auch von Ölsuchern genutzt werden konnten. Doch wenn diese Interessen in Konflikt gerieten, unterlagen stets die Naturschützer – am offenkundigsten im Kampf um das Hetch Hetchy Valley in Yosemite, wo 1923 ein Damm gebaut wurde, um San Francisco mit Wasser zu versorgen.
«Das Ingenieurwesen ist eindeutig das Leitbild des Industriezeitalters», schrieb Aldo Leopold, der Vater der Wildökologie, 1938. «Die Ökologie gehört vielleicht zu den Streitern für eine neue Ordnung … Unser Problem besteht darin, das Bewusstsein der beiden Wissenschaftszweige in Einklang zu bringen.» Obwohl die Ökologie weit unterlegen war, machte sie im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts zaghafte Fortschritte. 1970, am ersten Earth Day, hatte sie eine neue politische Bewegung hervorgebracht. Im folgenden Jahrzehnt gelang es der Naturpolitik, ein breiteres Verständnis der Verflechtung ökologischer Bedrohungen zu entwickeln. Die Besorgnis über Luft- und Wasserverschmutzung, Klimawandel, Stadtentwicklung, Rohstoffförderung, Artensterben, Dürre, Flächenbrände und Vermüllung von Straßenrändern wurden unter der Rubrik «Umwelt» zusammengefasst. Deren Definition hat sich inzwischen erweitert und schließt nun auch die Erkenntnis mit ein, dass Umweltbeeinträchtigung, indem sie die Ungleichheiten, die unsere Gesellschaft vergiften, weiter verschärft, die Demokratie selbst beschädigt. Diese Erkenntnis hat den Tod der romantischen Vorstellung eingeläutet, dass die Natur unberührt von menschlichem Einfluss sei. Wir sind nicht länger unschuldig.
Was wir mit unangebrachter Nostalgie noch immer floskelhaft «die Welt der Natur» nennen, ist verschwunden, falls sie je existiert hat. Kaum ein Stein, Blatt oder Kubikmeter Luft ist nicht von unserer ungeschickten Hand gezeichnet. Es ist, wie Diane Ackerman schrieb, «als wären Außerirdische mit Riesenhämmern und Lasermeißeln erschienen und hätten begonnen, die Kontinente umzugestalten. Wir haben die Landschaft in eine neue Art von Architektur verwandelt, haben den Planeten zu unserem Sandkasten gemacht.»
Niemand hat die Ungereimtheiten des Naturideals besser zum Ausdruck gebracht als der Historiker William Cronon in seinem bahnbrechenden Essay «The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature». Cronon teilt weitgehend Captain Forringtons Standpunkt. Die Natur, schreibt er, «ist eine zutiefst menschliche Schöpfung … Wenn wir in den Spiegel schauen, den sie uns vorhält, erliegen wir allzu leicht der Vorstellung, dass wir die Natur betrachten, obwohl wir in Wirklichkeit nur das Abbild unserer eigenen unergründeten Sehnsüchte und Wünsche sehen.» Die idealisierte Wildnis ist ein Mythos und widerspricht den Zielen der Umweltschützer. Denn wenn künftig etwas Wildnisähnliches überleben soll, kann das nur «durch eine sehr aufmerksame und bewusste Steuerung» geschehen.
Die beliebtesten Naturschutzgebiete unterliegen bereits staatlichen Regulierungen, politischen Kompromissen und den ständigen Eingriffen, die beschönigend als «Raumplanung» bezeichnet werden. Sogar die Rewilding-Bewegung, die wohlwollende Vernachlässigung der Natur predigt, damit diese sich in ihrem eigenen Tempo erholen kann, erkennt die Notwendigkeit an, sich einzumischen. In Wilding, Isabella Trees Bericht über die Verwandlung ihres englischen Anwesens in ein Naturrefugium, werden das Anbringen von Stacheldraht, die Einfuhr von Langhornrindern und eingefangenen Hirschen und die großzügige Verwendung von Glyphosat beschrieben. Das ehrgeizigste Renaturierungsprojekt, der von dem Biologen Edward O. Wilson in seinem Buch Die Hälfte der Erde dargelegte Vorschlag, die Hälfte des Planeten unter Naturschutz zu stellen, basiert auf der Aussage, dass wir – in Anlehnung an Descartes’ «Herrscher und Besitzer der Natur» – «Architekten und Beherrscher des Anthropozäns» sind und dafür Verantwortung übernehmen müssen. Für die Schaffung einer unter Naturschutz stehenden Hälfte der Erde bräuchte man letztlich politische Verträge, Steuern und Armeen.
Wir haben Aldo Leopolds Anweisung befolgt, «ein paar Überreste der Wildnis als Museumsstücke zur Erbauung derjenigen [zu bewahren], die die Ursprünge ihres kulturellen Erbes irgendwann gern sehen, anfassen oder erforschen würden». Wir waren erfolgreich – auf verheerende Weise. Wir haben die Überreste, aber sonst kaum etwas. Eine der grundlegenden Erkenntnisse der Ökologie ist, dass isolierte Flecken Wildnis todgeweiht sind.
Ingenieur und Ökologe sind schon von Anfang an verfeindet. Seit seinen Anfängen im achtzehnten Jahrhundert hat das Bauingenieurwesen versucht, einen widerspenstigen Planeten gefügig zu machen – ungünstige Neigungen und Winkel einzuebnen, zerklüftetes Gelände vereinfacht in einem ebenen Gitter darzustellen, Chaos zu ordnen. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich ein Wandel vollzogen. Ingenieure haben Gebäude entworfen, die wie Berge geformt sind, um Emissionen zu verringern, Windturbinen, die Walflossen nachempfunden sind, um ihre Effizienz zu vergrößern, Ziegelsteine aus Bakterien, die Kohlendioxid aufnehmen. Es ist ihnen gelungen, die Natur stärker zu kontrollieren, indem sie sie nachahmen.
Umweltschützer haben unterdessen akzeptiert, dass ein bedrohtes Ökosystem, wie jeder Patient in kritischem Zustand, auf eine ständig eingreifende Pflege angewiesen ist.
Zwei zusammenhängende Beobachtungen des Romanciers William Gibson schildern das nächste Kapitel dieser Geschichte. Die erste ist längst zu einer Plattitüde geworden: «Die Zukunft ist bereits da – sie ist bloß nicht gleichmäßig verteilt.» Bei der anderen geht es um «die Verspätung der Seele», die Vorstellung, dass der menschliche Körper auf Langstreckenflügen schneller reist als der Geist: «Die Seelen können sich nicht so schnell bewegen, sie bleiben zurück, und bei der Ankunft muss man auf sie warten wie auf verlorengegangenes Gepäck.» Das unangenehme Gefühl, auf die Ankunft der eigenen Seele warten zu müssen, nennen wir Jetlag.
Mit der Natur ist es nicht anders. Die Zukunft ist bereits da, ungleichmäßig verteilt. Wir erkennen die Anzeichen: steigende Meeresspiegel, regelmäßige Heimsuchungen durch apokalyptische Naturkatastrophen, die erzwungene Migration von Millionen von Menschen, das beschleunigte Aussterben von Tierarten, die Korallenbleiche und weltweite Pandemien. Hinzu kommen In-vitro-Fleisch, umgeformte Küstenlinien, die Neubelebung ausgestorbener Arten, grün leuchtende Kaninchen. Unsere Seelen kommen da nicht mehr mit.
Auch in der denkbar optimistischsten Zukunft werden wir unsere Fauna und Flora und unsere Genome tiefgreifend umgestalten. Die Ergebnisse werden unheimlich sein. Es wird uns schwerfallen, uns vor Augen zu halten, dass die Bepflanzung des amerikanischen Südwestens mit üppigem von der Mittelmeerküste importierten Rasen, die Brustvergrößerung bei Hühnern oder die Bändigung der reißendsten Flüsse der Welt ebenso unheimlich sind. Wenn unsere Erfindungen beängstigend sind, so liegt das nur daran, dass wir darin ein Spiegelbild unserer Wünsche sehen. Es ist unmöglich, alles, was wir «natürlich» nennen, vor den Verheerungen des Klimawandels, vor Verschmutzung und psychopathischer Profitgier zu schützen, wenn wir nicht verstehen, dass die Natur, deren Verlust wir fürchten, unsere eigene ist.
Die Natur bewahren bedeutet unsere Identität bewahren: alles Schöne und Freie und Heilige an uns, das wir in die Zukunft mitnehmen wollen. Wenn wir diesen verletzlichen Teil unserer selbst nicht verteidigen, bleiben uns nur Hologramm-Bilder unserer schlimmsten Triebe, Roboter, die unsere Albträume verkörpern, und wir driften langsam in eine Wüste von biblischen Dimensionen: ein Gebiet der Einsamkeit und Rohheit.
Im Folgenden erzähle ich Geschichten von Menschen, die sich schwierige Fragen darüber stellen, was es bedeutet, in einer Zeit schrecklicher Verantwortung zu leben. Im ersten Teil, «Tatort», untersucht eine Reihe von Amateurdetektiven Verbrechen an der Natur. Konfrontiert mit den schlimmsten Vergehen der Menschheit, fragen sie: Wie konnte es so weit kommen?
In den Geschichten in «Zeit des Zweifels» geht es um Menschen, deren grundlegendes Verständnis der physischen Welt durch eine neue Realität auf den Kopf gestellt wird. Wenn unser Land, unsere Nahrung und unser Klima mit dem, was wir kannten, keine Ähnlichkeit mehr haben, wie sollen wir dann verhindern, dass wir auch unsere Menschlichkeit verlieren?
«Wir sind wie Götter, warum sollten wir dann nicht auch gut darin werden?», schrieb Stewart Brand im Whole Earth Catalog. Später korrigierte er das: «Wir sind wie Götter und MÜSSEN gut darin werden.» Wir wissen, wie es aussieht, schlecht darin zu sein. Margaret Atwoods MaddAddam-Trilogie, die Filme von Alex Garland, Edward Burtynskys großformatige Fotos von Industriebrachen, die Petrischalen-Kunst von Suzanne Anker und die Biografien von monomanischen Milliardären in Brunello-Cucinelli-T-Shirts verschaffen uns einen Eindruck davon. Die Angst des Umweltschützers vor technologischen Lösungen hat nicht so viel mit der Technologie selbst zu tun, sondern mehr mit den Leuten, die sie nutzen. «Technologie ist neutral», schreibt Roderick Nash. «Das Problem ist, wie sie genutzt wird.» Weil wir keine Götter, sondern von Angst und Selbstüberschätzung geplagte Primaten sind, endet es gewöhnlich blamabel, wenn wir uns als Gottheiten sehen. In «Wie Götter» versuchen Künstler und Ingenieure, eine menschlichere Zukunft zu schaffen, und haben dabei mit unbeabsichtigten Folgen, moralischen Sackgassen und ihrer eigenen Eitelkeit zu kämpfen.
Die Entwicklung unserer Epoche – dieses Zeitalters der Seelenverspätung – verläuft von Naivität über Schock, Schrecken und Wut zu Entschlossenheit. Es gibt niemanden, der diesen Wandel besser verkörpert als Robert Bilott, ein Firmenanwalt, der als ein Mensch von DuPonts Amerika begann und zu einem Menschen der Zukunft wurde.
Teil ITatort
1Vergiftete Wahrheit – vom Kampf gegen jene, die uns krank machen
Wenige Monate bevor Robert Bilott bei Taft Stettinus & Hollister Teilhaber wurde, erhielt er einen Anruf von einem Farmer in Parkersburg, West Virginia. Wilbur Tennant sagte, dass seine Rinder wie die Fliegen sterben. Er war überzeugt, dass der Chemiekonzern DuPont, der in Parkersburg einen Standort hatte, der mehr als fünfunddreißigmal so groß war wie das Pentagon, dafür die Verantwortung trug. Tennant beklagte sich, er habe vor Ort versucht, etwas zu erreichen, doch die gesamte Stadt sei im Besitz von DuPont. Er sei in Parkersburg nicht nur von Anwälten, sondern auch von Politikern, Journalisten und Ärzten ignoriert worden. Bilott wurde aus der Sache einfach nicht schlau. Tennant war nicht leicht zu verstehen: Er sprach im Singsang eines Bergbewohners und war obendrein völlig aufgebracht. Bilott konnte sich nicht erklären, wie der Farmer an seine Telefonnummer gekommen war, und hätte vermutlich aufgelegt, wäre Tennant nicht mit dem Namen von Bilotts Großmutter herausgeplatzt.
Alma Holland White hatte in Vienna gelebt, einem nördlichen Vorort von Parkersburg, wo Bilott sie in den Sommern seiner Kindheit besucht hatte. 1973 hatte sie ihn an einem Wochenende zur Farm der befreundeten Familie Graham mitgenommen, die neben den Tennants wohnte. Bilott durfte reiten, Kühe melken und sah im Fernsehen, wie Secretariat die Triple Crown des Pferderennsports gewann. Das war eine von Bilotts schönsten Erinnerungen an eine unstete, unvorhersehbare Kindheit. Damals war er sieben gewesen.
Als die Grahams 1998 erfuhren, dass Wilbur Tennant einen Anwalt für Umweltrecht suchte, fiel ihnen ein, dass der Enkel ihrer Freundin inzwischen einer war. Ihnen war nicht klar, dass Bilott die falsche Art Umweltjurist war. Er vertrat keine Kläger oder Privatpersonen. Wie die anderen zweihundert Anwälte bei Taft, einer 1885 gegründeten Kanzlei mit engen Verbindungen zur Familie von Präsident William Howard Taft, die mehr als ein Jahrhundert lang die führende republikanische Dynastie in Ohio war, war Bilott Verteidiger. Er verteidigte Chemieunternehmen. Die Anwälte von DuPont waren seine Kollegen. Er achtete die Unternehmenskultur von DuPont. Der Konzern hatte das Geld, die Kompetenz und den Stolz, die Dinge richtig anzugehen. Dass die Firma rücksichtslos das Land eines armen Farmers vergiftet haben sollte, fand Billot deshalb nicht nur beispiellos, sondern auch absurd. Dennoch willigte er ein, sich mit dem Farmer zu treffen. Seinen Kollegen erzählte er, das tue er aus Loyalität zu seiner Großmutter. Doch es war auch aus Loyalität zu einem vergessenen Teil seiner selbst.
Eine Woche später kam Wilbur Tennant – stämmig, eins achtzig groß, Jeans, kariertes Flanellhemd, Baseballkappe – mit seiner Frau Sandra in die Zentrale von Taft in Cincinnati. Die Tennants schleppten Kartons, randvoll mit Videobändern, Fotos und Dokumenten, in den verglasten Empfangsbereich der Kanzlei im siebzehnten Stock. Man brachte sie in ein Wartezimmer, wo sie auf modernen grauen Midcentury-Sofas unter dem Ölporträt eines der Kanzleigründer saßen. Bilotts Vorgesetzter, ein Teilhaber namens Thomas Terp, nahm aus Neugier selbst an dem Treffen teil. Tennant war schließlich kein typischer Taft-Mandant. «Ich will es mal so formulieren», sagte Terp Jahre später. «Als er in unsere Kanzlei kam, sah er nicht gerade aus wie der Vizepräsident einer Bank.»
Wilbur Tennant erzählte, dass er und seine vier Geschwister den Hof führten, seit ihr Vater sie als Kinder verlassen hatte. Damals hatten sie nur über sieben Kühe, zweihundert Hühner und eine Hypothek von 1500 Dollar verfügt. Um zu überleben, mussten sie in den Hügeln nach Wurzeln und Beeren suchen. Im Lauf der Zeit hatten sie jedoch immer mehr Land und Vieh hinzugekauft und jeden Dollar, den sie verdienten, wieder in die Farm gesteckt, bis sie zweihundert Kühe besaßen, die auf rund 250 Hektar hügeligem Land weideten. Ihr Grundbesitz wäre sogar noch größer gewesen, hätten Wilburs Bruder Jim und dessen Frau Della Anfang der Achtzigerjahre nicht 25 Hektar an DuPont verkauft. Das Unternehmen wollte eine Mülldeponie für Washington Works errichten, seine Plastikfabrik in der Nähe von Parkersburg, wo Jim als ungelernter Arbeiter Gräben aushob, Beton goss und Abfälle entsorgte. Manager waren in einer Limousine vorgefahren und hatten ihm ein Angebot gemacht. Die Tennants wollten nicht verkaufen, doch Jim war schon seit Jahren krank gewesen, er hatte eine rätselhafte Krankheit, die seine Ärzte nicht einordnen konnten, und die Familie brauchte das Geld.
DuPont nannte das Stück Land nach dem Bach, der hindurchfloss, Dry-Run-Deponie. Der Dry Run Creek floss zu einer Weide, auf der die Kühe der Tennants grasten. Schon bald nach dem Verkauf gebärdeten sich die Rinder, als wären sie geisteskrank. Für die Tennants waren sie immer wie Haustiere, ja geradezu Familienmitglieder gewesen. Sobald sie einen der Tennants erblickten, kamen sie angetrottet, stupsten ihn mit der Schnauze an und ließen sich melken. Das war nun vorbei. Sie sabberten unkontrolliert. Sie brachten tote Kälber zur Welt. Ihre Zähne verfärbten sich schwarz. Ihre geröteten Augen bekamen einen finsteren, mordlüsternen Blick. Wenn sie die Farmer sahen, griffen sie an. Nachdem Della mit ihren Töchtern eine Kuh im Todeskampf vorgefunden hatte, die «das schrecklichste Gebrüll von sich gab, das wir je gehört hatten, während ihr das Blut aus Nase, Maul und Rektum strömte», weigerte sie sich, das Land ohne geladene Schusswaffe zu betreten. Drei Viertel der Herde waren gestorben.
Es waren nicht nur die Rinder: Es gab Unmengen toter Fische, Frösche, Katzen, Hunde und Hirsche. Die Hirsche starben einen seltsamen Tod. Sie sanken in Gruppen zu Boden, wie Mitglieder einer Selbstmordsekte. Die Tennants hörten auf, ihr Fleisch zu essen, nachdem Jim beim Ausnehmen eines Bocks feststellte, dass seine Innereien leuchtend grün waren.
Bei Taft brachte man einen Videorecorder in einen fensterlosen Konferenzsaal, und Wilbur legte eine seiner Kassetten ein. Die mit einer Handkamera gefilmten Aufnahmen waren körnig und verrauscht. Die Bilder wackelten und wiederholten sich. Der Ton lief mal schneller, mal langsamer. Alles hatte den Rhythmus und Stil eines Horrorfilms.
In der Anfangssequenz schwenkte die Kamera über den Bach, filmte den umliegenden Wald, die weißen, ihr Laub abwerfenden Eschen und das seicht dahinsickernde Wasser und hielt dann auf etwas, das wie eine Schneewehe an einer Biegung des Baches aussah. Die Kamera zoomte näher heran und zeigte einen Berg seifenartigen Schaum.
«Ich habe zwei tote Hirsche und zwei tote Rinder aus diesem Bach gezogen», sagte Wilbur aus dem Off. «Das Blut lief ihnen aus Nase und Maul. Sie versuchen, die Sache zu vertuschen. Aber das wird nicht klappen, denn ich bringe es ans Licht, damit alle es sehen.»
Die Kamera folgte einem großen, in den Bach mündenden Rohr, aus dem grüne Blasen kamen. «Das hier sollen meine Kühe auf meinem eigenen Grund und Boden saufen», sagte Wilbur. «Es ist höchste Zeit, dass man im zuständigen Ministerium mal in die Gänge kommt.»
Das Video sprang zu einer mageren, roten Kuh im Heu mit kahlen Flecken und gekrümmtem Rücken – Nierenversagen, vermutete Wilbur. Auf eine weitere Bildstörung folgte ein totes schwarzes Kalb, das im Schnee zusammengebrochen war. Sein Auge funkelte in leuchtendem Methylenblau. «Auf dieser Farm habe ich 153 Tiere verloren», sagte Wilbur. «Die Tierärzte in Parkersburg, die ich angerufen habe, rufen entweder nicht zurück oder wollen nichts mit der Sache zu tun haben.» Er seufzte. «Da sie nichts damit zu tun haben wollen, muss ich das hier selbst auseinandernehmen. Mit diesem Kopf hier fange ich an.»
Das Video setzte kurz aus. Danach war eine Großaufnahme des aufgeschnittenen Kalbskopfes auf dem Schnee zu sehen. Es folgten Bilder der schwarzen Zähne des Tieres, seiner sezierten Leber, von Herz, Magen, Nieren und Gallenblase. Wilbur wies auf ungewöhnliches Gewebe und Verfärbungen hin. «Das gefällt mir gar nicht», sagte er. «So was habe ich noch nie gesehen.»
Tennant erzählte Bilott, dass er Organe in seiner Tiefkühltruhe aufbewahrte, in der Hoffnung, sie könnten irgendwann in einem Labor untersucht werden. Er hatte riesige Tumore, zusammengefallene Venen, grüne Muskeln entdeckt. Was er nicht aufbewahrte, verbrannte er. Wenn es nachts regnete, funkelten die Rinderknochen im Dunkeln wie Leuchtstäbe.
Bilott sprach mehrere Stunden lang mit den Tennants, schaute sich Videos an und betrachtete Fotos. Er sah Rinder mit verklebten Schwänzen, missgebildeten Hufen, riesigen klaffenden Wunden und roten eingesunkenen Augen, Rinder, die an permanentem Durchfall litten, einen triefenden weißen Schleim sabberten, der die Konsistenz von Zahnpasta hatte, und krummbeinig umherwankten, als wären sie betrunken. Wilbur zoomte jedes Mal auf ihre Augen. «Diese Kuh hat so sehr gelitten», sagte er dann mit vor Entsetzen belegter Stimme, während das blinzelnde Auge auf die Größe der Leinwand wuchs.
Bilott wusste nicht, was er sagen sollte. Das ist schlimm, dachte er. Da passiert etwas wirklich Schlimmes.
Bilott erklärte sich unverzüglich bereit, den Fall Tennant zu übernehmen. Er hatte das Gefühl, dass es «das Richtige» war. Das hieß jedoch nicht, dass er dachte, seine vorherige Arbeit für Taft, bei der er Chemiekonzerne vertrat, sei falsch gewesen. Ehrlich gesagt, hatte er noch nie wirklich aus ethischer Perspektive über seinen Beruf nachgedacht.
Bilott sprach bedächtig, leise, mit der Abneigung eines Anwalts gegen unqualifizierte Bemerkungen. In seinen Augenwinkeln lag eine gewisse Anspannung. Er gab sich große Mühe, die ungeheure Energie hinter seiner äußeren Gelassenheit zu verbergen, doch gelegentlich, wenn er von einem Unrecht sprach, das ihm oder einem seiner Mandanten angetan worden war, sah man in seinem Gesichtsausdruck oder einem finsteren Blick eine innere Wut aufblitzen. Mit seiner sanften Stimme, dem milchig weißen Teint, dem an den Schläfen ergrauten, mustergültig gekämmten Haar und dem strengen Dresscode aus unscheinbaren Krawatten und säuberlich gebügelten dunklen Anzügen spielte Bilott seine Rolle als austauschbarer Firmenanwalt sehr überzeugend. Doch es war eine Rolle – er hatte sie einstudieren, proben und perfektionieren müssen. Anders als die meisten seiner Kollegen bei Taft hatte er keine Universität oder juristische Fakultät der Ivy League besucht. Er war weder Mitglied des Camargo Clubs noch des Kenwood Country Clubs und kannte auch nicht den Unterschied zwischen beiden. Sein Vater war Oberstleutnant der Luftwaffe gewesen, und Bilott hatte den größten Teil seiner Kindheit auf Militärbasen in der Nähe von Albany, New York, Flint in Michigan, Newport Beach in Kalifornien oder Wiesbaden in Westdeutschland verbracht. Er hatte acht verschiedene Schulen besucht, bevor er an der Fairborn High, unweit der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio, seinen Abschluss machte. Im vorletzten Schuljahr erhielt er die Zusage des New College of Florida, eines kleinen geisteswissenschaftlichen Colleges in Sarasota, das auf Noten verzichtete und den Studenten ermöglichte, ihren eigenen Studienplan zu erstellen. Das klang gut. Die Leute, die er in Sarasota kennenlernte, waren idealistisch und progressiv – ideologische Außenseiter im Amerika Ronald Reagans. Er traf sich zu Einzelgesprächen mit seinen Professoren, die betonten, wie wertvoll kritisches Denken sei. Er lernte, alles, was er las, infrage zu stellen, nicht alles für bare Münze zu nehmen, die Ansichten der anderen nicht zu beachten. Diese Philosophie bestätigte seine grundlegende Weltsicht und gab ihm die Sprache, um sie zum Ausdruck zu bringen. Bilott studierte Politikwissenschaft und schrieb seine Dissertation über den Aufstieg und Fall von Dayton. Er wollte Stadtdirektor werden.
Doch sein Vater, der spät im Leben noch Jura studiert hatte, ermunterte Bilott, das Gleiche zu tun. Zur Überraschung seiner Professoren stieg Bilott aus dem Promotionsprogramm in öffentlicher Verwaltung aus, um ein Jurastudium an der Ohio State University zu beginnen. Sein Lieblingskurs war Umweltrecht. Es war der einzige Bereich, in dem er das Gefühl hatte, «etwas bewirken zu können». Als er ein Angebot von Taft annahm, waren seine Mentoren und Freunde vom New College entsetzt. Sie warfen ihm vor, er sei käuflich. Doch Bilott sah es anders. Er wollte nur den besten Job annehmen, den er bekommen konnte. Er kannte niemanden, der als Firmenanwalt gearbeitet hatte, aber sein Vater sagte, je größer und wohlhabender eine Kanzlei sei, umso mehr Möglichkeiten würde er haben. Auch wenn Bilott sich keine großen Gedanken machte, leuchtete ihm das ein.
Bei Taft schloss er sich freiwillig Thomas Terps Umweltteam an. Es war, wie er vermutet hatte, eine Zeit, die große Chancen für Umweltjuristen bot. Zehn Jahre zuvor hatte der Kongress ein Gesetz erlassen, das als «Superfund» bekannt war und die Notfallsanierung von Sondermülldeponien finanzierte. Superfund brachte im Umweltrecht eine ganze Teildisziplin hervor, die ein tiefes Verständnis der neuen Vorschriften erforderte, um Verhandlungen zwischen Staat und Privatunternehmen führen zu können. Das war für Taft ein lukrativer Geschäftszweig, wenn auch nicht besonders verlockend für neue Mitarbeiter – mit Ausnahme von Rob Bilott.
Bilott sollte ermitteln, welche Unternehmen welche Giftstoffe und Sonderabfälle in welcher Menge auf welchen Deponien abluden. Er nahm Aussagen von Fabrikarbeitern auf, suchte in Archiven und stellte Unmengen historischer Daten zusammen. Er wurde ein Experte für den Regulierungsrahmen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, kurz EPA), für das Gesetz über sicheres Trinkwasser, das Gesetz über saubere Luft, das Giftstoffüberwachungsgesetz. Er prägte sich die chemischen Zusammensetzungen der Schadstoffe ein, obwohl Chemie an der Highschool sein schlechtestes Fach gewesen war. Er lernte, wie die Firmen mit Sondermüll umgingen, wie die Gesetze angewendet wurden und wie man seine Mandanten schützte. Er wurde ein echter Kenner der Materie.
Bilott war stolz auf seine Arbeit. Er glaubte, dass die meisten seiner Mandanten das Richtige tun wollten. Seine Aufgabe war es, ihnen dabei zu helfen. Er machte oft Überstunden, und einige seiner Kollegen machten sich Sorgen um ihn. Augenscheinlich kannte er nur wenige Leute in Cincinnati und nahm sich nicht die Zeit, jemanden kennenzulernen. Eine Kollegin aus Terps Umweltteam erklärte sich bereit, ihn mit einer Kindheitsfreundin namens Sarah Barlage bekannt zu machen. Auch Sarah war Anwältin, bei einer anderen Kanzlei im Stadtzentrum, wo sie Firmen gegen Schadenersatzforderungen von Angestellten vertrat. Bilott traf sich mit den beiden Freundinnen zum Mittagessen in Arnold’s Bar and Grill, dem ältesten Lokal in Cincinnatis Innenstadt. Jahre später konnte Sarah sich nicht erinnern, dass Bilott damals auch nur einmal den Mund aufgemacht hätte. Sie hatte sofort den Eindruck, dass er «anders war als die anderen Anwälte». Ihr machte seine Schweigsamkeit nichts aus, denn sie war ein gesprächiger Mensch und fand, dass sie sich gut ergänzten. Auch bei ihrer ersten Verabredung redete er nicht viel, denn sie gingen ins Kino und schauten sich Kap der Angst an. Später gestanden sie sich, dass sie eigentlich nur ungern ins Kino gingen. 1996 heirateten sie.
Zwei Jahre später kam der erste ihrer drei Söhne zur Welt. Bilott fühlte sich in seiner Stelle bei Taft so sicher, dass Barlage ihre Stelle aufgeben und sich ganz der Erziehung der Kinder widmen konnte. Sein Vorgesetzter Terp hatte ihn aus jener Zeit als «unglaublich intelligent, energiegeladen, hartnäckig und sehr, sehr sorgfältig» in Erinnerung. Er war ein mustergültiger Taft-Anwalt. Eine Teilhaberschaft stand kurz bevor.
Doch dann rief Wilbur Tennant an.
Der Fall Tennant brachte Taft in eine äußerst ungewöhnliche Lage. Es war unangenehm, sich mit DuPont anzulegen, aber Thomas Terp ging davon aus, dass der Konflikt schnell beigelegt sein würde. Er verteidigte Bilott gegen besorgte Kollegen und erklärte, dass die Übernahme der Einzelklage Taft zu einer besseren Firmenkanzlei mache, wie wenn ein Fotograf selbst für ein Porträt posiert oder ein Geschäftsführer eine Schicht am Fließband übernimmt. Das sei die Taft-Methode, sagte er, doch Bilotts Kollegen waren skeptisch.
Um in West Virginia Klage erheben zu können, brauchte Bilott einen dort ansässigen Anwalt. Er wandte sich an Larry Winter, einen Anwalt für Personenschäden, der im Umgang mit Menschen ganz anders als er selbst war – redselig, charmant, locker –, aber ebenfalls wusste, wie Riesenkonzerne funktionierten. Winter hatte selbst jahrelang als Anwalt für DuPont gearbeitet – als Teilhaber bei Spilman Thomas & Battle, die DuPont in West Virginia vertraten. Er war verblüfft, dass Bilott DuPont verklagte und trotzdem bei Taft blieb – «Unfassbar», sagte er –, freute sich aber, an dem Fall mitwirken zu können.
Bilott tat für die Tennants, was er auch für jeden Firmenmandanten getan hätte. Er nahm Genehmigungen in Augenschein, studierte Grundstücksverträge und forderte alle Unterlagen an, die mit der Dry-Run-Deponie zusammenhingen, einschließlich der Chemikalien, die DuPont dort entsorgte. Im Sommer 1999 reichten Bilott und Winter im Southern District of West Virginia offiziell eine Bundesklage gegen DuPont ein. Darin warfen sie dem Unternehmen vor, es habe gegen die Genehmigungen verstoßen und den Grund und Boden der Tennants verseucht. Noch in derselben Woche erhielt Bilott einen Anruf von DuPonts Syndikus Bernard Reilly.
Es schien eine glückliche Fügung zu sein: Bilott kannte Reilly seit Jahren und bewunderte ihn. Reilly sprach auf onkelhafte Art mit ihm, wie ein älterer Kollege oder ein Mitglied seines Clubs. Reilly sagte, er wolle dem jungen Anwalt in der Angelegenheit seiner Großmutter wirklich helfen. Und er habe eine gute Nachricht: DuPont habe bereits zu nicht unerheblichen Kosten eine eigene Untersuchung der Deponie eingeleitet, in Kooperation mit der EPA. Sechs Tierärzte – drei von DuPont ausgewählt und drei von der Behörde – würden die Ursache der Probleme mit den Rindern ermitteln. Bilott, überzeugt, dass eine Lösung bevorstand, willigte ein, auf die Ergebnisse zu warten, bevor er weitere Unterlagen anforderte. Reilly sagte, es werde ein paar Wochen dauern.
Es dauerte sechs Monate. Die Tierärzte kamen zu dem Schluss, dass DuPont für den Tod der Rinder keine Verantwortung trug. Trotz gründlicher Tests am Bach hatten sie «keine Anhaltspunkte für Giftstoffe» entdeckt. Verantwortlich sei stattdessen schlechte Viehhaltung: «falsche Ernährung, unzureichende tierärztliche Versorgung und mangelnde Fliegenbekämpfung». Die Tennants kannten sich angeblich nicht mit Viehhaltung aus. Wenn die Kühe starben, sei das ihre eigene Schuld.
Das gefiel den Tennants gar nicht, zumal sie unter den Folgen ihres Widerstands gegen den größten Arbeitgeber von Parkersburg zu leiden begannen. Sie beklagten sich bei Bilott, dass Männer in Pick-ups vor ihrem Grundstück parkten und sie fotografierten. Als sie eines Tages vom Kirchgang nach Hause kamen, waren ihre Akten im ganzen Zimmer verstreut. Hubschrauber flogen so niedrig über ihre Häuser hinweg, dass die Bilderrahmen von den Wänden fielen. Alte Freunde ignorierten die Tennants auf der Straße oder verließen das Restaurant, wenn sie es betraten. Darauf angesprochen, sagten sie zu ihnen: «Ich darf nicht mit euch reden», weil es selbstverständlich war, dass DuPonts Anweisungen in Parkersburg genauso bindend waren wie das Wort Gottes. Die Tennants wechselten viermal die Kirchengemeinde. Wilbur Tennant, dessen Gefriertruhe randvoll mit Rinderorganen war, wurde immer paranoider. «Er war zum Mord bereit», sagte Della. Wenn die Hubschrauber über ihnen dröhnten, stand er mit seinem Kaliber-25-06-Gewehr neben seinem Pick-up und brüllte den Himmel an.
Die Tennants riefen fast jeden Tag im Büro an, doch Bilott hatte ihnen nur wenig zu sagen. Er konnte es ihnen nicht übel nehmen, dass sie wütend waren. Auch er war wütend. Das Gutachten war, wie er viel zu spät begriff, bloß eine Verzögerungstaktik, noch dazu eine erfolgreiche, und sie kostete ihn mehr als sechs Monate Arbeit. Er bat den Richter, den Prozess zu verschieben. Er brauchte Zeit, um nach Dokumenten zu suchen, die erklärten, was die Seuche auf der Farm der Tennants ausgelöst hatte.
Nach dem Gutachten übergab DuPont den Fall an Spilman, die Kanzlei in West Virginia, in der Larry Winter Teilhaber gewesen war. Das schien eine Chance zu sein. Winter unterhielt noch freundschaftliche Beziehungen zu seinen früheren Kollegen. Sie ließen ihm bedenkenlos die internen Aufzeichnungen von DuPont zukommen. Bilott machte es sich zur Aufgabe, jedes Dokument – Korrespondenz mit der Regulierungsbehörde, Genehmigungsanträge, Grundstücksverträge – persönlich zu prüfen, konnte aber nichts entdecken, was dem Gutachten widersprach. Als er um mehr Informationen bat, um Akten, die mit den in Washington Works verwendeten Chemikalien zusammenhingen, reagierten die Spilman-Anwälte nicht mehr so freundlich. Sie hörten auf zu kooperieren, und wann immer sie etwas verzögern konnten, taten sie es. Doch erst als Bernard Reilly, der den Fall nach Bilotts Einschätzung schon vor Monaten abgegeben hatte, Bilotts Chef anrief, um sich zu beklagen, und ihn aufforderte, «mit der ganzen unnötigen Ermittlung» aufzuhören, begriff Bilott, dass er auf der richtigen Spur war. Im August 2000, nachdem er auf seiner Schatzsuche mehr als 60000 Dokumente überprüft hatte, entdeckte er es.
Er fand es in einem Brief, den DuPont knapp zwei Monate vorher an die EPA geschickt hatte. Der Verfasser, ein Direktor für «Angewandte Toxikologie und Gesundheit», nahm Bezug auf eine Blutserum-Studie bei Angestellten in Washington Works. Gegenstand der Studie war eine Chemikalie mit kryptischem Namen: Ammoniumperfluoroctanoat oder APFO. In all den Jahren, in denen Bilott mit Chemiekonzernen zusammengearbeitet hatte, war ihm APFO noch nie untergekommen. Es tauchte weder auf einer Liste regulierter Stoffe auf, noch konnte er es in Tafts hauseigener Bibliothek mit den vielen Chemielexika und umfassenden Datenbanken über Gefahrenstoffe entdecken. Doch ein bei Taft beschäftigter Chemie-Experte konnte sich vage an den Artikel einer Fachzeitschrift über eine ähnlich klingende Verbindung erinnern: Perfluoroctansulfonat, ein seifenartiger Wirkstoff, der vom Technologiekonzern 3M bei der Herstellung von Scotchgard verwendet wurde. Vor zwei Monaten – kurz vor dem Brief an die EPA – hatte 3M angekündigt, ihn nicht mehr herzustellen.
Bilott forderte die Herausgabe aller Unterlagen im Besitz von DuPont, die etwas mit dem Stoff zu tun hatten. Das Unternehmen weigerte sich. Bilott beantragte eine gerichtliche Anordnung, um die Herausgabe zu erzwingen. Daraufhin trafen in der Zentrale von Taft Dutzende von Kartons mit ungeordneten Akten ein: interne Korrespondenz, ärztliche Gutachten, vertrauliche Studien. Sie kamen palettenweise, insgesamt mehr als 100000 Seiten, manche ein halbes Jahrhundert alt. Das war eine Strategie, die in Anwaltskreisen «jemanden unter Papieren begraben» genannt wurde, doch für Bilott war es das reinste Geschenk. In den nächsten Monaten saß er auf dem Boden seines Büros, studierte die Dokumente und ordnete sie chronologisch. Er verzichtete auf seine Mittagspausen und ging nicht mehr ans Telefon. Seine Sekretärin erklärte den Anrufern, Mr. Bilott könne sein Telefon nicht rechtzeitig erreichen, da er von Kartons umzingelt sei. Allmählich hatte Bilott das Gefühl, dass er der Erste war, der die ganzen Akten je durchging. Zumindest wurde ersichtlich, dass niemand bei DuPont oder Spilman sich die Mühe gemacht hatte, die Unterlagen, die sie ihm schickten, zu überprüfen. Wie er es später ausdrückte: «Ich begann, eine Geschichte zu erkennen.»
Bilott neigte zu Tiefstapelei. («Zu sagen, dass Rob Bilott ein Tiefstapler ist», sagte sein Kollege Edison Hill, «ist Tiefstapelei.») Die Geschichte, die Bilott zu erkennen begann, während er im Schneidersitz auf dem Boden seines Büros saß, wäre eine Tragödie gewesen, wenn sie eine Form von Katharsis geboten hätte. Ihr Umfang, ihre Detailliertheit und ihre krasse Unverschämtheit waren verblüffend. Bilott sagte, er sei schockiert gewesen, doch auch das war Tiefstapelei. Er fand die Masse des Belastungsmaterials, das DuPont ihm geliefert hatte, einfach unglaublich. «Es war einer dieser Momente, in denen man beim Lesen seinen Augen nicht trauen kann», sagte er. «Dass das Ganze tatsächlich schriftlich festgehalten war. Es war etwas, wovon man ständig hört, aber nie erwartet hätte, es schwarz auf weiß vor sich zu sehen.»
An der Hochwassermauer im Point Park, am Ufer des Ohio ein paar Kilometer flussaufwärts von Washington Works, steht in großen weißen Buchstaben:
Willkommen in Parkersburg, W.V.
«Lasst uns Freunde sein.»
Vor Kurzem hatte jemand die zweite Zeile übertüncht. «Diese Verschandelung [der Hochwassermauer] widert mich an», schrieb ein Einwohner an den Redaktionsleiter. «Ich hoffe aufrichtig, dass der Vandalismus bald behoben wird.»
Die Bewohner von Parkersburg und den benachbarten Städten haben seltsame Erinnerungen an das Wasser. Sandra Follett weiß noch, dass sie als Jugendliche an Sommerabenden mit ihren Freunden zu einem warmen Teich auf dem Gelände von DuPont schlich, der von zweiköpfigen Fröschen bevölkert war. Die Jungen fingen die kleinen Monster, die Mädchen kreischten, und die Paare knutschten zum Klang der missgebildeten Frösche, die aus beiden Mäulern quakten.
Als Mike Smalley Ende der Achtzigerjahre mit seiner Frau Linda in die Gegend zog, hörten sie Gerüchte, dass DuPont das Trinkwasser verschmutze, schenkten dem aber keinen Glauben. Smalley brach bei der Erinnerung in Tränen aus. «Linda hatte einen großen Wasserkrug. Sie füllte ihn auf, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, und trank den ganzen Abend daraus. Ich und die Jungs tranken kein Wasser. Ich trank immer Cola und sie Mountain Dew. Aber Linda trank bestimmt fünf Liter am Tag.» Später, als sie schon krank war, sagte sie resigniert: «Und ich habe so viel Wasser getrunken.»
Darlene Kiger erinnerte sich an die sterbenden Haustiere. Ihre Mutter kaufte immer wieder Sittiche, und sie starben jedes Mal ohne ersichtlichen Grund. Auch Hunde starben ständig. Nachdem der erste Hund ihrer Nachbarin riesige Tumore entwickelt hatte, schaffte sie sich einen Pudel an, der ebenfalls Tumore bekam. Kigers eigener Malteser, den sie Dog nannte, bekam keinen Krebs. Er wurde blind. Ihre Kinder lachten, wenn Dog gegen Telefonmasten rannte, doch als er begann, von Stühlen zu stürzen und sich, von krampfartigen Anfällen geschüttelt, am Boden wand, verging ihnen das Lachen. Danach legten sie sich keine Hunde mehr zu.
Es waren nicht nur die Tiere. Darlene kannte drei Männer in ihren Zwanzigern, bei denen Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Es schien, als gäbe es in Parkersburg kein Kind ohne Asthma. Sie kannte eine alte Frau, bei deren fünfjähriger Enkelin sich die Zähne plötzlich schwarz verfärbt hatten.
Bilott verfolgte die Geschichte bis 1951 zurück, damals hatte DuPont angefangen, von 3M eine Chemikalie namens Perfluoroctansäure oder PFOA zu kaufen – der geläufigere Name für APFO. DuPont wollte PFOA bei der Herstellung von Teflon verwenden. 3M hatte PFOA, das gewöhnlich die Form einer außerordentlich gleitfähigen Flüssigkeit annahm, erst vier Jahre vorher erfunden. Es sollte verhindern, dass eine Beschichtung während der Produktion verklumpte. Obwohl PFOA